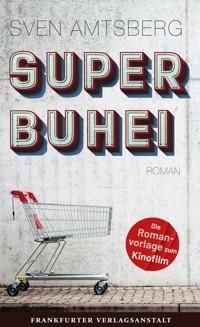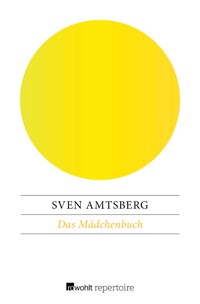
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amtsberg zielt mit seinem Erzählen auf fremdes, schillerndes Terrain: die Frauen. Die sind rätselhaft, unberechenbar, leidenschaftlich, normal, hässlich, fröhlich – aber immer fremd. Der Erzähler lässt sich mit den Mädchen ein, sucht und sammelt wie ein Schmetterlingsjäger alle Exemplare und betrachtet sie im Licht des Alltags. Ein Alltag im Hamburg der neunziger Jahre, der bei aller abgeklärten Kühle von einer neoromantischen Sehnsucht durchzogen ist. Es sind witzige, überraschende, zuweilen verspielte Exkursionen in die Welt der Träume, des Verstummens, der Sehnsucht und Machtspiele. Amtsbergs Ton ist von einer spröden Sachlichkeit, die die Gefühlsempfindlichkeit erst leuchten lässt. Sein Sprachrhythmus ist von bestechender Musikalität (geschliffen in vielen Lesungen) – umwerfend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Sven Amtsberg
Das Mädchenbuch
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Amtsberg zielt mit seinem Erzählen auf fremdes, schillerndes Terrain: die Frauen. Die sind rätselhaft, unberechenbar, leidenschaftlich, normal, hässlich, fröhlich – aber immer fremd. Der Erzähler lässt sich mit den Mädchen ein, sucht und sammelt wie ein Schmetterlingsjäger alle Exemplare und betrachtet sie im Licht des Alltags. Ein Alltag im Hamburg der neunziger Jahre, der bei aller abgeklärten Kühle von einer neoromantischen Sehnsucht durchzogen ist. Es sind witzige, überraschende, zuweilen verspielte Exkursionen in die Welt der Träume, des Verstummens, der Sehnsucht und Machtspiele.
Amtsbergs Ton ist von einer spröden Sachlichkeit, die die Gefühlsempfindlichkeit erst leuchten lässt. Sein Sprachrhythmus ist von bestechender Musikalität (geschliffen in vielen Lesungen) – umwerfend.
Über Sven Amtsberg
Sven Amtsberg, 1972 geboren, lebt als freier Autor und Verleger in Hamburg. Er erhielt 2001 den Hamburger Förderpreis für Literatur und ist Gründungsmitglied des Macht Club e. V.
Inhaltsübersicht
Du, weißt du noch, wie wir auf Schlittschuhen waren,
Und ich hab’ geglaubt, du könntest prima fahren,
Ohne Pause ließ ich meine Worte holpern,
Und du hast dauernd versucht zu stolpern,
Dass ich dich auffing,
Das war das erste Rendezvous,
Und seitdem verflog jeder Tag wie im Nu,
Und jetzt möchte ich, dass du weißt,
Wo immer du auch hin verreist,
Nach Atlantic City oder in Schnee und Eis,
Dass bis ans Ende unserer Tage,
Solange ich deinen Ring an meinem Finger trage,
Ich da bin und dich auffange.
Rocky Balboa, 1979
Abgeschnittene Haare
Es hat sich etwas verändert. Ich habe es erst später bemerkt. Aber es scheint an diesem Tag angefangen zu haben. An dem Tag, an dem sie ihr Haar abschnitt. Es sich kurz schnitt. Sie hatte vorher lange Haare. Braune Haare. Ich mag ihr langes Haar. Ich mochte es.
Ich weiß noch, wie es war, als sie vom Frisör wiederkam. Sie hat nicht erzählt, dass sie hinwollte. Die Sonne schien. Sie lächelte, als sie die Haustür aufschloss. Es wirkte unnatürlich. Es schien, als hätte ich sie noch nie zuvor lächeln gesehen. Aber ich sagte nichts. Starrte sie nur an. Starrte auf den Teil ihres Haars, der noch da war. Um sie ein heller Kranz von der Sonne. Ihre Gestalt wirkte ausgefranst an den Rändern. Es blendete mich.
Sie schloss die Tür wieder hinter sich, und ich konnte sie jetzt richtig betrachten. Sie stand für einen Moment einfach da, und auch die Situation schien stehen zu bleiben. Wurde zu einer Fotografie. Sie mit dem kurzen Haar im Flur. Dahinter die fliederfarbene Mustertapete, die wir gemeinsam ausgesucht hatten. Neben ihr stand der Schrank aus Eiche, der im Laufe der Zeit immer dunkler zu werden schien. Es lagen allerlei unnütze Dinge in ihm. Handschuhe, Schals, Mützen. Mehr Dinge fielen mir nicht ein. Sie stand daneben. Die dunkle Ecke des Schranks ragte in das Bild, berührte sie fast an ihrem Kopf. Drum herum die fliederfarbenen Papierblumen. Es wirkte fremd. Sie wirkte fremd, und ich wusste, dass ich ihre Frisur nicht mochte. Und ich wusste, dass sie nie wieder lange Haare haben würde. Und dass irgendetwas mit ihnen gegangen war. Etwas von dem, was mal gewesen war.
Aber ich sagte nichts. Ich log sie an.
Schön siehst du aus, sagte ich und streckte meine Hand nach ihr aus.
Die Situation löste sich wieder aus ihrer Erstarrung. Aus der Fotografie begann ein Film zu werden. Sie griff nach meiner Hand und begann sich an ihr zu drehen. Drehte sich, damit ich ihren Kopf von allen Seiten sehen konnte. Das Haar daran, das sich kaum noch bewegte bei ihrer Bewegung. Jedenfalls im Gegensatz zu früher. Es wirkte fast lächerlich, so kurz, wie es jetzt war.
Wir sprachen nicht weiter darüber. Ich ertrug einfach, dass es so war, wie es war. Sie schien glücklicher zu sein. Sie lachte in den nächsten Tagen mehr als sonst, und es tröstete mich ein bisschen darüber hinweg, dass wir etwas verloren hatten. Es war schön, sie so zu sehen. Das musste ich zugeben.
Die Tage vergingen, und ich sah ihrem Haar beim Wachsen zu. Vermutlich geschah es eher unbewusst, aber ich ertappte mich oft dabei, wie ich es jeden Tag eine Weile betrachtete. Ihr fiel es auf, und sie fragte etwas später danach. Sie fragte mich, was ich immer so gucken würde. Nichts, sagte ich erst, und beim zweiten Mal sagte ich, dass ich mich noch immer nicht an ihre neue Frisur gewöhnt hätte. Das war etwas, was der Wahrheit schon sehr viel näher kam, als dass es mir gefiel. Dass sie schön aussah.
Sie lachte und strich sich Haar hinter ihr Ohr. Eine Geste, die neu war. Die mit dem neuen Haarschnitt gekommen war.
Auch das irritierte mich. Ständig strich sie sich jetzt Strähnen hinters Ohr. Schatz, sagte sie, so langsam solltest du dich dran gewöhnen. Mir gefällt es so, wie es ist.
Ja, erwiderte ich nur und ging ins Bad, um zu duschen. Um alleine sein zu können.
Der Spiegel beschlug von dem heißen, laufenden Wasser in der Dusche. Ich musste aufhören, mein Gesicht anzustarren. Ich zog mich aus stattdessen und betrachtete die Falten, die meinen Körper überzogen wie ein Algengeflecht. Schön war auch ich nicht mehr, und ich wusste nicht, ob ich es jemals gewesen war.
Das Wasser war fast zu heiß. Meine Haut wurde rot, aber ich tat nichts dagegen. Es war ein angenehmes Gefühl, das Brennen auf der Haut spüren zu können. Ich dachte, es würde meiner Haut gut tun. Sie straffen, die Algen glätten.
Dann stand ich nackt im Schlafzimmer vor dem Kleiderschrank. Starrte in sein Inneres. Ich musste lange so dagestanden haben.
Was ist mit dir, fragte sie.
Ich spürte ihre Hände auf meinem noch warmen Körper. Sie waren kalt, und ich hätte nicht sagen können, wie viele es waren. Die Berührung war unangenehm, und es war gar nicht, dass sie kälter war als ich. Es war etwas anderes.
Ich roch sie. Spürte sie. Merkte, wie sie ihren Körper an mich presste, schmiegte. Und wäre gerne fortgegangen. Hinein in den Kleiderschrank und hätte die Türen geschlossen. Aber das tat ich nicht. Weil man das nicht tut. Ich streckte nur meine Hände hinein und griff nach Sachen, wahllos, Unterwäsche, eine blaue Hose, ein gelbes Hemd. Dann trat ich ein Stück zurück, um die Türen wieder schließen zu können. Sie war jetzt nicht mehr hinter mir, sie war verschwunden. Ich konnte ihre Schritte auf der Treppe hören.
Wir aßen stumm Abendbrot. Ich aß trocknes Brot. Nippte an kaltem Tee. Starrte sie an, während ich meinen Mund fühlte. Die Dinge darin.
Sie blickte auf ihren Teller. Früher hatte ihr Haar ihr Gesicht dabei verdeckt. Es hatte bis zur Tischplatte gereicht. Jetzt schien sie zu lächeln. Ihre Lippen zogen sich bis unter die Augen, während sie weiter in den orangen Kreisen auf dem Teller versank und lächelte. Und lächelte.
Ich hörte auf zu kauen. Legte das Graubrot auf den Teller zurück. Rannte die Treppen nach oben. Mit meinen Händen griff ich in die Tiefen des Kleiderschranks. Ließ alles, was sie anfassten, in den dunkelblauen Lederkoffer fallen.
Deine verdammten Haare, schrie ich auf der Treppe. Hysterisch und laut. Wo sind deine verdammten Haare.
Sie sah mich erschrocken an. Was ist mit meinen Haaren, fragte sie. Dabei fasste sie ihr kurzes Haar an. Was hast du.
Sie war mir nach oben gefolgt. Sie hatte im Türrahmen des Schlafzimmers gestanden. Mich beobachtet. Ich hatte sie beiseite geschoben. Ich hatte erst auf der Treppe angefangen zu sprechen. Angefangen zu schreien. Sie hatte die ganze Zeit geredet. Ich hatte es nicht gehört. Ich hatte gar nichts gehört. Hatte nur meine Hände gesehen. Wie sie die Verschlüsse schlossen. Wie sie den Griff nahmen. Dann war ich auf der Treppe. Deine verdammten Haare.
Ich sah sie von draußen in der Haustür stehen. Die angebissene Scheibe Graubrot noch immer in ihrer Hand. Sie balancierte sie auf ihren weißen Fingerspitzen. Mit den Augen folgte sie mir. Ich lief die Ausfahrt entlang. Ich lief auf die Straße. Immer wieder schrie ich, deine verdammten Haare. Deine gottverdammten Haare.
Sie sah, wie ein metallicgrüner Opel Omega mich erfasste. Wie ich ein Stückchen durch die Luft geschleudert wurde. Der Koffer durch die Luft segelte. Auf das Grundstück der Nachbarn fiel. Er ging nicht auf.
Während des Fallens sah ich sie noch einmal an. Ich hatte aufgehört zu schreien. Deine verdammten Haare. In mir war jetzt die Stille. Von den Bremsen hörte ich nichts. Von den Reifen hörte ich nichts. Alles, was war, war Sehen. Ihre Augen waren jetzt große Augen. Ihr Mund war rund. Ein Schrei kam aus ihm heraus. Und dann begannen die Geräusche wieder einzusetzen. Asphalt kam. Der Geruch meiner Kindheit. Meine Mutter ist da. Sie trägt Lockenwickler und singt.
Sie ist weiß. Sie sitzt auf der Bettkante. Neben mir hustet jemand Schleim aus.
Hinter ihr sind bunte Farben. Ihr Gesicht ist verschwommen. Das Braun ist länger als das Weiß. Flächen.
Ich strecke die Hand nach ihr aus. Versuche die Farben zu berühren. Das Braun.
Die Farben kommen näher. Das Braun beginnt zu schaukeln.
Sie beugt sich runter zu mir.
Ich kann das Braun berühren. Es fühlt sich warm an. Weich.
Alster
Es ist ziemlich weit, um die Alster zu gehen. Vor allem um die Außenalster. Bei schönem Wetter geht es. Bei schlechtem dauert es länger. Man muss sich immer wieder unterstellen, damit man nicht nass wird von dem Regen. Weil man dann sonst krank werden kann. Weil man dann sonst noch mit nassen Klamotten um die Alster laufen muss und der Weg ziemlich weit ist. Gerade wenn es regnet.
Ich bin noch nie um die Alster gelaufen. Warum auch. Man kommt ja doch nur wieder da an, wo man losgelaufen ist. Das ist sinnlos.
Mit ihr muss ich das erste Mal um die Alster. Als wir losgehen, scheint noch die Sonne. Irgendwann tut sie das nicht mehr, und der Regen kommt. Aber wir können nicht mehr umkehren, weil wir schon zu weit gelaufen sind. Da ist der Weg nach vorne, genauso lang wie der zurück. Da geht man lieber nach vorne. Stellt sich unter und wartet, dass der Regen wieder aufhört.
Ich erzähle ihr von meiner Drogensucht. Dass es harmlos anfing. Marihuana auf Partys, Haschisch in Kellerräumen. Ich war jung und ahnungslos. Dann haben wir Heroin geraucht, sage ich. Das Spritzen kam erst später.
Sie sagt, ich habe Angst vor Spritzen.
Das gibt sich mit der Zeit, sage ich. Wird so normal wie Butter aufs Brot schmieren.
Ja, sagt sie.
Ja, sage ich.
Wir gehen weiter um die Alster. Sie zeigt auf dicke Vögel mit dicken Beinen, die am Rand der Alster sind. Gänse, sagt sie. Graugänse.
Ich zeige auf einen weißen Vogel auf dem Wasser. Schwan, sage ich. Das ist ein Schwan.
Ja, sagt sie.
Schlimm wurde es, als das Geld ausging, sage ich nach einer Weile, in der wir so getan haben, als würden uns die alten Scheißvögel auf der Alster interessieren. Wir mussten uns was besorgen. Drogen können teuer sein, wenn man viel davon nimmt.
Sie nickt und formt meine Haare mit ihren Händen zu einem Seitenscheitel. Es ist angenehm, wie sie das tut. Es beruhigt mich auf eine Art. Sie erinnert mich an LSD.
Du erinnerst mich an LSD, sage ich, und wir bleiben stehen, damit sie mich küssen kann.
Hast du schon ans Aufhören gedacht, fragt sie anschließend. Ja, sage ich, schon oft. Ans Aufhören denkt man ja ständig. Weil es irgendwann auch aufhören muss, wenn es mal angefangen hat.
Sie nickt ernst, das verstehe ich.
Methadon, sage ich.
Methadon, sagt sie. Dabei hält sie meine Hand fest wie eine Drogentherapie.
Als der Regen kommt, haben wir die Hälfte des Weges hinter uns. Sind am höchsten Punkt der Alster angekommen, wäre die Alster ein Berg.
Die Menschen, die sich die Alster ausgedacht haben und den Weg darum, haben sich auch ein kleines Haus ausgedacht, das keine Fenster hat. Es ist darin genauso kalt wie draußen, nur durch das Dach über den Löchern, in denen normalerweise Fenster sind, ist es trocken. Man wartet dort, geht man im Regen spazieren, und sieht den Menschen auf dem Wasser zu, wie sie ganz nass werden. Und krank.
Die Menschen auf dem Wasser, die Menschen in den Booten, die tun, als würden sie rudern, als würden sie irgendwohin müssen, obwohl doch jeder weiß, dass man auf der Alster nicht weit kommt, das sind unbekümmerte, dumpfe Menschen. Sie lachen und kreischen noch. Tun so, als würden sie die Krankheiten nicht interessieren. Sind auch noch laut dabei, damit jeder ihnen zusehen kann, wie sie sich anstecken. Es sind schon Menschen gestorben durch Krankheiten, aber auch das scheint ihnen egal zu sein. Weil auf der Alster nichts nach Tod aussieht. Auch wenn es so riecht.
Wir stehen in dem kleinen Wartehäuschen. Mir fällt nichts mehr ein, was ich ihr noch sagen könnte, und sie spricht sowieso nicht viel. Wir schieben uns statt Worten die Zungen gegenseitig in den Mund. Tief zwischen die Lippen und den Zahnbereich. Man kann die Augen dabei schließen, weil es sonst nichts zu sehen gibt. Für einen Moment könnte man die Patienten auf dem See vergessen, würden sie nur nicht so kreischen und schreien. So tun, als wären sie glücklich, die Arschgeigen.
An der Alster in ihr zu sein, mit der Zunge, und die Augen zu schließen ist wie eine Art Meditation für mich. Es ist in manchen Momenten besser als Methadon, und selbst das Heroin kann ich in diesem feuchten Augenblick vergessen. Es gibt dann nur noch ihren Mund. Eine Tropfsteinhöhle, die mir Schutz gewährt vor dem, was außerhalb von ihr liegt. Angst kenne ich keine mehr, und auch das Reden kann man sich dann sparen. Weil vorher schon so viel gesagt worden ist, um überhaupt küssen zu können. Man muss sich nicht gut kennen zum Küssen, aber ein bisschen zumindest, und dazu muss man reden, reden, reden.
Als der Regen wieder aufhört, gehen wir wieder um die Alster. Kurz habe ich das Gefühl, dass wir gar nicht weitergehen, sondern zurück. Aber ich sage nichts, weil ich nicht dumm erscheinen will. Und nach einiger Zeit merke ich, dass wir doch weiter um die Alster gehen und nicht wieder zurück. Und ich freue mich, dass es jetzt nicht mehr so weit ist. Meine Füße tun weh, und ich habe keine Lust mehr, mit ihr um die Alster zu gehen. Ich wäre jetzt lieber alleine und würde gerne kiffen. Richtig kiffen.
Ich sage, ich würde jetzt gerne kiffen. Richtig kiffen.
Sie sagt nichts, weil ihr Telefon in diesem Moment klingelt. Und dann sagt sie doch was, aber das geht mich nichts an, und ich tue so, als wenn ich weghöre, und überlege, wer Tom ist. Ob Tom ihr Verlobter ist. Aber ich frage sie nicht, als sie das Telefon zurück in ihre Sporttasche gesteckt hat. Ich möchte gleichgültig erscheinen. Sie soll nicht denken, dass ich was von ihr will. Außerdem ist die Alster gleich zu Ende, da möchte ich nicht noch solche Gespräche anzetteln. Dann dauert es ja noch länger, als es das eh schon tut. Und dann dauert es auch noch länger bis zum Kiffen. Und man kann weniger kiffen, weil die Nacht dann schneller beginnt. Und wenn die Nacht schneller beginnt, dann hört sie auch schneller auf, und dann beginnt der Tag auch wieder schneller. Und der Tag beginnt mit dem Morgen. Und morgens kiffe ich nicht, weil ich davon müde werde, und dann ist der Tag so schnell rum, und es ist gleich wieder Nacht.
Gleich ist wieder Nacht, sage ich.
Ja, sagt sie. Schön, nicht. Es wird Sterne geben.
Wir gehen unter einer Brücke durch, die die Binnenalster von der Außenalster trennt. Und dann sieht man auch schon das Ende von der Alster, und ich weiß, dass es jetzt auch bald gut ist mit dem Umdiealstergehen. Ich endlich nach Hause komme und kiffen kann. Und ich überlege kurz, ob ich nicht auch noch ein paar Beutel Kokain nehmen sollte. Und vielleicht auch etwas Heroin. Und ich halte es für eine gute Idee.
Kurz vor dem Punkt, wo wir losgegangen sind, fängt es noch einmal an zu regnen, und sie will sich schon wieder unterstellen. Aber ich habe keine Lust mehr dazu. Der Regen ist mir egal.
Der Regen ist mir egal, schreie ich ihr noch zu, als ich loslaufe.
Ich laufe, so schnell ich kann, durch den Regen, der mir nichts mehr anhaben kann. Scheiß auf die Krankheiten, denke ich.
Scheiß auf die Krankheiten, rufe ich einigen Passanten zu, die sich untergestellt haben.
Es ist gar nicht so weit bis zu mir, wenn man läuft. Ich habe das Gefühl, dass gar keine Zeit vergeht, und dann bin ich auch schon zu Hause. Ich reiße mir die nassen Klamotten vom Leibe und rauche währenddessen den ersten Joint. Anschließend rauche ich noch fünf weitere und kaue dabei auf bewusstseinserweiternden Tabletten rum. Irgendwann sehe ich Farben und nackte Engel, die Bobdylanlieder auf Deutsch singen. Ich habe das Gefühl zu schweben. Der Erde näher zu sein als sonst. Ich kann sie mit der Hand berühren. Die violette Oberfläche.
Es ist ein toller Abend für mich, und das Gefühl scheint gar nicht wieder aufzuhören.
Scheiß auf die Alster, denke ich noch, als ich anfange, mir den Körper mit Wasserfarben zu bemalen.
Scheiß auf die Alster, rufe ich lachend, als ich anfange, mich rhythmisch zu bewegen. Zu Klängen, die mich umgeben. Sich so warm anfühlen, dass ich nicht von dort zurückkehren möchte. Niemals zurückkehren möchte. Da bleiben möchte, wo ich bin. Ein Leben zwischen den Gehirnhälften. Dort, wo es besser ist als draußen. Dort, wo es keine Alster gibt, um die man ständig laufen muss. Wo man keine Spaziergänge machen muss. Und ständig nur reden, reden, reden.
Annas Kleid
Annas Kleid hing noch über der Lehne des Küchenstuhls. Dort, wo sie es zuletzt ausgezogen haben musste. Ich hatte ihr nicht dabei zugesehen. Ich hatte nur das Kleid dort gefunden. Es glänzte an manchen Tagen, wenn die Sonne schien.
Ich ließ ihr Kleid auf dem Stuhl. Ich konnte es nicht wegnehmen von dort. Es ging nicht. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich es hätte hintun sollen. In den Keller oder auf den Dachboden. Nein, das wäre nicht gegangen. So einfach war das alles nicht. Zumal Anna noch nicht so lange verschwunden war.
Ich habe oft gedacht, dass sie jeden Moment wiederkommen könnte. Sie würde die Tür öffnen. Plastiktüten auf dem Fußboden abstellen. Lachen. Und dann würde sie fragen, wo ihr blaues Kleid hin wäre. Und ich hätte ihr sagen müssen, dass ich es auf den Dachboden gebracht hatte. Das wäre mir unangenehm gewesen. Sie hätte denken müssen, dass ich schnell vergesse. Zu schnell. Nein, das hätte ich nicht ertragen können. Das wäre nicht gegangen. Schon allein ihretwegen. Vergessen hätte ihr wehgetan. Das weiß ich.
Doch Anna kam nicht wieder. Und es schmerzte, ständig daran erinnert zu werden, dass sie einmal da gewesen war. Da war nicht nur ihr blaues Kleid. Die ganze Wohnung roch nach ihr.
Ich hatte gelüftet nach ihrem Verschwinden. Mehrere Tage sogar. Die Fenster standen offen, und es regnete herein. Doch ihr Geruch wollte einfach nicht weggehen. Er hing zwar nicht mehr so dick in der Wohnung, wie es vorher der Fall gewesen war, wie ein Duftperlenvorhang, durch den man hindurchgehen musste. Aber er war immer noch da. Ich nahm ihn nur allzu deutlich wahr. Ich stieß einfach überall auf ihn. Annas Geruch hing in den Sachen. Der ganze Kleiderschrank schien nach ihr zu riechen. Das war mir früher nie aufgefallen. Erst jetzt nahm ich wahr, wie intensiv es da drinnen nach ihr roch. Als hätte sie da drinnen gelebt und nicht hier draußen bei mir.
Doch am schlimmsten war es nachts im Bett. Das ganze Bett roch nach Anna. Die Leopardenbettwäsche, die Spannbettlaken, einfach alles. Selbst als ich ihre Decke und ihr Kopfkissen unter das Bett stopfte, hörte es nicht auf. Ich wechselte schließlich die gesamten Bezüge und auch das Laken aus. Verbrannte alles in einer Tonne im Hof. Erst jetzt fing es an, allmählich erträglicher zu werden. Ich fand nachts wieder etwas Ruhe, und ihr Geruch schlich sich nicht mehr in meine Träume. Ich träumte wieder von gelben Stofftieren mit braunen Knopfaugen.
Mit der Zeit verging auch meine Langeweile. Ich gewöhnte mich mehr und mehr daran, allein zu sein. Obwohl Anna immer sehr viel Zeit mit mir verbracht hatte, wir spielten sehr gerne Brettspiele miteinander, füllte ich diese relativ schnell. Ich entwickelte neue Hobbys. Ich begann in Illustrierten zu lesen und frischte mein Interesse für Filme wieder auf. Die Ausleihkarte für die Videothek musste ich erneuern lassen. Fünf Jahre ist eine lange Zeit, sagte der Mann zu mir, da passiert ne ganze Menge. Dann schob er mir eine nagelneue Karte über den Tresen, für die ich nichts bezahlen musste. Ich war froh darüber, ohne große Umschweife meinen Neigungen nachgehen zu können. Ich schlenderte durch die Videothek und wählte mir die Filme nach den Abbildungen auf den Schutzhüllen aus. Sie haben aber ne Menge vor, sagte der Mann, als er mir die vierunddreißig Filme, die ich ausgesucht hatte, aus den Regalen holte. Ich nickte und war froh, als die Filme in den Plastiktüten verstaut waren. Ich machte mich damit auf den Nachhauseweg. Ich schob den Stuhl mit Annas Kleid beiseite und breitete die Kassetten auf dem Küchentisch aus. Ich ging dabei sehr sorgfältig vor. Ordnete die Filme nach Kategorien, wie sie das auch in der Fernsehzeitung taten. Action. Komödie. Erotik. Es stellte sich heraus, dass der Komödienstapel eigentlich gar kein richtiger Stapel war. Jedenfalls im Gegensatz zu den beiden anderen. Ich sah die Kassette als Erstes. Ein Film über einen Mann, der die ganze Zeit pupst. Der Film war in Schwarz-Weiß. Als er zu Ende war, spulte ich ihn zurück und sah ihn mir noch einmal von vorne an. Aber lustig fand ich ihn noch immer nicht. Da machten mir die Filme vom Erotikstapel schon mehr Spaß. Jedenfalls wurde mir nicht langweilig dabei.
Ich musste relativ viel Geld für die Filme bezahlen. Das hatte ich nicht gedacht, und ich beschloss, lieber bei den Illustrierten zu bleiben. Das war billiger. Schließlich lag die ganze Wohnung mit ihnen voll. Anna hatte sie gesammelt. Sie liebte Illustrierte. Ich selbst hatte eigentlich nie etwas dafür übergehabt. Wozu die Zeit mit Illustrierten vergeuden, wenn man stattdessen ebenso gut Brettspiele machen konnte, dachte ich. Aber ich änderte meine Meinung recht schnell. Das ist schon immer so gewesen.
Ich fing erst nach drei Monaten wieder an, Anna zu vermissen. Nach einer Zeit, in der ich sehr viel gelesen hatte. Ich hatte fast jede Zeitschrift gelesen. Sämtliche Jahrgänge der Brigitte seit 1978. In den älteren Ausgaben war weiter hinten noch eine kleine Maus versteckt. Das fand ich eine Zeit lang sehr amüsant. Irgendwann hörte aber auch das wieder auf, und ich fing an, mich mehr und mehr zu langweilen. Die Einsamkeit fing an, mich zu zerquetschen, und ich beschloss, mal wieder rauszugehen.
Draußen war es mittlerweile warm geworden. Es war fast schon Sommer. Die Leute hatten wenig an, und ich fiel etwas auf in meiner Daunenjacke. Ich zog sie aus und brachte sie zurück nach Hause, um dann noch einmal, diesmal nur in einem T-Shirt und kurzen Hosen, loszugehen. Unterwegs kaufte ich bei einem italienischen Mann Eis, das er angeblich selber machte. Das Eis schmeckte nicht schlecht. Doch nach einiger Zeit fing es an zu tropfen, und ich schmiss es in einen Teich mit schwimmenden Vögeln. Sie fingen an zu schnattern und hackten nach der Waffel. Ich musste lachen, aber Spaß empfand ich nicht wirklich dabei. Ich lachte nur so.
Als es zu dunkel wurde zum Draußensein, ging ich wieder rein. Ich setzte mich in die Küche und dachte lange nach. Sehr lange. Dabei betrachtete ich das Kleid, das noch immer über der Lehne des Küchenstuhls hing.
Annas Kleid passte mir besser, als ich gedacht hatte. Sogar der Reißverschluss ließ sich schließen. Herr Dobermann von nebenan half mir dabei. Er zog anfangs zwar skeptisch die Augenbrauen nach oben, kam meiner Bitte aber dann doch nach. Er sagte, ich bräuchte Hilfe. Ich nickte und ging zurück in meine Wohnung.
Anna hatte fast alle ihre Schminksachen dagelassen. Sie lagen noch immer unter dem Waschbecken. Ich hatte mich noch nie geschminkt, und es war nicht so einfach, wie es aussah. Ich brauchte einige Zeit. Musste immer wieder das Make-up abwischen, um es neu aufzutragen. Meine Haut fing an sich zu röten, begann zu jucken. Aber schließlich war ich mit dem Ergebnis doch recht zufrieden und vergaß darüber den Juckreiz. Ich sah Anna sogar etwas ähnlich. Sicher, so perfekt wie sie hatte ich es nicht hinbekommen, aber es konnte sich sehen lassen.
Dann begann ich mir die Haare zu schneiden. Sie waren mit der Zeit sehr lang geworden. Ich hatte sie einfach vergessen. Hatte lange nicht mehr in den Spiegel gesehen. Jetzt war ich froh darüber. Sie hatten mittlerweile fast die Länge von Annas Haaren bekommen. Nur der Pony musste etwas gerade geschnitten werden. Kurz musste ich kichern bei dem Wort Pony und schnitt etwas zu viel ab. Aber es war nicht so schlimm.
Als ich fertig war, betrachtete ich mich im Spiegel. Ich konnte mich nicht von Anna unterscheiden. Ich fing an, mit mir zu reden. Und es tat gut, mal wieder zu reden. Richtig zu reden. Ich sagte Anna, dass ich mich einsam fühlte, und sie sagte dasselbe. Dann schwiegen wir wieder.
Annas Mutter freute sich sehr, als ich sie besuchte. Anna, schrie sie immer wieder, Anna. Wir saßen im Wohnzimmer.
Wir saßen ganz dicht beieinander. Annas Mutter umarmte mich immer wieder. Drückte mir Küsse auf die Wangen, und ich begann mir Sorgen zu machen um das mühsam aufgetragene Make-up. Ich war froh, als sie endlich von mir abließ und wir nur noch redeten. Wir sprachen über ihre künstlichen Hüftgelenke und aßen Mandelgebäck. Irgendwann ein bisschen später zog sie ihre Strumpfhose runter und zeigte mir die Narben. Ich wurde rot unter dem Makeup, aber ich glaube, sie hat es nicht bemerkt. Sie zog sich wieder an und zeigte mir mein altes Zimmer. Es wäre noch genauso wie damals, als ich ausgezogen war. Zu diesem, na, wie hieß der noch. Ich sagte meinen Namen und nahm eins der Plüschtiere von Annas Bett. Es roch alt, als ich es vorsichtig an mein Gesicht presste.
Ich blieb bei meiner Mutter. Ich kümmere mich um sie. Sie ist schon sehr alt. Ihre Hüfte macht ihr nach wie vor zu schaffen. Ich gehe für sie einkaufen und koche. Den Haushalt will sie aber weiterhin selber machen. Sie lässt sich einfach nicht dabei helfen. Sie sagt, das wäre ja noch schöner, die eigene Tochter und putzen. Ich lasse sie.
Meine Mutter ist wie eine Freundin für mich. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich werde es nicht zulassen, dass sich jemand zwischen uns drängt. Wenn es draußen an der Tür klingelt, sage ich, dass sie ruhig sein soll. Damit die Männer von der GEZ uns nicht finden. Ich lege eine Decke über meine Mutter. Presse ein Kissen auf ihr Gesicht. Und sie hält den Atem an. Sie hält ihn sehr, sehr lange an.
Ich sehe alt aus im Spiegel. Ich habe mir Narben auf die Hüften gemalt. Ich humpel durch die Wohnung. Erst bin ich im Flur. Dann in der Küche. Ihr Kleid hängt dort über der Lehne des Küchenstuhls. Es glänzt an manchen Tagen, wenn die Sonne scheint.
Bar
Die Wohnung war leer. Maria war mit dem Kind fortgefahren. Ich wusste nicht genau, wohin. Irgendein Verwandter oder eine Verwandte. Vater oder Mutter. Ich wusste nur, dass sie eine Weile fort sein würde. Ein paar Tage oder auch mehr.
Es war angenehm, allein in der Wohnung zu sein. Mir wurden keine Fragen gestellt. Ich konnte so sein, wie ich wirklich war.
Ich nahm mir Bier aus dem Kühlschrank und setzte mich in Unterhosen ins Wohnzimmer. Ich sah mir Filme an und trank, bis es hell wurde. Gegen halb acht rief ich bei der Arbeit an, um mich krankzumelden. Auch dort wurden mir keine Fragen gestellt. Die Sekretärin wünschte mir gute Besserung und schien nicht bemerkt zu haben, dass ich betrunken war. Ich bedankte mich und legte auf. Anschließend ging ich schlafen.
Als ich wach wurde, war es draußen schon wieder dunkel. Der Digitalwecker leuchtete im Schlafzimmer. Es war kurz nach sechs.
Ich hatte Kopfschmerzen und nahm weiße Tabletten aus dem Alibert im Bad. Schluckte sie mit Leitungswasser. Dann schob ich den Fernseher auf dem Fernsehwagen ins Schlafzimmer. Aß belegte Brote im Bett, während ich mir Vorabendserien ansah.
Die Kopfschmerzen ließen mit der Zeit nach. Ich fing an, mich besser zu fühlen. Als das Abendprogramm begann, duschte ich und verließ das Haus.
Es war ein Donnerstag. Maria war seit drei Tagen fort. Oder waren es jetzt schon vier. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass sie heute nicht wiederkommen würde. Oder besser, ich ahnte es. Und es war gut so. Sie sollte mich so nicht sehen, in diesem Zustand. Man sah mir an, dass ich getrunken hatte. Meine Haut war im Gesicht gerötet. Ich hatte dunkle Ringe unter den Augen bekommen. Alles nicht sonderlich schlimm, aber ihr wäre es aufgefallen. Sie hätte mir Fragen gestellt. Ich hätte mich herausreden müssen. Außerdem war da noch das Kind. Es war besser, dass ich alleine war.
Ich ging eine Weile durch das Viertel. Streifte umher, wie man so schön sagt. Dann ging ich in eine Bar. Ich kannte den Besitzer. Wir tranken Bier. Um Mitternacht gab es Sekt, weil wer Geburtstag hatte. Ab da dann nur noch Schnaps.
Es ging mir gut. Ich unterhielt mich. Mir wurde weiterer Schnaps hingestellt. Ich musste nichts bezahlen dafür. Und ich trank. Und trank. Und trank.
Ich fühlte mich gar nicht so betrunken, wie ich es sein musste. Ich merkte es erst, als ich wieder zu Hause war und im Bett lag. Es drehte sich. Die Welt drehte sich. Ich musste mich erbrechen.
Es roch säuerlich im Zimmer, als ich aufwachte. Ich fühlte mich ein bisschen furchtbar. Es war halb drei. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich rief wieder bei meiner Arbeit an und log etwas von einem Arzttermin, der länger als erwartet gedauert hätte. Murmelte etwas von Grippe, eine seltene Form davon. Am Apparat war die Frau von gestern. Sie wünschte mir gute Besserung. Ich sagte, Montag wäre ich wieder da, auf alle Fälle. Dann legte ich auf.
Ich öffnete das Fenster im Schlafzimmer und schmiss den voll gekotzten Bettvorleger weg. Er stank fürchterlich. Ich würde mir eine Erklärung für Maria einfallen lassen müssen. Sie würde fragen, wo der Bettvorleger wäre. Ich überlegte kurz, einen Hund zu kaufen, um sagen zu können, dass der Hund den Bettvorleger voll geschissen hätte. Ich verwarf diese Idee dann aber wieder. Ich wusste, dass Maria keine Hunde mochte. Und sie wusste, dass ich das wusste. Außerdem war da noch das Kind, und das interessierte sich nicht für Tiere. Ich musste mir etwas anderes einfallen lassen. Etwas, das sie glauben konnte. Noch hatte ich ja Zeit. Sie würde heute schon nicht wiederkommen. Schließlich war Freitag. Da fuhr man nicht nach Hause.
Im Bad steckte ich mir den Finger in den Hals und erbrach durchsichtige Flüssigkeit. Ich fühlte mich nicht wirklich besser danach. Die Übelkeit hielt weiter an.