
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Christopher Boone ist fünfzehn Jahre, drei Monate und zwei Tage alt. Er kennt alle Länder und deren Hauptstädte sowie sämtliche Primzahlen bis 7507. Er liebt die Farbe Rot, hasst hingegen Gelb und Braun. Unordnung, Überraschungen und fremde Menschen versetzen ihn in Panik, denn Christopher leidet an einer leichten Form von Autismus. Als aber der Pudel in Nachbars Garten mit einer Mistgabel umgebracht wird, beginnt Christopher, aus seiner fest gefügten, kleinen Welt auszubrechen: Mutig stellt er den schändlichen Verbrecher und erfährt außerdem, was es heißt, in der Welt der Erwachsenen zu leben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mark Haddon • Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone
DER AUTOR
Mark Haddon wuchs in Northampton auf und studierte in Oxford, arbeitete anschließend sechs Jahre lang mit geistig und körperlich behinderten Menschen. »Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone« ist nur eines von 15 Kinderbüchern, die er verfasste. Es wurde zum internationalen Erfolg. Inzwischen erscheint das Buch in 24 Ländern und auch die Filmrechte wurden bereits verkauft.
Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch ist Sos gewidmet.
Mit einem Dankeschön an Kathryn Heyman, Clare Alexander, Kate Shaw und Dave Cohen
2
Es war 7 Minuten nach Mitternacht. Der Hund lag mitten auf dem Rasen vor Mrs Shears’ Haus, und seine Augen waren geschlossen. Obwohl er auf der Seite lag, sah es aus, als würde er rennen, so wie Hunde rennen, wenn sie im Traum einer Katze nachjagen. Aber dieser Hund rannte weder noch war er am Schlafen. Er war tot. Eine Mistgabel ragte aus dem Fell hervor. Die Zinken mussten sich ganz durch den Hund bis in den Boden gebohrt haben, denn die Gabel stand senkrecht. Ich dachte mir, dass man den Hund wahrscheinlich mit der Mistgabel getötet hatte, denn andere Wunden waren an seinem Körper nicht zu sehen; und ich glaube, niemand würde eine Mistgabel in einen Hund rammen, wenn dieser schon an etwas anderem gestorben ist, zum Beispiel an Krebs oder durch einen Verkehrsunfall. Aber so richtig sicher war ich mir natürlich nicht.
Ich trat durch das Gartentor von Mrs Shears und machte es hinter mir zu. Dann ging ich über den Rasen und kniete mich neben den Hund. Ich legte die Hand auf seine Schnauze. Sie war noch warm.
Der Hund hieß Wellington. Er gehörte Mrs Shears, einer Freundin von uns. Sie wohnte auf der anderen Straßenseite, zwei Häuser weiter links.
Wellington war ein Pudel. Aber nicht einer dieser kleinen Pudel, denen man das Fell trimmt, sondern ein großer. Er hatte lockiges schwarzes Fell, aber wenn man näher heranging, konnte man sehen, dass die Haut unter dem Fell ganz hellgelb war, wie bei einem Hühnchen.
Ich streichelte Wellington und überlegte, wer ihn wohl umgebracht hatte, und warum.
3
Ich heiße Christopher John Francis Boone. Ich kenne alle Länder der Welt und ihre Hauptstädte und sämtliche Primzahlen bis 7507.
Vor einigen Jahren, als ich Siobhan kennen lernte, zeigte
sie mir dieses Bild
und ich wusste, es bedeutete »traurig«; genauso fühlte ich mich, als ich den toten Hund fand.
Dann zeigte sie mir dieses Bild
und ich wusste, es bedeutete »glücklich«; so fühle ich mich zum Beispiel, wenn ich etwas über die Apollo Weltraum-Missionen lese oder wenn ich um 3 oder 4 Uhr morgens noch wach bin und die Straße auf und ab gehen und so tun kann, als sei ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt.
Dann malte sie noch ein paar andere Bilder,
aber ich konnte nicht sagen, was sie bedeuteten.
Ich ließ Siobhan viele solcher Gesichter malen und daneben genau hinschreiben, was sie bedeuten. Den Zettel steckte ich in die Tasche und zog ihn jedes Mal heraus, wenn ich nicht verstand, was jemand sagte. Aber es war sehr schwierig zu entscheiden, welche Abbildung der jeweiligen Miene am meisten entsprach, weil die Mimik der Menschen ja sehr rasch wechselt.
Als ich Siobhan davon erzählte, nahm sie einen Stift und noch einen Zettel und sagte, die Leute fühlten sich dann wahrscheinlich sehr
und dann lachte sie. Ich zerriss den ersten Zettel und warf ihn weg. Siobhan entschuldigte sich. Und wenn ich jetzt mal jemanden nicht verstehe, dann frage ich ihn, was er meint, oder ich gehe einfach weg.
5
Ich zog die Mistgabel aus dem Hund, nahm ihn in die Arme und drückte ihn an mich. Aus den Wunden tropfte Blut.
Ich finde Hunde gut. Man weiß immer, was sie denken. Sie haben nur vier Stimmungen: glücklich, traurig, ärgerlich und aufmerksam. Außerdem sind sie treu. Und Hunde lügen nicht, weil sie nicht sprechen können.
Ich hatte den Pudel 4 Minuten lang an mich gedrückt, als ich jemanden schreien hörte. Ich schaute auf und sah Mrs Shears von der Terrasse her auf mich zurennen. Sie trug Schlafanzug und Morgenrock. Ihre Zehennägel waren hellrosa lackiert, und sie lief barfuß.
»Scheiße!«, schrie sie, »Was hast du mit meinem Hund gemacht? «
Ich kann es nicht leiden, wenn Leute mich anschreien. Ich kriege dann immer Angst, dass sie mich schlagen oder anfassen, und weiß nicht, was als Nächstes passieren wird.
»Lass den Hund los!«, schrie unsere Nachbarin. »Verdammt noch mal, lass ihn los!«
Ich legte Wellington auf den Rasen und rutschte einen Meter zurück.
Sie beugte sich hinunter. Ich dachte, Mrs Shears würde den Hund jetzt auch aufheben und in den Arm nehmen, aber das tat sie eben nicht. Vielleicht hatte sie das viele Blut bemerkt und wollte sich nicht schmutzig machen. Stattdessen begann sie jetzt wieder loszuschreien.
Ich hielt mir die Ohren zu, schloss die Augen und rollte mich nach vorn, bis ich zusammengekauert dalag, die Stirn ins Gras gepresst. Das Gras fühlte sich nass und kalt an. Das war schön.
7
Dies ist ein Kriminalroman, in dem ein Mord passiert.
Siobhan hat mir gesagt, ich solle etwas schreiben, das ich selber gern lesen würde. Meistens lese ich Bücher über Wissenschaft und Mathematik. Romane dagegen gefallen mir nicht so gut. In richtigen Romanen sagen Leute zum Beispiel: ›Ich bin mit Eisen und Silber geädert, mit Dreck gemasert. Ich kann mich nicht zu jener starken Faust schließen, zu der jene sich ballen, die nicht vom Ansporn abhängig sind.‹1 Was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung. Vater weiß es auch nicht. Siobhan und Mr Jeavons ebenfalls nicht. Ich habe sie alle gefragt.
Siobhan hat langes blondes Haar und trägt eine Brille aus grünem Kunststoff. Und Mr Jeavons riecht nach Seife und trägt braune Schuhe mit jeweils etwa 60 winzigen kreisrunden Löchern drin.
Ja, Kriminalromane mag ich gern. Deshalb schreibe ich jetzt einen.
In Kriminalromanen geht es darum, dass jemand herausfindet, wer der Mörder ist, und ihn dann festnimmt. Es ist ein Puzzle. Wenn das Puzzle gut ist, bekommt man die Lösung manchmal schon heraus, bevor das Buch zu Ende ist.
Siobhan hat mir erklärt, dass schon der Einstieg eines Buches den Leser fesseln müsse. Daher habe ich mit dem Hund angefangen. Aber ich habe auch deshalb mit dem Hund angefangen, weil ich das selbst so erlebt habe, und ich kann mir nur sehr schwer Sachen ausdenken, die mir selbst nicht passiert sind.
Als Siobhan die erste Seite gelesen hatte, sagte sie, das müsse man anders machen. Das Wort »machen« hat sie in Gänsefüßchen gesetzt, in diese gekrümmten Anführungszeichen, die sie mit Zeige- und Mittelfingern in die Luft schreibt. Sie sagte, in Kriminalromanen würden normalerweise Menschen getötet. Ich habe erwidert, dass in Der Hund der Baskervilles doch gleich zwei Hunde getötet würden, der im Titel genannte Hund und James Mortimers Spaniel, aber Siobhan hat nur gemeint, die Mordopfer seien gar nicht die beiden Hunde, das Mordopfer sei Sir Charles Baskerville. Und zwar deshalb, weil man sich als Leser mehr für Menschen interessiere als für Hunde, und sobald in dem Buch ein Mensch getötet werde, würde man gern weiterlesen.
Ich erklärte ihr, dass ich gern über etwas schreiben wolle, was wirklich passiert ist, und dass ich zwar Leute kenne, die gestorben seien, aber niemanden, der umgebracht worden wäre, abgesehen von Mr Paulson, den Vater von Edward aus der Schule, und das war kein Mord, sondern ein Unfall beim Segelfliegen, und außerdem habe ich ihn gar nicht richtig gekannt. Ich sagte ihr auch, dass ich mir sehr viel aus Hunden mache, denn sie seien treu und ehrlich und manche unter ihnen seien auch klüger und interessanter als bestimmte Menschen. Als Steve zum Beispiel, der jeden Donnerstag in die Betreuung kommt und der beim Essen Hilfe braucht und nicht mal einen Stock apportieren kann. Siobhan hat mich gebeten, so etwas nie zu Steves Mutter zu sagen.
11
Dann kam die Polizei. Ich mag Polizisten. Die haben Uniformen und Nummern, und man weiß genau, wozu sie da sind. Es waren eine Frau und ein Mann. Die Polizistin hatte am linken Knöchel ein kleines Loch in der Strumpfhose und mitten in dem Loch einen roten Kratzer. An der Schuhsohle des Mannes klebte ein orangerotes Blatt, das guckte seitlich raus.
Die Polizistin nahm Mrs Shears in den Arm und führte sie zum Haus zurück.
Ich lag im Gras und hob den Kopf leicht an.
Der Polizist hockte sich an meine Seite und sagte: »Kannst du mir vielleicht mal erklären, was hier vorgeht, junger Mann?«
Ich richtete mich auf und antwortete: »Der Hund ist tot.«
»So weit war ich auch schon«, meinte er.
»Ich glaube, dass jemand den Hund umgebracht hat«, sagte ich.
»Wie alt bist du?«, fragte er.
»Ich bin 15 Jahre und 3 Monate und 2 Tage alt.«
»Und was genau hast du im Garten gemacht?«
»Ich habe den Hund im Arm gehalten«, antwortete ich.
»Und warum hast du den Hund im Arm gehalten?«
Das war eine schwierige Frage. Ich wollte ihn eben im Arm halten. Ich mag Hunde. Es hat mich traurig gemacht, dass der Hund tot war.
Polizisten mag ich auch, und daher wollte ich die Frage auch ordentlich beantworten, aber der Polizist ließ mir nicht genug Zeit zum Nachdenken.
»Warum hast du den Hund im Arm gehalten?«, fragte er wieder.
»Ich mag Hunde.«
»Hast du den Hund umgebracht?«
»Ich habe den Hund nicht umgebracht.«
»Ist das deine Mistgabel?«
«Nein.«
»Das scheint dich ja alles sehr mitzunehmen«, meinte er jetzt.
Er fragte zu viel, und er stellte die Fragen zu schnell hintereinander. Sie türmten sich in meinem Kopf auf wie die Brotlaibe in der Fabrik, wo Onkel Terry arbeitet. Die Fabrik ist eine Bäckerei, und mein Onkel bedient die Schneidemaschinen. Manchmal arbeitet die Maschine nicht schnell genug, aber es kommt trotzdem immer mehr Brot nach, und dann gibt es eine Verstopfung. Und manchmal stelle ich mir mein Gehirn als Maschine vor, aber nicht unbedingt als Brotschneidemaschine. So kann man den anderen Leuten leichter erklären, was darin vorgeht.
Der Polizist sagte: »Ich frage dich jetzt noch einmal …«
Ich rollte mich wieder auf dem Rasen zusammen, presste die Stirn auf den Boden und machte das Geräusch, das mein Vater stöhnen nennt. Dieses Geräusch mache ich immer dann, wenn aus der äußeren Welt zu viele Informationen auf mich einstürmen. Das ist so, wie wenn man aufgewühlt ist und sich das Radio ans Ohr hält und es genau zwischen zwei Sendern einstellt, bis man nur weißes Rauschen hört; dreht man die Lautstärke voll auf, so hört man nur noch dieses Rauschen, und dann weiß man, dass man in Sicherheit ist, weil man kein anderes Geräusch wahrnimmt.
Der Polizist hat mich am Arm gepackt und hochgezogen.
Dass er mich so anfasste, hat mir überhaupt nicht gefallen.
Und da habe ich nach ihm geschlagen.
13
Das wird kein lustiges Buch. Ich kann keine Witze erzählen, weil ich sie nicht verstehe. Hier ist zum Beispiel ein Witz, den mein Vater erzählt hat:
Sein Gesicht war gezeichnet, aber die Tränen waren echt.
Inzwischen weiß ich, warum das lustig sein soll. Ich hab mich erkundigt. Es soll lustig sein, weil gezeichnet zwei Bedeutungen hat, und zwar 1) mit einem Stift gezeichnet 2) von Spuren des Leids oder Schmerzes geprägt. Bei der Formulierung im ersten Satzteil denkt man nur an Bedeutung 2), doch der zweite Satzteil verweist überraschend auf Bedeutung 1).
Wenn ich versuche, mir diesen Witz selber so zu erzählen, dass alle Bedeutungen und Bezüge gleichzeitig da sind, kommt es mir vor, als würde ich gleichzeitig lauter verschiedene Musikstücke hören, und das ist unangenehm und verwirrend und nicht so schön wie weißes Rauschen. Es ist, als versuchten mehrere Leute gleichzeitig über verschiedene Dinge mit mir zu reden.
Daher kommen in diesem Buch keine Witze vor.
17
Der Polizist starrte mich eine Weile schweigend an. Dann sagte er: »Ich werde dich jetzt wegen tätlicher Bedrohung eines Polizeibeamten festnehmen.«
Da war ich erst einmal beruhigt, denn genau das sagen Polizisten im Fernsehen und im Kino ja auch immer.
Dann fügte er hinzu: »Ich rate dir jetzt ernsthaft, sofort hinten in den Streifenwagen einzusteigen. Wenn du mir noch mal so kommst, kannst du was erleben, du kleines Arschloch! Kapiert?«
Ich ging zum Streifenwagen, der direkt vor dem Gartentor stand. Der Polizist öffnete die Tür, und ich stieg ein. Er selbst kletterte auf den Fahrersitz und rief über Funk die Polizistin, die sich ja immer noch im Haus befand. »Der kleine Scheißkerl wollte mir gerade eine reinhauen, Kate«, sagte er. »Kannst du bei Mrs Shears bleiben, während ich ihn zur Wache bringe? Ich schicke Tony vorbei, damit er dich abholt.«
»Klar«, sagte sie. »Bis später.«
Der Polizist sagte: »Ist gebongt«, und wir fuhren los.
Im Einsatzwagen roch es nach heißem Plastik und Aftershave und Pommes.
Ich betrachtete den Himmel, während wir Richtung Stadtmitte fuhren. Es war eine klare Nacht, und man sah die Milchstraße.
Manche Leute halten die Milchstraße für ein langes Band von Sternen, aber das stimmt nicht. Unsere Galaxie ist eine riesige Scheibe aus Sternen, 100 000 von Lichtjahren entfernt, und das Sonnensystem befindet sich irgendwo am äußersten Rand dieser Scheibe.
Wenn man in Richtung A schaut, in einem Winkel von 90 Grad zur Scheibe, erkennt man kaum Sterne. Schaut man aber in Richtung B, findet man viel mehr Sterne, weil man nämlich in den Kern der Galaxie blickt, und da die Galaxie eine Scheibe ist, sieht man ein Band aus Sternen.
Ich musste an etwas denken, das die Wissenschaftler lange Zeit sehr verwirrt hat: Der Himmel ist nachts dunkel, obwohl sich im Universum Billionen von Sternen befinden und eigentlich in jeder Richtung, in die man schaut, Sterne stehen müssten; sodass der Himmel eigentlich ganz vom Licht der Sterne erfüllt sein sollte, weil das Licht auf seinem Weg zur Erde ja durch fast nichts behindert wird.
Doch dann fand man heraus, dass sich das Universum ausdehnt, dass die Sterne seit dem Urknall alle voneinander wegrasen und dass sich die Sterne desto schneller bewegen, je weiter sie von uns entfernt sind, manche fast mit Lichtgeschwindigkeit, weshalb uns ihr Licht auch niemals erreicht.
Mir gefällt das. Darauf kann man von selber kommen, indem man einfach nachts zum Himmel hinaufschaut und nachdenkt, ohne jemanden fragen zu müssen.
Wenn das Universum eines Tages nicht mehr weiter explodiert, werden die Sterne allmählich langsamer – wie ein Ball, den man in die Luft geworfen hat –, und irgendwann kommen sie zum Stillstand und fallen wieder zum Mittelpunkt des Universums zurück. Nichts kann uns mehr daran hindern, alle Sterne der Welt zu erblicken, weil sie auf uns zukommen, immer schneller und schneller, und dann wissen wir, dass das Ende der Welt bevorsteht, denn wenn wir dann nachts zum Himmel emporblicken, gibt es keine Dunkelheit mehr, nur noch das gleißende Licht der Billionen und Aberbillionen von Sternen, die alle auf uns zufallen.
Nur wird das leider niemand mehr sehen können, weil es dann auf der Erde keine Menschen mehr geben wird. Die sind bis dahin vermutlich alle ausgestorben. Und wenn es doch noch Menschen gäbe, wäre das Licht so gleißend und heiß, dass sie alle verbrennen würden, selbst wenn sie in Tunneln hausten.
19
Buchkapitel überschreibt man normalerweise mit den Kardinalzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Ich jedoch habe beschlossen, meine Kapitel mit den Primzahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13 usw. zu überschreiben, weil ich Primzahlen klasse finde.
Welche Zahlen Primzahlen sind, bekommt man so heraus:
Zuerst schreibt man alle positiven ganzen Zahlen auf:
Man entfernt alle Zahlen, die durch 2 teilbar sind. Dann entfernt man alle Zahlen, die durch 3 teilbar sind. Schließlich entfernt man alle Zahlen, die durch 4 und 5 und 6 und 7 und so weiter teilbar sind. Die Zahlen, die übrig bleiben, sind die Primzahlen.
Die Regel, mit der man Primzahlen ermittelt, ist also ganz einfach, aber es hat noch niemand eine Formel entdeckt, mit der sich feststellen ließe, ob es sich bei einer sehr hohen Zahl um eine Primzahl handelt oder wie die nächste Primzahl heißt. Bei einer wirklich sehr, sehr hohen Zahl kann es Jahre dauern, bis der Computer errechnet hat, ob es eine Primzahl ist.
Primzahlen eignen sich gut für Geheimcodes, und in Amerika werden sie als militärisch relevant eingestuft. Wenn man eine Primzahl findet, die über 100 Ziffern lang ist, muss man es der CIA melden und die kauft sie einem dann für $ 10 000 ab. Aber das wäre wohl keine sehr gute Methode, seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Primzahlen bleiben übrig, wenn man alle Muster entfernt. Ich denke, Primzahlen sind wie das Leben. Sie sind sehr logisch, aber man käme niemals auf die Regeln, selbst wenn man die ganze Zeit über nichts anderes nachdenken würde.
23
Als ich auf der Polizeiwache ankam, musste ich direkt am Eingang die Schnürsenkel aus meinen Schuhen ziehen und alles, was in meinen Taschen war, auf den Tisch legen. Auf diese Art wollte man verhindern, dass ich noch einen Gegenstand bei mir trug, mit dem ich Selbstmord begehen, fliehen oder einen Polizisten angreifen konnte.
Der Sergeant hinter dem Tisch hatte stark behaarte Hände, und seine Fingernägel waren so weit abgeknabbert, dass sie geblutet hatten.
In meinen Taschen befanden sich folgende Gegenstände:
Ein Schweizer Armeemesser mit 13 Teilen, einschließlich einer Abisolierzange, einer Säge, einem Zahnstocher und einer Pinzette.Ein Stück Schnur.Ein hölzernes Puzzleteil, das so aussah: 3 Körnchen Rattenfutter für meine Ratte Toby.£ 1,47 (bestehend aus einer £ 1-Münze, einer 20 Pence-Münze, zwei 10 Pence-Münzen, einer 5 Pence-Münze und einer 2 Pence-Münze).Eine rote Büroklammer.Ein Haustürschlüssel.Ich trug auch meine Armbanduhr, und die sollte ich ebenfalls abgeben, aber ich sagte, meine Uhr bräuchte ich unbedingt, weil ich immer genau wissen müsse, wie spät es ist. Als man sie mir abnehmen wollte, begann ich zu brüllen, und da durfte ich sie behalten.
Man fragte mich, ob ich Familie hätte. Ich sagte ja.
Man fragte mich, wer denn noch alles zu meiner Familie gehöre.
Ich antwortete, mein Vater, aber Mutter sei tot. Und ich sagte, da gebe es noch Onkel Terry, aber der lebe in Sunderland und sei Vaters Bruder, und dann noch meine Großeltern, aber drei davon seien tot und Grandma Burton wohne im Heim, denn sie leide an Altersdemenz und halte mich für jemanden aus dem Fernsehen.
Als Nächstes wollten sie Vaters Telefonnummer wissen.
Ich sagte, er habe zwei Nummern, eine für zu Hause und eine fürs Handy, und nannte ihnen beide.
Die Zelle auf der Polizeistation war ganz hübsch. Sie bildete fast einen perfekten Würfel: 2 Meter lang, 2 Meter breit, 2 Meter hoch. Sie enthielt annähernd 8 Kubikmeter Luft. Sie hatte ein kleines vergittertes Fenster und auf der gegenüber liegenden Seite eine Eisentür mit einer langen schmalen Durchreiche in Bodennähe, um Tabletts mit Essen in die Zelle zu schieben. Weiter oben war eine Schiebeluke, durch die die Polizisten hereinschauen und sehen konnten, ob der Gefangene nicht entflohen war oder Selbstmord begangen hatte. Außerdem gab es noch eine gepolsterte Bank.
Ich überlegte, wie ich fliehen würde, wenn ich jetzt in so einer Romangeschichte wäre. Ziemlich schwierig, denn bis auf Kleider und Schuhe trug ich nichts am Leib, und in den Schuhen waren ja nicht einmal Schnürsenkel.
Der beste Plan schien mir, auf einen richtig schönen Tag zu warten, dann mit meiner Brille das Sonnenlicht auf ein Kleidungsstück zu fokussieren und ein Feuer zu entfachen. Sie würden den Rauch sehen und mich aus meiner Zelle holen, und dann würde ich fliehen. Falls sie den Rauch nicht bemerkten, konnte ich immer noch auf die Kleider pinkeln und die Flammen löschen.
Ich fragte mich, ob Mrs Shears behauptet hatte, ich sei Wellingtons Mörder, und ob sie wohl ins Gefängnis musste, wenn die Polizei herausfand, dass sie log. Denn wenn man über andere Leute Lügen verbreitet, nennt man das Verleumdung.
29
Ich finde die Menschen sehr verwirrend.
Dafür gibt es zwei Hauptgründe.
Der erste Hauptgrund ist der, dass die Menschen sehr viel sagen, ohne überhaupt Wörter zu benutzen. Siobhan hat mir erklärt, dass schon das Hochziehen einer Augenbraue alles Mögliche bedeuten kann. Es kann heißen »Ich hätte gern Sex mit dir«, aber es kann auch heißen »Ich glaube, du hast da gerade etwas sehr Dummes gesagt.«
Wenn man den Mund zumacht und laut durch die Nase ausatmet, meint Siobhan, kann das sowohl bedeuten, dass man sich entspannt, als auch, dass man sich gerade langweilt oder sogar wütend ist. Das hängt ganz davon ab, wie viel Luft aus deiner Nase kommt und wie schnell, und auch davon, wie man dabei den Mund verzieht, wie man dasitzt und was man kurz davor gesagt hat und hundert andere Dinge, die so kompliziert sind, dass man in ein paar Sekunden nicht dahinter kommt.
Der zweite Hauptgrund ist der, dass die Leute so oft Metaphern benutzen. Hier sind einige Beispiele für Metaphern:
Ich hab mir einen Ast gelacht.
Er war ihr Augapfel.
Sie hatten eine Leiche im Keller.
Der Himmel hängt voller Bassgeigen.
Der Hund war mausetot.
Das Wort Metapher bedeutet, dass man etwas von einem Ort zum anderen trägt. Es kommt von den griechischen Wörtern µετα (das bedeutet von einem Ort zum anderen) und Φερειν (das bedeutet tragen), und damit ist gemeint, dass man etwas mit einem Wort beschreibt, das etwas anderes bezeichnet, das es nicht ist. Das bedeutet, dass das Wort Metapher eine Metapher ist.
Meiner Meinung nach müsste es Lüge heißen, weil doch niemals Bassgeigen am Himmel hängen und kein Mensch Leichen im Keller hat. Und wenn ich mir die zweite Redensart bildlich vorzustellen versuche, ist das sehr verwirrend, weil die Vorstellung von einem Apfel im Auge doch nichts damit zu tun hat, dass man jemanden sehr gern hat, und dann vergisst man, worüber der andere eigentlich gesprochen hat.
Mein Name ist auch eine Metapher. Er bedeutet Christus tragen und kommt von dem griechischen Wort xρίστoζ (was Jesus Christus heißt) und Φερείν, das ist der Name, den der heilige Christophorus erhielt, weil er Jesus Christus über einen Fluss getragen hat.
Jetzt fragt man sich natürlich, was für einen Namen er wohl hatte, bevor er Christus über den Fluss trug. Aber da hatte er überhaupt keinen Namen, weil es nämlich eine apokryphe Geschichte ist und somit auch eine Lüge.
Mutter hat immer gesagt, Christopher sei ein schöner Name, weil es in seiner Geschichte um Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft geht, aber ich will gar nicht, dass mein Name für eine Geschichte über Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft steht. Ich will, dass mein Name für mich steht.
31
Es war 1.12 Uhr, als mein Vater auf der Polizeiwache erschien. Gesehen habe ich ihn erst um 1.28 Uhr, aber ich weiß, dass er vorher da war, denn ich habe ihn gehört.
Er brüllte: »Ich will zu meinem Sohn!« Und: »Warum hat man ihn eingesperrt, verdammt noch mal?« Und: »Na klar hab ich eine Stinkwut!«
Ich hörte, wie ein Polizist zu ihm sagte, er soll sich beruhigen. Dann habe ich lange Zeit gar nichts gehört.
Um 1.28 Uhr öffnete ein Polizist die Zellentür und sagte, es sei jemand für mich da.
Ich ging hinaus. Vater stand im Korridor. Er hielt seine rechte Hand hoch und spreizte die Finger wie einen Fächer. Ich hielt meine linke Hand hoch und spreizte die Finger zu einem Fächer, und dann legten wir unsere Finger und Daumen aufeinander. Das machen wir, weil Vater mich manchmal gern in den Arm nehmen würde, aber ich mag Umarmungen nicht, deshalb machen wir es so, und es bedeutet, dass er mich lieb hat.
Dann forderte der Polizist uns auf, ihm durch den Korridor in einen anderen Raum zu folgen. In diesem Raum standen ein Tisch und drei Stühle. Er sagte, wir sollten uns an die eine Seite des Tischs setzen, und er setzte sich uns gegenüber. Auf dem Tisch stand ein Tonbandgerät, und ich fragte, ob er mich jetzt verhören und das Verhör auf Band aufnehmen würde.
»Ich denke, das wird nicht nötig sein«, sagte er.
Er war Kommissar. Das erkannte ich daran, dass er keine Uniform trug. Er hatte viele Haare in der Nase. Es sah aus, als versteckten sich zwei klitzekleine Mäuse in seinen Nasenlöchern. 2 Er sagte: »Ich habe mit deinem Vater gesprochen, und er meint, dass du den Polizisten nicht schlagen wolltest.«
Ich erwiderte nichts, weil es ja keine Frage war.
»Wolltest du den Polizisten schlagen?«
»Ja.«
Er verzog das Gesicht und fragte: »Aber du wolltest dem Polizisten nicht wehtun?«
Ich dachte nach und sagte: »Nein. Wehtun wollte ich dem Polizisten nicht. Ich wollte nur, dass er mich nicht mehr anfasst. «
Darauf er: »Du weißt aber, dass man einen Polizisten nicht schlagen darf?«
»Ja.«
Er schwieg ein paar Sekunden und fragte dann: »Hast du den Hund getötet, Christopher?«
»Ich habe den Hund nicht getötet«, antwortete ich.
»Du weißt, dass man einen Polizisten nicht anlügen darf und dass du dir große Probleme einhandelst, wenn du das dennoch tust?«
»Ja.«
»Also, weißt du, wer den Hund getötet hat?«
»Nein.«
»Sagst du auch die Wahrheit?«
»Ja. Ich sage immer die Wahrheit.«
Darauf er: »Na gut. Du bekommst jetzt eine Verwarnung von mir.«
»Ist das so ein Zettel wie eine Urkunde, die ich behalten darf?«, fragte ich.
»Nein, eine Verwarnung heißt, wir fertigen ein Protokoll darüber an, dass du einen Polizisten geschlagen hast und dass es ein Versehen war und dass du dem Polizisten nicht wehtun wolltest.«
»Es war aber kein Versehen.«
Da sagte Vater: »Christopher, bitte.«
Der Polizist machte den Mund zu, atmete laut durch die Nase aus und meinte: »Wenn du noch mal etwas anstellst, holen wir dieses Protokoll heraus. Wir werden dann sehen, dass du schon eine Verwarnung erhalten hast, und die Sache deswegen wesentlich ernster nehmen. Hast du mich verstanden? «
Ich sagte ja, ich hätte verstanden.
Darauf meinte er, wir könnten jetzt gehen, und er stand auf, öffnete die Tür, und wir gingen hinaus in den Korridor und zum Schreibtisch am Eingang zurück, wo ich mein Schweizer Armeemesser und mein Stück Schnur und das hölzerne Puzzleteil und die 3 Körnchen Rattenfutter für Toby und meine 1,47 Pfund und die Büroklammer und meinen Haustürschlüssel abholte (die sich alle in einer kleinen Plastiktüte befanden), und dann gingen wir hinaus zu Vaters Wagen und fuhren heim…
37
Ich lüge nie. Mutter hat immer gesagt, das komme daher, dass ich ein guter Mensch sei. Aber das stimmt nicht. Es kommt daher, dass ich nicht lügen kann.
cbt – C. Bertelsmann Taschenbuch
Der Taschenbuchverlag für Jugendliche
Verlagsgruppe Random House
3. Auflage
Erstmals als cbt Taschenbuch Juli 2006
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2003 der Originalausgabe by Mark Haddon
Die englische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel
»The Curious Incident of the Dog in the Night-Time«
bei Jonathan Cape, London.
Der englische Originaltitel ist ein Zitat aus diesem Dialog
einer Sherlock-Holmes-Geschichte: »Gibt es sonst noch etwas, worauf Sie meineAufmerksamkeit lenken wollen?«»Der sonderbare Umstand mit dem Hund in der Nacht.«»Aber der Hund hat in der Nacht doch gar nichts getan.«»Das ist ja gerade das Sonderbare«, meinte Sherlock Holmes.(Arthur Conan Doyle, Silver Blaze) © 2003 der deutschsprachigen Ausgabe
Karl Blessing Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Übersetzung: Sabine Hübner Die Arbeit der Übersetzerin wurde gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-06356-6V002
www.cbj-verlag.de
www.randomhouse.de
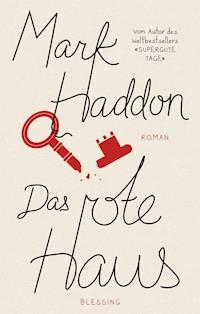














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













