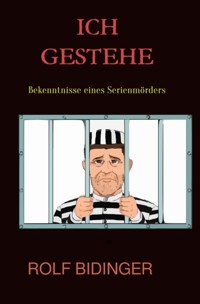3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
komisch, skurrile kurzgeschichte
Eine seltsame Nacht im Theater. Das große Silvesterkonzert ist beendet, aber Ruhe kehrt nicht ein. Die Instrumente proben den Aufstand.
Diese und weitere seltsame Geschichten! Komisch, skurril und grotesk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Symphonie der Nacht
NEUE SATIREN
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenGeteilte Freude
Geteilte Freude
Was ein Autor schreibt, ist nicht so von Bedeutung. Entscheidend ist, wie viel er schreibt. Wobei es nicht auf die Länge des Textes ankommt, sondern einzig und allein darauf, dass es durch vier teilbar ist. Denn jedes Buch muss durch vier teilbar sein, sonst hat es Leerseiten. Leerseiten heißen Leerseiten, weil sie leer sind. Da steht dann nichts. Das stimmt keinen Leser froh. Wobei ich Bücher kenne, wo ich geradezu nach einer Leerseite lechze. Manche Bücher sollten überhaupt nur aus Leerseiten bestehen! Wobei es sogar noch besser gewesen wäre, man hätte den Autor erschossen oder eine ähnlich gelagerte Alternative erwogen, bevor er angefangen hat zu schreiben. Leider verbietet das Gesetz solche Maßnahmen, die ich jedoch als Überdenkenswert erachte.
Dieses Buch kommt gänzlich ohne Leerseiten auf, da ich penibel darauf geachtet habe. Denn bei einer Leerseite kommt der Leser nur unnötig ins Grübeln. Er kommt womöglich auf den unsinnigen Gedanken, der Autor könnte die Leerseite absichtlich freigelassen haben, um dem Leser einen Denkanstoß zu geben. Ihn geradezu zu zwingen, sich intellektuell mit diesem textfreien Blatt auseinanderzusetzen. Doch gerade dies birgt ungeahnte Gefahren. Während nämlich dann die 388 Seiten Text, die Zahl bitte nur als Beispiel begreifen, denn genauso hätte ich 112, 226 oder 8876 Seiten schreiben können, solange es nur durch vier teilbar ist, völlig in Vergessenheit geraten. Jetzt starrt der Leser nur noch auf die Leerseite und fragt sich, was der Autor wohl nicht geschrieben hat, dass so etwas passiert ist. Dann geht die Fantasie mit ihm durch, denn er befürchtet, etwas Wesentliches zu verpassen, was da eigentlich auf der Leerseite stehen könnte. Diese Unwissenheit kann zu Schlaflosigkeit führen und am nächsten morgen ist man gereizt und fängt an sich mit seiner Umwelt zu streiten. Es wäre nicht der erste Fall, der wegen einer Nichtigkeit zum Mord führt. Oder eben, wenn man alleinstehend ist, in Ermangelung eines adäquaten Mitstreiters, zum Selbstmord. Etwaige Erben könnten dann den Verlag, der das Buch mit der Leerseite herausgegeben hat, verklagen. Ein gewiefter Verlag wird nun seinerseits den Autor zur Verantwortung ziehen und Regress fordern. Und das wäre ja Letztenendes ICH! Irgendwo in meinem Vertrag steht sicher etwas im Kleingedruckten. Vermutlich unsichtbar mit Zitronenwasser geschrieben, was man nur sichtbar machen kann, wenn man die entsprechende Stelle frei bügelt. Da ich aber nur knitterfreie Kleidung trage, was mich von der Last des Bügelns befreit, fehlt es mir an dem nötigen Werkzeug. Dies weiß natürlich mein Verleger, dem ich einmal persönlich ansichtig war und nutzt dieses rechtliche Schlupfloch schamlos aus. Ihn stört die Leerzeile nicht, denn sowohl das Korrektorat, noch das Lektorat, haben damit viel Arbeit. Auch muss die Leerseite nicht aufwendig gesetzt werden. Damit spart der Verlag Unsummen. Eine Leerseite ist damit ein lohnendes Geschäft. Ein cleverer Verleger animiert sogar, was ich als verwerflich ansehe, den Autor dazu, möglichst viele Leerseiten zu produzieren, vorausgesetzt, hinterher lässt es sich durch vier teilen.
Da ich meinem Verlag nicht den Triumph gönne, aus meinen Leerseiten Kapital zu schlagen, habe ich jegliche Empfehlung in den Wind geschlagen und solange weitergeschrieben, bis auch die letzte Seite beschriftet war.
Dies wollte ich dem geneigten Leser nur mitteilen, bevor er mit dem Lesen beginnt, denn es drohte ernsthaft, sich bei mir eine Leerseite einzustellen, die ich jedoch, dank dieser Zeilen, im letzten Moment auffüllen konnte.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen leerseitenfreien Genuss, der nun nachfolgenden buchstabenreichen Seiten. Ich hoffe, es war lehrreich für sie oder hätten sie die lieber eine Leerseite gehabt?
Symphonie der Nacht
Symphonie der Nacht
Das große Haus lag, in der Dunkelheit der Nacht, still da. Der Trubel war verflogen. Die letzten Gäste sind gegangen, die sich eben noch am Champagner labten. Die angeregten Gespräche, über das soeben Gehörte, sind verstummt. Auf den Gängen, wo vor kurzem noch emsiges und hektisches Treiben war, zeigt sich jetzt nur noch eine kleine Abordnung von hauseigenen Wollmäusen, die ihre höchst eigene Version von Schwanensee aufführen.
Der Pförtner hat seine letzte Runde gedreht und sitzt nun wieder, verschanzend hinter seiner Bildzeitung und hofft darauf, nicht weiter gestört zu werden. Er genießt die nächtliche Ruhe, die er sich, mit eigens mitgebrachtem Kaffee versüßt. Gut behütet steht die Thermoskanne neben ihm. Zur Geschmacksverstärkung hatte er den Kaffee mit Kognak versetzt, nach einem alten Pförtnergeheimrezept. Zwei drittel Kaffee zu einem drittel Kognak. Die Mischung machts eben. So wird er die Nacht gut durchstehen. Sicherheitshalber liegt neben der Thermoskanne eine Rolle Pfefferminzbonbons für den Ernstfall.
Das große Silvesterkonzert ist vorüber. Das große Symphonieorchester hat wieder einmal alles gegeben. Der Dirigent dirigierte, als ginge es um sein Leben. Der Generalmusikdirektor hatte es sich nehmen lassen, heute selbst das Dirigat zu übernehmen. Er jagte seine Musiker von einem Höhepunkt zum nächsten. Ein Feuerwerk der klassischen Unterhaltung.
Die in edle Garderobe geschlüpften Abonnenten, dankten es ihnen mit frenetischem Applaus.
Kein Schmuckstück wurde unbeaufsichtigt zuhause zurückgelassen, sondern stolz präsentiert. Lange hausinterne Diskussionen gingen dem heutigen Besuch voraus. Nicht gerade wenige Ehemänner hatten unter dem Weihnachtsbaum Eintrittskarten für diesen Abend liegen. Doch so mancher sehnte sich nach seiner jährlichen Krawatte zurück. Allerorten hörte man in der Weihnachtsnacht, anklagend und verzweifelt die Rufe manches Mannes: „Muss ich da mitgehen? -- Nimm doch deine Freundin mit!“ – oder „Das Jahr fängt ja gut an!“
Viele empfanden es sowieso schon ungerecht, dass ihre Frauen eine Freundin haben dürfen und ihnen wird sie nicht zugestanden. Einige Männer gönnen sich trotzdem eine. Aber eine, die klassische Musik hasst. Sollte dennoch einmal ein Ehemann mit seiner Geliebten ins Konzert gehen, dann hat er den Sinn des Lebens nicht verstanden. Eine Geliebte ist zur körperlichen und nicht zur geistigen Erbauung erfunden worden.
Doch nicht nur das die Ehemänner mit mussten, sie wurden auch noch gezwungen, ihren guten schwarzen Anzug anzuziehen, den sie ausschließlich für Beerdigungen angeschafft haben und der sonst, eingemottet, ganz hinten, versteckt im Kleiderschrank hängt. Dort wartet er genügsam auf den nächsten Todesfall, der ihm dann wieder einen großen Auftritt beschert. Als letzte Amtshandlung wird er mitsamt seinem Besitzer dereinst den letzten Weg gehen.
Als es auf Mitternacht zuging, in dieser letzten Nacht des Jahres, betrat der Intendant, König über das Dreispartenhaus, die Bühne und zählte von zehn auf null herunter, unter Zuhilfenahme eines Spickzettels und einem Glas Champagner, der ihm auf Produktionskosten, aus dem Requisitenbudget zur Verfügung gestellt wurde.
Der Inspizient rutschte unruhig auf seinem Stuhl, denn er hatte heute die wichtigste Aufgabe. Er musste exakt um Zwölf den elektrischen Gong ertönen lassen. Gongt er zu früh, wird allen das neue Jahr unheimlich lange vorkommen. Gongt er zu spät, steht ihm eine Abmahnung ins Haus.
Der Intendant ist ein Pedant und schlägt damit den Dirigenten noch um Längen, der unbeirrt darauf besteht, jeden Ton so spielen zu lassen, wie der Komponist, in seinem Übereifer, es vorgesehen hat.
Und wehe, es spielt jemand ein F statt eines Fis, dann schüttelt er verächtlich seinen Kopf und seine hochtoupierte Haarpracht wird endgültig zerstört. Da hilft selbst das stabilisierende Haarspray nichts mehr.
Der Maskenbildner, der in der Gasse ängstlich um sein Kunstwerk bangt, erleidet einen höchst theatralischen Zusammenbruch sämtlicher Nerven.
Die Bühnenarbeiter können ihn gerade noch davon abhalten, sich am Schnürboden aufzuhängen. Nicht ganz uneigennützig, denn hinterher haben sie die Arbeit damit ihn wieder abzuhängen.
Doch all dies ist heute nicht geschehen. Das Orchester spielte überragend, der Generalmusikdirektor dirigierte wie ein junger Gott und die Frisur hielt, was der Maskenbildner ihr versprach. Auch der Inspizient war auf die Sekunde genau und der Intendant zählte den Countdown fehlerfrei von seinem Spickzettel herunter. Dann rief er sein „Happy New Year“ in die Menge und das Volk machte es ihm gleich. Es wurde angestoßen und geküsst.
Der Intendant, im Eifer des feierlichen Moments, küsste das halbe Orchester und gab auch jeder Musikerin die Hand. Nachdem nun das neue Jahr gebührend empfangen wurde, fremde Menschen sich in den Armen lagen, erhob der Generalmusikdirektor ein letztes Mal seinen Stab und warf die Arme weit nach oben, was ihm die Gelenke etwas übel nahmen, denn sie wurden von seinem überraschenden Handeln vollkommen überrumpelt. So hatten sie sich das neue Jahr nicht vorgestellt. Der Dirigent auch nicht, der noch in der Nacht die Notaufnahme aufsuchte, weil er auf den letzten Metern versäumt hatte, Körper und Geist in Einklang zu bringen.
Trotz der heftigen Schmerzen, die ihm seine Schulter bereitete und auch die zweite Geige, die sich zweimal verstrich, kämpfte er sich mit letzter Kraft, durch die „Ode an die Freude“, die als Rausschmeißer intoniert wurde.
Chor und Extrachor schmetterten aus vollen Kehlen, doch konnten sie das miteinstimmende Publikum nicht übertönen, was jegliche einstudierte Phrasierungen und Solopartien untergehen ließ, in den Disharmonien, die ihnen aus dem Saal entgegenschallten.
Nachdem das Orchester den letzten Ton verklingen ließ und auf enthusiastischen Applaus erschöpft wartete, übernahm das Publikum kurzerhand die Regie des Abends und sang einfach ungehemmt weiter. Künstlerisch gesehen ein Desaster.
Sprach- und machtlos stand der Dirigent da und in seiner Verzweiflung ließ er das komplette Orchester sich erheben, damit er nicht so alleine herumstehen musste.
Da hatten sie es nun endlich einmal geschafft, aus den Niederungen des Orchestergrabens emporzusteigen, um auf der großen Bühne zu glänzen und dann das!
Doch der Generalmusikdirektor hatte sich schon insgeheim eine Rache ausgedacht. Im nächsten Jahr würde er keine Strauss-Walzer mehr spielen. Das soll André Rieu machen!
Er würde nur noch ganz schwere Kost auf den Spielplan setzen. Schönberg, Stockhausen und Alban Berg und als Rausschmeißer einen Trauermarsch. Was heißt einen, alle Trauermärsche, die die Klassik hervorgebracht hat. Donizetti, Grieg, Beethoven und Händel. Da gibt es dann nichts mehr zum Mitgrölen. Nur keinen Mozart, der Ralph Siegel der klassischen Musik!
Er wird es diesen Kunstbanausen schon zeigen. Und alles in Moll, damit auch ja kein Ballermann Feeling aufkommt. Die Melodieführung werden die Bässe übernehmen und eine singende Säge. Eine Kreissäge! Bei dem Gedanken daran erhellte sich seine finstere Miene.
Und im Chor müssen alle Bass singen, auch die Soprane. Die Countertenöre können ihren Resturlaub nehmen oder Champagner ausschenken.
Er würde den Befrackten und Roben ausführenden Gästen schon zeigen, was es heißt, in seinen Konzerten ungefragt los zu plärren. Symphonische Konzerte, selbst wenn sie an Silvester stattfinden, sind zur Erbauung von Seele und Geist da und sind keine Mitmachveranstaltungen. Fehlt nur noch das sie mitklatschen würden, diese typisch deutsche Unart. Das sollen sie bei Silbereisen machen, aber nicht bei Hayden, Brahms oder Hindemith.
Man stelle sich nur einfach einmal vor, bei Mozarts Requiem in d-Moll würde mitgesungen oder gar rhythmisch geklatscht werden. Da wäre doch die schöne traurige Stimmung dahin.
Um dem vorzubeugen sind die meisten Requiem, auch völlig zurecht, auf Lateinisch. Die Wahrscheinlichkeit, einen ganzen Konzertsaal mit Muttersprachlern angefüllt zu finden, die alle Texte mitsingen können, kann man getrost als eher gering einstufen.
Mit solchen Gedanken quält sich wohl jeder verantwortungsbewusste Generalmusikdirektor.
Aber erst dann!
Als normaler Kapellmeister wollte er noch einfach pünktlich Feierabend haben, um die letzte Bahn zu kriegen. Da wurde dann auch schon mal, gegen Ende hin, das Tempo massiv angezogen, so dass die Streicher kaum mitkamen.
Ein seltsames Geräusch schreckte den Pförtner aus dem Schlaf, den der Inhalt seiner leeren Thermoskanne zu verantworten hatte. Es war ein wehleidiges markerschütterndes Heulen.
„Übt hier noch jemand?“, dachte er so bei sich.
Er verwarf den Gedanken jedoch gleich wieder, denn ein verantwortungsvoller, gewerkschaftlich organisierter Musiker, würde sich nie erdreisten, außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Probenzeit, sein Instrument auch nur eines Blickes würdigen.
Die deutsche Orchestervereinigung, kurz DOV, hat da klare Richtlinien. Wer dagegen verstößt, erhält Blas- Streich- oder Schlagverbot.
Was der Pförtner nicht ahnen konnte, tief unten, in einem kleinen stickigen dunklen Raum, gleich neben dem Orchestergraben, lag eine traurige Geige, die ihr Schicksal bejammerte.
Neben ihr lag, was der Anlass des Jammerns war, ihr Geigenbogen, der völlig zerzaust aussah. Und die Geige schämte sich dafür, denn sie war nicht irgend eine Geige. Sie war die erste Geige und damit Vorbild für alle Streicher, die unter der Knute, ihr musikalisch zu Diensten waren. Wobei sie sich selbst lieber als Violine bezeichnete. Geige klingt ihr einfach zu profan. Begrifflich gesehen ist es aber dasselbe. Manche, die sich damit als Kulturbanausen outen, verwechseln sie oft mit einer Bratsche oder einer Viola. Doch die Viola ist eine Armgeige. Achtung! Nicht zu verwechseln mit einer Arschgeige. Letztere sind meist unmusikalisch und humorlos. Soweit etwas Hintergrundinformation für die hier anwesenden Volkshochschulbesucher unter ihnen.
Aus allen Ecken krochen nun die vom Konzert geschundenen Klangkörper hervor, um zu sehen, was es mit der klagenden ersten Geige auf sich hat. Gerade sie, die doch als Einzige stets den dank des Dirigenten erhält. Allerdings muss ihr Bespieler dafür die stets verschwitzte Hand des Allmächtigen in Kauf nehmen, während sie unter seinem Kinn klemmt.
„Seht nur her, ihr die ihr mit mir Beethovens Neunte heute Abend gestemmt habt. Alle meine Streicher, die unter mir dienen, haben gerissene Saiten. Sämtliche unserer Bogen haben zerrissene Pferdehaare. Da hilft auch keine Haarkur mehr. Alles ist ganz fürchterlich.“, schluchzte die erste Geige, zum Stein erweichen.
„Was soll ich erst sagen!“, meldete sich eine Tuba.
„Ich bin fast ertrunken, im Speichel meines Tubisten.
„Wir rosten doch so leicht!“,sprangen ihm die Trompeten zur Seite.
Eine schrille Stimme mischte sich plötzlich ein.
„Ach mir gehts gut!“
Es war die Triangel, die sich da ungefragt einmischte.
„Halt du dich aus der Diskussion raus.“, brummte der Kontrabass, übellaunig wie immer.
„Du bist ja nicht einmal ein richtiges Instrument.“
„Genau!“, unterstützte ihn das Fagott.
„Drei mickrige Schläge im ganzen Konzert, aber dann hier einen auf dicke Hose machen wollen!“
„Was kann ich denn dafür, wenn hier nur Komponisten gespielt werden, die mich ignorieren. Das ist musikalisches Mobbing! Liszt! Warum spielen wir nicht Liszt? In seinem Klavierkonzert Nr. 1 in Es-Dur, da habe ich ein fabelhaftes Solo!“
„Ach Gott, die olle Kamelle!“, rief augenrollend die Posaune und machte sich ganz lang.
„Ohne mich wäre Mozarts Entführung aus dem Serail nix! Da hatte ich meinen großen Durchbruch.“, meinte die, der oder das Triangel.
Welches Instrument kann schon von sich behaupten drei Geschlechter zu haben!
„Danach ging es aber steil bergab mit der Karriere!“, pfiff ihr die Piccoloflöte den Marsch.
„Ruhe jetzt! Ich will schlafen.“
Es war die dicke Kesselpauke, die sich da lautstark beschwerte und entsprechend ihrer masochistischen Veranlagung, schlug sie sich selbst dabei.
„Ja bitte!“, pflichtete ihm die schüchterne Harfe bei und zupfte verlegen an sich herum.
Doch jetzt ging es erst richtig los. Jede Instrumentenfamilie rottete sich zusammen und ging auf die andren Familienclans los. Blechbläser gegen Holzbläser und vereint gegen die Streicher. Zunächst noch piano, doch dann anschwellend hin bis zum großen Crescendo. Nur die Harfe hielt sich zurück, da sie zu den Zupfinstrumenten zählt und im Orchester alleinstehend ist.
Von all dem völlig unbeeindruckt, lag in seiner holzgeschnitzten und mit rotem Samt ausgeschlagenen Kiste, der von allen verehrte und hoch geachtete Taktstock. Er räusperte sich nur kurz, dann erhob er sich würdevoll. Sofort verstummten alle Instrumente automatisch. Einige aus Respekt vor seiner ungeheuren Macht, andere aus Angst, da sie nur einen Zeitvertrag haben.
„Aber meine Damen und Herren! Ich muss doch sehr bitten. Ihrer aller Taktlosigkeit wird sie morgen teuer zu stehen kommen. Auf dem Probenplan steht der Säbeltanz und da werden sie alle ihre Kräfte brauchen. Und jetzt gute Nacht.“
Langsam kehrte wieder Ruhe ein und die ermüdeten Helden fielen in tiefen Schlaf. Nur die kleine Piccoloflöte nicht. Sie gönnte sich noch einen kleinen Piccolo als Absacker, ehe auch ihr die Augen zufielen.
Als am nächsten Morgen die Musiker ihre Instrumente holten, zeigten sie sich doch etwas verwundert, denn alle ihre Instrumente waren noch immer sehr verstimmt.
Vierzeiler
Vierzeiler
Der Schmetterling, der Schmetterling,
Das ist vielleicht ein dummes Ding.
Fliegt kopflos in den Ventilator.
Und braucht ab jetzt einen Rollator.
Die Königskobra war verschreckt,
Als sie den eignen Schwanz entdeckt.
Drauf war sie dann auch ganz versessen.
Und hat sich selber aufgefressen.
Die Schwarze Witwe Kunigund,
Ernährt sich wirklich sehr gesund.
Ihr Mann die Nähe zu ihr meidet,
sonst wird er nämlich ausgeweidet.
Es war einmal ein Regenwurm,
Der wollt hinauf auf einen Turm.
Nach der ersten Stufe war er platt,
Weil er ja keine Füße hat.
Es sprach der Eber Friederich,
mir ist ja heut so wunderlich.
Und sprang dann auf die eigne Frau.
Und machte sie zu einer Sau.
Die Eintagsfliege Helmut Brüssig,
die war des Lebens überdrüssig.
„Wer will schon, dass ich hier noch bleibe!“
Und stürzt sich in ne Autoscheibe.
Es schwamm im Meer ein alter Wal,
der war am Kopf schon ziemlich kahl.
Er sprach zu sich, so auf die Schnelle:
„Ich brauch jetzt eine Dauerwelle!“
Im Beutel eines Känguru,
da fand sein Junges keine ruh.
Am Anfang hat es nur gemotzt,
dann hat es einfach reingekotzt.
Es war einmal ein kleiner Floh,
mit seinem Leben war er froh.
Er lebte auf dem Dobermann,
weil sowas nur ein Floh tun kann.
Mathilde, eine stolze Kuh,
hört einem Stier geduldig zu.
Der faselt was von großer Liebe.
Und springt auf sie – aufgrund der Triebe.
Im Bad da lebt ein Silberfisch.
Der fand`s hygienisch nicht mehr frisch.
Er zog dann in der Dusche ein.
Schwimmt jetzt im Abfluss, klinisch rein.
Es war einmal die Blindschleiche,
die lag auf einer Schienenweiche.
Da kam ein Zug, in schneller Fahrt!
Das war für die Schlange hart.
Klaus Dieter war ein stolzer Pfau,
kam abends heim zu seiner Frau.
Die wurde grad vom Storch beglückt,
das hat Klaus Dieter nicht entzückt.
Ein Rabe saß auf einer Hecke.
Und schielte nach der Weinbergschnecke.
Die Schnecke war kein großer Sprinter,
erlebte nicht den nächsten Winter.
Reine Selbstverteidigung
Reine Selbstverteidigung
1. Der Fremde
Nachts auf einer Polizeistation. Ein Polizist in Uniform, sitzt hinter seinem Schreibtisch und malt Galgenmännchen. Es ist Heiligabend und noch wurden ihm keine Selbstmorde gemeldet, doch er weiß, es ist nur die Ruhe vor dem Sturm.
Noch sitzen die Familien beim Festtagsbraten und sind noch nicht zum gemütlichen Teil übergegangen, der erfahrungsgemäß das größte Konfliktpotenzial bereithält.
Helmut Studer arbeitet, wie jedes Jahr über die Festtage, seit seine Frau vor Jahren ihm abhandengekommen ist.
Sie ging, mit zwei Koffern in der Hand, zur Christmette und gilt seitdem als unauffindbar.
Inwieweit ein kleiner häuslicher Disput, hinsichtlich des Kartoffelsalats, den es zu den Wiener Würstchen geben sollte, eine Rolle gespielt hat, konnten seine Kollegen nicht klären, da Herr Studer sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berief.
Er bestätigte lediglich seinen nachfragenden Kollegen, dass er Essig und Öl gewünscht hätte, seine Frau aber auf Majonäse bestanden habe. Auch sei es schließlich seine Privatangelegenheit, wann er im Keller neuen Estrich verlegt.
Im internen Abschlussbericht wurde dann auch vermerkt, zwischen dem Verschwinden der Frau und dem Verlegen des Estriches, könnte kein kausaler Zusammenhang festgestellt werden.
Man beließ es dann auch bei einer mündlichen Rüge und verpflichtete ihn, seine Weihnachtsgratifikation einem sozialen Zweck zukommen zulassen.
Die Flasche Sekt wurde dann auch, entsprechend der Verfügung, am Silvesterabend unter den Kollegen aufgeteilt. Damit war die Sache dann zur Zufriedenheit aller erledigt.
Seitdem ist der Heiligabend für Herrn Studer nicht mehr so, wie er einmal war. Er übernimmt nun jedes Jahr die Schicht an Heiligabend, wofür ihm seine Kollegen sehr dankbar sind.
Gerade als die Kirchenglocken zur Zwanzig Uhr Weihnachtsmesse läuten, öffnet sich die Tür der Dienststelle.
Ein kleiner unscheinbarer Mann kommt herein, tritt an den Schalter und grüßt höflich.
„Ich wünsche frohe Weihnachten!“
Wachtmeister Studer schaut von seinen Galgenmännchen auf und blickt mürrisch auf den Störenfried.
„Ja, was gibt`s?“, erwidert er den Gruß, in der Hoffnung, dass der Mann nichts Besonderes will, außer vielleicht nach dem Weg zu fragen.
„Ich habe da einmal eine Frage.“, meint der Mann etwas zögerlich.
„Na dann fragen sie mal!“, antwortet Wachtmeister Studer ohne jegliches Interesse und malt an einem neuen Galgenmännchen.
„Haben wir noch die Todesstrafe?“
Wachtmeister Studer schaut irritiert von seinen Galgenmännchen auf.
„Was ist los?“
„Ob wir die Todesstrafe noch haben, wollte ich wissen!“
„Nein!“, antwortet Wachtmeister Studer einsilbig.
Über das Gesicht des abendlichen Besuchers huscht ein Lächeln der Erleichterung.
„Da habe ich ja nochmal Schwein gehabt.“
„Ja ich auch.“, erwidert Studer.
Dann beginnt er wieder seine Galgenmännchen weiter zu malen. Interessiert sieht ihm der Besucher dabei zu.
„Ah Galgenmännchen!“, ruft er freudig, als er erkennt, was Studer da zeichnet. „
Die habe ich früher auch gerne gemalt. Und „das ist das Haus vom Nikolaus! Aber das ist natürlich schon die hohe Kunst.“
Studer blickt kurz auf, dann malt er stoisch weiter und meint nur:
„Das Haus vom Nikolaus male ich nur an Ostern.“
„Ach!“, meint der fremde Besucher vielsagend.
„Yepp!“, meint Studer und schüttelt seinen Kopf, weil er sich gerade verzeichnet hat.
Er legt den Kugelschreiber zur Seite, öffnet eine Flasche Tipp ex und versucht mit dem kleinen Pinsel, den Fehler ungeschehen zu machen.
„Oh, da habe ich sie wohl in der Konzentration gestört. Das tut mir aber leid.“, entschuldigt sich der Fremde.
„Ist sonst noch was?“, knurrt Studer und schaut missmutig auf die Korrektur, die man deutlich sieht.
„Bleistift!“, ruft der Mann plötzlich und strahlt über das ganze Gesicht.
„Was?“
„Malen sie doch mit einem Bleistift. Wenn ihnen dann ein Fehler unterläuft, korrigieren sie doch mit einem Radiergummi. Tipp ex macht immer so unschöne Hubbel.“
„Das ist kein Hubbel, nur eine dezente Unebenheit.“
„Bitte, ganz wie sie meinen. Ist ja ihr Bild.“
„Eben.“
Für einen Moment entsteht eine Pause. Studer beginnt gerade ein weiteres Galgenmännchen und der Mann schaut ihm dabei sehr aufmerksam zu.
„Was machen sie denn, wenn das Blatt voll ist?“, erkundigt sich der Mann.
Ohne aufzusehen, antwortet Studer: „Dann nehm ich ein neues Blatt.“
„Dürfen sie das denn oder sind das keine Dienstblätter?“
„Die Polizei darf alles. Und solange kein Verbrechen vorliegt, kann ich machen, was ich will.“
„Mein Chef würde mir das nicht erlauben!“, meint der fremde und zieht sich nach einem Stuhl um, den er sich an Wachtmeister Studers Schreibtisch heranziehen will.
„Der Stuhl bleibt, wo er ist! Der ist Staatseigentum.“