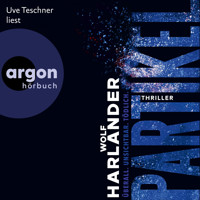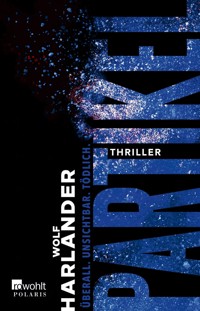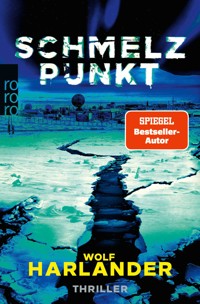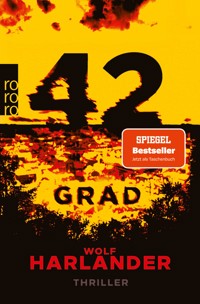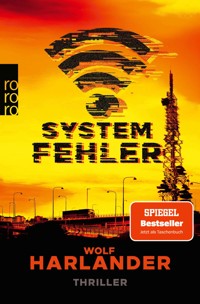
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Offline – und die Welt stürzt ins Nichts. «Was passiert, wenn eine Terrorgruppe das gesamte Internet lahmlegt? Ein packendes, brutales und leider überhaupt nicht unwahrscheinliches Szenario, ausgemalt von einem unserer besten Thrillerautoren.» Focus Mitten in der Urlaubszeit bricht europaweit das Internet zusammen. Flugzeuge können nicht mehr landen, Ärzte nicht mehr operieren, der Verkehr versinkt im Chaos. Bald sind alle Kommunikationswege gekappt. Ganz Europa befindet sich im Ausnahmezustand, die Menschen geraten in Panik, die Versorgung bricht zusammen. BND-Ermittler Nelson Carius vermutet ein hochkomplexes Computervirus hinter den Internetausfällen. Eine Spur führt ihn ausgerechnet zu IT-Experte Daniel Faber aus München, einem unbescholtenen Familienvater. Während das ganze Land gegen das Chaos kämpft, muss Daniel nicht nur seine Familie retten, sondern auch seine Unschuld beweisen … Wenn Fiktion auf Realität trifft: Harlander entwirft ein Szenario, das Experten für sehr wahrscheinlich halten: einen totalen Internetausfall, der unsere Zivilisation in die Knie zwingen würde. Für seinen ersten Thriller «42 Grad» wurde Harlander ausgezeichnet mit dem Stuttgarter Krimipreis und der MIMI 2021, dem Publikumspreis des Deutschen Buchhandels.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wolf Harlander
Systemfehler
Thriller
Über dieses Buch
Offline – und die Welt stürzt ins Nichts.
Mitten in der Urlaubszeit bricht europaweit das Internet zusammen. Flugzeuge können nicht mehr landen, Ärzte nicht mehr operieren, der Verkehr versinkt im Chaos. Bald sind alle Kommunikationswege gekappt.
Ganz Europa befindet sich im Ausnahmezustand, die Menschen geraten in Panik, die Versorgung bricht zusammen. BND-Ermittler Nelson Carius vermutet ein hochkomplexes Computervirus hinter den Internetausfällen. Eine Spur führt ihn ausgerechnet zu IT-Experte Daniel Faber aus München, einem unbescholtenen Familienvater. Während das ganze Land gegen das Chaos kämpft, muss Daniel nicht nur seine Familie retten, sondern auch seine Unschuld beweisen …
Vita
Wolf Harlander, geboren 1958 in Nürnberg, studierte Journalistik, Politik und Volkswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach einem Volontariat bei einer Tageszeitung und der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule arbeitete er für Tageszeitungen, Radio, Fernsehen und als Redakteur der Wirtschaftsmagazine Capital und Wirtschaftswoche. Für seinen ersten Thriller «42 Grad» wurde Harlander ausgezeichnet mit dem Stuttgarter Krimipreis und der MIMI 2021, dem Publikumspreis des Deutschen Buchhandels. Er lebt heute als Autor in München.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2021 by Wolf Harlander
Redaktion Katharina Naumann
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock; Glasshouse/Noll Image/Cavan Social/Plainpicture
ISBN 978-3-644-01027-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Jeder Bürger hängt – direkt oder indirekt – von unseren Informationsnetzwerken ab. Sie werden zunehmend zum Rückgrat unserer Wirtschaft und unserer Infrastruktur; unserer nationalen Sicherheit und unseres persönlichen Wohlergehens. Aber es ist kein Geheimnis, dass Terroristen unsere Computernetzwerke ausnutzen könnten, um uns einen empfindlichen Schlag zu versetzen.
Barack Obama
Prolog
Um die Zivilisation in die Knie zu zwingen, braucht es keine Bomben, keine Raketen.
Am Anfang vom Ende steht eine Computertastatur.
Er weiß das. Eifrig tippt er Buchstaben, Zahlen und Zeichen. Es ist, als schriebe er eine Geschichte – nur in einer seltsamen Sprache. Die Mikroprozessoren verwandeln die elektrischen Impulse jedes Tastendrucks nach und nach in Befehle und bauen daraus eine digitale Gestalt.
Wie Gott erschafft er gerade etwas Neues: ein künstliches Lebewesen, einen Golem. Ein Virus.
Es ist ein Rausch, er fühlt sich wie der Allmächtige. Er ist Gott.
Auf seinen Befehl hin wird sein Geschöpf Chaos, Tod und Zerstörung auslösen.
Wenn die Zeit kommt, wird er es erwecken.
Mit einem Klick schickt er das Virus auf die Reise. Von seinem Rechner fließen die verschlüsselten Befehle als digitale Impulse über ein Kabel zu einem Computer-Internetknoten, der es umgehend in die Weiten des Internets leitet – hinein in Millionen fremde Geräte.
Das dauert nur Sekunden.
Das Wesen fragt nicht, ob es eingelassen wird. Es hat seine eigenen Schlüssel dabei und verschafft sich heimlich Zutritt zu seiner neuen Heimat. Dort nistet es sich tief in die Eingeweide des fremden Gerätes ein, gut versteckt zwischen den anderen Programmen.
Es lauert in einer winzigen Ecke des Speicher-Chips, bis seine Zeit gekommen ist – verborgen und geschützt vor den Blicken der Menschen.
Bis sein Schöpfer ruft. Dann entfaltet es seine Zerstörungskraft.
Wenn die Menschen es bemerken, ist es zu spät.
Kapitel 1
Im Großraumbüro herrschte rege Geschäftigkeit. Einige Mitarbeiter telefonierten oder unterhielten sich, vier von ihnen spielten Tischfußball in einer Ecke, die meisten aber starrten auf ihre Monitore und hämmerten in ihre Tastaturen. Daniel Faber hatte einen kleinen Einzeltisch in der Nähe der Toiletten, seine Kollegen, fast alles junge Männer, saßen nebeneinander an einem roh gezimmerten Holzschreibtisch.
Das ganze Stockwerk war als Loft eingerichtet: Unverputzte Wände, Kabel und Lampen baumelten nackt von der Decke, die Abluftröhren der Klimaanlage zogen sich durch den Raum. An den Wänden hingen Dartscheiben, Plakate von Kinofilmen und Bilder aus Videospielen. Einige wenige Räume waren als Besprechungszimmer und für die Computernetzwerke abgetrennt.
Daniel schaute konzentriert auf seinen Bildschirm, er ordnete die Zielgruppen der neuen Werbekampagne in eine Tabelle. In weitere Spalten trug er die Werbekanäle ein, die die Firma buchen wollte: Internet-Plattformen, Spiele-Diskussionsforen, Auftritte auf Messen, sogar ganz klassische Anzeigen in gedruckten Fachmagazinen waren vorgesehen.
Von seinem Platz aus konnte er den Geschäftsführer in seinem Glasverschlag sehen. Seine Jobbezeichnung lautete Chief Executive Officer, das klang einfach internationaler. Entsprechend warfen die Mitarbeiter im Büro mit englischen Begriffen und Schlagwörtern nur so um sich, als gäbe es für jedes Wort einen Bonus. Und wer Programmierer war und das auch zeigen wollte, streute zusätzlich Fachausdrücke aus der Computerwelt ein, möglichst unverständlich, wie die Geheimsprache der Sekte der Erleuchteten.
Daniel hatte diese Wichtigtuerei nie so recht verstanden. Mit seinen zweiundvierzig Jahren war er der älteste Angestellte bei Furor Games Ltd., älter sogar als der Boss und Hauptaktionär. Daniels offizieller Titel lautete Digital Marketing Manager, und er war als einer von vier Mitarbeitern zuständig für Werbung und die Einführung der neuen Produkte.
Er verwaltete ein gutgefülltes Budget. Schließlich ging es um etwas für das junge Unternehmen: Das neue Game Cyber Nation War sollte alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen und den deutschen Spieleentwickler endgültig in die Weltliga der Internet-Spiele katapultieren, es sollte einen Spitzenplatz erobern, neben den ganz Großen wie Fortnite, World of Warcraft, Counter-Strike oder Call of Duty.
Die Furor Games Ltd., die ihr Hauptquartier in einem Gewerbegebiet am Rande von München hatte, konnte in ihrer fünfjährigen Geschichte bereits einige Erfolge in der Spiele-Gemeinde der sogenannten Online-Challenge-Games feiern. Save the Princess hatte den Laden reich gemacht, War of the Clans war in der Szene berühmt-berüchtigt.
Es war ein hartes Geschäft hinter den Kulissen, ein gnadenloser Kampf um einen weltweiten Milliardenmarkt, um die Aufmerksamkeit der Kunden. Denn die Abonnenten oder Käufer waren längst nicht mehr nur Kinder oder Jugendliche, das musste Daniel bei seinen Verkaufsstrategien berücksichtigen.
Die Deutschen besaßen offenbar eine schier ungebremste Leidenschaft für Computerspiele. Etwa die Hälfte aller Menschen über vierzehn Jahren daddelte regelmäßig oder zumindest gelegentlich in der Freizeit, und rund um den Globus sah es nicht viel anders aus. Kurz gesagt: Das Geschäft lief wie verrückt.
Und der nächste große Coup stand bereits kurz bevor. Eine erste Version von Cyber Nation War war gerade fertiggestellt, ausgewählte Personen sollten das Spiel nun testen – Daniel gehörte wie immer dazu. Er musste sich einen Eindruck verschaffen, um Werbeargumente für den Verkauf finden zu können.
Für gewöhnlich hatte auch sein Sohn Ben dann die Möglichkeit, die Spiele vorab auszuprobieren – obwohl das offiziell nicht erlaubt war. Aber Ben war immer ganz wild darauf, einer der Ersten zu sein, er konnte sich stundenlang in sein Zimmer einsperren, um Runde über Runde vor dem Bildschirm zu hocken. Hin und wieder machte sich Daniel Sorgen, Ben könnte über das Online-Zocken die Schule vernachlässigen. Auf der anderen Seite lieferte ihm Bens Input gute Hinweise für die Vermarktung. Seine praktische Kritik und seine Tipps, wo die Firma noch feilen musste, waren von unschätzbarem Wert.
Daniel schnappte sich seine Tasse und ging zum Kaffeeautomaten. Getränke waren bei Furor Games für die Angestellten gratis, außerdem gab es einen Korb mit frischem Obst und einen mit Schokoriegeln.
Beim Rückweg zu seinem Platz sah er den Programmentwicklern über die Schulter. Sie waren so sehr auf ihre Arbeit konzentriert, dass sie ihn gar nicht bemerkten. Auf den Monitoren erschienen Ausschnitte von künstlichen Landkarten und Konstruktionen einzelner Spielfiguren. Andere wieder schrieben Programmcodes, Zeilen, die auf den ersten Blick aussahen wie Sätze, für den Normalsterblichen aber völlig unverständlich waren. Es wimmelte nur so von Ausdrücken wie #include, void, cout, list, #define und Unmengen von Zeichen wie Sternchen, Schrägstrichen, Klammern oder Punkten.
Insgesamt ergaben die Millionen Codezeilen am Ende das Computerprogramm, die Software, die durch weitere Dolmetscherprogramme übersetzt werden musste, damit die Geräte die Aufgaben und Befehle tatsächlich verstanden. Für Daniel war es wie Lesen in einem Buch, er war schließlich vom Fach. Die wichtigsten Programmiersprachen kannte er in- und auswendig. Früher hatte er ebenso wie seine Kollegen für das Schreiben dieser Codes gebrannt, tagelang hatte er sich in diese kryptischen Zeichenfolgen vertiefen können, aus denen auf den Bildschirmen am Ende ganz neue Welten wurden.
Auf dem Monitor eines Kollegen fiel ihm ein Fehler in einem Code auf, den dieser gerade schrieb. Er überlegte, ob er darauf hinweisen sollte, er wollte nicht wie ein Besserwisser klingen. Aber letztlich konnte sein Hinweis ja nur helfen. Er gab sich einen Ruck und tippte dem Programmierer auf die Schulter.
«Ja?», rief der junge Mann laut, ohne seine Kopfhörer abzunehmen.
Daniel machte ihm ein Zeichen, dass er mit ihm sprechen wolle, und deutete auf den Bildschirm.
Der Kollege verzog das Gesicht und nahm den Kopfhörer ab. «Was ist? Ich bin beschäftigt, siehst du doch!»
«Entschuldigung.» Er zeigte auf die betreffende Stelle. «Da hast du dich bestimmt vertippt, der Code wird nicht funktionieren.»
«Ach, tatsächlich?» Der junge Mann lehnte sich zurück und sah ihn mitleidig an.
«Ich mein ja nur, als Kollege.»
«Was du nicht sagst, Kollege.» Er hob spöttisch die Augenbrauen. «Wie schön, einen Kollegen wie dich zu haben, du Kollege, du.»
«Ich … ich wollte nur helfen.»
«Weißt du was? Halte andere Menschen einfach nicht vom Arbeiten ab. Ich weiß genau, was ich tue. Warum müsst ihr Marketing-Fuzzis überall euren Senf dazugeben? Bleib in deiner Ecke, trink deinen Kaffee und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß.»
«Aber das …»
«Nichts für ungut, aber hiervon verstehst du nichts. Bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also, lass gut sein, kümmere dich um dein Werbezeugs oder was du auch immer machst, das hier ist nicht deine Welt.» Er setzte seinen Kopfhörer wieder auf und wandte sich seinem Bildschirm zu.
Daniel biss sich auf die Zunge, um nicht zu einer deutlichen Antwort auszuholen. Was sollte das schon bringen? Der Kollege hatte ja recht, er war bei Furor Games als Marketing-Experte eingestellt worden und nicht als Softwareentwickler. Von seinen Programmierfähigkeiten wussten die meisten hier nichts, und er hielt sich normalerweise auch zurück, um sich nicht unbeliebt zu machen. Zumal die jüngeren Kollegen eine ganz eigene Auffassung von ihrem Job hatten und sich außerhalb ihres Arbeitsbereichs für wenig interessierten, schon gar nicht dafür, dass er ausgebildeter IT-Spezialist war und durchaus etwas von Programmierung und Softwareentwicklung verstand. Er hatte in Aachen an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Informatik studiert und danach mehrere Jobs bei Softwarefirmen und Beratungsunternehmen für Internet-Sicherheit gehabt.
Damals, vor vier Jahren, war ihm die Stelle bei Furor Games ideal erschienen, um die Spieleentwicklung von allen Seiten kennenzulernen und sich für neue Aufgaben zu empfehlen. Dass er Digital Marketing Manager bleiben würde, hätte er selbst nicht gedacht.
Er seufzte. Es musste sich etwas ändern. Er nahm sich vor, das Thema nicht länger aufzuschieben und endlich mit dem Geschäftsführer darüber zu sprechen.
Er war Lord BloodEater, der große Zerstörer. Mit seiner Feuerwalze drang er in die Höhle ein und verbrannte einen Nezzarin-Ork. Das brachte ihm vier Punkte, die er sofort gegen eine Streitaxt aus Elfenstahl eintauschte.
Hinter einem Felsen lauerte ein doppelköpfiger Höllenhund aus dem Lager der Pil’Resut. Er setzte zum Sprung an. Giftige Dämpfe entwichen den beiden Mäulern, jedes Einatmen wäre tödlich. Lord BloodEater hob seinen Schild, schleuderte dem Tier seinen Dreizack entgegen und traf direkt ins Herz. Mit einem Jaulen zerfiel der Angreifer zu Asche.
Sein Begleiter EarlCombat kämpfte derweil mit einer Kobra, die über einen zeitweiligen Schutzzauber verfügte. Er versuchte mit einer Fackel aus Titanenholz dagegenzuhalten. Aber die Kobra ließ sich damit nicht besiegen, sondern kam näher und näher.
«Schnell, nimm den magischen Spiegel und blende sie», rief Lord BloodEater. «Und dann hack ihr mit dem Schwert den Kopf ab!»
Es funktionierte. Der Kopf flog durch die Luft. Aus der Schlange spritzte grünes Blut.
«Pass auf!»
Zu spät.
Einige Tropfen trafen EarlCombat. Sofort verfärbte sich seine Kleidung, sie fing an zu rauchen.
«Du musst deine Jacke ausziehen, los!», sagte Lord Blood-Eater. «Und schmier dich mit der Salbe aus Hexenwaldkräutern ein.»
«Dann ist mein Vorrat aufgebraucht. Ich hab dann nichts mehr bei der nächsten Wunde.»
«Egal, tu’s.»
«Aber ich …»
«Mach’s einfach.»
EarlCombat behandelte sich mit der Salbe, gleich danach war er wiederhergestellt.
«Das war knapp», sagte er. «Und jetzt?»
«Wir sollten es noch mal versuchen.»
«Wirklich?»
Vor ihnen lag die Sumpfebene Daanveerlan, die zum Herrschaftsgebiet der Flusstrolle gehörte. Die Durchquerung war notwendig, um das nächste Spiel-Level zu erreichen. Einmal waren sie bereits gescheitert und hatten sich zurückziehen müssen.
Die Gefahren waren vielfältig: Sumpf-Olme schnappten nach den Reisenden, versteckte Strudel zogen sie hinab in die Unterwelt.
Und das Schlimmste waren die Dunklen Abgesandten, die Wächter der Ebene, grausam, heimtückisch und im Dienst der Flusstrolle.
Jederzeit konnten sie scheinbar aus dem Nichts auftauchen, mit Netzen und zielgenauen Pfeilen bewaffnet. Sie ernährten sich von den Kadavern der Wildtiere und erholten sich blitzartig von ihren Verletzungen.
«Ben.» Die Stimme kam aus der Ferne.
«Wir sollten zusätzliche Waffen kaufen», sagte Lord Blood-Eater.
«Und einen Schutzmantel, unter den wir im Notfall kriechen können», antwortete EarlCombat.
«Ben, hörst du mich?» Es war seine Mutter.
«Gleich», rief Ben alias Lord BloodEater, tief ins Spiel versunken. EarlCombat und er bezahlten die Waffe und machten sich auf den Weg. Am Anfang glich die Landschaft mehr einer Wüste. Überall waren verdorrte Sträucher und Gräser. Aber schon bald stießen sie auf einen Tümpel mit einer schwarzen Flüssigkeit, aus der Blasen aufstiegen. Was für Wesen lebten dort?
Die Tür ging auf, und ein Kopf erschien im Türrahmen. «Habt ihr was an den Ohren? Ich hab dich gerufen, Ben.» Seine Mutter klang ungehalten.
«Ja, Mam, einen Moment noch. Moritz und ich wollen nur noch den Spielzug zu Ende bringen.»
«Nichts gleich. Das Essen steht auf dem Tisch.» Sie sah seinen Freund an. «Und du, Moritz, willst du mit uns essen?»
«Danke, aber ich muss gleich nach Hause.» Sein Kumpel sprang auf und sammelte eilig seine Sachen zusammen. «Frier das Spiel ein, wir machen morgen weiter», sagte er.
Ben seufzte. Moritz war sein bester Freund, er war ebenfalls dreizehn Jahre alt, sie besuchten dieselbe Klasse in der Schule. Und er kämpfte mit ihm Seite an Seite als EarlCombat bei War of the Clans.
«Meinetwegen, bis morgen», antwortete Ben.
Moritz verabschiedete sich hastig und drückte sich an Bens Mutter vorbei aus dem Zimmer.
«Wofür hab ich vor meiner Tür das Betreten-verboten-Schild aufgehängt, wenn du dich sowieso nicht daran hältst?», sagte Ben missmutig zu seiner Mutter. «Wir hatten gerade einen so geilen Lauf – und du machst alles kaputt.»
«Du wirst es überleben. Außerdem klebst du schon den ganzen Nachmittag mit Moritz am Bildschirm. Eine Pause tut dir gut. Für heute ist es genug.»
«Du hast überhaupt keinen Respekt vor meiner Privatsphäre. Und wir haben doch Ferien, da kann ich machen, was ich will.»
«Ferien heißt nicht, die ganze Zeit nur in diesem dunklen Loch herumzuhängen.» Sie machte eine unbestimmte Geste in Richtung seines ungemachten Bettes und der auf dem Boden verstreuten Zeitschriften. «Du könntest deine Zeit besser nutzen und hier mal aufräumen, das ist dringend nötig, wie mir scheint. Und das Fenster aufzureißen und frische Luft hereinzulassen, wäre auch nicht verkehrt.»
«Mir gefällt’s aber so.» Ben verschränkte trotzig die Arme vor der Brust. Warum mussten Eltern einen immer bevormunden? Er war schließlich kein kleines Kind mehr.
«Jetzt komm, ich hab Spaghetti gemacht, die werden kalt. Und dein Vater wartet schon.» Seine Mutter verließ das Zimmer.
«Moment noch.» Er sicherte den Spielstand. War of the Clans machte immer noch Spaß, es war eben ein Klassiker der Online-Games, auch wenn die neueren Spiele eine bessere Grafik boten und mehr Auswahl bei den Figuren.
«Und, hast du deinen Rekord schon eingestellt?», begrüßte ihn sein Vater am Tisch. Ben lud sich Nudeln auf den Teller, goss Tomatensoße darüber und streute Parmesan drauf. Sein Vater hatte die eigene Portion schon halb aufgegessen.
Ben schüttelte den Kopf. «Leider haben uns Mam und du mit eurem altmodischen Abendessen-Ritual total aus dem Konzept gebracht. Dabei waren wir so nah dran, die Sumpfebene zu packen.»
«Was Vernünftiges zu essen ist nicht altmodisch.» Sein Vater klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. «Es ist doch schön, wenn wir alle wenigstens einmal am Tag zusammensitzen. Und wenn du was im Bauch hast, besiegst du jedes Sumpfmonster mit links.»
«Aber wo sind Carolin und Sophie? Die müssen auch nicht mitessen.» Seine beiden Schwestern waren erst zehn und zwölf Jahre alt, durften aber trotzdem immer viel mehr als er, schien ihm.
«Die dürfen heute ausnahmsweise bei einer Freundin übernachten», sagte seine Mam.
«Seht ihr, die müssen sich nicht an so bescheuerte Regeln halten.»
«Jeder große Krieger trägt Verantwortung.» Sein Vater lächelte. «Du kannst dich später wieder in deine Burg verkriechen.»
Sie aßen schweigend.
«Wann krieg ich denn endlich euer neues Game?», fragte Ben nach einer Weile. «Ist es wirklich so krass, wie du erzählt hast?»
«Du meinst Cyber Nation War? Das ist Spitzenklasse, wirklich das Beste, was wir bisher produziert haben. Wir planen es als reine Online-Version. Und die Zahl der Menschen, die gleichzeitig spielen können, ist erstmals unbegrenzt. Man darf Staaten gründen, eigene Völker und Armeen bilden, jeder kann gegen jeden kämpfen, es gibt kein Limit – und wenn das halbe Internet mit dabei ist. Je mehr, desto besser. Es ist wirklich sensationell.»
«Das klingt mega, genau das Richtige für meine Ferien. Wann geht’s damit los?»
«Geduld, Geduld, mein Herr. In zwei Wochen gibt Furor Games die Online-Zugänge zum Testen frei.»
«Aber du kannst doch bestimmt früher …»
«In zwei Wochen, hab ich gesagt. Und dabei bleibt’s.»
«Wenn du meinst …» Ben schob sich die letzte Gabel Spaghetti in den Mund, stellte seinen Teller in die Spüle und verzog sich zurück in sein Zimmer.
Daniel dimmte mit seiner App auf dem Handy das Licht. «So ist’s gemütlicher.» Er umarmte seine Frau und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
«Wir müssen mit unserem Sohn reden, so geht das nicht weiter.» Isabelle setzte sich an den Küchentisch und schenkte sich ein Glas Wein ein.
«Warum, was hat er denn angestellt?» Daniel sah den Blick seiner Frau und ahnte, dass das bevorstehende Gespräch nicht angenehm werden würde.
«Das weißt du genau. Den ganzen Tag schließt er sich in seiner Höhle ein und spielt diese Videospiele. Und außer Moritz hat er keinen richtigen Freund.»
«Na, so schlimm ist es auch wieder nicht. Seine Schulnoten sind doch ganz passabel.»
«Aber auch nicht gut. Das kommt von dieser Zockerei. Manchmal frage ich mich, ob unser Sohn schon spielsüchtig ist.»
«Das gibt sich wieder. Mit dreizehn Jahren ist man in einem schwierigen Alter. Du wirst sehen, seine Interessen ändern sich wieder. Dann sind andere Dinge wichtig, Freundinnen zum Beispiel.» Er nahm ihre Hand. «Mach dir deswegen keinen Kopf.»
«Das sagst du, aber ich bin mir da nicht so sicher. Dieses Abhängen am Computer ist doch keine Altersfrage. Ich möchte nicht wissen, wie viele Männer in ihrer Freizeit mit Bierflasche und Pizza vor ihrem Monitor sitzen, den Joystick in der Hand.»
«Jetzt hast du aber Vorurteile. Außerdem weiß ich wirklich nicht, welchen Joystick du meinst.» Daniel grinste. «Es gibt übrigens auch Frauen, die Online-Games lieben.»
«Unsere Töchter jedenfalls nicht, die interessieren sich für Pferde und Ballett und kämen nie auf die Idee, mit Maschinengewehren irgendwelche Gegner umzunieten.»
«Carolin und Sophie mögen diese Ego-Shooter nicht, da hast du recht. Für so was sind sie mit ihren zehn und zwölf Jahren auch noch zu jung. Aber hast du mal in ihre Handys geguckt? Da wimmelt es nur so von Geschicklichkeitsspielen – ganz zu schweigen von den vielen Online-Filmchen mit Schminktipps und so.»
«Die Apps sind doch harmlos, das ist Kinderkram», sagte Isabelle.
«Tatsächlich? Bist du dir da so sicher? Wir kriegen doch gar nicht so richtig mit, was da alles zu sehen ist.»
«Du lenkst vom Thema ab.» Sie klang ungehalten. «Auch wenn Ferien sind, könnte Ben zwischendurch mal was anderes machen, zur Abwechslung ein Buch lesen oder raus an die frische Luft und Sport treiben oder mit Bekannten zum Eisessen gehen.»
«Ich rede mit ihm.»
«Eigentlich wollten wir doch in den Urlaub fahren, ans Meer. Du hast es den Kindern versprochen, Daniel. Und ich hätte auch nichts dagegen, mal aus dieser Wohnung herauszukommen.»
«Ja, stimmt. Ich wünsche mir ja auch nichts mehr, als dass unsere Familie gemeinsam etwas unternimmt. Aber wir stecken nun mal gerade in der heißen Phase der Einführung von Cyber Nation War …»
«Oder wir fahren wenigstens zu deiner Schwester Claudia nach Hamburg. Sie hat uns schon seit längerem zu sich eingeladen. Und dort gibt es viel Wasser, da können die Kinder Boot fahren.»
«Rauf in den Norden mit dem Auto dauert ewig. Außerdem hätte sie sowieso kaum Zeit für uns. Sie ist nun mal Ärztin und muss viel arbeiten, ich ja auch.»
«Immer denkst du nur an deine Arbeit. Und die Familie kommt zu kurz.»
«Wir holen den Urlaub nach, Ehrenwort.»
«Ich hab es so satt!» Isabelle lehnte sich zurück. «Immer heißt es später, später, irgendwann. Nichts passiert. Nichts!»
Daniel griff nach ihrer Hand. Sie zog sie weg.
«Sieh dich doch mal um. Wir leben in einer kleinen, engen Wohnung. Und ich weiß, dass wir nur wenig Geld sparen können. Nur Ben hat sein eigenes Zimmer, die Mädchen müssen sich eins teilen. Darf ich mal träumen und für jedes unserer Kinder ein eigenes Zimmer wünschen? Und ein größeres Bad? Von einer zweiten Toilette ganz zu schweigen.»
«Schatz, wir haben darüber geredet. Die Mietpreise in München sind astronomisch. Das können wir uns momentan nicht leisten – leider. Glaub mir, ich hätte auch gern ein zusätzliches Arbeitszimmer für uns. Wir müssen uns halt gedulden.»
Seine Frau hatte einen wunden Punkt getroffen. Er war selbst unzufrieden mit der derzeitigen Situation. Niemand in der Familie war damit wirklich glücklich. Es war frustrierend. Er liebte seine Frau, er liebte seine Kinder und wollte, dass sie alle zufrieden waren.
«Ich bin es leid, ständig vertröstet zu werden. Das Einfachste wäre doch, du bekämst mehr Gehalt. Ich würde ja gern selber arbeiten gehen und was zu unserer Haushaltskasse beisteuern, aber du weißt ja, wie es ist. Teilzeitjobs in meiner Branche sind rar. Ich verstehe gar nicht, warum du in deiner Firma so wenig verdienst. Du hast Informationstechnik studiert, du hast bereits jede Menge Berufserfahrung – und angeblich sind IT-Leute doch gesucht.»
«Nun, Marketingjobs werden aber nun mal nicht gerade gut bezahlt …»
«Dann ist es das falsche Unternehmen. Oder du hast den falschen Job. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie du als Student immer von all den spannenden und wichtigen Aufgaben geschwärmt hast, die du dir für dein Berufsleben vorstelltest. Davon ist doch gar nichts übrig geblieben.»
Daniel konnte sich ebenfalls lebhaft an seine Zeit in Aachen erinnern, aber vor allem deshalb, weil er dort Isabelle kennengelernt hatte. Sie war eine französische Sprachstudentin gewesen, die dort ein Praktikum machte.
Er hatte sie auf dem Uni-Campus gesehen. Sie war ihm sofort aufgefallen mit ihren langen braunen Haaren, dem Blümchenkleid und dem verschmitzten Lächeln, das sie so einmalig machte.
Er war ihr gefolgt und hatte darüber seine Vorlesung verpasst, bis sie sich plötzlich umgedreht und mit französischem Akzent gesagt hatte: «Sag mal, bist du ein Stalker, dass du mir die ganze Zeit nachläufst?»
Vor Überraschung und Verlegenheit hatte er keinen Ton herausgebracht, bis sie zu lachen begonnen hatte. Sie waren gemeinsam in ein Café gegangen, hatten sich unterhalten, die Stunden waren verflogen.
Und dann war sie weg gewesen. Er hatte dummerweise vergessen, nach ihrer Adresse zu fragen. Er kannte nur ihren Namen: Isabelle Arnaud.
Die nächsten Tage versuchte er verzweifelt, sie ausfindig zu machen, fragte im Café und bei seinen Kommilitonen nach der französischen Sprachstudentin – ohne Erfolg.
Erst einen Monat später traf er sie in der Uni-Mensa wieder – oder sie ihn. Sie hatte kurzfristig zurück zu ihren Eltern gemusst.
Von da an waren sie unzertrennlich. Sie machten gemeinsame Urlaube in der Provence, er zeigte ihr Aachen, sie reisten nach München, fuhren in die bayerischen Alpen. Und am Ende, als sie beide das Gefühl hatten, sie wollten für immer zusammenbleiben, besuchten sie ihre Eltern.
Kaum war Daniel mit dem Studium fertig, heirateten sie. Schon bald war Ben unterwegs. Isabelle musste ihren Wunsch begraben, als Sprachlehrerin zu arbeiten, Daniel jobbte bei verschiedenen Software-Firmen, bis er eine Festanstellung bei einer Kölner Unternehmensberatung für IT-Services fand. Als die Firma von einem US-Unternehmen übernommen wurde, wechselte Daniel zu einem Spezialunternehmen für Internetsicherheit in Frankfurt. Dort geriet er in Konflikte mit einem Auftraggeber, der seine Sicherheitslücken verbergen wollte – am Ende musste er kündigen.
Daniel musste schnell wieder Geld verdienen, ihre Familie war inzwischen mit den Töchtern Carolin und Sophie gewachsen. Und so beschlossen Isabelle und er, es im Süden Deutschlands zu versuchen, wo bei Furor Games eine Marketingstelle ausgeschrieben war.
Die Aufgaben bei den verschiedenen Jobs waren mal mehr, mal weniger aufregend gewesen. Aber immer hatte er versucht, das Beste draus zu machen, er hatte sich angestrengt. Für die Kinder waren die Umzüge in fremde Städte natürlich nicht einfach gewesen. Und Isabelle hatte zurückstecken müssen, doch sie hatte ihn immer unterstützt.
«Ich weiß, wie schwer es für dich ist, Liebling», sagte er zu ihr. «Manches haben wir uns anders vorgestellt. Aber es geht uns doch nicht schlecht. Wir kriegen schon die Kurve, da bin ich mir sicher.»
Seine Frau seufzte. «Aber wann? Es ist gar nicht wegen des Geldes. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Familie auseinanderdriftet. Wir haben zu wenig Zeit füreinander. Jeder ist mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, sogar unsere Kinder. Schau dir nur Ben an, der scheint ja mit seinem Computer zusammengewachsen zu sein. Und wir beide …»
«Was willst du damit sagen?»
«Ach nichts. Es ist nur so, dass momentan etwas nicht stimmt. Ich kann es auch nicht richtig beschreiben.»
«Und, was schlägst du vor?»
«Ich weiß auch nicht … Vielleicht bräuchten wir alle einen Break, eine Pause, in der wir eine Zeitlang innehalten von all dem. Ich weiß nur: So kann es nicht weitergehen.»
Dr. Claudia Weiss sah auf die Uhr. Es war schon nach Mitternacht, sie war mittlerweile seit siebzehn Stunden auf den Beinen. Sie gähnte. Es war höchste Zeit, nach Hause zu gehen. In Gedanken lag sie bereits in ihrem Bett. Vielleicht würde sie vorher noch ein Glas Wein trinken, um runterzukommen.
Heute hatte sie ihren Dienst früher antreten müssen als vorgesehen: eine Notoperation. Und der dafür eingeplante Kollege war mit dem Fahrrad gestürzt und hatte sich die Hand verletzt. Typisch – er war ein wenig schusselig, wenn auch ganz nett und ein hervorragender Chirurg.
Gerade bei schwierigen Eingriffen wurde Claudia oft hinzugebeten, weil sie sich über die Jahre einen exzellenten Ruf bei Operationen mittels Video-Endoskopie erworben hatte. Sie hatte zu der sogenannten Schlüsselloch-Methode sogar Aufsätze in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Im Kern ging es darum, dass feine Glasfaserschläuche und winzige chirurgische Geräte in das Innere des Körpers geführt wurden, gesteuert über Monitore.
Sie streckte sich in ihrem Stuhl, rieb sich die Augen. Genug für heute mit diesem Bürokram. Angeblich sollten ja Computer und automatische Datenverarbeitung die Arbeit hier im Klinikum erleichtern, aber sie hatte den Eindruck, dass sie viel länger damit beschäftigt war, die Formulare und Anforderungen in den Computer zu tippen als damals, als alles noch auf Papier und Karteikarten eingetragen wurde.
«Brauchen Sie noch was, Frau Doktor?» Eine Sekretärin stand in der Tür.
«Danke, ich komme schon allein zurecht», antwortete sie. «Was machen Sie denn noch hier? Fahren Sie heim. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.»
Sie ging ans Fenster. Draußen gewitterte es immer noch, der Regen erlaubte nur wenige Meter Sicht. Nirgends in den Nachbarbüros schien noch Licht zu brennen, wahrscheinlich war sie um diese Zeit ganz allein im Verwaltungstrakt.
Ein Bericht war noch zu schreiben – eine schwierige Herzoperation. Eine Zeitlang hatte es so ausgesehen, als würde es die betagte Patientin nicht überleben, aber dann war doch noch alles gutgegangen.
Der Tod war ein ständiger Begleiter ihrer Arbeit, das wusste sie, aber sie empfand es dennoch jedes Mal als Niederlage, wenn sie jemandem nicht mehr helfen konnte. Sie hatte diesen Beruf ergriffen, um Leben zu retten, um Menschen wieder gesund zu machen. Das war ein erhebendes, ein befriedigendes Gefühl, es trieb sie an und machte sie glücklich.
Aber jetzt war es genug für heute. Den Bericht konnte sie auch morgen noch fertigschreiben. Sie wollte die Datei gerade abspeichern, als das Licht im Raum zu flackern begann und ganz erlosch. Gleich darauf flimmerte auch der Bildschirm, dann war alles schwarz.
Hoffentlich war die Datei nicht verloren. Der Gedanke, alles neu schreiben zu müssen, ärgerte sie. Sie blieb in der Dunkelheit sitzen, in der Hoffnung, dass bald wieder Strom fließen und alles so sein würde wie vorher.
Aber nichts tat sich.
Sie tastete nach dem Einschaltknopf und startete den Computer neu. Der Monitor leuchtete auf. Nach einiger Zeit war wieder die gewohnte Arbeitsmaske zu sehen. Erneut lud sie den Bericht – aber die Seite war leer.
«Mist, Mist, Mist», fluchte sie vor sich hin. Ihre ganze Arbeit war umsonst gewesen. Morgen würde sie jemanden kommen lassen, der die Datei hoffentlich wiederherstellen konnte.
Sie betätigte den Lichtschalter. Die Lampen flammten auf.
«Na immerhin», flüsterte sie. Sie schaltete den Computer aus, packte ihre Sachen in die Tasche, steckte den Autoschlüssel ein. Als sie an der Tür war, ging das Licht erneut aus. Mit dem Licht ihres Handys suchte sie am Schreibtisch die Nummer des technischen Notdienstes. Es dauerte ewig, bis sich eine verschlafene Stimme meldete. «Ja?»
«Hier ist Doktor Claudia Weiss. In meinem Büro ist das Licht ausgefallen, vielleicht ist was mit dem Strom nicht in Ordnung, mein Computer ist auch abgestürzt.»
«Ach, kein Licht?», wiederholte der Mann träge.
«Wie ich bereits gesagt habe.» Sie verdrehte die Augen.
«Haben Sie schon mal die Glühbirnen raus- und wieder reingeschraubt?»
«Es werden kaum mehrere gleichzeitig kaputtgehen.»
«Sie glauben gar nicht, was wir schon alles erlebt haben. Und die Schalter, haben Sie die Schalter ausprobiert? Die klemmen gern fest.»
«Kommen Sie bitte und sehen sich es selbst an.»
«Tut mir leid. Ich habe allein Bereitschaft und darf meinen Posten nicht verlassen. Die Techniker sind erst wieder morgen früh da. Die IT-Spezialisten sowieso. Mein Rat: Versuchen Sie es morgen wieder, falls dann das Problem immer noch auftritt.»
Wortlos legte sie auf. Draußen im Flur war es ebenfalls dunkel.
«Hallo, noch jemand bei der Arbeit?», rief sie.
Keine Antwort.
«Hallo!» Diesmal lauter.
Stille.
Nochmals betätigte sie den Lichtschalter im Gang.
Nichts.
Erst jetzt wurde es ihr richtig bewusst: Sie war ganz allein in diesem Teil des Gebäudes, der zum Verwaltungstrakt gehörte. Ein mulmiges Gefühl breitete sich in ihrer Magengegend aus.
Im schwachen Lichtkegel ihres Mobiltelefons suchte sie den Weg bis zum Aufzug und drückte den Knopf. Ein leichtes Vibrieren verriet ihr: Der Lift war unterwegs. Gleich danach ging die Tür auf und gab den Blick frei auf die erleuchtete Kabine.
«Also doch kein Stromausfall», sagte sie zu sich selbst und stieg erleichtert ein.
Gerade hatte sie ein Stockwerk passiert, als der Aufzug mit einem Ruck stehen blieb. Dann erlosch das Licht in der Kabine.
Sie unterdrückte einen Schrei. Nervös fingerte sie nach ihrem Handy und suchte gleichzeitig den Notfallknopf im Lift. Dort stand, dass gleich jemand über den eingebauten Lautsprecher antworten würde, schließlich war der Aufzug mit einer Wartungszentrale verbunden. Sie zwang sich, ruhig zu bleiben und nicht in Panik auszubrechen.
Aber nichts geschah. Keine Antwort. Wie erstarrt stand sie da, Minuten erschienen ihr wie eine Ewigkeit. Endlich ertönte ein mechanisches Geräusch, das sie nicht verstand. Gleichzeitig ging die Beleuchtung an, der Aufzug setzte sich wieder in Bewegung.
Voller Angst wartete sie, bis der Lift endlich unten ankam und die Tür aufging. Vor Erleichterung hüpfte sie geradezu hinaus, froh, der Enge entflohen zu sein.
Aber in der Tiefgarage war ebenfalls das gesamte Licht ausgefallen.
«Das gibt es doch nicht. Will mich hier jemand verarschen?», murmelte sie. Ihr Akku war beinahe leer, und das Licht ihres Handys drohte gleich zu erlöschen. Nur noch wenige Fahrzeuge standen in den Parkbuchten. Langsam ging sie in Richtung ihres Autos.
Ein Geräusch ließ sie erstarren. War da etwas an der Tür?
«Ist da jemand?» Sie leuchtete in die Richtung, konnte aber nichts erkennen.
Niemand antwortete. Sie ging einige Schritte.
Wieder ein Geräusch, nun von der entgegengesetzten Seite. Oder bildete sie sich das nur ein? Sie fing an zu laufen, erreichte ihr Auto, öffnete die Fahrertür und setzte sich hinters Steuer. Sofort schaltete sie die Zentralverriegelung ein. Mit zittrigen Fingern startete sie den Motor.
Bericht der Nachrichtenagentur Agence France-Presse, Paris
Großflächiger Ausfall von Verkehrsleitsystemen in Europa
Frankreich, Deutschland und England betroffen – Chaos für mehrere Stunden – 14 Tote
Mehrere europäische Großstädte wurden heute schwer von Schäden in den Netzwerken der Verkehrssysteme getroffen. In der Folge gab es Chaos auf den Straßen, Verspätungen des öffentlichen Nahverkehrs und Unfälle. Auch die berühmte Tower Bridge in London war betroffen. Es dauerte fast einen Tag, bis der Normalzustand wiederhergestellt werden konnte.
In Paris gab es einen Verkehrsstau auf der D906 in Richtung Zentrum. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen schaltete an einer Kreuzung die Ampel auf Gelb und fing dann an zu flackern. Ein Sportwagen, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, konnte nur mit Mühe bremsen und rammte ein zweites Auto. Innerhalb von Sekunden verkeilten sich nach Angaben der Polizei ein Dutzend Autos ineinander. Für die Rettungsfahrzeuge gab es kein Durchkommen mehr.
Über die Ursachen gibt es bisher nur Spekulationen. War es ein unglücklicher Zufall, ein kurzzeitiger Stromausfall – oder hat das automatische Steuerungssystem versagt?
In London waren die Touristen des Ausflugsschiffes Morning Glory am stärksten betroffen, die eine London-Tour auf der Themse mit einer Fahrt durch die Tower Bridge gebucht hatten. Nach Schilderung von Beteiligten schwenkten die beweglichen Teile der Brücke vorschriftsmäßig nach oben, als das Signalsystem unregelmäßig zu blinken begann. Zugleich senkten sich die Fahrbahnelemente wieder bis zur Höhe des Oberdecks, wie die Aufnahmen der Überwachungskameras später bewiesen. Die Aufbauten kollidierten mit der Brücke, schrammten über die gesamte Länge des Schiffes und begruben Gäste und Besatzung unter sich. Dreißig Sekunden später fuhren die Brückenteile wieder in die korrekte Position hoch.
Auch andere Signalanlagen entlang der Themse waren von den Störungen betroffen. Die Regierung in London hat eine Untersuchung angeordnet. Die Tower Bridge wird bis auf Weiteres gesperrt. Möglicherweise waren marode Leitungen oder defekte Internetverbindungen die Ursache für das Unglück.
In Berlin gab es Probleme mit den Schranken an Bahnübergängen innerhalb des Stadtgebietes. Die Polizei musste Straßen sperren. Der S-Bahn-Verkehr wurde über Stunden eingestellt. Die Fernsteuerung der Anlagen hatte nicht korrekt funktioniert, erklärte die Bahn, das sei aber lediglich «eine vorläufige Einschätzung».
Im Stadtteil Marienfelde war zuvor eine Fußgängerin verunglückt, als sie die Gleise einer S-Bahn in der Nähe des lokalen Bahnhofs überquerte. Es hatte kein Warnlicht gegeben, und die Schranken hätten sich nicht gesenkt, so ein Radfahrer, der die Szene beobachtet hatte.
Mehrere Europa-Parlamentarier, Mitglieder der rechtsextremen Fraktion «Identität und Demokratie» (ID), prangerten das «Systemversagen» der Regierungen in Europa an: «Diese Ausfälle zeigen, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien nicht in der Lage sind, einfache technische Abläufe zum Schutz ihrer Bürger sicherzustellen. Statt sich im Europawahn zu verausgaben, fordern wir die Verantwortlichen auf, zurückzutreten und sich endlich um die nationalen Belange ihrer Bürger zu kümmern», heißt es in einer Erklärung.
Kapitel 2
Der Radiowecker spielte einen Rock-Oldie von Metallica. Nelson Carius tastete nach dem Ausschaltknopf und schlug darauf, bis es wieder still war. Er zog sich die Decke über den Kopf, aber nach fünf Minuten sprang der Wecker erneut an. Ohne die Augen zu öffnen, griff er nach dem Stromkabel und riss es mit einem Ruck aus der Steckdose.
Er drehte sich auf die andere Seite. Am liebsten hätte er weitergeschlafen, eingemummelt in der Decke, in der herrlichen Dunkelheit und Stille. Aber es half nichts, er musste raus und sich auf den Weg machen, zuerst zu seiner neuen Wohnung, dann zu seiner zukünftigen Arbeitsstelle – und beides war in Berlin.
Er gähnte. Zumindest machte der Duft frisch gebrühten Kaffees das Aufstehen erträglicher. Er hatte schon am Vorabend die Zeitschaltuhr für die Kaffeemaschine programmiert. Nach der Dusche machte er sich ein Marmeladenbrot und checkte nebenbei die Nachrichten auf seinem Handy. Zum Anziehen hatte er wie immer Jeans und ein T-Shirt gewählt, dazu Turnschuhe. Er packte weitere Klamotten und Waschutensilien in seinen Rucksack. Womöglich würde er längere Zeit nicht mehr zurückkommen.
Pünktlich verließ Nelson die Wohnung und sperrte sorgfältig hinter sich ab. Er bewohnte in einem alten Hinterhof-Reparaturbetrieb im Kölner Stadtteil Ehrenfeld zwei kleine Zimmer und einen größeren Raum, der angefüllt war mit alten Messgeräten, Werkzeugen, ausrangierten Fernsehern, Radios und Plattenspielern – die Werkstatt. Dort sah es immer noch so aus, als hätte jemand vor langer Zeit die Flucht ergriffen und alles stehen und liegen gelassen.
Und genau so war es auch gewesen. Die Werkstatt hatte einst seinen Eltern gehört und war längst außer Betrieb, nur ein Blechschild mit der Aufschrift «Carius – Reparaturen – bitte klingeln» am Eingang wies noch auf die vergessene Vergangenheit des Betriebes hin. Die Räume waren das Einzige, was ihm Vater und Mutter hinterlassen hatten.
Sein Vater und seine Mutter. Sein Bild von ihnen war verblasst. Wenn er an sie dachte, an jenes Ereignis damals … Es machte ihn jedes Mal wieder traurig, auch heute noch.
Seit er wieder zurück in Deutschland war, war ihre Werkstatt sein neues Zuhause. Zugleich ein Versteck, ein Ort, an dem er ganz für sich allein war, wo niemand ihn finden würde.
Er hatte es sich inzwischen zum Freizeitvergnügen gemacht, die alten Elektrogeräte selbst instand zu setzen. Bei dem Radiowecker war es ihm gelungen, auch der Röhrenfernseher mit Holzfurnier taugte wieder zum Empfang einiger TV-Programme.
Eigentlich hätte er die ganzen Geräte und die Regale voller Bauteile entsorgen sollen, aber das brachte er noch nicht übers Herz – zu viele Erinnerungen hingen an diesem Schicksalsort. Zu viele unbeantwortete Fragen. Zu viel Schmerz.
Die Zugfahrt nutzte Nelson, um ein Buch über neue Ansätze der Datenverarbeitung zu lesen. Am Berliner Hauptbahnhof deponierte er seinen Rucksack in einem Gepäckfach, dann trat er aus dem großen Glasgebäude hinaus ins Getümmel der Hauptstadt. Er ging zu Fuß und machte einen Umweg über Bundeskanzleramt und Reichstagsgebäude zur Chausseestraße.
Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes war ein mehrflügeliger Betonbau im Bezirk Mitte, die glatte Fassade sah mit ihren einheitlichen Fensterfronten aus wie gerastert. Nelson meldete sich am Empfang, nannte seinen Namen und wartete darauf, dass er abgeholt wurde. Der BND war einer der drei Geheimdienste in Deutschland und auf die Auslandsaufklärung spezialisiert. Er unterstand direkt dem Bundeskanzleramt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, abgekürzt BfV, kümmerte sich um Spionageabwehr und staatsfeindliche Angriffe innerhalb des Landes. Und der MAD – der Militärische Abschirmdienst – war für die Bundeswehr und militärische Sicherheitsaufgaben zuständig.
Eine Sekretärin brachte ihn in einen Konferenzraum im zweiten Stock, vorbei an langen Gängen und Säulenreihen. Dort wartete schon ein Mann in den Vierzigern auf ihn, gekleidet in Anzug und Krawatte.
«Herzlich willkommen bei uns, Herr Carius», begrüßte ihn der Beamte. «Bitte nehmen Sie doch Platz.» Er deutete auf einen Stuhl und setzte sich ihm gegenüber. «Bevor Sie offiziell Ihren ersten Arbeitstag beginnen, unterhalten wir uns kurz. Mein Name ist Doktor Robert Horn, ich arbeite in der Abteilung TA – Technische Aufklärung. Bis vor einigen Jahren war ich in der Abteilung TE tätig, Internationaler Terrorismus und Organisierte Kriminalität. Die beiden Bereiche arbeiten selbstverständlich Hand in Hand.»
Nelson fragte sich, ob Robert Horn wohl sein richtiger Name war. «Freut mich, Sie kennenzulernen. Wo wird mein Einsatzgebiet sein?»
«Genau darüber sollten wir jetzt sprechen.» Horn öffnete eine schmale Aktenmappe, die vor ihm lag. «Wie ich sehe, haben Sie Ihre Grundausbildung bei uns mit Auszeichnung bestanden, auch die Sicherheitsüberprüfung ergab keine Beanstandungen.»
Für einen Moment hielt Nelson die Luft an. Die Überprüfung hatte also nichts zutage gefördert. Das war gut. Keine weiteren Fragen zur Vergangenheit.
«Gut, gut. Das hier bei uns ist Ihre erste Festanstellung, wie ich den Akten entnehme. Mit einunddreißig Jahren sind Sie da ja nicht gerade der Jüngste.»
Nelson nickte. Auf die Frage war er vorbereitet. «Ich bin nach dem Studium viel in der Welt herumgereist und habe mein Geld durch Gelegenheitsjobs verdient, als Reiseleiter, Outdoor-Guide oder in Computerläden. Mir hat’s immer gereicht. Ich hatte es nicht so eilig, von morgens bis abends in einem Büro zu sitzen. Und ich hoffe, das muss ich hier auch nicht.»
«Ganz ohne Schreibtischarbeit wird es wohl nicht gehen. Aber keine Sorge, Sie kommen schon noch genug an die frische Luft.» Horn blätterte in seinen Unterlagen. «Ihre Auslandsaufenthalte sind für uns von Vorteil, zudem sprechen Sie einige Sprachen. Und Sie haben in Stanford studiert, gleich mehrere Fächer, wie ich sehe, Datenanalyse, IT, Politik und Psychologie.» Er blickte auf und lächelte ihn an. «Da blieb ja kaum noch Zeit, die kalifornische Sonne zu genießen.»
«Wie Sie in meiner Personalakte sehen, habe ich mir mit dem Studium etwas mehr Zeit gelassen.» Nelson grinste. «Der Spaß kam also nicht zu kurz, keine Sorge.»
«Nun, bei uns geht es da ernster zu. Ich habe mir gedacht, Sie fangen in der Technischen Aufklärung an. Mal sehen, wie es Ihnen dort gefällt oder ob Sie später wechseln wollen. Wie Sie wissen, sind Sie momentan zunächst zur Probe eingestellt. Aber ich habe keine Sorge, dass Sie die Probezeit nicht bestehen.»
«Ich werde mich reinhängen.» Nelson nickte bekräftigend. Er war tatsächlich gespannt auf die neue Arbeit. Und wenn er auch noch würde reisen können …
«Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Büro.»
Es war ein kleines Zimmer mit zwei Arbeitsplätzen.
Robert Horn deutete auf den linken Schreibtisch. «Ihre Kollegin ist gerade auf einem Außeneinsatz, Sie werden sie später kennenlernen.» Dann zog er einen Ausweis aus der Tasche und reichte ihn Nelson. «Und hier ist Ihre neue Identität für externe Aufgaben.»
Kriminalkommissar des Bundeskriminalamtes, las er. «Ich soll unter meinem richtigen Namen Nelson Carius als BKA-Ermittler firmieren? Ich dachte, man sucht für uns Decknamen aus.»
«Nur wenn es notwendig ist. Und das sehen wir bei Ihnen – vorerst – nicht. Aber machen Sie sich da keine Gedanken, wir sind Meister darin, falsche Identitäten zu produzieren, falls Sie künftig Bedarf haben sollten.»
Horn reichte ihm einen versiegelten Umschlag. «Darin finden Sie die Passwörter für das interne und externe Netzwerk sowie weitere Instruktionen und eine Geheimhaltungsverpflichtung, die Sie bitte jetzt gleich unterschreiben. Nehmen Sie ruhig Platz und machen Sie es sich bequem.»
Nelson setzte sich an den Schreibtisch. Das Büro war modern und funktional eingerichtet, aber es hatte etwas Nüchternes und erinnerte ihn ein wenig an eine Mönchszelle. Der einzige Wandschmuck war ein Foto von einer Berglandschaft an der Wand seiner Kollegin. «Wonderful Bhutan» stand darauf. Nelson unterschrieb das Papier und startete seinen Computer.
«Sie sollen sich bei uns natürlich nicht langweilen», sagte Horn. «Deshalb habe ich gleich eine Aufgabe für Sie. Sie finden die entsprechenden Informationen in Ihrem persönlichen Postfach.»
«Worum geht es denn?»
«Vielleicht haben Sie in den Nachrichten gehört, dass es in verschiedenen europäischen Städten gleichzeitig zu Ausfällen von Verkehrsleitsystemen gekommen ist. In London etwa funktionierte kurzzeitig die Tower Bridge nicht mehr, ebenso wie die Warnanlagen entlang der Themse. In Paris fielen vorübergehend die Ampeln aus. Und bei uns in Berlin gab es reihenweise Störungen an Bahnübergängen. Das kann kein Zufall sein.»
«Und wie kommt da der BND ins Spiel?»
«Bei diesen Vorfällen starben insgesamt vierzehn Personen, mehrere Dutzend wurden verletzt. Das ist keine Lappalie, sage ich Ihnen, sondern eine ernste Angelegenheit. Es sieht ganz nach einem koordinierten Cyberangriff aus, so lautet jedenfalls die Einschätzung unserer Freunde in den französischen und britischen Geheimdiensten. Und wir teilen diese Einschätzung. Wir wissen nicht, wie dieser Angriff vonstattenging, wer dahintersteckt und was die Motive sind. Das herauszufinden, ist nun Ihre Aufgabe – ein guter Test für Sie, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich habe Sie aus bestimmten Gründen eingestellt, wie Sie wissen, Herr Carius. Also enttäuschen Sie mich nicht.»
«Leo?»
«Leo, wo bist du?»
«Leo! Es gibt dein Lieblingsfresschen, das magst du doch so gern. Na komm.»
Renate Faber füllte den Inhalt der Dose in eine Porzellanschüssel und stellte sie auf den Boden. Er würde schon auftauchen, das funktionierte immer.
Und tatsächlich, nach wenigen Sekunden erschien ihr Kater an der Küchentür.
«Mein Braver.» Sie streichelte sein grau-weiß getigertes Fell. «Jetzt friss schön, vielleicht gibt es dann später zur Belohnung noch ein Leckerli.»
Zufrieden sah Renate dem Tier zu, wie es leise schmatzend den Napf leerte.
«Du willst raus? Na dann komm.» Kaum hatte sie die Terrassentür geöffnet, verschwand der Kater wieder.
Sie zog sich Arbeitsschuhe und Lederhandschuhe an, nahm die Schere und ging in ihren Garten. Er war zwar klein, aber ihr eigenes Reich – Rasen, Hecke, Beete, alles hatte sie über die Jahre liebevoll gepflanzt und gepflegt. Ihre Stimmung hob sich jedes Mal, wenn sie die Farbtupfer der Blumen sah, das satte Grün der Sträucher, das Rot ihrer Tomatenstauden.
Vor allem mit ihren Rosen konnte sie sich stundenlang beschäftigen. Aber heute wollte sie nur einige Blüten für die Vase im Wohnzimmer abschneiden. Sie suchte fünf besonders lange Stängel aus und trennte sie geschickt von der Staude. Dazu noch etwas Schleierkraut und ein paar grüne Zweige – das würde einen wunderbaren Strauß abgeben.
So richtig hatte sie die Gartenarbeit erst nach dem Tod ihres Mannes Holger entdeckt. Er war früh gestorben, Darmkrebs. Seitdem lebte sie allein in dem Haus am Rande von Nürnberg. Jahrelang hatten sie auf große Urlaube verzichtet, um für ein Heim zu sparen, und als sie endlich eins gefunden hatten, das sie sich leisten konnten, war es ein heruntergekommener Bau aus den fünfziger Jahren gewesen. Doch Holger hatte es Stück für Stück wiederhergerichtet. Er war schon immer ein Bastler und Tüftler gewesen.
Sie seufzte. Bei der Erinnerung an ihren Mann wurde es ihr jedes Mal schwer ums Herz. Immer wieder fragte sie sich, ob es mit ihren 75 Jahren noch richtig war, allein in diesem Haus zu wohnen. Manchmal spürte sie die Einsamkeit, da halfen kein Fernseher, kein Radio, keine Katze. Sie tröstete sich mit ihren Büchern über solche Phasen hinweg. Das half. Meistens jedenfalls. Und sie hatte immer noch ihren Sohn, der regelmäßig nach ihr sah und sie besuchte. Und ihre Tochter in Hamburg, aber die hatte nie Zeit und meldete sich nur gelegentlich per Telefon.
Außerdem fühlte sie sich fit und rüstig, und es hingen so viele Erinnerungen an diesen Mauern … Nein, sie würde ihr Nest nicht freiwillig verlassen, da würde man sie schon im Sarg hinaustragen müssen.
Es klingelte an der Haustür.
«Ich komm ja schon, Geduld!», rief sie, ohne ihren Schritt zu beschleunigen. Zuerst legte sie die Rosen behutsam in der Küche ab.
Es klingelte erneut, jetzt energischer.
«Moment!»
Sie öffnete die Haustür. Stefanie, ihre Nachbarin, stand vor ihr, atemlos. «Renate, es ist etwas Furchtbares passiert!»
«Komm erst mal rein.»
Die Frau schien vollkommen aufgelöst, sie stürmte direkt an Renate vorbei ins Wohnzimmer und ließ sich in einen Sessel fallen. Ihr Gesicht war gerötet.
«Willst du eine Tasse Kaffee? Ich hätte noch ein Stück frischen Erdbeerkuchen.»
«Ich kann jetzt nichts essen. Ich bin total erledigt.» Stefanies Arme hingen schlaff herab, alle Kraft schien aus ihr gewichen zu sein.
«Was ist denn los?»
«Ich glaube, meinem Simon ist etwas zugestoßen. Vermutlich ein Unfall. Er … Er könnte tot sein.»
Simon war ihr Sohn, er studierte gerade in Frankfurt und machte ein Praktikum bei einer Bank.
Für einen Moment war Renate schockiert. Andererseits kannte sie den Hang ihrer Nachbarin zur Übertreibung.
«Wie kommst du denn darauf?»
«Er hat sich gestern und heute nicht bei mir gemeldet. Das hat er noch nie gemacht. Noch nie! Da muss etwas Ernstes geschehen sein, das ist die einzige Erklärung. Ich hab keine ruhige Minute mehr.»
«Mein Sohn meldet sich allenfalls einmal die Woche, und das ist vollkommen in Ordnung. Mach dir da bloß keine Gedanken.»
«Dein Sohn ist auch wesentlich älter, er hat Familie, steht fest im Leben, aber mein Simon …» Sie schüttelte den Kopf.
«Sei nicht albern, Simon ist auch kein kleiner Junge mehr.»
«Ich weiß, ich weiß. Aber ich hab ihm extra aufgetragen, mich jeden Tag anzurufen, damit ich weiß, wie’s ihm geht. Schließlich arbeitet er momentan in diesem Bahnhofsviertel in Frankfurt …»
«Du meinst, in einem dieser Bürotürme der Banken. Die sind doch nicht gefährlich.»
«Hast du eine Ahnung, du warst doch noch nie dort. Aber ich. Das ist alles in der Nähe des Bahnhofsviertels. Und da geht es zu, sag ich dir, ich hab schon einiges darüber gelesen: Drogen, Kriminelle, Prostitution – da braucht es nicht viel, und man wird zum Opfer von diesen, diesen …»
«Du machst dir viel zu viele Gedanken, Stefanie. Ruf ihn doch einfach an.»
«Das ist es ja! Ich hab mehrmals versucht, ihn auf dem Handy zu erreichen, hab Textnachrichten geschickt, Anfragen mit dem Chat-Programm gestellt – aber keine Reaktion. Nicht mal der Anrufbeantworter sprang an – und ein Freizeichen hörte ich in der Leitung auch nicht. Das ist ungewöhnlich. Simon hat sein Handy immer bei sich, ständig fummelt er damit rum.»
Renate verstand nur einen Teil von dem, was ihre Nachbarin sagte. Ein Mobiltelefon hatte sie nie besessen, das wollte sie auch nicht, obwohl ihr Sohn sie dazu gedrängt hatte. Und Computer oder Internetanschluss kamen ihr ebenfalls nicht ins Haus – sie wollte sich nicht mit diesem neumodischen Zeugs beschäftigen müssen. Ihre Nachbarin war der beste Beweis dafür, dass das nur zu Ärger und Aufregung führte. Ihr alter Telefonapparat reichte für sie vollkommen aus.
«Das ist irgendwie unheimlich, richtig unheimlich», fuhr Stefanie fort. «Jemand hat meinen Simon niedergeschlagen und sein Handy geraubt – anders kann ich mir das nicht erklären. Selbst auf meine E-Mails reagiert er nicht. Was soll ich tun? Vermutlich liegt er bewusstlos in einem Krankenhaus. Wir müssen die Kliniken abtelefonieren.»
«Du kannst gerne meinen Apparat benutzen. Aber ich wette, es findet sich eine harmlose Erklärung. Vielleicht muss Simon viel arbeiten und hat keine Zeit, ans Telefon zu gehen. Oder er hat eine junge Frau kennengelernt und ist gerade mit ihr …»
Stefanie war aufgesprungen. «Ich will so was nicht hören!»
«Rufen wir doch die Bank an und fragen nach Simon, das ist das Einfachste.»
«Äh … ich weiß gar nicht, in welcher Zweigstelle der Deutschen Bank er genau arbeitet. Und selbst wenn, hab ich keine Ahnung, wie die Abteilung heißt, in der er sein Praktikum macht.»
«Und seine Studienkollegen? Die wissen vielleicht, wo er steckt.»
«Die kenne ich nicht. Nein, mein Simon würde nie sein Mobiltelefon freiwillig aus der Hand geben. Das ist sein Leben. Da ist was passiert, das spüre ich.»
Claudia überlegte, ob sie Tobias anrufen sollte, ihren neuen Freund. Nach ihrer Scheidung war er der Erste gewesen, dem sie sich wieder etwas geöffnet hatte – wobei der Status ihrer Beziehung immer noch nicht ganz klar war: Sie hatten beide nach wie vor eigene Wohnungen und sahen sich eher selten, was allerdings vor allem an ihren unregelmäßigen Arbeitszeiten lag – er war Rettungspilot, sie Ärztin, und Einsätze in der Nacht oder an Wochenenden waren für sie beide Alltag.
Aber sie hatte sich spontan zu Tobias hingezogen gefühlt, zu seiner humorvollen Art, seiner Unbeschwertheit, seiner Leidenschaft. War es Liebe? Oder nur eine Liebelei? Wenn sie ehrlich war, wusste sie es nicht. Noch nicht. Es würde Zeit brauchen, das herauszufinden.
Dafür war ihr Gefühlsleben zu sehr in Unordnung. Noch immer nagte die Trennung von ihrem Mann an ihr, die gegenseitigen Verletzungen, der Streit, dem die formelle Scheidung immerhin endlich ein Ende gesetzt hatte.
Sechs Jahre waren sie zusammen gewesen, bis er feststellte, dass ihm ihr bisheriges gemeinsames Leben zu wenig gab, und ein Verhältnis mit einer anderen Frau begann. Hin und wieder überlegte sie, ihren Nachnamen wieder in Faber zu ändern, um auch die letzten Verbindungen zu ihm zu kappen, aber bisher hatte sie noch keine Zeit dafür gefunden.
Sie wählte Tobias’ Nummer, hörte aber nur eine Computerstimme, die sagte, der Teilnehmer sei vorübergehend nicht erreichbar. Nicht einmal der Anrufbeantworter sprang an. Das war ungewöhnlich. Ein erneuter Versuch endete mit dem gleichen Ergebnis.
Sollte sie jetzt versuchen, ihre Mutter in Nürnberg zu erreichen? Sie sah auf die Uhr, vermutlich hielt Renate gerade ihr Mittagsschläfchen, da wollte sie nicht stören. Sie steckte das Handy wieder in ihre Tasche.
Hatte Tobias vielleicht plötzlich eine wichtige Besprechung? Sonst war er doch immer um die Mittagszeit erreichbar. Nun gut, sie würde es später nochmals versuchen. Sie würde ihn an diesem Abend gern noch sehen, um mit ihm essen zu gehen. Oder gleich zu ihr nach Hause …
Zurück in ihrem Büro wartete bereits der Leiter der Gebäudeservices auf sie.
«Und, Rätsel gelöst?», fragte sie ihn statt einer Begrüßung.
«Guten Tag, Frau Doktor Weiss», antwortete der Mann. «Ich hoffe, ich komme gerade nicht ungelegen.»
«Nicht im Geringsten.»
«Sie hatten ja Meldung gemacht, dass in der Nacht möglicherweise verschiedene Systeme ausgefallen seien.»
«Was heißt hier ‹möglicherweise›? Das ist tatsächlich passiert. Und ich kann Ihnen sagen, es ist kein Spaß, mitten in der Nacht hier im Krankenhaus im Dunkeln zu stehen – und keine Menschenseele weit und breit. Auch der Notdienst wollte mir nicht helfen. Das fand ich schon ziemlich unheimlich.»
«Ich glaub Ihnen das, Frau Doktor, aber …»
«Wieso habe ich den Eindruck, dass Sie genau das Gegenteil von dem denken, was Sie sagen? Das war alles echt, ich habe es selbst erlebt.»
«Jaja, natürlich. Nur haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass übermüdete Mitarbeiter …»
«Entschuldigen Sie! Wollen Sie mir etwa zu verstehen geben, ich hätte mir das alles nur eingebildet?»
«Das wollte ich nicht sagen. Es ist nur so, unsere Messungen haben nichts ergeben. Absolut nichts. Am Morgen liefen alle Systeme wieder normal, der Aufzug, das Licht, das Computernetzwerk – alles war wie immer.»
«Das heißt noch lange nicht, dass es einige Stunden vorher genauso war.»
«Schon, aber da haben wir das nächste Problem: Unsere Protokolle zur Datenerfassung und Überwachung haben keinerlei Anomalien registriert. Alles war – und ist – im grünen Bereich. Wir haben stichprobenartig verschiedene Sensoren und Schaltkreise getestet. Kein auffälliger Befund.»
«Und?»
«Äh, was meinen Sie?» Der Mann war unsicher geworden.
«Na, welche Schlüsse ziehen Sie daraus?»
«Ich, ich weiß nicht so recht …»
«Aber das ist doch Ihr Fachgebiet, das sollten Sie wissen. In der Nacht war es vielleicht nur ein Stromausfall. Aber das hier ist ein Krankenhaus. Da können wir solche seltsamen Überraschungen nicht gebrauchen.»
«Bei allem Respekt, Frau Doktor, wir verstehen unser Handwerk, meine Mitarbeiter sind bestens geschult. Es besteht einfach ein Widerspruch, wenn ich das so formulieren darf, zwischen Ihrem Bericht und den Analysen der Experten. Und dieser Widerspruch ist bisher nicht aufgelöst.»
«Und wo liegt das Problem?»
«Das Problem ist, dass wir kein Problem entdecken konnten.»
«Was werden Sie jetzt dagegen unternehmen?»
«Nun … äh … Wie soll ich es sagen … Wir vertrauen auf unsere Arbeit. Die Untersuchungen haben gezeigt: Da war nichts. Die Computeranalysen haben es bestätigt: Ein Fehler ist nicht feststellbar. Und unsere Datenverarbeitung irrt sich nie.»
Langsam füllte sich der Konferenzraum. Männer und Frauen unterschiedlichen Alters kamen herein, manche lässig angezogen, die meisten jedoch in formeller Kleidung.
Nelson suchte sich einen Platz an der Seite, er war sich nicht sicher, ob es hier eine festgelegte Sitzordnung gab. Einige beäugten ihn, sagten aber nichts. War das die antrainierte Zurückhaltung von Spionen? Das würde er sicher noch herausfinden. Er war mit Abstand der Jüngste im Raum, nur eine Frau in weißer Bluse und mit streng nach hinten frisierten braunen Haaren schien in seinem Alter zu sein.
Als Letzter betrat Dr. Robert Horn den Raum und setzte sich an die Stirnseite. Er schlug seine Aktenmappe auf.
«Legen wir los, wir haben ein umfangreiches Programm vor uns», begann er. «Aber als Erstes will ich Ihnen unseren neuen Kollegen Nelson Carius vorstellen.» Er nickte ihm zu. «Herr Carius wird unsere Abteilung TA verstärken. Willkommen.»
Die Anwesenden klopften zur Begrüßung auf den Tisch. Nelson stand kurz auf, sagte, wie sehr er sich auf die neue Aufgabe freue und auf Unterstützung der Kollegen hoffe, und lächelte allen zu.
Dann ergriff Robert Horn erneut das Wort. «Punkt eins unserer Tagesordnung ist der Wochenreport aus den Fachabteilungen. Bitte.»
Reihum berichteten die BND-Mitarbeiter von Einsätzen, anstehenden Aufgaben oder den Entwicklungen in Drittländern. Diskussionen gab es keine, nur hin und wieder fragte jemand nach. Horn machte sich Notizen.
«Und was ist mit dem Ausfall des Handynetzes in den verschiedenen europäischen Regionen?», fragte er. «Sie alle haben die Fernsehnachrichten gesehen. Für die Medien war das ein Riesenthema. Schließlich besitzt ja so gut wie jeder ein Mobiltelefon.»
«Wir arbeiten dran», sagte ein Mann mittleren Alters. «Nach ersten Meldungen gab es wegen des Netzwerkausfalls sieben Tote: zwei Mountainbiker in Innsbruck, die mit einem Felsen kollidiert sind, vier Urlauber in Norditalien, die nach dem Ausfall des mobilen Navis in einen Fluss gefahren und dort ertrunken sind, sowie eine Frau in Portugal, die vom Verrücktspielen ihres Handys so abgelenkt war, dass sie in eine Baugrube fiel und sich den Hals brach.»
Gekicher.
«Das ist nicht zum Lachen. Bitte bleiben Sie ernst», ermahnte Horn.
«Die Mobilfunkgesellschaften arbeiten noch an der Aufklärung», fuhr der andere Kollege fort. «Auffällig ist, dass diese Vorfälle gleichzeitig aufgetreten sind – über Ländergrenzen hinweg und parallel in verschiedenen Netzen. Wir gehen von einem Angriff über das Internet aus.»
«Ist das wirklich ein Beweis für eine Attacke?», fragte eine Frau mit Brille. «Wir alle hier am Tisch wissen aus eigener Erfahrung, dass unsere Mobilfunknetze alles andere als stabil sind. Ständig bricht die Verbindung zusammen, man hat hin und wieder keinen Empfang, oder eine App funktioniert nicht. Bei mir ist das jedenfalls so.»
Viele nickten.
«Außerdem sind kurzzeitige Zusammenbrüche des Netzes nicht so ungewöhnlich, wie man denkt», fuhr die Frau fort. «Allein in Deutschland registrieren die Anbieter über hundert Vorfälle pro Monat, meistens können sie die Fehler aber schnell wieder reparieren. Verständlich, dass die Unternehmen das in der Öffentlichkeit nicht gern zugeben. Das ist natürlich schlecht fürs Geschäft.»
«Welche Erkenntnisse haben unsere befreundeten Geheimdienste?», fragte Horn in die Versammlung.
«Die Kollegen von der Nato, aus Großbritannien, Italien und Frankreich analysieren noch», antwortete ein hochgewachsener Mann, «bis jetzt haben sie weder eine eindeutige Quelle ausgemacht noch die Bauart eines möglichen Internet-Virus identifiziert. Und die Amerikaner melden überhaupt keine Angriffe dieser Art, offenbar ist die Attacke, sollte es tatsächlich eine Attacke sein, auf Europa begrenzt.»
«Für mich ist es eindeutig ein abgestimmter Angriff», meldete sich Nelson zu Wort. «Umfang und Tiefe zeigen, dass wir es mit Profis zu tun haben.»
«Aha, und woher nimmt unser neuer Kollege seine Weisheiten?» Die junge Frau mit der strengen Frisur sah ihn direkt an. «Haben Sie Belege? Oder wollen Sie hier nur die Rolle des Weltuntergangs-Propheten spielen und sich wichtigmachen?»
Nelson ärgerte sich über diese Bemerkung. Was bildete sich die Frau ein? Er hatte das Recht, einen Diskussionsbeitrag zu leisten, ob er nun neu war oder nicht.
«Ganz grundsätzlich zeigen die Cyberattacken der vergangenen Jahre, wie anfällig das World Wide Web und die dahinterliegende Hardware sind», fuhr er deshalb fort. «Das Internet ist die Achillesferse moderner Gesellschaften.»
Er sah die junge Frau direkt an. «Und um Ihre Frage gleich vorwegzunehmen: Das ist der Erkenntnisstand der Wissenschaftler und Fachleute rund um den Globus, ich gebe das nur wieder. In unserer schönen neuen Welt haben wir Menschen das Rückgrat unserer Zivilisation den Computern und Softwares anvertraut. Das hat für jeden Einzelnen viele Vorteile, es macht unseren Alltag bequem und hilft der Wirtschaft.» Nelson blickte in die Runde. Jetzt hatte er ihre Aufmerksamkeit. «Der Nachteil ist: Wir haben keinen Notfallplan, wenn es mal schiefläuft. Es gibt keinen Plan B. Deshalb heißt es für uns alle: Augen zu und hoffen, dass alles gutgeht. Wir vertrauen auf störanfällige, technisch längst überholte Lösungen aus der Steinzeit des Internets. Das ist unser marodes Fundament für die Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Leider bieten wir damit Kriminellen und Terroristen freie Bahn.»
«Eine schöne Ansprache, Herr Kollege», antwortete die junge Frau. «Man sieht, Sie haben Fachbücher studiert. Doch was hat das alles mit unserem konkreten Thema zu tun?»
«Wir sehen hier eine großangelegte Aktion. Die Gruppe, die dahintersteckt, arbeitet noch unerkannt.»
«Und?»
«Und ich glaube, das ist größer, als wir aktuell vermuten. Ich bin sogar überzeugt, die Angriffe auf die Verkehrssysteme bei uns in Deutschland, auf die Ampelanlagen in Paris und auf die Tower Bridge hängen ebenfalls damit zusammen. Das sind ein und dieselben Täter.»
«Ich muss der Kollegin recht geben: Sind das mehr als Vermutungen?», fragte Horn. «Wir brauchen mehr Anhaltspunkte.»