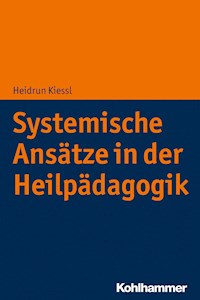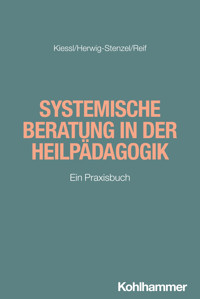
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Systemtheoretisches Wissen ist heute in der Heilpädagogik, z. B. bei der Beratung von Familien, selbstverständlicher Standard. In der Ausbildung sind dabei konkrete Anwendungsbeispiele und Problemlösungsansätze von besonderem Interesse. Fünf reale Fallstudien wurden deshalb als geeignete Formen zur Vermittlung dieses anwendungsorientierten Wissens aufgearbeitet, um einen profunden Einblick in die Vielfalt der Beratung von Familien zu geben. Interessierte BeraterInnen und Lernende von Beratung sowie Studierende der Heilpädagogik und verwandter Disziplinen finden in diesem Buch eine praxisnahe Einführung in die systemische Beratung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
1 Einleitung
2 Familiengeheimnis als Kraft zum Trennen und Kraft zum Binden – Der Fall Lukas
2.1 Fallbeschreibung
2.2 Behandlungsgeschehen und Resonanzen I
2.3 Resonanzen II
2.4 Resonanzen III
3 Die Raupe, die sich zum Schmetterling entpuppt – Der Fall Annika
3.1 Fallbeschreibung
Anmeldeanlass
Zur Person
3.2 Sitzungsabläufe mit Resonanzen I
Erster Termin: Kontaktanbahnung, Ankommen, erster Kontrakt
Zweiter Termin: Familie
Dritter Termin: Netzwerk, Gesundheit und Körper
Vierter Termin: Helfertiere
Fünfter Termin: soziale Interaktion, Beziehungsmuster
Sechster Termin: Annikas Abschied/Los- und Auflösung
3.3 Resonanzen II
Die Konstruktion eines professionellen Unterstützungsnetzwerkes zur Unterstützung der Familie B. und Auftrag
Setting
Auftrag
Intake mit Annika
Kontrakt
Familie, Umwelt und Transformationsprozesse
3.4 Resonanzen III
4 »Ich – wir – die anderen« – eine Familie im permanenten Wandlungsprozess – Der Fall Familie G.
4.1 Fallbeschreibung
4.2 Sitzungsabläufe mit Resonanzen I
Ausgangssituation und Kontaktaufnahme
Kontrakt und Setting
Erste Sitzung
Zweite Sitzung: Beziehungsarbeit und Beziehungsentwicklung
Dritte Sitzung: Gruppenbildung und Solidarität
Vierte Sitzung: Bindung und Freiheit
Fünfte Sitzung: ich – wir – die anderen
Sechste Sitzung: Bilanz und Zukunft
Siebte Sitzung: Start in den Neuanfang
Achte Sitzung: Struktur und neue Beziehungskonstruktion
Neunte Sitzung: Abschied beginnt – Konflikte werden benötigt, um zum Ende zu kommen
Zehnte Sitzung: Was noch zu sagen ist
Elfte Sitzung: Abschied
Abschlussbetrachtung
4.3 Resonanzen II
4.4 Resonanzen III
5 Die »Alten« verteilen ihre Hinterlassenschaft – Der Fall Familie H.
5.1 Fallbeschreibung
5.2 Resonanzen I
Der kulturelle Kontext
Ende der Beratung
5.3 Resonanzen II
5.4 Resonanzen III
6 Übergänge, wenn das Neue noch nicht da ist – Der Fall Frau S.
6.1 Fallbeschreibung
6.2 Resonanzen I
Kontaktaufnahme, Zielbestimmung, Kontrakt
Prozessverlauf
Methodenwahl
Analyse des Familiensystems
Aktivierung der Klientin
Ende der Beratung
6.3 Resonanzen II
6.4 Resonanzen III
7 Abschluss
7.1 Systemische Beratung im heilpädagogischen Kontext
7.2 Die Metapher der bunten Häuser
7.3 Setting und Settingdesign in der systemischen Beratung und der Heilpädagogik
7.4 Resonanzen III
Nachklang zum Abschluss: Resonanzen der Lesenden III
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Die Autorinnen, der Autor
Heidrun Kiessl, Jg. 1969, Juristin, Dipl. Heilpädagogin (FH), systemische Therapeutin (IFW, SG). Von 2011 bis 2025 Professorin für Heilpädagogik und Beratung an der Fachhochschule der Diakonie, Bielefeld. Seit März 2025 Professorin an der Katholischen Hochschule Freiburg.
Eckehard Herwig-Stenzel, MAS, MBA, Jg. 1945, Supervisor, Organisationsberater in eigener Praxis und Lehrbeauftragter für Beratung und Familientherapie, mit dem Schwerpunkt: Veränderungsprozesse in sozialen Systemen.
Jutta Reif, Jg. 1979, staatlich anerkannte Erzieherin, staatlich anerkannte Heilpädagogin, Heilpädagogin (B. A.), systemische Therapeutin (hsi, DGSF), Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (BAG), Systemisch Integrative Paartherapeutin (HJI), Emotionsfokussierte Paartherapie/Core Skills (ICEEFT), Mitarbeiterin in einer psychosozialen Beratungsstelle.
Heidrun Kiessl/Eckehard Herwig-Stenzel/Jutta Reif
Systemische Beratungin der Heilpädagogik
Ein Praxisbuch
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-040784-8
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-040785-5epub: ISBN 978-3-17-040786-2
1 Einleitung
Das gemeinsame Erarbeiten eines Vortrags für die Jubiläumstagung des Studiengangs Heilpädagogik an der Fachhochschule der Diakonie, Bielefeld, im Februar 2020 brachte mit dem eigenwilligen Format, eine multiperspektivische Fallanalyse in ihrer Essenz den Zuhörenden zu vermitteln, einen spannenden kollegialen Fachdiskurs dreier Expert*innen für systemische Beratung im Kontext der Heilpädagogik in Gange: Dabei ging es um die Umsetzung systemischer und heilpädagogischer Ansätze und Methoden in der Zusammenarbeit des Autor*innentrios.
Ganz im Sinne systemisch-konstruktivistischer Ansätze eröffneten verschiedene Beobachtungsebenen jeweils andere Betrachtungen und Herangehensweisen an eine Beratung. Das gemeinsame Eintauchen eröffnete Resonanzen und Begegnungen sowie zirkuläres Lernen am Fall und darüber hinaus: tragende Säulen der Heilpädagogik.
Diesen Prozess befanden wir als so bereichernd, dass daraus die Idee für dieses gemeinsame Buch entstand, um gemeinsam im Aufdröseln, Drehen und Wenden von Beratungspraxisfällen Verstehen von systemischer Beratung im heilpädagogischen Kontext zu ermöglichen und entsprechende Lernprozesse anzuregen. Uns verdeutlichte sich dabei, wie verschiedene Disziplinen wie psychologische, psychosoziale und heilpädagogische Beratung und vielfältige berufliche Identitäten ineinandergreifen.
Abb. 1.1:Resonanzrunde (Grafische Umsetzung: Bernd Heide von Scheven)
Mit der Differenz und Multiperspektivität unserer Autor*innentriade sind wir so in einen Aktionsforschungsprozess (Altrichter, Feindt & Thünemann 2022) im Praxisfeld Heilpädagogik und Beratung eingestiegen, um aus den verschiedenen Rollen, Berater*in, Reflecting Team, Intervision, Supervision ganz im Sinne der Kybernetik erster, zweiter oder dritter Ordnung uns und den Lesenden entsprechende Weiterentwicklung zu ermöglichen.
Abb. 1.2:Eigene Darstellung zur Aktionsforschung modifiziert nach Altrichter und Feindt (2008, S. 449)
In diesem ko-kreativen Forschungsprozess konnten wir sehr viel lernen. Schlussfolgerungen und Ideen für die heilpädagogisch-systemische Beratungspraxis konnten generiert werden. Lesenden kann so ein Lernen am Fall und mit seiner Aufschlüsselung aus verschiedenen Perspektiven über systemische Ansätze in der Heilpädagogik ermöglicht werden. Daraus kann eine eigene fachliche Position und Haltung für die Beratungspraxis entstehen und viele Tools und Methoden können in die eigene Praxis transferiert werden.
Aufbauend auf dem Band »Systemische Ansätze in der Heilpädagogik« von Heidrun Kiessl (Kiessl 2019) ist nun das Ziel, mit dem vorliegenden Band ein Praxisbuch vorzulegen, in dem systemische Beratungspraxis in/für die Heilpädagogik sowie entsprechende Methoden im Beratungsprozess aus verschiedenen psychosozialen Handlungsfeldern vermittelt werden.
Über die im Folgenden dargestellten Fallanalysen werden Lesende (Student*innen, Praktiker*innen und Dozent*innen) dazu in einen Ermöglichungsraum heilpädagogisch-systemischer Beratungspraxis eingeladen. Sie können reflektieren und sich in Folge selbst eine Lösung ausdenken.
Im Verlauf des Buches werden wir zusammen mit Ihnen in fünf Beratungsfälle mit verschiedenen Settings eintauchen. Alle Fälle stammen aus der Beratungspraxis der Autorinnen. Aus diesem Grunde werden wir die weibliche Form in der Bearbeitung der Fälle, also in der jeweiligen Fallbeschreibung durch die Falleinbringerin, verwenden, z. B. »die Heilpädagogin/Beraterin«. Die Gedanken der Heilpädagogin/Beraterin sind an manchen Stellen in der Ich-Form verfasst. Die Resonanzen auf Basis von Intervision und Supervision haben einen allgemeinen Charakter und werden gendergerecht ausgeführt.
Die Fälle wurden anonymisiert und mit einzelnen Informationen wie Orten, Berufen etc. verfremdet. Dabei wird das inhaltliche Fallgeschehen widergespiegelt und zum Schutz der betreffenden Personen werden ausgewählte Angaben so verfremdet, dass keine Rückschlüsse auf reale Personen möglich sind.
Im Folgenden werden wir im Text den*die Heilpädagog*in und den*die Berater*in mit einem Schrägstrich getrennt aufführen. Hierzu folgende Geschichte:
Im Modul Beratung an der Hochschule wurde im Seminar von einem*einer Studierende*n die Frage gestellt: »Ich schreibe meine Hausarbeit im Modul Beratung. Mein Handlungsfeld ist aber Pädagogik. Kann ich auch Beispiele aus der Pädagogik nehmen?« Diese Frage wurde von der*dem Lehrenden wie folgt beantwortet:
»Diese zunächst einfache Antwort auf diese Frage ist aus Sicht der objektiven Hermeneutik sehr interessant, denn sie deckt einige zu differenzierende neue Fragen und Antworten auf – ist also eine sehr komplexe Fragestellung.
1.
Die Fragestellung lässt vermuten, dass sie von einem*einer Pädagog*in gestellt worden ist. Würde ein*e Gesundheits- und Krankenpfleger*in, Heilerziehungspfleger*in diese Frage auch so formulieren?
2.
Welche Zuschreibung wird der Pädagogik und welche der Beratung gegeben? Hier könnte vermutet werden, dass z. B. die Beratung mehr dem Psychosozialen zugeschrieben wird.
3.
Es fällt auf, dass zwei verschiedene Begriffe schon eine Definition vorwegnehmen. Das Modul Beratung setzt ein ›Beratungsfeld‹ voraus? Die*der Fragesteller*in hat aber scheinbar nur ein anderes Handlungsfeld zur Verfügung.
4.
Hieraus entsteht die Frage, was der Unterschied zwischen (Be-)Handlung und Beratung (Rat geben) ist.
5.
Wenn es diesen Unterschied gibt, ist zu fragen, ob (Be-)Handlung Beratung ausschließt bzw. umgekehrt. Wir müssen uns nun zur Beantwortung dieser Frage zunächst die Definition von Pädagogik ansehen. In der Pädagogik geht es im Wesentlichen und im weitesten Sinne um Erziehung und Bildung.
6.
In der Pädagogik gibt es aber offensichtlich auf der Handlungsebene der*des Pädagog*in Behandlung und Beratung. Der Beratungsansatz hat demnach mit dem eigentlichen Handlungsfeld nichts zu tun. Er ist aber auch dort etabliert. Man kann also nicht sagen: ›Ich bin Pädagoge, Gesundheitspfleger usw.‹ oder ›Ich bin Berater‹.
7.
Demnach kann Beratung in den verschiedensten Disziplinen ausgeübt werden. Bleibt die Frage nach dem Vergleich zwischen (Be-)Handlung und Beratung. Einen wichtigen Unterschied erhalten wir auf die Fragestellung: Wer handelt? Handelt die*der Pädagog*in, die*der Ärztin*Arzt, Pfleger*in usw. für den ›Handlungssuchenden‹, weil dieser es nicht kann, darf oder will? Oder muss eine Person selbst handeln und benötigt dazu die richtige Anleitung, Vorgaben oder Ideen, Möglichkeiten von einer weiteren Person?
8.
Muss eine Person für sich selbst handeln, ist zu klären, ob es um Vorgaben und Anleitung (Fremdbestimmung) geht. Das würde Training sein und könnte mit den Techniken des Trainings begleitet werden. Wenn es um Selbstbestimmung, also um die Entwicklung von Ideen, Möglichkeiten oder Hinweise geht, z. B. eine mögliche Deformation, ein Handicap oder eine nicht wünschenswerte Besonderheit zu beseitigen bzw. die Möglichkeit zu schaffen, mit dieser besser zu leben, ist Beratung angefragt. Diese folgt ihrer eigenen Dynamik.
9.
Wir müssen also Therapie (bei Kontrollverlust), Behandlung (ich kann es nicht selbst machen), Training (ich werde für etwas fit gemacht) und Beratung (Rat geben zur Selbsthilfe) unterscheiden. Somit hat der*die Pädagog*in eine professionelle Expertise in der Behandlung und eine eigene professionelle Expertise in der Beratung.
Tab. 1.1:Information zur nachfolgenden Fallbeschreibung (eigene Darstellung)
Fall
Kontext Berater*in
Thema
Setting
Fall 1
Psychosomatische Fachklinik für Familienrehabilitation
Fachabteilung Heilpädagogik
Familiengeheimnis
Begleitung von Mutter und Sohn aus Fortsetzungsfamilie
Fall 2
Psychologische Beratungsstelle für Familien
Von der Raupe zum Schmetterling
Beratung einer Jugendlichen im familiären Auftragsgeflecht
Fall 3
Psychologische Beratungsstelle für Familien
Ich, wir, die anderen – eine Familie im permanenten Wandlungsprozess
Kernfamilie, Ehepaar mit fünf Kindern
Fall 4
Lebensberatung in der psychologischen Beratungsstelle
Die »Alten« verteilen ihre Hinterlassenschaft
Einzelberatung zur Vorbereitung der Beratung der ganzen Familie
Fall 5
Lebensberatung in der psychologischen Beratungsstelle
Übergänge, wenn das Neue noch nicht da ist
Einzelberatung im Kontext einer Fortsetzungsfamilie
Die Bezugnahme auf Grundlagen systemischer Ansätze erfolgt durch Verweis auf Kiessl (2019).
In diesem Band werden ergänzend erweiternde Wissensbausteine in informativen Kästen im Kontext des jeweiligen Falls vermittelt. Sie dienen an relevanten Stellen zur Erläuterung oder Vertiefung und beinhalten weiterführende Literatur zur entsprechenden Thematik.
Die Falleinbringerin beschreibt ihre Vorgehensweise im Beratungsprozess in den stattgefundenen Sitzungen. Im Sinne der Aktionsforschung wird exploriert, was in den Sitzungen geschieht, welche Methoden eingesetzt werden und was mit Klient*innen und der*dem Berater*in passiert.
Dieses Buch zeichnet sich dadurch aus, dass der Fall aus der Beraterinnenperspektive, sprich aus der Sicht einer falleinbringenden Autorin direkt aus der Praxis beschrieben wird. Daher wird in den Fallbeschreibungen für dieses Praxisbuch teilweise die Ich-Form gewählt. Die Begriffe Autor*innen und Berater*innen werden im Rahmen dieses Buches synonym verwendet, da wir alle drei sowohl Falleinbringende als auch Autor*innen dieses Praxisbuches sind. Die beiden anderen Autor*innen nehmen dann entsprechend die Rollen der Resonanzgebenden ein. Die unterschiedlichen Betrachtungsebenen ermöglichen ein vertieftes Eintauchen in das Fallgeschehen.
Die Struktur des jeweiligen Falles wird mit der Idee herausgearbeitet, dass die jeweiligen Strukturen innerhalb des Systems und in der Wechselwirkung mit der*dem Heilpädagog*in/Berater*in die »Besonderheiten« setzen. Welche Fragen werden vorgebracht, welche Hypothesen aufgestellt, verworfen und verfolgt, welche Regeln bilden sich ab, welches Setting entwickelt sich, wie ist der jeweilige Kontext und das Netzwerk, welche Lösungen entstehen usw. (vieles aus Kiessl 2019, S. 54 – 139).
Das Herausarbeiten geschieht über einen multiperspektiven, trialogisch-kooperativen Beratungs- und Forschungsprozess der Autor*innen. Dieser ist folgendermaßen strukturiert, wobei die in der Chronologie der Fallbearbeitung verwendeten Piktogramme den Lesenden die Orientierung erleichtern sollen, welche der Resonanzen gerade beschrieben wird.
1.
Beschreibung Falleinbringerin Ausgangsbasis Fall/Anamnese/Vorgeschichte/Etappen im Prozess/Markierungen z. B. Sitzung 1 – 3, 4 usw.
2.
Resonanzen I: intervisorische/supervisorische Perspektive durch den*die Mitautor*innen
3.
Resonanzen II: Betrachtung des Prozesses (auf Ebene 1 und 2) aus einer weiteren Perspektive
4.
Resonanzen III: Die Lesenden werden eingeladen, die eigene Betrachtung der Beratung zu erarbeiten und einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Hier soll der Transfer angeregt werden, was für Lesende über den Fall hinaus ggf. für ihre Praxis relevant sein könnte.
5.
Die Lesenden können ihre Reflexion dazu verschriftlichen.
In den gemeinsamen Treffen des Autor*innentrios bestand zunächst eine gewisse Verführung, schon alle Perspektiven zu bündeln, während der Fall (an-)läuft. Die Bereicherung der Forschung entstand in der Verschachtelung der Resonanzen aus verschiedenen Beobachtungsebenen im Nachhinein und einer Feinjustierung der Ausarbeitung mit wiederholter Reflexion im Autor*innenteam.
In diesen Fallbesprechungen des Autor*innentrios erfolgte insbesondere eine sorgfältige Selektion, welche weiteren Fälle beforscht werden, um weitere Lern- und Entwicklungsräume zu erschließen (Fokus auf anderes Setting, anderes Handlungsfeld, methodische Variationen etc.). Innerhalb der einzelnen Fallbeschreibungen wollen wir unterschiedliche Herangehensweisen mit dem Eintritt der Forschenden/Beobachtenden in das beforschte System eröffnen und hoffen, die Lesenden gut auf diese Reise mitnehmen zu können.
Abb. 1.3:Fallbearbeitung und Resonanzen (eigene Darstellung)
Für die Lesenden sollen die Prozesse im Beratungssystem transparent und verstehbar gemacht werden, so dass mindestens triadische Systeme integriert werden (Rufer 2018, S. 425). Zur Vertiefung und zur Förderung selbstorganisierter Lernprozesse werden Vertiefungsaufgaben/-fragen gestellt.
Kybernetik II
Intervision, Supervision oder Reflecting Team sind die Errungenschaften der Kybernetik zweiter Ordnung (Kybernetik II; Kiessl 2019, S. 22 f.), um weitere unabhängigere Beobachtungsebenen einzuführen. Diese sollen der Beraterin/Heilpädagogin, die im Rahmen der Gespräche zum Teil des Beratungssystems wird, eine »Adlerperspektive« auf den Fall und ihr bisheriges Fallverstehen verschaffen, um ihr neue systemische Hypothesen zu eröffnen, die ihre Möglichkeiten für Interventionen vergrößern. Die Resonanzen I und II sind auch als außenstehende Beobachtungsinstanzen relevant, um der fallführenden Beraterin/Heilpädagogin andere Betrachtungsweisen für ihre Familienberatungen und den Wechselwirkungen im System zu verschaffen und Lesenden verschiedene Perspektiven auf den jeweiligen Fall und die Beratung zu eröffnen.
Familien und ihre interpersonalen Bezüge sind die Basis aller hier im Buch vorgestellten Familienberatungen. Diese Grundpfeiler wollen wir hier zunächst kurz skizzieren.
Familie
Familie ist »dort, wo Menschen verschiedener Generationen dauerhaft füreinander Verantwortung füreinander übernehmen, füreinander einstehen und gegenseitige Fürsorge leisten« (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2017, S. 12) umschreibt eine Definition von Familie, die im Rahmen heutiger familiärer Vielfalt und Vielschichtigkeit auf einen kleinen gemeinsamen Nenner hinweist und auf eine große Bandbreite an Familienformen/familiären Zusammensetzungen anwendbar ist (BMFSJ 2021, S. 50, Kardorff & Ohlbrecht, 2023, S. 15 – 30).
Sie bezeichnet den Wandel in der Gewichtung vom traditionellen Familienverständnis der sogenannten bürgerlichen Normalfamilie (standesamtlich legitimierte Vater-Mutter-Kind-Triade) hin zu zum Teil kontrovers betrachteten facettenreichen Lebens-, Liebes- und Beziehungsformen im »ganz normalen Chaos der Liebe« (Beck-Gernsheim 2010, S. 17). Auf gesellschaftlicher Ebene führt der soziale Wandel ferner zu veränderten Familienformen, Familiengrößen, dem Grad der verwandtschaftlichen Unterstützung, dem Zeitpunkt der Eheschließung oder der Einstellung zur lebenslangen Ehe und Partnerschaft (Ecarius & Schierbaum 2022, zit. n. Kardorff & Ohlbrecht 2023, S. 15). Familie ist gleichzeitig eine »strukturkonservative gesellschaftliche Institution« und unterliegt gleichwohl mannigfacher Transformationsprozesse (Kardorff & Ohlbrecht 2023, S. 18). Die jeweiligen soziohistorischen und soziokulturellen Bedingungen prägen das familiäre Beziehungsgefüge, determinieren es aber nicht (Schneewind 2016, S. 243).
Familie besteht dann, wenn für Kinder Verantwortung übernommen wird, unter Orientierung an dem Leitbild »Kernfamilie« (Funcke 2017, S. 134 – 145). Dies kann sich vollziehen bei
»heterosexuellen Kernfamilien, polyamorösen Liebesbeziehungen, Regenbogenfamilien, Singles, Paare[n] im ›Living-Apart-Together‹, Fernbeziehungen, einseitige[n] oder beidseitige[n] Stieffamilien, Patchworkfamilien, Alleinerziehende[n] und Wohngemeinschaften – sie alle können Kinder einbeziehen, als Hauptwohnsitz im Haushalt, als Besuchskontakt im partiellen Haushalt oder als Ort der zufälligen Begegnung mit einem Elternteil« (Ahlers 1998, zit. nach Ahlers 2018, S. 19, zur Datenlage Elternschaft in Deutschland Juncke et al. 2021).
Die Elternschaft kann in sogenannten »unkonventionellen und wenig bekannten Familienformen unklar zu eruieren sein« (Funcke 2009, S. 168). Das heißt, dass die Beratungsperson einer Familie immer genau den soziohistorischen und soziokulturellen Kontext und die familiären Zusammenhänge in unterschiedlichsten Lebens- und Personenkonstellationen individuell zusammenzufügen und zu erforschen hat. Auf jeden Fall bedeutet es, sich von fixen Voraussetzungen, Annahmen und Ideen im Vorhinein zu verabschieden und die Familie darin zu begleiten, ihre Familieneinheit zu identifizieren und zu stärken.
Wie unterschiedlich Familie sein kann, entfaltet sich auch in den Fallausarbeitungen. Es zeigt sich nicht nur hier, sondern in der Beratungspraxis allgemein, dass bei klassisch-traditionell geprägten Familien die jeweilige Familienkultur sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Die Auswahl der Fälle ergab sich aus der aktuellen Beratungspraxis. Bei einem weiteren Anschlussprojekt könnte ein Schwerpunkt auf sogenannte unkonventionelle Familien (Funcke 2017, S. 134 – 145) gelegt werden. Konkret ergaben sich in unserem Buch die »Formen« der Familien in der Beratungspraxis durch die thematische Auswahl verschiedener Settings, Themen- und Handlungsfelder, unter der Prämisse, für Lesende bereichernd zu sein.
In der Ex-post-Betrachtung fällt auf, dass sich der Schwerpunkt eher bei traditionellen und weniger bei unkonventionellen Familien gebildet hat. Aber es gilt für alle gleichermaßen, dass sich in jeder Familie eine eigene Kultur und Dynamik entfaltet, so dass erlebte Brüchigkeit in Beziehungen oder Problembeschreibungen sowie Ressourcen und Resilienzen überall und mannigfach vertreten sein können.
Familienberatung
Die Aufgaben und Funktion der Beratung von Familien orientiert sich an den Prämissen des SGB VIII. Die Kompetenzen und Ressourcen von Familien und ihren Mitgliedern sollen gestärkt werden (BMFSJ 2021, S.18). Die Beratung von Familien, Eltern, Kindern und Jugendlichen erfolgt vor allem in Beratungsstellen. Angeboten werden individuelle Beratungsangebote für Einzelpersonen, Paare, und/oder Familien. Thematisiert werden insbesondere das Thema Trennung und Scheidung sowie familiäre Konflikte im weiteren Sinne (Juncke et al. 2021, S. 62).
Erziehungsberatungsstellen widmen sich (zu 88 %) der Erziehungskompetenz, Fragen bezüglich der Pubertät (58 %) und zur Nutzung digitaler Medien (48 %), aber auch bei Konflikt- und Krisensituationen sowie Trennung und Scheidung (Juncke et al. 2021, 62). Da es oft Überschneidungen in den Beratungsanliegen gibt und multikomplexe Fragestellungen zunehmend auftreten, werden hier die am häufigsten genannten Anmeldegründe dargestellt. Die SGB-VIII-Reform hin zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe gilt auch für Beratungsstellen und Beratungsangebote. Insbesondere zeigen Studienergebnisse, dass es einen Beratungsbedarf für die ganze Familie gibt, beispielsweise bei Familien mit einem Kind mit andauernden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Falkson, Heitmann, Tiesmeyer & Schmidt 2022, 121).
Beratung kann auch im Kontext einer heilpädagogischen oder kinder- und jugendtherapeutischen Einzelbegleitung oder im Gruppensetting für Kinder/Jugendliche erfolgen. Bei Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Eltern kann im Rahmen der Angehörigenberatung oder im gemeindepsychiatrischen Kontext sowie im häuslichen Umfeld Beratung stattfinden.
Im Kontext der konfessionellen Beratung bieten Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen ihre Beratungsdienstleistung für Einzelne, Paare und Familien an. Auch selbsthilfeorientierte Einrichtungen und Koordinationsstellen erbringen Beratungsleistungen in geringem Umfang (Juncke et al. 2021, S. 58).
Familientherapie
Die Familientherapie unter Einbezug der ganzen Familie sowie mehrgenerationaler Perspektiven fand ihre Ausformung im letzten Jahrhundert (vgl. zur Historie Kiessl 2019, S. 9 – 12). In der gegenwärtigen Fortschreibung fand die Systemische Therapie als psychotherapeutisches Verfahren für Erwachsene Anerkennung, das nicht nur den Menschen mit entsprechender Diagnose und Indikation therapeutisch mit entsprechenden Behandlungsstrategien begleitet, sondern das therapeutische Setting auf die Familie und zunehmend das Netzwerk ausweitet. Unterschiedliche Konstellationen von Familie und Netzwerk werden in das therapeutische Setting einbezogen. Anerkannte Psychotherapieverfahren verwenden spezifische Psychotherapiemethoden verbunden mit Interventionen oder Techniken, um die angestrebten Behandlungsziele zu erreichen (Hanswille 2020, S.159).
Auf der Ebene der verwendeten Interventionen und Techniken (vgl. Kiessl 2019, S. 71 – 78) kann es im Rahmen der diesem Buch zugrunde liegenden Fälle Überschneidungen zur Psychotherapie geben, obwohl die Beratenden mit ihrem institutionellen Kontext das Feld der Beratung nicht verlassen. Eine trennscharfe Unterscheidung von Beratung und Psychotherapie ist auf der handwerklichen Ebene von Interventionen oder Techniken in der Beratungspraxis häufig nicht möglich. Die verwendeten Interventionen oder Techniken sind zunächst »oft nicht spezifisch systemisch« (Hanswille 2020, 165). Eine systemische Einfärbung des Beratungsgeschehens entsteht durch systemische Hypothesen und entsprechender Zielformulierung und Auftragsklärung im prozesshaften Geschehen. Getragen wird dies von Systemischen Haltungen. In der Familientherapie sind diese in ein klinisches Modell zum »Zustandekommen und der Aufrechterhaltung von Problemen, Störungen, Krankheiten« sowie Theorien der Veränderung (und gerahmt durch interdisziplinäre Systemtheorie der Synergetik) eingebettet (Geyerhofer, Ritsch & Thoma, 2018, S. 63, zit. n. Hanswille 2020, S. 165, Kiessl 2019, S. 21 – 35).
Resonanzen
Diese zunächst metaphorische Begriffswahl symbolisierte den stattfindenden Austauschprozess, der auf den verschiedenen Ebenen (s. o.) unter den Autor*innen stattgefunden hat. Verschiedene Betrachtungsebenen und die damit verbundenen Diskussionen konnten als kreative und bezogene Schwingungsprozesse verstanden und erfahren werden, die den Fall und die systemisch-heilpädagogische Praxis sowie das Lernen der Autor*innen und der Lesenden zum Klingen bringen kann (Rosa 2019, S. 282 f.).
Diese Resonanzvorgänge waren inspirierend. An vielem davon mangelte es in der Zeit der Coronapandemie. Umso eindringlicher halten wir an diesem Begriff fest.
In der Vorbereitung dieses Buches fand eine theoretische Untermauerung dieser der Physik entliehenen Metapher statt. In der Psychodynamik wird das Beziehungsgeschehen in der Therapie in einem Resonanzraum umschrieben. Das leitende Gefühl ist in der Psychodynamik, mit sich in einen Resonanzzustand zu gelangen, um in der Lage zu sein, mit anderen Menschen in einen Resonanzzustand zu gelangen. Dieser ermöglicht die Anverwandlung, sowie die »berührende Aneignung und Begegnung« (Rosa 2019, S. 286 m. w. N.).
Der Soziologe Hartmut Rosa arbeitete in seiner Soziologie der Weltbeziehungen Resonanz als Schlüsselkategorie für gelingendes Lebens heraus und etablierte Resonanz als sozialwissenschaftliche Analysekategorie. Resonanz ist Grundbedürfnis und Fähigkeit, aber vor allem ist es ein Beziehungsmodus (ebd. S. 288, 293). Es entspricht dem dialogischen Prinzip, das der Religionsphilosoph Martin Buber (1878 – 1965) formuliert hat (ebd. S. 289) und an dem sich die Heilpädagogik für Begegnung, Begleitung und Unterstützung verstärkt orientiert.
Für Rosa ist Resonanz eine Antwortbeziehung, in der beide Seiten mit eigener Stimme sprechen. Es erfordert vom Subjekt und der Welt einerseits Geschlossenheit und Konsistenz, um mit eigener Stimme zu sprechen. Andererseits bedeutet es offen zu sein, sich affizieren oder erreichen zu lassen (ebd., S. 298).
Familie ist für Rosa nicht nur »Resonanzhafen der Moderne«, sie ist »organisatorisches Zentrum und institutionelle Zurechnungsinstanz für Akkumulation von ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital (ebd., 352). Dabei bleibt auch heute die Kernfamilie die Idealvorstellung (ebd. S. 343). In der Familie können jedoch »Resonanzblockaden auftreten« (ebd. S. 342), die in der Familienberatung relevant werden. Es gilt, den Hafen sicher zu gestalten und für die Familie Resonanzblockaden wahrnehmbar zu machen, um sie durch neue Sichtweisen auf sich selbst und als Familie aufzulockern oder sogar zu lösen.
Für das Buchprojekt fanden wir uns jeweils mit intrinsischem Interesse und Motivation ein, um Beratung zu beforschen und ein Lehrbuch zu schreiben, um durch Intervision zu lernen. Im gemeinsamen Aufdröseln und Erarbeiten des Buches in vielen Projektsitzungen sowie dem »Ausbrüten« der einzelnen Bestandteile in Klausur gleichermaßen erfahren wir Resonanzbeziehungen und einen kreativen Flow, in denen wir uns wechselseitig erreichen, antworten und verstärken mit der Idee, gleichzeitig »weltwirksam« zu sein, unsere Erfahrungen und Erkenntnisse zu teilen, in einen »kollektiven Transformationsprozess« (ebd., S. 334) einzusteigen und mit dem Buch etwas für Lesende zu erreichen (ebd., S. 275). Dieser sogenannte »Resonanzmodus« (ebd., S. 337) bereicherte unsere Arbeit an dem Buch und damit auch dessen Inhalt unseres Buches als horizontale (Beziehung zu Menschen), diagonale (Beziehung zur Dingwelt), vertikale (Beziehung zur Welt als Ganzes) »Resonanzachse« sehr.
Wir hoffen, dass es gelingt, etwas zu schaffen, das für Lesende von Bedeutung ist und wiederum die heilpädagogische Beratungspraxis noch mehr zum Resonanzraum machen kann.
2 Familiengeheimnis als Kraft zum Trennen und Kraft zum Binden – Der Fall Lukas
2.1 Fallbeschreibung
Lukas, neun Jahre, und seine Mutter kommen wegen Schwierigkeiten und Streitereien untereinander in die Fachabteilung »Familienheilpädagogik« in der psychosomatischen Fachklinik für Familienrehabilitation. Lukas' im Vorfeld des Klinikaufenthaltes diagnostizierte Autismusspektrumsstörung (früher: Asperger-Autismus) und seine Störung des Sozialverhaltens wird von der Mutter im Aufnahmegespräch mit der fallführenden Psychologin als Grund für das Problemverhalten von Lukas beschrieben (auf weitere Diagnosen der Mutter wird zur besseren Veranschaulichung an dieser Stelle nicht eingegangen).
Mit der Anmeldung der Familie in der heilpädagogischen Fachabteilung der Klinik verspricht sich die Psychologin der Station eine Verbesserung der Beziehung und eine Befriedung zwischen Mutter und Sohn. Die Psychologin leitet dann an die Heilpädagogik weiter, wenn die Kinder jünger als zwölf Jahre alt sind oder wenn bei Jugendlichen eine Behinderung und/oder sprachliche Einschränkung ein Thema in der Familie ist/sind.
2.2 Behandlungsgeschehen und Resonanzen I
Einleitung in den Fall
Bewusst entscheidet sich die Beraterin/Heilpädagogin, den in der Fallvorstellung im Team gewonnenen Diagnosen von Lukas keine Beachtung zu schenken und die Akte ungelesen wegzupacken.
Gedanken und Fragen der Heilpädagogin/Beraterin
Was würde passieren, wenn ich davon ausginge, dass Lukas mit seiner diagnostizierten seelischen Behinderung in der Kommunikation und Interaktion sowie in seiner Mentalisierungsfähigkeit so eingeschränkt ist, dass es nicht möglich wäre, mit der Familie die Themen zu bearbeiten und »anspruchsvollere« Methoden einzusetzen? Hier würde die Wirklichkeitskonstruktion »Diagnose« weiter fortgeschrieben werden.
Ich verabschiede mich von diesen Gedanken, mein Verhalten an der Diagnose auszurichten. So nehme ich die Chancen und Möglichkeiten war, die in der Familie und in der Begegnung stecken, um diese zu fokussieren. Möglicherweise wird so eine andere und neue Wirklichkeit konstruiert.
Wie kann ich eine andere Sicht auf das Problem oder Thema ermöglichen? Innerlich registriere ich, dass durch die Diagnose ihr innerer Stressmotor anzuspringen droht. Indem ich das Thema Diagnose beiseitepacke und durchatme, kann ich mich mit Neugier der Begegnung im Erstkontakt öffnen und eine entsprechende Haltung des Nichtwissens einnehmen. Ich lasse mich auf die Begegnung im Erstkontakt ein. Hier kommt zusätzlich zur heilpädagogischen Haltung eine bewusst neutrale Haltung und ein allparteiliches Ausbalancieren in der Verteilung von Aufmerksamkeit und Energie.
Weiter im Fallgeschehen
Als Mutter und Sohn im Anmeldebereich der heilpädagogischen Fachabteilung zum Erstgespräch ankommen, nimmt die Heilpädagogin/Beraterin zu einem liebenswerten kleinen Jungen mit Fußball unter dem Arm und einer sympathischen, gestresst wirkenden Mutter Kontakt auf. Als das Joining (Kiessl 2019, S. 54) und die Erklärungen über die Familienheilpädagogik in der psychosomatischen Fachklinik durch die Beraterin abgeschlossen sind, setzt Frau A. dazu an, vor Lukas in die Problembeschreibung einzusteigen. Lukas wird beim Luft- und Ausholen seiner Mutter sichtlich etwas kleiner.
Gedanken und Fragen der Heilpädagogin/Beraterin
Wie gelingt es mir, Lukas zu erreichen, eine gute Kooperation und einen Kontakt hinzubekommen sowie gleichzeitig seine Mutter in ihrer Not zu würdigen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen?
Doch wo liegen die Bedürfnisse von Lukas und hat er überhaupt ein Anliegen?
Wie verläuft die Kommunikation zwischen Mutter und Sohn und was hat das mit ihrer Beziehung zu tun? Die Idee ist: Verändert sich die Beziehung, verbessert sich möglicherweise die Kommunikation (was schon Paul Watzlawick in seiner Kommunikationstheorie festgezurrt hat).
Kann sich hier in der »Familienheilpädagogik« ein neuer Raum öffnen, in dem die beiden einander zuhören, in einen guten Kontakt kommen und sich das beobachtete Kommunikationsmuster durchbrechen lässt?
Wie gestaltet sich die Beziehung im Dreieck Mutter – Sohn – Heilpädagogin/Beraterin?
Wie kann es mir gelingen, nicht in die Problemtrance einzusteigen und die mangelnde Kommunikation und ersichtlich belastete Beziehung zu manifestieren?
Weiter im Fallgeschehen
Bevor es dazu kommt, sich in problematischen Beschreibungen zu verfangen, lädt die Heilpädagogin/Beraterin die beiden ein, sich auf ein gestalterisches Spiel einzulassen, in dem es darum geht, Schätze an alle Familienmitglieder und sich selbst zu verschenken. Jedes Familienmitglied wird mit einem Teller auf dem Tisch mit Namen versehen repräsentiert. Da die Familie groß ist, dauert das Ganze etwas. Es stehen insgesamt fünf Teller auf dem Tisch. Lukas hat noch zwei deutlich kleinere Halbgeschwister aus der aktuellen Partnerschaft. Zu seinem leiblichen Papa hat Lukas guten und regelmäßigen Kontakt.
Einmal werden »Edelsteine« als positive Eigenschaften, Stärken oder etwas, was jemand gut kann (wenn es schwerfällt, etwas Positives an sich oder anderen zu finden), verschenkt und benannt. Anschließend werden Wünsche formuliert und Bedürfnisse an die anderen adressiert.
Frau A. ist zunächst überrascht, genauso Lukas, der entlastet ist und sich nicht mehr im Zentrum der öffentlich gemachten, mütterlichen Kritik sieht. Das Problem drückt besonders Frau A. Sie hat Stress und erhofft sich Entlastung. Die Heilpädagogin/Beraterin begründet ihren Vorschlag mit ihrem Wunsch, die beiden und die nicht anwesenden Familienmitglieder zunächst einmal etwas besser kennenlernen zu wollen. Im Zuge dessen sollen anhand des Spiels, insbesondere mit den formulierten Wünschen, im Ergebnis gemeinsame Anliegen formuliert werden. Lukas ist begeistert dabei und Frau A. springt über ihren Schatten.
Der Fokus auf die guten Eigenschaften und Ressourcen des Einzelnen sowie der Familie und dem Hören und Erzählen der damit verbundenen Geschichten, des Weiteren die spielerische Interaktion ermöglichen es beiden, sich in einer gewissen Leichtigkeit freudvoll und interessiert zu begegnen. Es gelingt, sich zuzuhören und an der Ressource gute Beziehung anzuknüpfen, die bei Beratungsbeginn einer gewissen Problemtrance zum Opfer gefallen ist, und beide schaffen es, sich nicht »im Problem zu verhaken«. Der Alltag und die Mutter-Sohn-Interaktion sind durch die Problemzuschreibungen überlagert und andere oder neue Sichtweisen an sich schwer zu verankern. Die Zugänge zueinander sind dadurch erschwert.
Es gelingt anschließend kooperativ, das zentrale Anliegen beider aufzugreifen, nämlich die Beziehung zueinander zu verbessern. Die anschließende Auftragsklärung und das Kontrakten gelingt sehr schnell. Es kann nun mit beiden konstruktiv an ihren formulierten Themen gearbeitet werden, was in Folge auch geschieht. Das System organisiert sich selbst weiter neu.
Die Heilpädagogin/Beraterin arbeitet weiter ressourcen- und lösungsorientiert. Gleichermaßen bekommt das Thema, wie Lukas seine Familie erlebt, eine größere Bedeutung. An dieser Stelle wird der Auftrag erweitert und Lukas eingeladen, mit Tierfiguren und Materialien seine Familie aufzustellen. Diese Chance nutzt er. Seine Mutter hört und sieht zu. In der Aufstellung bilden sich überraschend tiefgehende familiäre Themen ab, die Lukas mit großer Feinfühligkeit und Sensibilität wahrgenommen und getragen hat.
Am Ende der Beratung gelingt es Frau A. zu erkennen, dass sie sehr viele Gemeinsamkeiten mit ihrem Sohn hat. Lukas gelingt es, seine Befürchtungen und Emotionen bezüglich einem in der Beratung aufgedeckten Familiengeheimnis zu formulieren, das im Gespräch bearbeitet werden kann. Er hat Sorge um seine Mutter. Sie ist häuslicher Gewalt durch den aktuellen Lebenspartner ausgesetzt. Emotionen haben Platz: Ängste, Sorgen, Wut und Trauer. Sie sind da und werden zum Teil in Worte gepackt und geteilt. Das Geheimnis wird in den Beratungsraum gestellt, findet ein Außen und durch die anwesende Heilpädagogin/Beraterin eine gewisse Öffentlichkeit.
Das Thema kann gemeinsam besprochen werden und die beiden finden eine Lösung, wie es Entlastung für Lukas geben kann und was er dafür benötigt. Es entsteht eine große Verbundenheit zwischen Mutter und Sohn. Durch den geteilten Lösungsraum, das Expertentum von Lukas und seiner Mutter entwickelt sich in Kombination mit vielen Ressourcen in wenigen Sitzungen ein wunderbares und zusätzlich überraschendes Ergebnis.
Weitere Gedanken der Heilpädagogin/Beraterin
Ich spüre eine Verbundenheit in und mit der Familie. Bei mir stellt sich eine emotionale Berührtheit ein, eine Resonanz verbunden mit einem respektvollen Staunen über das Ergebnis, den Flow und die veränderte Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Die Verbundenheit konnte sich durch eine gute Verabschiedung sowie den Einsatz eines Abschlussbriefes mit verschiedenen Komplimenten lösen. Ich freute mich wiederum über die Dankeskarte der Familie zum Abschluss.