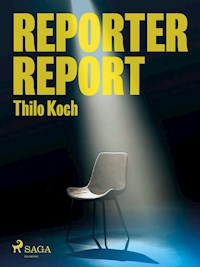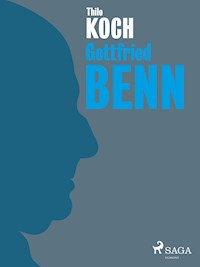Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Tagebuch aus Washington
- Sprache: Deutsch
1960 wurde der Autor Thilo Koch als Amerika-Korrespondent nach Washington geschickt. Seine Reportage beginnt direkt mit einem besonders bedeutsamen Tag: der Amtseinführung des Präsidenten J.F. Kennedy. Der Text besteht aus Notizen der jeweiligen Tage und manchmal auch darüber hinaus. Mit dem Versuch amerikanische Politik mit einem deutschen Blick zu begutachten, startet Thilo Koch in diesem Band seine Erzählungen darüber, wie er die "Ära Kennedy" erlebte. Dabei bleibt er bei seinen Schilderungen stets sachlich und berichtet sehr detailreich was geschieht.Die Ära Kennedy hatte Thilo Koch vollständig als Journalist begleitet, da er für den ARD Korrespondent in Washington war. In dieser Reihe erzählt Koch über diese Ära aus der Sicht eines deutschen Journalisten. Der Autor bleibt stets sachlich bei seiner Berichtserstattung, jedoch ist gleichzeitig seine eigene Einstellung zu den Geschehnissen in den USA deutlich, was der Buchreihe ihren ganz eigenen Charme verpasst. Der Journalist lädt den Leser ein, in die damalige Zeit einzutauchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thilo Koch
Tagebuch aus Washington 1
Saga
Tagebuch aus Washington 1Cover Bild: Shutterstock Copyright © 1963, 2019 Thilo Koch und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711836095
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
VORWORT
Amerika — es geht noch immer eine besondere und sonderbare Faszination davon aus. Hast Du es besser, Amerika, wie Goethe meinte? Ist das noch immer die Neue Welt, was Kolumbus vor 450 Jahren zum erstenmal sichtete? »Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten« — haben wir es da mit einem Mythos oder einer Wirklichkeit zu tun?
Ich sah die Vereinigten Staaten zum erstenmal 1951. Es war eine ausgedehnte Reise »from coast to coast«, und es war eine tiefgreifende Erfahrung. Abgestoßen und angezogen zugleich, kehrte ich aus den weiten Horizonten zwischen Atlantik und Pazifik in meine Berliner Enge zurück.
Neun Jahre später ging ich als Amerika-Korrespondent des Deutschen Fernsehens, des Norddeutschen und des Westdeutschen Rundfunks nach Washington. Ich kam gerade zurecht, um Chruschtschow mit dem Schuh auf seinen Tisch in der UNO-Vollversammlung trommeln zu sehen und um zu berichten vom Wahlkampf zwischen Nixon und Kennedy.
Dieses Washingtoner Tagebuch beginnt mit der Reportage von einem besonders kalten und besonders bedeutsamen Tage: der Amtseinführung des jüngsten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy. Meine Familie war gerade übergesiedelt. Die Kinder machten erste Gehversuche in amerikanischen Schulen. Ich begann meine regelmäßige Arbeit etwa gleichzeitig mit einem neuen Präsidenten der USA, der sich so besonders viel vorgenommen hatte.
Der erste Band meines Washingtoner Tagebuchs umfaßt das Jahr 1961, das erste Kennedy-Jahr. Es war zugleich mein erstes Amerika-Jahr. Ich kam aus Berlin; dort hatte ich mein ganzes bisheriges Leben als Journalist zugebracht. Berlin als Thema blieb mir treu. Ob in Washington selbst oder in Wien, bei der ersten Begegnung Kennedys mit Chruschtschow — die Berlin-Frage war ein Angelpunkt der amerikanischen Außenpolitik 1961, ein Angelpunkt besonders der deutsch-amerikanischen Beziehungen in jenem Jahr. Der Stoff dieser Tagebuchnotizen sind Kommentare und Berichte für den Norddeutschen und Westdeutschen Rundfunk und Artikel für DIE ZEIT. Es handelt sich um Notizen vom Tage, manchmal mit Reflexionen über den Tag hinaus. Sie sind geschrieben im Machtzentrum »des Westens«.
Ein deutscher Journalist übermittelte sie aus Amerika nach Deutschland hinüber. Ihr Gegenstand ist nicht in erster Linie Amerika, sondern eher: amerikanische Politik in ihrer Bedeutung für uns Deutsche.
Washington, im Mai 1963
Thilo Koch
TAGEBUCH AUS WASHINGTON I
20. Januar 1961
Heute gratulierten sich die Vereinigten Staaten zu ihrem fünfunddreißigsten Präsidenten. Heute blieb Washington im Schneesturm stecken. Heute wurde ein neuer Stil geboren: der Kennedy-Look. Ein historischer Tag, ein kalter Tag, ein interessanter Tag.
Auf Stapeln von blütenweißem Papier war alles bis in die einzelne Festsekunde hinein wunderschön geplant. Aber am Vorabend des hohen Tages begann es zu schneien. Die sonst brodelnde »rush hour« erstarrte unter dem eisigen Anhauch eines plötzlichen Wintertages. Zehntausende von »Straßenkreuzern« blieben im Schnee stecken, wurden von ihren Besitzern stehen gelassen. Washington war aktionsunfähig, in den Büros richtete man sich zum Übernachten ein, die Hausfrauen überprüften die Vorräte im Kühlschrank, das Radio unterbrach seine Programme für Wetterdurchsagen. Erschütternd, wie hilflos der amerikanische Zivilisationsbürger einer unerwarteten Hinterlist der wilden Natur dieses nur scheinbar gezähmten Kontinents unterliegt. Washington glich einer Schildkröte, die man unverhofft auf den Rücken geworfen hat. Zwanzig Zentimeter Schnee genügen, um den amerikanischen Regierungsapparat lahmzulegen. Ein Angreifer brauchte sich nur mit dem guten alten »General Winter« zu verbünden, dann . . . Das Inaugurationskomitee nahm den Kampf erstaunlich aktiv auf, und heute morgen war zum mindesten die Pennsylvania Avenue von Schnee und Eis geräumt; die Achse, um die sich die Amtseinführung John F. Kennedys drehen sollte, war frei.
So sah ich von meiner verschneiten Tribüne aus pünktlich elf Uhr dreißig den großen schwarzen Wagen vom Weißen Haus kommend in die breite Triumphstraße einbiegen und zum Kapitol hinauffahren. Im Fond zwei schwarze Zylinder, mehr war nicht zu erkennen; an den Straßenrändern Lautsprecher mit scheppernder Jubel-Trubel-Musik; auf den wochenlang vorher errichteten hölzernen Tribünen außer frierenden Reportern: niemand. Aus allen Teilen des riesigen Landes waren sie angeblich herbeigereist, die Inaugurationsbesucher Washingtons. In der Tat, die Hotels erwiesen sich als überfüllt. Von den Washingtonern selbst erwartet niemand viel Paradebegeisterung. Aber wo waren sie nun, die hunderttausend Schaulustigen, Zugereisten?
Sie erwählten den besseren Teil der Tapferkeit und blieben vor dem heimischen Fernsehschirm, und so fiel der Auftakt armselig aus, nichts von einer Premiere, eher das Bild einer fehlgeschlagenen Generalprobe. Am Kapitol, zu Füßen der festlichen Empore, beim feierlichen Akt selbst, war immerhin eine gewisse Repräsentanz des amerikanischen Volkes zusammengekommen. Der äußere Eindruck allerdings glich auch mehr einer Farmerversammlung in Alaska als dem hochansehnlichen Festpublikum für die erlauchteste politische Zeremonie der Vereinigten Staaten. Homburg und Stresemann waren dem Skianzug gewichen.
Nicht so die Akteure und Ehrengäste auf dem Podium selbst. Kennedy hatte sich zum Zylinder entschlossen, und Eisenhower leistete ihm wohlwollend Gesellschaft. Das war ein kleines äußeres Zeichen für die insgesamt überraschend freundschaftliche Wachablösung. Vor acht Jahren, als der Republikaner Dwight D. Eisenhower den Demokraten Harry S. Truman zur Inauguration vom Weißen Haus abholte, fiel die Begrüßung frostig aus; Eisenhower verließ nicht einmal den Wagen. Nach dem Eid gab es den zeremoniellen Händedruck, aber Truman setzte sich sofort ostentativ wieder auf seinen Stuhl, während alle anderen Festgäste noch minutenlang applaudierten. Diesmal lud Eisenhower seinen jugendlichen Nachfolger vor der Fahrt zum Kapitol zu einer Tasse heißen Kaffee ein, und ich sah, wie die beiden Herren sich auf der Tribüne gute fünf Minuten angeregt und ernsthaft miteinander unterhielten, bevor zunächst der neue Vizepräsident Lyndon B. Johnson den Eid schwor. Eisenhower ist siebzig und der älteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, Kennedy dreiundvierzig und der jüngste Mann, der je ins Weiße Haus einzog. Ein Wechsel der Generationen, ein Wechsel der politischen Gruppierungen, und dennoch ganz offensichtlich kein Groll von beiden Seiten, keine Eifersucht, keine Ressentiments.
Eisenhower ließ in seiner »Fare-well-Pressekonferenz«, in der ich ihn am Mittwoch sah, allerdings keinen Zweifel, daß er die Entscheidung vom 8. November 1960 bedauerte. Er fühlt sich von seinen Amerikanern persönlich betrogen, da er, der große Nationalheld, doch mit aller Kraft für Richard M. Nixon in die Wahlkampfarena gestiegen war. Aber es ist einer der liebenswertesten Züge dieses amerikanischen Volkes, daß der Verlierer nicht notwendigerweise den Überlegenen zu hassen beginnt. So bekam Kennedy nach dem Eid von niemandem einen herzlicheren und längeren Händedruck als von Nixon. Manche Beobachter halten den bisherigen Vizepräsidenten, der in diesen Tagen eine Anwaltspraxis in seinem Heimatstaat Kalifornien eröffnen wird, für einen raffinierten Schauspieler. Davon hat »Tricky-Dicki« sicherlich etwas. Immerhin wäre er dann ein ausgezeichneter Schauspieler, weil er an die Rolle, die er spielt, glaubt. So wurde er zu einem repräsentablen Vizepräsidenten, so steigerte er sich zu einem attraktiven Präsidentschaftskandidaten und so gibt er mit sehr viel Anstand den Verlierer. Sein persönliches Verhältnis zu Kennedy war niemals schlecht, die beiden waren zusammen Senatoren im Kapitol und sind ja nahezu Altersgenossen.
Eisenhowers Verhältnis zu Kennedy gleicht dem eines Generals gegenüber einem jungen Offizier einer anderen Division, der sich im Kampf gegen den gemeinsamen Feind ausgezeichnet hat. Kennedy seinerseits hat der heftigen Kritik an der Eisenhower-Regierung niemals den Akzent persönlicher Angriffe gegen den Mann an der Spitze dieser Regierung gegeben. Sicherlich hatte das taktische Gründe, aber spätestens heute wurde es vor Hunderten von Fernsehkameras sichtbar: der alte und der neue Herr achten einander.
Auch Expräsident Truman saß wieder auf der Tribüne und diesmal übers ganze Gesicht strahlend. Innerhalb der gemeinsamen Partei, der demokratischen, war Harry S. nicht für den jungen Millionärssohn aus Boston gewesen. Er hatte einen Mann reiferen Alters und größerer politischer Erfahrung in den Wahlkampf schicken wollen. Nun aber steht er sehr eifrig hinter dem Mann, für den die Tatsachen gesprochen haben. Während wir alle auf die Nationalhymne warten, die wiederum von Marion Anderson, der berühmten Negersängerin vorgetragen wird, erzählt mir ein amerikanischer Kollege einen Dialog zwischen Kennedy und dem Schatzmeister seiner Partei. »Der Wahlkampf war teuer, John, wir haben vier Millionen Dollar Schulden.« Kennedy: »Was hätten Sie wohl mit den vier Millionen gemacht, wenn wir sie gespart hätten, aber unterlegen wären?«
Er sieht von weitem oft aus wie ein »Sonny-Boy«. Das täuscht. John Kennedy wirkt aus der Nähe ungemein ernsthaft. Ein Mann, der sich verantwortlich fühlt, der die Verantwortung geradezu sucht. Er hat sich als Offizier bezeichnenderweise gerade bei der Rettung schiffbrüchiger Kameraden bewährt. John Kennedy leidet an einer Wirbelsäulenverletzung, die ihn noch vor wenigen Jahren zu einer lebensgefährlichen Operation zwang. Er ging lange an Krükken und weiß, was körperliche Schmerzen sind. Wie er dort oben sitzt, zwischen Eisenhower und dem Rednerpult, mit zusammengenommenen Knien und zwei scharfen Falten zwischen den Augenbrauen, mit der eckigen Stirn unter dem charakteristischen Haarschopf, wirkt er entschlossen, vertrauenswürdig, zugleich merkwürdig angespannt und gelassen. Während der Nationalhymne formen seine Lippen stumm die Worte des Textes. Der Blick schweift, seine Augen sehen oft so aus, als ob sie Ziele suchen, die andere nicht sehen. Ein Mann, der eine Mission erfüllen will.
Sehr ruhig spricht er dem obersten Richter der Vereinigten Staaten die Eidesformel nach. Zwischen den erhobenen Schwurhänden der beiden Männer eine alte schwere Familienbibel der Kennedys. Er hat den Mantel abgelegt trotz schneidender Kälte und tritt jetzt mit großer Selbstverständlichkeit ans Rednerpult, um zum erstenmal als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu seinem Volk zu sprechen. Die Rede ist angenehm kurz, erfreulich phrasenlos, klug und friedfertig, selbstbewußt und überzeugt. Dort steht ein Intellektueller als Präsident, ein Mann, der sich als Journalist und Schriftsteller bewährte, bevor und während er Parlamentarier war. Es ist ein Vergnügen, diese anständige Sprache, diese nüchterne Logik zu vernehmen und den vollkommen untheatralischen Vortragsstil zu sehen. Kennedys Stimme wird hoch und flach, wenn er laut spricht, die Betonung bekommt leicht etwas Singendes. Franklin D. Roosevelt zum Beispiel war ein weit besserer Redner, Eisenhower eine faszinierendere Erscheinung. Aber von diesem jungen Präsidenten geht etwas Prägendes aus, das Erwartungen weckt auf neue Formen, neue Inhalte der amerikanischen Selbstverwirklichung. Hier beginnt, was man in diesen Tagen den »Kennedy-Look« zu nennen anfängt.
Eigentlich knüpfte sich der Begriff zunächst mehr an die Erscheinung der Gattin des neuen Präsidenten, Jacqueline Kennedy, geborene Bouvier. Jackie ist durchaus kein junges Mädchen mehr, hat die dreißig überschritten. Aber sie wirkt nahezu kindlich, immer ein bißchen scheu, lächelt pflichtbewußt und sagt nicht viel. Über ihre Intelligenz gibt es verschiedene Versionen. Einig ist man sich im ganzen Lande darüber, daß Jacqueline Geschmack hat. Sie trug die Haare immer auf eigene Weise, und sie ist bekannt für einfache Kleider. Jetzt sitzt sie neben dem Nerz von Mamie Eisenhower auf der Empore am Kapitol und ist in diesem Augenblick die ungekrönte Königin der Amerikaner. Aber anders als bei Elisabeth von England geht nichts Majestätisches von ihr aus. Sie trägt einen hellen Mantel mit dazu passender großer topfartiger Kappe. Offensichtlich ist sie ein wenig zu sportlich angezogen, mehr wie für ein elegantes Rennen als für eine Art von Krönungszeremonie. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist in der Tat eine Art Monarch, mit den umfangreichen Rechten und Pflichten eines konstitutionellen Königs. Entscheidender Unterschied: Er ist ein Herrscher auf Zeit und unter genauer Kontrolle der beiden Häuser des Parlaments. Aber er ist Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlshaber aller Streitkräfte in einem. Die Gattin des Präsidenten wird auch in Amerika als »First Lady« bezeichnet.
Eine sehr junge und vielleicht die hübscheste First Lady haben die Vereinigten Staaten, und auf den Bällen des Inaugurationstages strahlte sie in einem weißen Abendkleid, das später einmal neben den Inaugurationsroben aller früheren Präsidentengattinnen im Washingtoner Smithonian-Museum ausgestellt werden wird. Wie soll man den Jacqueline-Kennedy-Look beschreiben? Sie hat ein schönes, mädchenhaftes Gesicht, eine gute Figur, schlanke Beine, eine anmutige Haltung, sie weiß, was sie kleidet. Es trifft nicht zu, daß sie ihre Garderobe nur von Pariser Modehäusern bezieht. Ihr Schneider ist ein Amerikaner italienischer Herkunft, und ihr erklärtes Ziel ist es, auf betont amerikanische Weise schick auszusehen. Das freilich ist ein schwieriges Unterfangen, denn ganze Generationen von Karikaturisten haben mit gutem Grund davon gelebt, die komischen Übertreibungen der amerikanischen Frauenmode zu glossieren. Jackie im Gegensatz dazu will nicht »overdone« erscheinen. Vielleicht bezeichnet man ihren Stil am besten als: raffiniert einfach.
Der neue Präsident sagt, an die Adresse Moskaus gewandt: »Wir werden uns nicht fürchten zu verhandeln, aber niemals werden wir aus Furcht verhandeln.« Er schenkt den Leuten reinen Wein ein. Er schildert die Lage der Welt, die Lage der Vereinigten Staaten innerhalb dieser Welt realistisch. Er hat keine Angst vor düsteren Farben. Aber in dieser ersten Rede als Präsident ist er optimistisch gestimmt. Seine Zukunftsperspektiven resultieren aus seinem Glauben. Er betont, daß die Menschenrechte nicht von der Gnade des Staates kommen, sondern von Gott unmittelbar. Kennedy liebt historische Bezüge. Er erinnert mit berechtigtem Stolz daran, daß die amerikanische Demokratie ihre Tradition hat. Es war 1789, als George Washington als erster Präsident dieser Vereinigten Staaten von Amerika inauguriert wurde. Die Verfassung, die sich die Amerikaner selbst gaben, ist noch heute ununterbrochen in Kraft.
Niemand könnte heute an diesem 20. Januar 1961 sagen, ob mit diesem Tage ebenfalls eine neue Zeit beginnen wird, wie das vor 175 Jahren der Fall war. Es hieße Kennedys Absichten und Möglichkeiten überschätzen, wenn man von ihm eine Revolution erwarten wollte. Er ist ein »linker, ein liberaler« Demokrat, aber sowohl persönlich als auch politisch steht er auf dem Boden festverwurzelter Traditionen; er wird sich als konservativ erweisen, wo immer die Überlieferung den Forderungen der Stunde gerecht werden kann. Aber er scheint entschlossen zu sein, radikal den alten Zopf abzuschneiden, wo die modernen Probleme der industrialisierten Gesellschaft nur mit soziologischen und ökonomischen Strukturveränderungen bewältigt werden können.
Dies ist ein Land, in dem offenbar krasse, manchmal schreiende Gegensätze lässig nebeneinander bestehen können. Zur zeremoniellen politischen Würde gesellt sich hier mit Eifer die Volksbelustigung, der karnevalistische Jux. Nach dem Eid die Rede, nach der Rede ein Lunch im Kapitol, nach dem Lunch die triumphale Fahrt vom Kapitol zum Weißen Haus und vor dem Weißen Haus: Parade. Präsident und First Lady, das neue Kabinett — sie stehen Stunde um Stunde in der Kälte und lachen, schwenken die Zylinder, klatschen sich die Hände warm. Stundenlang bis in die Dunkelheit hinein defilieren sie vorbei, die »Floats«, Festwagen der einzelnen Staaten, voran die Heimatstaaten des Präsidenten und des Vizepräsidenten, Massachusetts und Texas. Da blüht der nationale Kitsch und der US-Föderalismus feiert sich selber fröhlich. Immer wieder in langen Zügen Reiter halb in Uniform, halb in Cowboy-Tracht, die Erinnerung an den Grenzkampf, an die Landnahme, an die Pionierzeit. Der letzte Büffel wird vorbeigeritten, die letzten Indianer im Federschmuck trappeln durch den Schneematsch. Zwischen den Mädchenbeinen der Girlparaden und bunten Kapellen erscheinen auch die neuesten atomaren Waffen; Pershing, Zeus, Polaris, Minuteman und ein Modell des neuesten Stratosphärenflugzeuges B 70. Im alten Rom wurden die Auguren befragt, wenn eine bedeutende Persönlichkeit ein Amt übernahm. Diese Priester gaben vor, die Himmelszeichen deuten zu können. Eine Inauguration, eine feierliche Einweihung und Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten hängt nicht ab von dem Willen einer Gottheit, der sich durch Himmelszeichen kundtäte, sondern von der Entscheidung des Volkes. In den Vereinigten Staaten allerdings ist der Wille des Volkes im Bewußtsein dieses Volkes, im Bewußtsein vor allem derer, die es führen, identisch mit dem Willen Gottes selbst.
Während des Wahlkampfes sagte der Präsidentschaftskandidat Senator Kennedy einmal: »Ich bin es leid, in den Morgenzeitungen immer nur zu lesen: Herr Chruschtschow erklärte und beschloß . . ., Herr Castro erklärte und beschloß . . . Ich wünsche zu lesen: Der Präsident der Vereinigten Staaten erklärte und beschloß . . .« Kein Zweifel, wir werden das künftig sehr oft lesen. Es gehört nicht viel Prophetengabe dazu, wenn man heute, an diesem 20. Januar 1961, in Washington voraussagt: dies wird das Jahr Kennedys sein.
29. Januar 1961
Das Uhrwerk der Kennedy-Regierung ist zusammengesetzt; nun schnurrt es ab, vorläufig präzise und ohne zu stocken, ganz nach Art seines Herren und Meisters. Heute hat der neue Präsident es noch einmal vor den Augen des Kongresses aufgezogen, denn morgen ist es zum erstenmal in Gefahr, zum Stillstand gebracht zu werden. Morgen muß Präsident Kennedy nach glänzendem Start seine erste schwere Hürde nehmen. Es geht um die Reform einer komplizierten parlamentarischen Einzelprozedur, um das sogenannte Rules-Committee. Heute und hier nur soviel dazu: ein Ausschuß im Parlament, eben dieses Gesetz-Komitee, kann die Termine in der Gesetzgebungsmaschine bestimmen, das heißt, wenn es will, unendlich verschieben. Die Kennedy-Regierung braucht schnelle Gesetze für alle ihre Pläne. Im jetzigen Gesetz-Komitee verfügt Kennedy aber über keine sichere Mehrheit, darum soll es erweitert werden.
Des Präsidenten heutige Botschaft an den Kongreß ist das Gegenstück zu Eisenhowers Abschiedsadresse. Sie hat Bedeutung an sich, aber ihr aktuelles Gewicht bekommt sie durch die für morgen zu erwartende Entscheidung. Kennedy setzte sein ganzes persönliches Prestige in direkter Konfrontation mit beiden Häusern des Kongresses ein, um die Abgeordneten und Senatoren zu überzeugen, daß sie ihn unterstützen müssen, wenn die Vereinigten Staaten überleben
sollen. In der Tat, so weit geht Kennedy. »Meine Regierungszeit wird eine Prüfung der Frage sein«, sagte er, »ob eine Nation, die so organisiert und regiert wird wie die unsere, fortdauern kann; das Ergebnis ist durchaus nicht gewiß.« Warum? Präsident Kennedy zählte noch einmal alles auf, was er schon im Wahlkampf vorgebracht hatte: die Arbeitslosigkeit, die Dollar- und Goldkalamitäten, das gesunkene Prestige der Vereinigten Staaten, die Verteidigungslücke.
Es war, mit einem Wort, die dunkle Kehrseite der Medaille, deren glänzende Vorderseite Eisenhower vorgezeigt hatte. Die amerikanische Wirklichkeit, die ganze, wird man folgern dürfen, ist beschrieben, wenn wir Eisenhowers und Kennedys Botschaften zusammen nehmen. Er zählte auf, was geschehen müsse, damit die Vereinigten Staaten stark und gesund werden könnten. Er kündigte eine Welle von Gesetzesvorschlägen an, die seine Regierung unverzüglich dem Parlament vorlegen werde. Dabei bezeichnete er diesen Kongreß als seine eigentliche Heimat in Washington, appellierte an seine ehemaligen Kollegen im Repräsentantenhaus und im Senat, an deren Seite er ja tatsächlich 14 Jahre gearbeitet hat.
Die Hauptsorge ist natürlich das Geld. Kennedys Pläne sind durchdacht und könnten Erfolg haben. Aber er braucht viele Milliarden mehr dafür, als in der großen Kasse des Staatshaushaltes enthalten sind. Die Steuerschraube soll nur im Notfall angezogen werden. Was Kennedy fordert, ist eigentlich eine Art amerikanisches Wirtschaftswunder. Das eigentliche Wunder würde nicht in der bloßen Steigerung der Produktion bestehen, sondern in einem gesunden Ausgleich innerhalb der amerikanischen Wirtschaft und in besseren Arrangements für den Absatz außerhalb, auch für die Hilfeleistungen, denn selbst das Schenken muß heute rationalisiert und politisch-diplomatisch gesteuert werden.
Der Präsident erwähnte Deutschland in seiner Kongreßbotschaft nicht ausdrücklich. Er rechnet aber offenbar fest mit großen finanziellen Opfern der Bundesrepublik auf dem Altar der westlichen Bündnisverpflichtungen. Er sucht andrerseits unverkennbar den Ausgleich, zumindest den Waffenstillstand mit der Sowjetunion. Kennedy will Zeit gewinnen zur Stabilisierung der Vereinigten Staaten.
Er muß diese Atempause den Russen abhandeln. Er weiß, daß sie ihn bei dieser Gelegenheit binden wollen. Er muß einsteigen in dieses Risiko. Er ist der Mann dazu, mehr als den Einsatz zurückzugewinnen. Aber er setzt vorläufig behutsam und so spät wie möglich. Nicht ausgeschlossen, daß der Gegenspieler ihn schon sehr bald stellt. Kennedy wird nicht ausweichen.
1961 werden wir kein leichtes Leben haben, sagte er vor wenigen Minuten auf dem Kapitolhügel in Washington. Wir wollen aufs Beste hoffen, aber aufs Schlimmste uns vorbereiten. Die Zeit ist nicht unser Freund in diesem Augenblick. John Kennedy hat den Kopf des Kongresses angesprochen in einem Stil, der an Churchill erinnert. Er hat sogar das Herz des Kongresses erreicht durch den festen Ernst, der von ihm ausgeht. Ob er allerdings die Abstimmungsmaschinerie umkonstruieren kann, das wird sich morgen zeigen, damit fällt morgen die wichtigste politische Entscheidung in den Vereinigten Staaten seit der Präsidentenwahl selbst.
1.Februar 1961
Mächtig ist der Präsident der Vereinigten Staaten, mächtiger ist der Kongreß. Gestern wären dem neuen Herrn im Weißen Hause um ein Haar die Hände gebunden worden; aber Kennedy hat Glück. Mit 217 zu 212 Stimmen beschloß »Das Haus«, sein »Rules-Committee« zu vergrößern. Das klingt wie höhere Mathematik, und doch war es die Weichenstellung für Kennedys gesamte Wirksamkeit.
Der Regierungschef in einer Demokratie kann nicht aus eigener Machtvollkommenheit Gesetze erlassen. Sache der Regierung ist es, Gesetzentwürfe dem Parlament vorzulegen; dieses berät die Entwürfe und stimmt darüber ab. Kennedy braucht für all die großen Pläne, die er hat, Dutzende von neuen Gesetzen: für den Mindestlohn und die Rüstung, für die Krankenversicherung der Rentner und die Entwicklungshilfe, für das neue Schulprogramm und die Rassenfrage. Seine Partei hat in beiden Häusern des Parlaments eine solide Mehrheit. Infolgedessen wurde bei seiner Wahl gesagt: obwohl er mit so knappem Vorsprung durchs Ziel ging, wird er kräftig regieren können, denn er hat ja den Kongreß auf seiner Seite.
Diese Rechnung war ohne den Wirt gemacht, der in diesem Falle »Rules-Committee« heißt. Dieses hat im amerikanischen Parlamentarismus eine Schlüsselstellung. Es ist eine Art Verfahrensausschuß, der darüber bestimmt, wann ein Gesetzentwurf vors Haus kommt und zum Gesetz werden kann. Dieses Komitee besteht aus 12 Abgeordneten, 8 von der linken Seite des Repräsentantenhauses, 4 von der rechten, also 8 Demokraten, 4 Republikaner. Der Demokrat Kennedy sollte demnach mit 8 zu 4 Stimmen keine Schwierigkeiten mit diesem Schlüsselkomitee vor der Tür zur Gesetzgebung haben. Dem war aber mitnichten so.
Die in jedem Staatsgebilde anzutreffenden beiden politischen Hauptströmungen, die des Bewahren- und die des Verändernwollens, kann man in den Vereinigten Staaten konservativ und liberal nennen. Die Republikaner sind konservativ, die Demokraten liberal. Nun gibt es aber in den Südstaaten dieser Vereinigten Staaten eine politische Mischrasse; das sind konservative Demokraten, sie geben sich liberal, solange es nicht um die Sonderrechte, genauer die Sonderunrechte in den Südstaaten geht: die Rassentrennung mit all dem Unheil, das daraus schon erwachsen ist. Diese konservativen Südstaatendemokraten sind keine Freunde des liberalen Kennedy aus dem nördlichen Massachusetts; viele von ihnen haben ihn nicht gewählt, obwohl er der Kandidat ihrer Partei war.
Zwei von den 8 demokratischen Abgeordneten im Verfahrensausschuß nun sind konservative Anti-Kennedy-Demokraten, darunter ihr Vorsitzender, Mr. Smith. Sie hätten mit schöner Ausdauer zusammen mit den 4 Republikanern im Ausschuß das Gesetzgebungswerk der neuen Regierung durch das Stimmenverhältnis 6 zu 6 im Ausschuß blockieren können. Der Ausschuß kann zwar Gesetzentwürfe nicht zurückweisen; aber er kann sie unendlich zurückhalten. Der gewiegte Parlamentarier Kennedy tüftelte also zusammen mit dem Führer der Mehrheitsfraktion des Repräsentantenhauses, Sam Rayburn, einen Vorschlag aus, das Gesetzkomitee auf 15 Mitglieder zu vergrößern.
Ich saß auf der Pressetribüne, und ich hatte in keinem Parlament der Welt bisher eine Debatte und eine Abstimmung erlebt, die so ruhig und kurz und gleichzeitig so sensationsgeladen war. Alle Zuschauertribünen überfüllt, dicke Trauben von Wartenden vor den 17 Türen — ganz einfach interessierte Bürger. Von den 437 Abgeordneten waren 429 anwesend. Sie wurden namentlich aufgerufen und antworteten laut mit ja oder nein. Bis zur Mitte des Alphabetes, etwa zum M, führten knapp die Konservativen. Das Ergebnis dann doch: 217 zu 212 für den liberalen Vorschlag, für den Sprecher des Hauses, Rayburn; letzten Endes für Kennedy. Das »Rules-Committee« besteht nunmehr aus 5 Republikanern und 10 Demokraten, von denen 8 liberal stimmen werden, so daß bei Kampfabstimmungen das Verhältnis 8 zu 7 ist.
Der Parlamentarismus ist oft in Gefahr, sich an einem seiner vielen Zöpfe aufzuhängen. Schmal ist der Grat zwischen einem entmündigten Parlament in der Hand eines autokratischen Regierungschefs und einem übermächtigen Parlament, das jede vorausschauende Regierungsarbeit lähmt. Kennedys erstes ernsthaftes Hindernis ist genommen. Der Kampf zeigte, daß der Mann, der auf dem besten Wege ist, das Herz des Volkes zu gewinnen, es schwer haben wird, den mißtrauischen Kopf der Volksvertretung für seine Politik einzunehmen.
4. Februar 1961
Ein ironischer Kolumnist schrieb neulich, er wisse, wie man als Arbeitsloser in den Vereinigten Staaten wieder in Lohn und Brot gelangen könne; man müsse nur in Harvard studiert haben. Das war eine Anspielung darauf, daß ungewöhnlich viele neue Angestellte in Washington tatsächlich von der Universität John Kennedys, Harvard, kommen. Harvard, das bedeutet für Amerika eine bestimmte geistige Haltung, einen unverkennbaren intellektuellen Stil. Kennedys Inaugurationsadresse, seine erste Botschaft an den Kongreß, hatten literarischen Rang. Man weiß von John Kennedy, daß er Churchill bewundert; er soll alles gelesen haben, was Sir Winston jemals schrieb. Wie der große alte Brite, so nützt der hoffnungsvolle junge Amerikaner die Möglichkeiten der englischen Sprache, Erhabenheit und Würde auszudrücken. Aber wie unterschiedlich der Vortrag; Churchill ritt mit dem Pathos des 19. Jahrhunderts die langen Wogen seiner Sätze — Kennedy hämmert kühl und nüchtern, aber ebenso unbeirrbar auf die Köpfe seiner Zuhörer ein. Kennedys Stimme ist flach und, wenn er schnell spricht, unschön; nach Art der Leute aus Neu-England zieht er manche Vokale singend in die Länge und macht aus einem ›s‹ manchmal ein ›sch‹, so z. B. ist die Wendung »thish year« charakteristisch.
Bei der feierlichen Inauguration, bei der Amtseinführung Kennedys auf den Stufen des Capitols, sprach der 85jährige amerikanische Lyriker Robert Frost ein eigenes Gedicht. Frost ist gewissermaßen der Rudolf Alexander Schröder Amerikas. Es war eine rührende Szene, als der alte Herr im grellen Sonnenlicht über dem eingeschneiten Washington sein Manuskript nicht mehr lesen konnte. Er begann zu stammeln und zu stocken. Da ließ der hinter ihm sitzende John Kennedy ihm seinen Zylinder so übers Rednerpult halten, daß Schatten darauf fiel. Nun ging es. Frost war später der erste Gast des neuen Präsidenten im Weißen Haus. Ein neues augusteisches Zeitalter, ein Zeitalter der Macht und der Poesie werde er heraufführen, der junge Präsident, äußerte später Robert Frost. Die Zeichen stünden glücklich wie zu Zeiten des ersten römischen Kaisers Augustus und seines Dichters Virgil.
Geist und Macht, in diesem 20. Jahrhundert so getrennt voneinander und gleichzeitig so ineinander verbissen wie kaum jemals zuvor — sie sollen also in diesen sechziger Jahren auf diesem Kontinent Amerika durch diesen jungen Präsidenten ein neues, ein fruchtbares Verhältnis zueinander finden? Weiß Gott, diese Vereinigten Staaten, so mächtig sie sind, könnten einen Zuwachs an Poesie im weitesten Sinne, an Schönheit, an Pflege der Künste, an ästhetischer Produktivität gebrauchen. John Kennedy und seine Frau Jacqueline bringen dafür gewiß einen Sinn mit in die höchste Sphäre der Macht, ins Weiße Haus. Der Präsident selbst hat alle Hände voll zu tun, nach dem »Augustus« zu streben. So hängt es entscheidend ab von der jungen First Lady Amerikas, ob die Prophezeiung Robert Frosts mehr sein kann als der wohlmeinende Segen eines Greises. Einer der ersten Gäste Mrs. Kennedys im Weißen Haus war Georg Balanchin, der große Ballettdirektor aus New York. Der neue euphorische Flügelschlag der amerikanischen Seele bezieht seinen Schwung vorerst aus Indizien; eine Tasse Tee bei Jacqueline, empfangen von einem Künstler des Landes, dessen Werk gewöhnlich eher als eine kuriose Angelegenheit der Privatinitiative betrachtet wird, eine offizielle, eine allerhöchste Tasse Tee, wird von den Gesellschaftsreportern der amerikanischen Zeitungen als günstiges Himmelszeichen gedeutet. Miß Pamela Turnure, die überaus reizende Pressesekretärin der jungen, überaus reizenden Präsidentengattin, erläuterte dazu, daß Mrs. Kennedy mit Mr. Balanchin über den russischen Tanzmeister Diaghilev gesprochen habe und über das harte Brot von Tänzern in einem Lande, wo Künste wie Ballett und Oper ihre Mittel nur aus den Händen launischer Mäzene erhalten.
Es mehren sich Stimmen, die einen Kultusminister der Vereinigten Staaten fordern, ein geradezu revolutionärer Vorschlag in einem Lande, wo man »den Staat« für ein notwendiges Übel hält und seinen Dienern gerade nur so viele Rechte einräumt, wie unumgänglich erscheint. Aber die Öffentlichkeit diskutiert und versteht mehr und mehr, daß kostspielige Kunstübungen, bei denen viele Hände und lange Proben erforderlich sind, den regelmäßigen Zuschuß der öffentlichen Hand nicht entbehren können; Oper und Ballett brauchen kontinuierliche Arbeits- und Übungsbedingungen, die nun einmal nur »Vater Staat« garantieren kann. Die junge First Lady im Weißen Haus sah sich in einem der kümmerlichen Theater Washingtons Balanchins New-York-City-Ballett an; sie kennt es aus New York, wo sie vor ihrer Ehe mit John Kennedy als Fotoreporterin gearbeitet hat.
Die Begeisterung Amerikas für den Kennedy-Look, für Voraussagen wie die vom »augusteischen Zeitalter«, ist besser zu verstehen vor dem Hintergrund der biederen Eisenhower-Ära. Mamie Eisenhower und Balanchin zum Tee? Eine absurde Vorstellung. Aber man mißverstehe das nicht parteipolitisch. Auch Mrs. Harry S. Truman hat sicherlich nicht einen einzigen Künstler oder Literaten oder Wissenschaftler bei sich im Weißen Hause gesehen. Und die Roosevelts? In den letzten Amtsjahren von Franklin D. war Krieg, und er war alt und krank. Tatsächlich ist es also 20 Jahre her, seit im guten alten White House eine geistigere gesellschaftliche Atmosphäre wehte.
Der neue amerikanische Präsident ist ein Intellektueller, und das allein könnte man als einen »unamerikanischen Umtrieb« bezeichnen. Als »egg-head« wird hierzulande ja verächtlich bezeichnet, wer das müßige Geschäft des Nachdenkens professionell betreibt. Adlai Stevenson ist zweimal als Präsidentschaftskandidat wegen seines intellektuellen Habitus unterlegen gegenüber dem Vater des Vaterlandes, Eisenhower, einem soldatisch-bäuerischem Typ. Kennedy hatte den Vorzug, daß er nicht nur der Doktor aus Harvard ist, nicht nur der Autor von Büchern mit so bezeichnenden Titeln wie »Profile des Mutes«, sondern auch als Soldat seinen Mann stand. Als Schnellbootkommandant erhielt er eine der höchsten Auszeichnungen der amerikanischen Marine und wurde wegen der abenteuerlichen Rettung der Überlebenden seiner Mannschaft als einer der Helden des zweiten Weltkrieges gefeiert. John Kennedy ist also Intellektueller und Held und Sportsmann; gern gedruckt im Wahlkampf wurden Bilder, wo er als Mannschaftskapitän einer football-Mannschaft in furchteinflößendem Polsterdreß zu sehen ist. Überdies — und das war das Entscheidende — erwies sich John Fitzgerald Kennedy als telegen. Er ist nicht eigentlich hübsch, der junge amerikanische Augustus; aber es geht eine ruhige Selbstsicherheit von ihm aus, eine zurückhaltende Festigkeit, die nicht nur die amerikanischen Wählerinnen, sondern auch besonnene männliche Amerikaner via Television für ihn einnahmen.
Jacqueline schließlich tat das ihre. Sie ist von einer eher »kontinentalen«, einer französischen Schönheit. Selbst ihr Lächeln ist mehr als »keep-smiling«. Sie wirkt immer weiblich und ohne äußerlichen Aufwand verführerisch. Jede echte Amerikanerin sei eine Sklavin des Nerzmantels, heißt ein Werbeslogan. Jacqueline erschien zwischen den Nerzmänteln von Mrs. Eisenhower und Mrs. Johnson, der Gattin des neuen Vize-Präsidenten, in einem hellen, sehr schlicht geschnittenen Wollmantel. Der Schneider Jacquelines ist ein italienischer Amerikaner mit Namen Oleg Cassini. Ein bekannter Fernsehwitzbold fragte dieser Tage die Amerikanerinnen: »Wissen Sie, was die neueste Nerzmode ist? Unerschwinglich — Schafwolle-Nerz, zugeschnitten von Cassini.«
7. Februar 1961
Ein dicker Mann mit dünnen Ärmchen starrt mißmutig und verblüfft und übersättigt auf seinen Bauch; er steht unter anstrengenden Turngeräten, vor ihm lachend im Trainingsanzug John Kennedy. Der Dicke trägt an seiner ungeschickten Sporthose als Abzeichen die Buchstaben »USA«. Diese Karikatur fand ich heute in der »Washington Post«, der einzigen Zeitung, die gegenwärtig täglich und pünktlich bis zu mir heraus geliefert wird — nach Bethesda, was soviel heißt wie »Gnadenort«, ein Gebiet in der Umgebung der amerikanischen Bundeshauptstadt. Ein fixer stämmiger Junge, der ewig kaut, bringt sie in einem großen Leinenbeutel. Seine Backen sind rot von der alpinen Winterkälte, der Schnee knirscht unter seinen dicken Sohlen, wenn er früh, sehr früh morgens über die Einfahrt trabt. So haben sie oft begonnen, die guten, alten amerikanischen Legenden »vom Zeitungsboy zum Zeitungskönig«, »vom Tellerwäscher zum Multimillionär«. Will auch er Kapitalist werden oder Präsident, der Junge von der »Washington Post«?
Es ist eine andere Generation, die mit dem Präsidenten vom Jahrgang 1917 ans Ruder der Weltmacht kam — es wird eine Generation sein, die in eine Welt hineinwächst, deren Normen und Formen in diesen sechziger Jahren geprägt werden. Könnte es nicht sein, daß meinem Zeitungsboy, wenn er einmal Kinder hat, der heute noch so unüberbrückbar scheinende Gegensatz Kapitalismus — Kommunismus bereits recht historisch vorkommt — so wie uns der »Universalienstreit« des Mittelalters? Es kam damals nach erbitterten Kämpfen um Begriffe zu einer mittleren Lösung. Aber kann es einen gemeinsamen Nenner geben für Freiheit und Unfreiheit, für Recht und Unrecht?
John Kennedy stellt sich solch »universelle« Fragen nicht. Er ist durchaus, was unser Schiller einen »philosophischen Kopf« genannt hätte; das bewies er als Harvard-Student, als Doktor, als Autor von Büchern. Das bestätigen seine Freunde und Berater, zumeist Intellektuelle aus den neu-englischen Universitätskreisen des amerikanischen Nordostens. Seine beiden ersten großen Reden — hier sagt man »Adressen« — beschäftigen immer noch, immer wieder, immer mehr nicht nur politische Kreise und Leitartikler, sie werden in der gesamten öffentlichen Diskussion fast wie Evangelien zitiert. Das ist oft übertrieben und bequem. Kennedy selbst, als ein gläubiger und praktizierender Katholik, würde sich jede unangemessene Verheiligung seiner Thesen verbitten.
Der Mann denkt praktisch, feiner ausgedrückt: pragmatisch. Er ist kein intellektueller Eiferer, kein Typ, wie man ihn unter »fortschrittlichen« Geistern, unter geschulten Marxisten zumal, so häufig antrifft. Seine sehr konservative, sehr normale religiöse Bindung bewahrt ihn davor, das eigene metaphysische Bedürfnis in ideologische pseudo-religiöse Aktivität umzugießen. Konkret gesagt: er befürwortet eine stärker lenkende und unternehmende Hand des Staates nicht, weil er an Begriffe wie »demokratischer Zentralismus« glaubt, sondern weil ihn die Anschauung und die Erfahrung in diesen Vereinigten Staaten lehrt, daß die moderne Industriegesellschaft sich ohne ein wohlverstandenes Maß zentraler Lenkung, ohne gemeinnütziges Denken selbst zugrunde richtet. Ein anderes Beispiel: Kennedy unterläßt es, die Aufrüstung oder Abrüstung mit Atomwaffen moralisch zu rechtfertigen oder zu verurteilen. Er findet sie vor. Er sieht ihre vernichtenden Aspekte. Er weiß, daß paradoxerweise Freiheit und Sicherheit von ihnen abhängen. Er versucht, sie durch politische Schritte Zug um Zug ins Arsenal historischer Schrecken zu verweisen, am Ende sich ganz von ihnen zu befreien. Das heißt, er setzt alles daran, zunächst über einen Atomwaffen-Versuchsstop mit der anderen Atommacht zu verhandeln.
Das Bemerkenswerte am Kopf des Präsidenten Kennedy scheint mir nicht so sehr seine Gedankenfülle oder Brillanz, sein Witz oder seine Tiefe zu sein — von alledem hat er relativ wenig, weniger jedenfalls als sein anfänglicher Gegenspieler und jetziger Mitarbeiter Adlai Stevenson. Nein, das Bemerkenswerte ist die Balance, die Natürlichkeit, das Feste seines Denkens. Viele Amerikaner empfinden seine Kritik am »American way of life« als radikal, revolutionär.
Aber tatsächlich kommt der grundgescheite und gebildete Millionärssohn aus Boston, Kennedy, weit weniger von »links«, als der bäurisch-soldatische Farmerssohn Eisenhower von »rechts« kam. Eisenhower suchte die Gesellschaft reicher, erfolgreicher Männer. Er bewunderte »big business«. John Kennedy sucht und bewundert durchaus nicht, im Gegensatz dazu, etwa die Gewerkschaftsführer als solche. Er hat Freunde in sehr unterschiedlichen Kreisen, am meisten unter Universitätsleuten, Journalisten, Künstlern, Schauspielern. Ob er mit Bergarbeitern, Rentnern, Farmern spricht oder die heimkehrenden RS-47-Flieger mit deren Frauen zum Kaffee bei sich im Weißen Haus hat, ob er Robert Frost, den Senior der amerikanischen Poeten, einlädt oder mit Harry Truman spazierengeht, immer bewegt er sich erstaunlich natürlich, unaufgeregt, angemessen, einfach. Er ist ein sozial fühlender, denkender, handelnder Mann. Er ist kein Sozialist.
Da haben wir den Punkt: John Kennedy ist nicht der Mann eines »Ismus«. Er hat Ideale, zu denen er sich gern bekennt, aber er ist nicht einmal ein Idealist. Er scheint zu wissen, daß auch Idealismus ins Verderben führen kann, eine Erfahrung, die wir Deutsche schmerzlicher machen mußten, als die Amerikaner sie machen konnten. Eine Sache um ihrer selbst willen tun? Das wäre eine völlig unverständliche Devise für einen politischen Kopf, der so sachlich ist, daß er sich immer des relativen Wertes einer Sache bewußt bleibt. Die Männer, die heute die Vereinigten Staaten führen, halten nicht viel von Postulaten, von feierlich und theoretisch beschworenen Forderungen. Sie bemühen sich vielmehr, so realistisch zu sein wie der Aufsichtsrat einer Firma, die zugleich große Gewinne und große Produktionsschwierigkeiten zu verzeichnen hat — so kühl und fleißig wie ein Kollegium von Physikern, die eine bestimmte Kettenreaktion in die richtige Richtung dirigieren möchten, ohne bis jetzt die rechte Formel zu wissen.
Das in Aktion zu sehen, ist sehr aufregend. Kennedys Tempo und Impetus sind alles andere als abstrakt und blutleer. Menschen sind am Werk, und so gibt es Leidenschaften. Aber Emotionen scheinen gut abgefangen und überspielt zu werden. Selbst Herausforderungen wie Castro, die den Amerikaner im Amerikaner tief treffen und beunruhigen, bringen die eiserne Rangordnung der Probleme nicht ins Wanken. Erstens: Fit werden. Zweitens: Mit dem Gegner Spielregeln vereinbaren. Das ist die simple Regel des Trainers Kennedy. Alles andere kommt mit der Zeit. Diese merkwürdige »Zeit« als Faktor der Geschichte hat so viele Gegensätze aufgehoben und in neue, andere Konflikte hineindirigiert. Wo ist die Erb- und Todfeindschaft geblieben zwischen Deutschland und Frankreich? Wo der völkermordende Streit zwischen katholischen und protestantischen Christen? Mein kleiner Zeitungsboy von der »Washington Post« — wird er sich an seinen Schuhsohlen, unter denen morgen früh wieder der amerikanische Schnee vor meinem Fenster knirscht, ganz beiläufig den Streit der großen politischen Theoreme von heute abgelaufen haben, wenn er einmal 43 Jahre alt ist — so alt oder jung wie dieser interessante neue Mann im ellipsenförmigen Arbeitszimmer des Weißen Hauses in Washington?
10. Februar 1961
Im großen Weltlazarett für die mancherlei politischen Krankheiten rund um den Globus, im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, fragt man sich heute, was sich wohl aus den neuesten Nachrichten über Lumumba ergeben mag. Dieser Mann wurde hier gerade in der letzten Zeit erneut zu einer Schlüsselfigur im Ringen um den Beginn einer Lösung am Kongo. Die Aussichten schienen sich gebessert zu haben. Der neue UN-Botschafter der Amerikaner war in Gespräche mit seinem sowjetischen Kollegen eingetreten, und die Umrisse eines Kompromisses zeichneten sich ab.
Ich konnte gestern und heute bei den Vereinten Nationen folgendes darüber erfahren: Es besteht eine allgemeine Neigung, stärker auf die Kongovorstellung der afrikanischen UN-Vertretungen zu hören. Diese afrikanischen Vorstellungen sind nicht einheitlich; sie treffen sich aber in der Forderung der Unabhängigkeit für den Kongo und der Nichteinmischung — Devise: »Afrika den Afrikanern.«
Praktisch allerdings läuft die Frage auf zweiseitige Verhandlungen zwischen Washington und Moskau hinaus. Diese Verhandlungen werden geführt über die Vermittlung von Stevenson und Sorin in New York, also über die UN-Botschafter der beiden Großmächte. Hier sehen die Amerikaner einen Zusammenhang zwischen Kongo und Laos. Stevenson — und hinter ihm Kennedy — scheint von den Russen Beweise der Verständigungsbereitschaft in diesen
beiden Krisen-Gebieten zu fordern. Die Amerikaner sind bereit, sich dafür ihrerseits auf strikte Neutralität zurückzuziehen.
Was den Kongo angeht, so sähe der Kompromiß etwa vier Punkte vor: l. Eine Entpolitisierung der rivalisierenden kongolesischen Streitkräfte, deren Kasernierung, die Einlagerung ihrer Waffen zu treuen Händen der UN-Truppen. 2. Eine Verstärkung dieser UN-Einheiten. 3. Bildung einer neuen Regierung auf föderativer Grundlage. Kasawubu soll bleiben, Mobutu kann verschwinden, Lumumba kann zurückkehren in die politische Arena. 4. Keine Einmischung von Ost oder West, Nord und Süd — abseits der UN-Aktivitäten.
So weit, so gut, aber es ist deutlich, daß Chruschtschow, wenn er einem solchen Kompromiß zustimmt, die Stellung der UN in ihrer gegenwärtigen Verfassung, das heißt also: Hammarskjöld, stärkt. Chruschtschow würde ferner eine bisher von den Kommunisten so intensiv benutzte Gelegenheit weniger gut handhaben können, in Afrika durch die Kongokrise Stimmung zu machen gegen die ehemaligen Kolonialmächte, gegen den Westen. Das ist für ihn ein ziemlich hoher Preis. Ist ihm eine freundliche Ausgangsbasis für den großen Handel mit Kennedy so viel wert?
Wir wollen es hoffen.
Und im Grunde hoffen es wohl auch die meisten der Afrikaner. Ein Kongo in der Krise kann ihrer Sache nur schaden.
10. Februar 1961
Die hübscheste und natürlich dadurch auch teuerste Gegend New Yorks ist die Park Avenue am Central Park. Dort erwarb die Bundesrepublik Deutschland ein schönes altes Haus und machte es zum Goethe-Haus. Der Weise von Weimar als Exportartikel? Warum nicht, wenn er sich kulturell gut verkauft? Aber tut er das?
Die amerikanische Öffentlichkeit räumte in diesen Tagen den deutschen Bemühungen, mit Goethe fürs geistige Deutschland zu werben, beträchtliche Publizität ein. Es war weniger das Goethe-Haus als das Gründgens-Gastspiel, mit dem man sich sehr aufmerksam befaßt. Der große Mann aus Hamburg mag selbst überrascht gewesen sein über die Ausführlichkeit und Anzahl der Premierenkritiken, die nach amerikanischem Brauch schon am anderen Morgen in den großen und kleinen New Yorker Zeitungen standen.
Die offiziellen Vertreter der Bundesrepublik hatten es an nichts fehlen lassen, Goethen ihrerseits in der Neuen Welt zu empfehlen. Botschafter Grewe kam durch Schneeverwehungen und Eiseskälte aus Washington herüber und gab einen in der Tat glanzvollen Empfang im neuen Goethe-Haus. Botschafter Knappstein, unser Mann bei den Vereinten Nationen in New York, versammelte am Abend darauf nicht weniger als fünfunddreißig UNO-Botschafter bei Kerzenlicht und »Mathäus Müller« um Gründgens, Quadflieg, die Weißgerber. New York ist die Stadt mit dem größten deutschsprachigen Bevölkerungsanteil irgendeines Ortes außerhalb Deutschlands selbst. Kein Wunder, daß das Haus ausverkauft war. Rührend die Anteilnahme alter, oft sehr alter deutscher Immigranten. Einige dieser deutschen Juden sind deutsch-nationaler gesonnen, als man es bei ihrem Schicksal begreift.
Ich hatte das Glück, in meinem Parkettstuhl einen hinter mir zu hören, der ganz zweifellos aus Leipzig stammte. Mit zittriger Stimme zitierte er die »Faust«-Stellen, die er noch wußte, seiner Frau immer einige Sekunden, bevor sie von der Bühne kamen. Als er schließlich etwas allzu vernehmlich deklamierte: »Da steh ich nu, ich armer Dohr...«, zischte ihn eine Dame mit wiederum unverkennbar Berlinischem Tonfall an: »Be kweiett!«
Sonst war die Akustik schlecht, und Quadflieg kam gar nicht über die Rampe. Er erzählte mir dann, wie ihm war. Das gesamte Ensemble hatte große Wetterschwierigkeiten bei der Anreise; auf den Azoren, in Kanada — überall saßen die Mimen, nur nicht rechtzeitig in New York. Quadflieg kam dazu mit einem Mandelabszeß an. Der Theaterarzt der Metropolitan operierte ihn im Bad seines Hotelzimmers die Nacht vor der Premiere.
Gretchen dagegen rührte die Herzen mit dem ersten Hauch. Die Weißberger sieht aus wie ein deutsches Mädchen im besten Sinne, und Amerika liebt Gretchen. Ein Kritiker schrieb, man habe selbst Schubert vergessen können, als Antje das Wort von der Ruhe sprach, die hin ist, und dem Herzen, das schwer. Die Flickenschildt fehlte, nicht nur in Marthens Garten; sie hatte von vornherein abgesagt wegen Krankheit. Sonst war alles da, auch Werner Hinz, der sich mit Quadflieg abwechseln wird, auch Frau Büchi, ein braunäugiges Ersatzgretchen aus Zürich, die mich belehrte, daß selbst Beutler nicht nachgewiesen habe, Goethe habe seine erfolgreichste Frauengestalt blauäugig gewollt. Bitte.
Und vor allem natürlich war Gründgens da. Sein Mephisto ist längst in die Theatergeschichte eingegangen; er ist das Lebenswerk dieses einzigartigen Schauspielers. Die New Yorker haben es gewürdigt, so wie es vor ihnen die Moskauer taten. Alles darüber ist bekannt. Deshalb lieber ein Wort über Mephisto im Smoking.
Der Mann fluoresziert. Partys sind »just parties«, — bis er kommt. Es verbreitet sich im Nu Brillanz und federnde Spannung um ihn. Man braucht ihn gar nicht selbst zu sehen im Dunstkreis der Zigaretten. Wo sich Wirbel bilden, da steht er. Es ist wie im Fischteich, wenn ein fetter, pardon — ein delikater Happen reinfällt. Und so hält er das Champagnerglas bis gegen zwei, blitzt und blendet, bezaubert. Ein faszinierender Gesandter des deutschen Theaters.
Goethe? Wie buchstabieren Sie diesen Namen, fragt mich ein achtzehnjähriges Töchterchen deutsch-englischer Eltern, das in einem der besten Colleges des Landes ist. Nein, sie hätten von deutschen Dichtern auf der höheren Schule nichts gehört, ganz sicher nichts von »Guussie«. Ob ihr die Premiere gefallen habe? O doch, es erinnere sie an Shakespeare ...
»Wie buchstabieren Sie Ihren Namen« wurde auf demselben Empfang Hans Egon Holthusen gefragt, der neue Programmdirektor des neuen Goethe-Hauses. Und da es nicht ein junges Ding war, die das wissen wollte, sondern Mrs. Piscator, war Direktor Holthusen über die Frage begreiflicherweise nicht sehr entzückt. »Sie müssen schon entschuldigen«, sagte in wienerischem Amerikanisch die Dame, »ich bin zwar eine geborene Deutsche, aber deutsch spreche ich nur noch selten, und die neuere deutsche Literatur kommt nicht über den Atlantik. Mein Mann ist zwar drüben ...«
Im Goethe-Haus soll es Kunstausstellungen geben, Lesungen, Musik. Holthusen, urban und um Haupteslänge alle überragend, wird das gut machen. Und es sollte in der Tat gut gemacht werden; denn wenn die Amerikaner schon so viel Geld für die Rüstung aus Deutschland holen wollen, wie sie gerade erklärten, dann sollen sie ruhig ein bißchen Kultur draufbekommen. So gut wie ihr Walt Whitman ist unser Johann Wolfgang immer noch.
13. Februar
Warum sprechen die neuen Männer in Washington so wenig von Deutschland und Berlin — so wurde in den ersten Wochen der Kennedy-Regierung von deutscher Seite mit einer gewissen Nervosität gefragt. Nun wird in Washington plötzlich von den Deutschen geredet, aber absolut nicht in dem Sinne, den jene deutsche Nervosität verriet. Die Amerikaner wollen Geld von uns, mehr, als wir zu geben bereit sind. Seit es der Präsident selbst vor der Weltpresse ausgesprochen hat, beginnen viele Kommentatoren beiderseits des Atlantiks auf- und nachzurechnen, wie es mit den finanziellen und moralischen Bilanzen stehe.
Ich war selbst Ohrenzeuge, als Außenminister Dean Rusk vor wenigen Tagen noch sagte, die deutschen Besuche seien »premature«, verfrüht. Er war angesprochen worden auf die Tagung der Atlantik-Brücke und auf Brentano. Rusk aber fuhr lächelnd fort: »Nevertheless ...« und machte eine diplomatische Geste mit der rechten Hand. In der Tat erscheint der Besuch des deutschen Außenministers den Amerikanern im Zeichen der verknoteten Finanzverhandlungen nicht sehr willkommen. Kennedy war ungewöhnlich deutlich, indem er das Angebot Bonns als ungenügend bezeichnete, aber er sprach, indem er bekanntgab, er werde Brentano empfangen, von einem notwendigen Verständnis für speziell deutsche Wirtschaftsprobleme.
Diese Einsicht geht nicht zurück auf die Stipvisite eines anderen Bundesministers, der in diesem Jahre die Vereinigten Staaten besuchte. Franz Josef Strauß äußerte in New York vor wenigen Wochen, Deutschlands Lasten würden von den Amerikanern unterschätzt. Die außen- und wirtschaftspolitischen Mahnungen des deutschen Ministers für Verteidigung wurden damals in Deutschland beachtet, nicht aber bei denen, an die sie adressiert wurden. Die hiesigen Zeitungen brachten kaum eine Zeile über die Ausführungen Straußens vor einem privaten Kreis in New York. Brentanos Reise dagegen bekommt nun ein Gewicht, das er selbst ursprünglich sicher nicht beabsichtigte.
Der ebenfalls private »Aufhänger« der Brentanoreise ist ganz in den Hintergrund getreten. Der deutsche Außenminister wird sehr früh und sehr persönlich feststellen können, wie die neuen Männer hier über die deutsche Frage denken. Freilich wird vorerst nur eine deutsche Geldfrage auf dem Tisch liegen. Die Botschaft des Bundeskanzlers, die Brentano überbringen soll, mag dagegen anderes wollen. Hoffentlich verrät sie nichts mehr von jener Nervosität, die hier keinen guten Eindruck machte.
Kennedy hat am letzten Wochenende die drei Asse der amerikanischen Kremlkenner bei sich gehabt: Llewellyn Thompson, den aus Moskau beorderten Botschafter, Charles Bohlen und George Kennan, der aus einer Versenkung wieder auftauchte, in die ihn John Foster Dulles expediert hatte. Kennan, hinter dem die Russen ihre diplomatische Tür einst ausdrücklich zuschlugen, bekommt als der neue Botschafter der Vereinigten Staaten in Belgrad eine Art Hintertürklinke zum Sowjetimperium in die Hand. Kennedy hat allerdings gleichzeitig Dean Acheson mit einem wichtigen Sonderauftrag betraut: die Überprüfung der NATO. Der grimmige Dean hatte mit seinem Parteifreund Kennan einmal eine so radikale Kontroverse über die richtige Rußlandpolitik der Vereinigten Staaten, daß Acheson für Kennan seinem anderen Gegner Dulles zum Verwechseln ähnlich sehen mußte.
Die Frage nach »Kennedy und Deutschland« ist unter einem entscheidenden Aspekt die Frage nach Kennedy und Moskau. Die Ouvertüre hat gerade begonnen; niemand kennt das Finale. Die Berufung von einander so entgegengesetzten Mitarbeitern wie Acheson und Kennan besagt indessen schon einiges über die von Kennedy beabsichtigte Instrumentierung. Er wird operieren nach dem Prinzip des berechneten Risikos auf der Grundlage von Stärke und Vernunft, Festigkeit und Verhandlungsbereitschaft. In dieser Richtung ist das unausgesprochene Stillhalteabkommen zwischen Washington und Moskau über Berlin zu suchen. Derjenige, dem so etwas am meisten mißfallen muß, heißt Ulbricht. Wir sollten froh sein, wenn unsere Schwierigkeiten so lange ruhen, bis wir wieder stärker geworden sind. Jedermann wußte, aber niemand gab es so recht zu: das westliche Verteidigungsbündnis ist in einer Krise.
Kennedy hat es nun mit der kühlen Selbstverständlichkeit ausgesprochen, die sein Stil ist. Das eigenwilligste Glied in der NATO-Kette sind die Franzosen, die ganz offen nationale Sonderinteressen wie Algerien über ihre Bündnisverpflichtungen stellen. Das werden die Vereinigten Staaten nun nicht mehr unendlich lange hinnehmen. Dean Acheson ist ausersehen, die NATO zu kurieren. Dazu gehört ein gutes Verhältnis zu Westdeutschland. Die Amerikaner brauchen uns — wir brauchen sie sowieso. Kennedy handelt danach. Wir werden vergeblich auf Erklärungen von ihm warten, die die Russen reizen könnten. Wir werden ihn nüchtern Opfer von uns fordern sehen. Wir werden ihn hinter uns wissen, wenn es ernst wird.
15. Februar 1961
Können die Russen gleichzeitig Hammarskjöld stürzen und mit Kennedy reden wollen — das ist die Frage, die man sich heute in Washington stellt. Man blickt auch von hier aus nach New York, wo ein weiterer Akt des dramatischen Ringens um das Übergewicht im Rate der Vereinten Nationen beginnt.
Die unerhört scharfe Attacke der Russen gegen die Kongomaßnahmen der UN konfrontiert die Welt mit drei Fragen: Was wird aus dem Kongo selbst; was wird aus den Vereinten Nationen; was wird aus den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen?
Was die Russen am Kongo wollen, haben sie nun deutlich genug ausgesprochen. Mit der Forderung nach der Machtübernahme durch den prokommunistischen Lumumba-Mann Gizenga soll im Herzen Afrikas eine Art sowjetischer Satellit aufgebaut werden. Mit anderen Worten: die eben beendete Kolonialherrschaft der Belgier, die das ganze Unheil verursachte, soll eine neue Art kommunistischer Kolonialherrschaft werden. Was kann geschehen? Die Hoffnungen richten sich weiterhin auf Kongoaktionen der UN. Die Russen haben mit ihrem Vorstoß unter den Neutralen wenig Beifall gefunden. Die afrikanischen UN-Delegationen reagierten überwiegend zurückhaltend. Die Inder wollen von einer Beendigung der UN-Kongoaktion nichts wissen. Sogar die Jugoslawen würden heute vermutlich nicht unbedingt an der Seite der Russen stehen. Wie aber andrerseits eine wirksame Arbeit der UN-Beauftragten am Kongo möglich werden soll gegen die Obstruktion Moskaus, das ist die beunruhigende Frage für das betroffene afrikanische Gebiet selbst.
Moskaus zweiter Schuß auf den Generalsekretär der Vereinten Nationen trägt wiederum den kalten Krieg in die Verhandlungsräume des großen Glashauses am East-River in New York. Chruschtschows persönliches Auftreten dort im Herbst vorigen Jahres leitete eine Kampagne ein, deren Ziel es ist, den Rat der Vereinten Nationen zu einem Instrument der kommunistischen Weltrevolution zu machen. Lumumbas Tod gab nun den Vorwand her, diese Kampagne weiterzuführen. Dabei erscheinen die Russen nicht nur westlichen Beobachtern als recht zweifelhafte Ankläger in dieser Sache. Der Fall Lumumba ist ein verwerflicher politischer Mord. Aber wie viele verwerfliche politische Morde hat es in der Geschichte der kommunistischen Revolutionen, in der Geschichte der Sowjetunion gegeben? Die Welt ist nicht ganz so vergeßlich, wie die kommunistischen Gewaltpolitiker glauben. Ihr erster Vorstoß gegen Hammarskjöld und damit gegen die Institution der Vereinten Nationen scheiterte im vergangenen Jahr. Der Generalsekretär behielt in der Versammlung eine zuverlässige Mehrheit, Die Frage ist heute, ob die Sowjets das Instrument UN zerstören wollen, wenn sie es nicht in ihre Hand bekommen. Können sie das? Nicht formell, aber durch ihr Veto-Recht im Sicherheitsrat, durch ihr Gewicht als Großmacht können sie entscheidende Aktionen blockieren, sie sind in der Lage, dieser UNO, die gerade Zähne bekommen hatte, einen Maulkorb anzulegen.