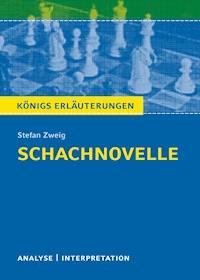7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bange, C., Verlag GmbH
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Königs Erläuterung zu Anne Frank: Tagebuch - Textanalyse und Interpretation mit ausführlicher Inhaltsangabe und Abituraufgaben. In einem Band bieten dir die neuen Königs Erläuterungen alles, was du zur Vorbereitung auf Referat, Klausur, Abitur oder Matura benötigst. Das spart dir lästiges Recherchieren und kostet weniger Zeit zur Vorbereitung. Alle wichtigen Infos zur Interpretation. - von der ausführlichen Inhaltsangabe über Aufbau, Personenkonstellation, Stil und Sprache bis zu Interpretationsansätzen - plus 4 Abituraufgaben mit Musterlösungen und 2 weitere zum kostenlosen Download ... sowohl kurz als auch ausführlich. - Die Schnellübersicht fasst alle wesentlichen Infos zu Werk und Autor und Analyse zusammen. - Die Kapitelzusammenfassungen zeigen dir das Wichtigste eines Kapitels im Überblick - ideal auch zum Wiederholen. ... und klar strukturiert. - Ein zweifarbiges Layout hilft dir Wesentliches einfacher und schneller zu erfassen. - Die Randspalte mit Schlüsselbegriffen ermöglichen dir eine bessere Orientierung. - Klar strukturierte Schaubilder verdeutlichen dir wichtige Sachverhalte auf einen Blick. ... mit vielen zusätzlichen Infos zum kostenlosen Download.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
KÖNIGS ERLÄUTERUNGEN
Band 410
Textanalyse und Interpretation zu
Anne Frank
TAGEBUCH
Walburga Freund-Spork
Alle erforderlichen Infos für Abitur, Matura, Klausur und Referat plus Musteraufgaben mit Lösungsansätzen
Zitierte Ausgaben: Anne Frank Tagebuch. Fassung von Otto H. Frank und Mirjam Pressler. Aus dem Niederländischen von Mirjam Pressler. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 16. Aufl. 2010.
Über die Autorin dieser Erläuterung: Walburga Freund-Spork, Studium der Germanistik und Geschichte an der Universität Münster. Realschullehrerin, Fachleiterin für das Fach Deutsch Sekundarstufe I, Mitautorin des Lehrplans Deutsch für die Sekundarstufe I (NRW), Referentin für Fort- und Weiterbildung bei der Bezirksregierung Detmold, stellv. Seminarleiterin am Studienseminar Sek. I in Paderborn. Literaturdidaktische Beiträge in den Zeitschriften Diskussion Deutsch, Praxis Deutsch, Blätter für den Deutschlehrer und Literatur für Leser, Untersuchungen zu Heinrich Heine, zu Novellen und Romanen der Gegenwart sowie zur modernen Essayistik in den Universitäts-Taschenbüchern und den Grabbe-Jahrbüchern, Autorin von Interpretationen und Lernhilfen namhafter Verlage.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52 a UrhG: Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.
2. Auflage 2014
ISBN 978-3-8044-6974-7
© 2009, 2012 by C. Bange Verlag, 96142 Hollfeld Alle Rechte vorbehalten! Titelbild: Anne Frank, © ullstein bild
Hinweise zur Bedienung
Inhaltsverzeichnis Das Inhaltsverzeichnis ist vollständig mit dem Inhalt dieses Buches verknüpft. Tippen Sie auf einen Eintrag und Sie gelangen zum entsprechenden Inhalt.
Fußnoten Fußnoten sind im Text in eckigen Klammern mit fortlaufender Nummerierung angegeben. Tippen Sie auf eine Fußnote und Sie gelangen zum entsprechenden Fußnotentext. Tippen Sie im aufgerufenen Fußnotentext auf die Ziffer zu Beginn der Zeile, und Sie gelangen wieder zum Ursprung. Sie können auch die Rücksprungfunktion Ihres ePub-Readers verwenden (sofern verfügbar).
Verknüpfungen zu Textstellen innerhalb des Textes (Querverweise) Querverweise, z. B. „s. S. 26 f.“, können durch Tippen auf den Verweis aufgerufen werden. Verwenden Sie die „Zurück“-Funktion Ihres ePub-Readers, um wieder zum Ursprung des Querverweises zu gelangen.
Verknüpfungen zu den Online-Aufgaben Im Abschnitt 6 „Prüfungsaufgaben“ finden Sie einen Hinweis zu zwei kostenlosen zusätzlichen Aufgaben. Diese Aufgaben können über die Webseite des Verlages aufgerufen werden. Tippen Sie auf die Verknüpfung und Sie werden direkt zu den Online-Aufgaben geführt. Dazu wird in den Web-Browser Ihres ePub-Readers gewechselt – sofern Ihr ePub-Reader eine Verbindung zum Internet unterstützt und über einen Web-Browser verfügt.
Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet werden durch eine Webadresse gekennzeichnet, z.B. www.wikipedia.de. Tippen Sie auf die Webadresse und Sie werden direkt zu der Internetseite geführt. Dazu wird in den Web-Browser Ihres ePub-Readers gewechselt – sofern Ihr ePub-Reader eine Verbindung zum Internet unterstützt und über einen Web-Browser verfügt. Hinweis:
INHALT
1. Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht
2. Anne Frank: Leben und Werk
2.1 Biografie
2.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Entwicklung bis 1933
Diskriminierung und Emigration
Der Weg in den Zweiten Weltkrieg
Judenverfolgung in den Niederlanden
Der Massenmord an den europäischen Juden
Anne Franks Tod in Bergen-Belsen
1945 und danach
2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken
3. Textanalyse und -Interpretation
3.1 Entstehung und Quellen
3.2 Inhaltsangabe
1. Teil: Vor dem „Untertauchen“; 12. 6.–5. 7. 1942
2. Teil: Umzug ins Versteck; 8. 7.–12. 7. 1942
3. Teil: Ankunft der van Daans, 14. 8.–12. 11. 1942
4. Teil: Der achte Untertaucher, van Dussel; 17. 11.–22. 12. 1942
5. Teil: Alltag im Hinterhaus, 13. 1.–30. 12. 1943
6. Teil: Anne verliebt sich, 2. 1.–6. 3. 1944
7. Teil: Anne und Peter, 7. 3.–7. 5. 1944
8. Teil: Endlich Hoffnung, 8. 5.–1. 8. 1944
3.3 Aufbau
Annes Verhältnis zu ihrer Familie
Der mühsame Alltag der Versteckten im Hinterhaus
Annes Verhältnis zu Peter van Daan
Annes Echo auf das Schicksal der Juden
Annes Echo auf den Kriegsverlauf
Urteile über die Helfer
3.4 Personenkonstellation und Charakteristiken
Die Familie Frank
Otto Frank,
Edith Frank,
Margot
Anne
Dr. Dussel
Die Familie van Daan
Kitty
3.5 Sachliche und sprachliche Erläuterungen
3.6 Stil und Sprache
3.7 Interpretationsansätze
4. Rezeptionsgeschichte
Erstausgabe
Die Hackett-Dramatisierung
Die Verfilmung von 1959
Kritik
Weitere Verfilmungen
Aufführung des Thalia-Theaters Hamburg
Wirkungsweise Anne Franks
5. Materialien
Die Helfer
Verrat und Verschleppung
Wir haben nichts gewusst?
Die wahre Pflicht
6. Prüfungsaufgaben mit Musterlösungen
Aufgabe 1 *
Aufgabe 2 **
Aufgabe 3 ***
Aufgabe 4 **
Literatur
Zitierte Ausgabe
Weitere Textausgabe
Lexikonartikel
Biografien
Weitere benutzte Literatur
Verfilmung
Internet-Adressen
Damit sich jeder Leser in dem vorliegenden Band rasch zurechtfindet und das für ihn Interessante gleich entdeckt, hier eine Übersicht.
Im 2. Kapitel beschreiben wir Anne Franks Leben und stellen den zeitgeschichtlichen Hintergrund dar:
Anne Frank lebt von 1929 bis 1945, sie stirbt im KZ Bergen Belsen im Alter von 16 Jahren an Flecktyphus.
Das jüdische Mädchen erhält im Juni 1942 ein Tagebuch geschenkt; kurz darauf muss sich ihre Familie in Amsterdam vor den Nazis verstecken, die seit 1940 die Niederlande besetzt halten und alle Juden in die Konzentrationslager in Polen deportieren.
Bis zur Entdeckung der Familie im August 1944 hält Anne im Tagebuch das Leben der verfolgten Familie in ihrem Versteck fest.
Im 3. Kapitel bieten wir eine Textanalyse und -interpretation.
Das Tagebuch der Anne Frank – Entstehung und Quellen:
Anne Franks Tagebuch entstand zwischen dem 12. Juni 1942 und dem 1. August 1944. Im März 1944 begann Anne Frank eine Überarbeitung ihrer Eintragungen (Version b). Insgesamt werden drei Fassungen (Version a, b und c) unterschieden, bei Version c handelt es sich um eine für die Rezeption maßgebende Mischfassung aus den Versionen a und b. Die aktuelle Taschenbuchausgabe (zitierte Ausgabe) ist eine erweiterte Fassung von Version c.
Inhalt:
Anne Frank erhält im Juni 1942 zu ihrem 13. Geburtstag ein Tagebuch geschenkt. Annes Eltern sind aus Deutschland in die Niederlande emigrierte Juden; inzwischen ist ihr Fluchtland allerdings von der Wehrmacht besetzt. Um den anlaufenden Deportationen zu entgehen, fassen Annes Eltern den Entschluss, sich auf unbestimmte Zeit zu verstecken, da sie davon ausgehen müssen, dass sie in den Konzentrationslagern der Nazis der Tod erwartet. Im Juli 1942 erfolgt der Umzug in das ungenutzte Hinterhaus der ehemaligen Firma des Vaters in Amsterdam; vor die Zugangstür wird ein drehbarer Schrank aufgestellt. Fortan lebt die vierköpfige Familie Frank (mit den beiden Töchtern Anne und Margot) zusammen mit der Familie van Daan (ein Sohn, Peter) und einige Monate später noch einem achten Untertaucher, dem Zahnarzt Dr. Dussel, im Hinterhaus. Eine kleine Gruppe von Helfern versorgt die Untergetauchten. Nur abends und am Wochenende, wenn die Angestellten und Arbeiter gegangen sind, können sie die Räume des Vorderhauses betreten. Anne erzählt vom Alltag auf engstem Raum, der ständigen Angst vor Entdeckung; es kommt immer wieder zu Spannungen, Konflikten und Streitereien; mehrmals wird ins Vorderhaus eingebrochen. Anfang 1944 verliebt sich Anne in den zwei Jahre älteren Peter van Daan. Die Invasion der Alliierten in der Normandie lässt die Hoffnung keimen, dass die Zeit im Versteck bald vorüber sein wird. Das Tagebuch endet am 1. August 1944, drei Tage später wurden die Untergetauchten verhaftet, da sie von einer bis heute unbekannten Person verraten wurden.
Chronologie und Schauplätze:
Anne Franks Tagebucheinträge reichen vom 12. Juni 1942 bis zum 1. August 1944. Abgesehen von den ersten, noch in Freiheit entstandenen Einträgen, ist der Schauplatz das Hinterhaus Prinsengracht 263 in dem von den Deutschen besetzten Amsterdam.
Aufbau:
Wie für die Gattung des Tagebuchs typisch, folgt Anne Franks Tagebuch keinem geplanten ästhetischen Aufbau. Möglich ist aber eine Unterteilung der Einträge, die sich an Veränderungen der äußeren oder inneren Lebensumstände Annes orientiert. Außerdem lassen sich wiederkehrende Aspekte bzw. Themenkreise feststellen (z. B. Annes Verhältnis zu ihrer Familie, der Alltag im Hinterhaus, Unvorsichtigkeiten, Annes Verhältnis zu Peter van Daan).
Personen:
Die Konstellation der Hinterhausbewohner ist geprägt von ihrer Familienzugehörigkeit:
Familie Frank: die Eltern Otto und Edith sowie ihre Töchter Margot und Anne
Familie van Daan (eigentl. van Pels): die Eltern Hans (eigentlich Hermann) und Petronella (eigentlich Auguste) sowie ihr Sohn Peter
Dazu kommt noch als Außenseiter Albert Dussel (eigentl. Fritz Pfeffer).
Des Weiteren gibt es noch die Helfer, die den Kontakt zur Außenwelt aufrechterhalten (Miep und Jan Gies, Kugler, Kleiman und Bep Voskuijl), den Lagerarbeiter van Maaren, der sich durch seine Neugier verdächtig macht, sowie „Kitty“, Annes fiktive beste Freundin und Adressatin ihrer Tagebuchbriefe.
Stil und Sprache:
Anne Franks Tagebuch ist dialogisch angelegt (an „Kitty“ gerichtet). Auffallend ist die Entwicklung von einer naiven, spontan erzählenden Schreiberin zu Beginn hin zu einer bewussten, konzentriert das Wesentliche erfassenden Gestalterin. Typisch für sie sind:
Ironie
drastische Wendungen
anschauliche Bildsprache
pointierte Situationserfassung
witzige Wortschöpfungen und Sprachkreationen
rhetorische Fragen
Interpretationsansätze:
Die Interpretationsansätze formulieren wünschenswerte Einsichten, die in der Auseinandersetzung mit dem Tagebuchtext für die Gegenwart und Zukunft der jungen Leser gewonnen werden sollten. So gibt das Tagebuch Anstoß zur motivierten Beschäftigung mit Fragen wie: Wie konnte die menschenverachtende, antisemitische Ideologie der Nazis eine so große Zustimmung in der deutschen Bevölkerung finden? Oder: Was sagen heutige Beispiele von Fremdenfeindlichkeit, Hass, Intoleranz und Neonazismus über unsere Gegenwart aus?
Anne Frank als Zwölfjährige 1929–1945© ullstein bild – ADN-Bildarchiv
JAHR
ORT
EREIGNIS
ALTER
1929
Frankfurt/Main
Anne Frank wird am 12. Juni als zweites Kind von Otto Frank und seiner Ehefrau Edith Holländer aus Aachen geboren. Sie erhält den Namen Annelies Marie. Otto Frank ist der Sohn eines jüdischen Bankiers aus Frankfurt. Er hatte dort am Lessinggymnasium 1908 Abitur gemacht, in Heidelberg ein Studium begonnen, das er aber nach kurzer Zeit abbrach. Er verbrachte danach Jahre in einer New Yorker Firma, ehe er 1915 nach Frankfurt zurückkehrte. Er meldete sich zum Militär und nahm an der Panzerschlacht bei Cambrai (Westfront) teil. Danach wurde er zum Offiziersanwärter vorgeschlagen. Er quittierte 1918 bei Kriegsende den Militärdienst als Leutnant.
1933
Frankfurt/Main Amsterdam
Vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse in Deutschland – Hitler wird zum Reichskanzler ernannt, die antisemitischen Tendenzen nehmen erheblich zu –, gründet Otto Frank die Firma „Opekta-Werke“ in Amsterdam, mit dem Ziel, sich und seiner Familie eine Existenzgrundlage in den Niederlanden zu sichern. Er bereitet so die Emigration aus Deutschland vor.
4
Amsterdam
Sommer: Die Familie siedelt nach Amsterdam um und nimmt eine Wohnung am Merwedeplein, Amsterdam-Zuid. Unmittelbarer Anlass ist das von den Nazis erlassene Gesetz, wonach jüdische und nichtjüdische Kinder getrennte Schulen besuchen müssen. Dies betrifft Margot, Annes Schwester, die als erstes Kind des Ehepaars Frank 1926 in Frankfurt geboren ist.
Aachen
Nach dem Umzug bleibt Anne zunächst noch bei ihrer Großmutter in Aachen.
1934
Amsterdam
Februar: Anne kommt als letztes Familienmitglied nach Amsterdam. Im Tagebuch erwähnt sie den Aufenthalt bei ihrer Großmutter als äußerst positiv.
5
1935
Amsterdam
Anne tritt in die Montessori-Schule in Amsterdam ein, die sie bis 1941 besucht.
6
1940
Amsterdam
1. Dezember: Otto Frank mietet das Gebäude Prinsengracht 263 und verlegt die Geschäfts- und Lagerräume dorthin.
11
1941
Amsterdam
Anne tritt in das jüdische Lyzeum ein, dessen Schülerin sie bis zum Umzug in das Versteck Prinsengracht 263 bleibt.
Gegen Jahresende: Otto Frank scheidet aus seiner Firma aus. Sein Geschäftsfreund Kugler wird als Nachfolger in das holländische Handelsregister eingetragen. Sein holländischer Freund Kleiman leitet die Geschäfte vor Ort.
12
1942
Amsterdam
12. Juni: Anne bekommt zu ihrem 13. Geburtstag ein Tagebuch geschenkt, sie beginnt sofort mit den ersten Eintragungen.
5. Juli: Margot erreicht die Aufforderung, sich in einer Auffangstelle für Juden für den Abtransport in das Arbeitslager Westerbork zu stellen.
6. Juli: Die Familie Frank taucht im Hinterhaus Prinsengracht 263 unter.
13. Juli: Die Familie van Pels (im Tagebuch van Daan) zieht ebenfalls in das Versteck im Hinterhaus. Die van Pels’ sind 1937 auf Grund der Judenverfolgung von Osnabrück nach Amsterdam geflohen. Hermann van Pels war Leiter einer Gewürzhandelsfirma, die mit den Opekta-Werken zusammengeschlossen war (Pomesin-Opekta-Werke). Er hatte sein Büro ebenfalls in der Prinsengracht 263.
16. November: Fritz Pfeffer (im Tagebuch Dussel) wird als achte Person ins Versteck aufgenommen. Anne muss fortan das Zimmer mit ihm teilen.
13
1942–1944
Amsterdam
Juli 1942–August 1944: Anne macht Einträge in ihr Tagebuch. Sie lernt Stenografie, Sprachen (Englisch, Französisch), Algebra, beschäftigt sich mit Literatur und Geschichte, stellt genealogische Tafeln vor dem Hintergrund ihrer Lektüre von Geschichtswerken auf. Sie erwartet aber auch jede Woche mit großer Spannung die Illustrierte „Cinema und Theater“, die ihr ein Mitarbeiter der Firma regelmäßig mitbringt. Ihr entnimmt sie den Bildschmuck neben ihrem Bett.
13–15
1944
Amsterdam
4. August: Die Untergetauchten werden auf Grund von Verrat entdeckt und verhaftet. Sie werden ins „Judendurchgangslager“ nach Westerbork bei Assen gebracht und dort zur Zwangsarbeit verpflichtet.
Miep Gies nimmt nach dem Abtransport die Tagebücher und Papiere, die von der Gestapo bei der Festnahme der Hinterhausbewohner auf dem Boden ausgeschüttet worden sind, in Verwahr.
15
WesterborkKZ Auschwitz
3. September: Die Hinterhausbewohner werden mit dem letzten von Westerbork nach Auschwitz abgehenden Zug ins Konzentrationslager abtransportiert. Wenige Wochen später stirbt Hermann van Pels (van Daan) in der Gaskammer.
KZ Bergen-Belsen
Oktober: Margot und Anne werden ins Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide verschleppt.
KZ Neuengamme
20. Dezember: Fritz Pfeffer (Dussel) kommt um.
1945
KZ Auschwitz
6. Januar: Edith Frank stirbt.
27. Januar: Otto Frank kommt bei der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee frei. Über Odessa am Schwarzen Meer und Marseille erreicht er am 3. Juni 1945 wieder Amsterdam.
15
März
KZ Bergen-Belsen
März: Margot und Anne sterben vermutlich an Flecktyphus als Folge von katastrophalen hygienischen Zuständen.
KZ Theresienstadt (?)
Frühjahr: Frau van Pels (van Daan) stirbt.
15
KZ Mauthausen
5. Mai: Peter van Pels (van Daan) stirbt.
Amsterdam
Anfang August: Miep Gies übergibt Otto Frank die Aufzeichnungen und Tagebücher seiner Tochter Anne.
1947
Niederlande
Die erste Ausgabe der Tagebücher, bearbeitet von Otto Frank, erscheint unter dem Titel Het Achterhuis.
1949
Amsterdam
Otto Frank erhält die niederländische Staatsbürgerschaft.
1950
Deutschland
In der Übersetzung von Anneliese Schütz erscheint in Deutschland Das Tagebuch der Anne Frank.
1952
Basel
Otto Frank zieht nach Basel um.
1953
November: Otto Frank heiratet Elfriede Geiringer (geb. Markovits), eine aus Wien nach Amsterdam emigrierte Jüdin, die mit ihrer Familie in der Nähe der Franks am Merwedeplein gewohnt und die Anne flüchtig gekannt hat. Ihr Mann und Sohn sind ebenfalls im KZ umgekommen. Sie ist Otto Frank im Zug nach Odessa zufällig begegnet.
1957
Frankfurt
12. Juli 1957: Eugen Kogon[1] hält anlässlich des Geburtstags Anne Franks eine Rede in der Paulskirche in Frankfurt. Anschließend wird eine Gedenktafel am ehemaligen Wohnhaus in Frankfurt, Ganghofer Str. 24, angebracht.
1980
Birsfelden/ Schweiz
19. August: Otto Frank stirbt im Alter von 91 Jahren. Er hat die handgeschriebenen Tagebuchaufzeichnungen testamentarisch dem Niederländischen Staatlichen Institut für Kriegsdokumentationen vermacht.
1986
Niederlande
Die Kritische Edition von Anne Franks Tagebuch erscheint.[2]
1992
Deutschland
In Deutschland kommt die erweiterte Neuausgabe des Tagebuchs in der Übersetzung von Mirjam Pressler auf den Markt.
2001
Deutschland
Die Taschenbuchausgabe mit den bisher unveröffentlichten Seiten erscheint.
ZUSAMMENFASSUNG
Das Tagebuch der Anne Frank ist vor dem Hintergrund von Nationalsozialismus, Zweitem Weltkrieg und Holocaust zu lesen. Nach seiner Ernennung zum Reichkanzler 1933 ließ sich Hitler mit dem sogenannten „Ermächtigungsgesetz“ die gesamte Staatsgewalt übertragen und schaltete somit das Parlament aus. Von nun an wurden im nationalsozialistischen Deutschland die jüdischen Mitbürger Zug um Zug aus dem wirtschaftlichen und kulturellen Leben ausgeschlossen. Immer neue diskriminierende Gesetze erschwerten ihnen die Teilhabe am normalen bürgerlichen Leben. Das Ziel der Nationalsozialisten war eine „Säuberung“ des deutschen Volkes (später ganz Europas) von der jüdischen Rasse, zunächst durch Auswanderung unter Zurücklassung der Vermögen, später durch systematische Verfolgung, Deportation und Ermordung in Konzentrationslagern. Das Schicksal Anne Franks steht beispielhaft für die Ermordung von 6 Millionen Juden aus vielen Ländern Europas.
Entwicklung bis 1933
Als Anne Frank 1929 zur Welt kam, hatte ihre Familie aufgrund der geschichtlichen Bedingungen im Deutschland der Weimarer Republik (1919–1933) eine Reihe wirtschaftlich negativer Erfahrungen machen müssen. Das von ihrem Großvater Michael Frank 1889 in Frankfurt am Main gegründete und schnell erfolgreiche Bankgeschäft, das sich vornehmlich auf den Devisenhandel stützte, ermöglichte rasch auch die Beteiligung an anderen Firmen, so dass sich die liberal-jüdische Familie Frank zu den wohlhabenden Bürgern Frankfurts rechnen konnte. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg (1914–1918) wendete sich aber das Blatt. Im Frieden von Versailles 1918 musste Deutschland die Kriegsschuld auf sich nehmen und sich bereit erklären, die Kriegsschulden, die den alliierten Verbündeten, vor allem Frankreich, entstanden waren, zu übernehmen und sukzessive durch Wiedergutmachungszahlungen, die sogenannten Reparationen, zu tilgen. Dies brachte die junge Weimarer Republik in große wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten. So geriet auch die Frank’sche Bank in Liquidationsschwierigkeiten. Die dem Kaiserreich gewährten Kriegsanleihen gingen verloren, Rückerstattungen gab es nicht. Hinzu kam, dass Deutschland keinen Devisenhandel betreiben durfte, folglich auch das Hauptgeschäft der Frank’schen Bank wegfiel. Darüber hinaus brachten einschränkende Bestimmungen der Siegermächte den Geldhandel fast vollständig zum Erliegen.
Ab 1924 versuchte Otto Frank, Annes Vater, der als Liquidator der Bank eingesetzt worden war, durch Rückzahlung der Schulden an die Gläubiger den Konkurs abzuwenden. Eine „saubere“ Abwicklung durch Entschädigung der Gläubiger war 1929 erreicht.
Während dieser Zeit hatte Otto Frank eine Bankniederlassung in Amsterdam