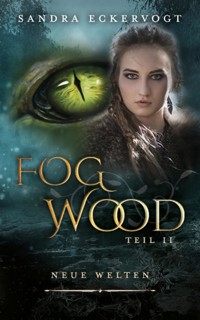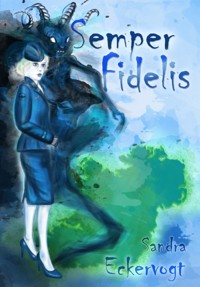2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Vanity wird für ihren nächsten Auftrag per Zeitmaschine in das Jahr 1818 nach Irland geschickt. In der Stadt Tara soll sie einen Professor des MI6 suchen, der die geheimen Pläne der Maschine bei sich trägt.
Die Organisation WICK.ED ist ebenfalls hinter den Aufzeichnungen her und befindet sich bereits in der Vergangenheit.
Vanity nimmt den Platz von Lady Marion ein, die ihr zum Verwechseln ähnelt, und macht Bekanntschaft mit dem neuen Stadtherrn Adrian Beckett.
Als ihr Vater in Tara auftaucht und der Besitzer des Seeschlosses, Lord Thomas Cylemore, haargenau wie Tom Fear aussieht, ist das Chaos perfekt.
Vanity muss nicht nur den Professor suchen, sondern herausfinden, wer hier im 19. Jahrhundert eine Show abzieht, um an die wichtigen Pläne zu gelangen.
Wie lange kann Vanity ihre eigene Tarnung aufrechterhalten?
Kommt der Stadtherr Adrian Beckett aus der Zukunft?
Kann Vanity der Nähe von Lord Thomas Cylemore widerstehen?
Und was hat ihr Vater hier eigentlich verloren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tara 1818
Das fünfte Abenteuer
Dieses Buch widme ich Chris, Alex und Ulf aus Berlin! Diese töften Jungs stehen mir und meiner Schreiberei seit Jahren zur Seite. Sie motivieren mich, diesen Traum vom Schreiben nicht aufzugeben. Ihr seid super, Freunde! Vielen, vielen Dank dafür, ich hab euch lieb! SandraBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTara 1818
Tara 1818
Das fünfte Abenteuer von Jamie Lee
Sandra Eckervogt
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten! Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Autors/Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden, wie zum Beispiel manuell oder mithilfe elektronischer und mechanischer Systeme inklusive Fotokopien, Bandaufzeichnungen und Datenspeicherung. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt. Die Personen und Handlung des Buches sind vom Autor frei erfunden.
©2020 Sandra Eckervogt
Prolog
Cylemore Rock Castle – 1818
Die Abendsonne tauchte den Himmel in wunderschöne, zarte Pastelltöne. Vereinzelt zogen Wolken am Horizont entlang. Möwen flogen tief über die Wasseroberfläche auf der Suche nach Nahrung. Die See war ruhig, auslaufende Wellen plätscherten leise an die Küste. Wie schwere Steine lagen die Riffe in dem endlos wirkenden Blau.
Thomas James Cylemore stand am Ende der Klippe und starrte seit geraumer Zeit auf das Meer. Seine grünen Augen schimmerten feucht und schwere, tiefe Schatten lagen unter ihnen. Sein Herz drohte vor Kummer und Schmerz zu zerbrechen. Vor fast sechs Monaten war seine geliebte Ehefrau Mary an der Schwindsucht verstorben.
Er würde den Anblick nie vergessen. Jedes Mal, wenn sie husten musste, hatte sie Blut gespuckt, und nach sechs Monaten war ihr Leben vorbei. Sie war in seinen Armen gestorben.
Das Leben, jeder einzelne Tag ohne sie war wie die Hölle auf Erden. Sein Lebensmut war mit ihr fortgegangen. Sein Glauben an Gott? Verloren.
Die verdammte Schwindsucht wütete seit Monaten in dieser Gegend und kaum jemand hatte eine Chance, diesem Teufelszeug zu entkommen. Im 16. Jahrhundert ist diese Krankheit schon einmal sehr präsent gewesen und hatte Tausenden von Menschen das Leben gekostet.
Hinzu kam, dass seit einigen Wochen ein neuer Lord über Tara herrschte. Man nannte ihn den dunklen Lord. Sein Name war Adrian Beckett. Manche Herrschaften sagten, er habe den alten Lord Arne O’Connor einfach ermordet. Doch niemand konnte ihm das beweisen.
Viele Bewohner in Tara und in der näheren Umgebung starben. Ob jung oder alt, ob Mann, Frau oder Kind, die Krankheit holte sich jeden.
Aber das war Thomas James egal. Er trauerte um seine geliebte Ehefrau. Und er wollte ihr heute Abend in das himmlische Paradies folgen. Er musste husten und hielt sich ein Taschentuch vor die Lippen. Es war voller Blut. Ihn hatte die Teufelskrankheit ebenfalls heimgesucht, doch er würde es nie zulassen, so elendig zu sterben, sich so lange zu quälen wie seine geliebte Mary.
Von einer Kräuterhexe hatte er ein pflanzliches Gift erhalten. Er musste es nur in ein Getränk mischen und kurze Zeit später würde er sterben.
Ein letztes Mal nahm er die Schönheit dieses Anblicks in sich auf. Morgen würde er nicht mehr hier sein.
Als er sich umdrehte und das Meer nicht mehr sah, erfüllte ihn seltsamerweise ein Gefühl von Glück, denn heute Abend würde er sterben, um mit seiner Frau Mary weiterleben zu können.
Der Speisesaal war durch viele Kerzen erleuchtet, die ihre Wachsspuren auf dem großen Holztisch hinterließen und auf den kalten Fliesen.
Thomas stach gedankenverloren im Essen herum. Seine Schwester Eva Jane saß ihm gegenüber und ihr entgingen die schweren schwarzen Schatten unter seinen Augen nicht. Ja, es ist ein tiefer Schicksalsschlag gewesen, als vor fast sechs Monaten seine Frau verstorben war. Aber auch sie hatte vor Wochen einen schmerzhaften Verlust erlitten, denn ihr Mann Paul Garden wurde von einem Räuber der Wood Gang getötet. Ihm wurden all seine Papiere und das Geld, das er bei sich trug, gestohlen. Kurz nach der Beerdigung war sie zu ihrem Bruder gezogen und lebte nun mit ihm und einigen Dienstboten in dem schönen Seeschloss Cylemore Rock Castle.
Eva Jane hatte gehofft, wenn sie zu ihrem Bruder zog, könnten sich beide gegenseitig Trost spenden, doch während sie langsam über die Trauer hinwegkam, hatte sie den Verdacht, dass es bei Thomas von Tag zu Tag schlimmer wurde.
Jeden Tag ging er zur Küste und blieb stundenlang dort. Sie hatte Angst, dass er eines Tages springen würde.
Eva Jane räusperte sich und lächelte zu ihm hinüber „Der Pastor hat mir gestern Abend nach der Messe erzählt, dass eine gewisse Marion Boyed vielleicht ein Mittel gegen die Schwindsucht hat.“
Es zuckte verächtlich um seine Mundwinkel und die Gabel stach weiter ziellos auf das Essen ein. „Der Pastor glaubt nicht an die Medizin. In den Augen der Kirche sind alle Menschen, die eine Gabe für Krankheiten haben, doch Ketzer und Hexen!“, gab er wütend von sich.
„Nein, Pastor Collin glaubt an die Medizin. Er hat es mir selbst gesagt und ich soll es niemandem erzählen“, versicherte sie ihm leise, damit die Dienerschaft es nicht hören konnte.
Er warf die Gabel achtlos auf den Tisch, worauf Eva Jane entsetzt zurückwich. „Hör auf! Er will dich nur aushorchen, ob du ebenfalls zu dieser Kräuterhexe gehst!“
Eva Jane holte tief Luft und tupfte sich mit der Serviette die Lippen ab. „Es tut mir leid, Thomas James. Ich weiß, wie hart es für dich ist, dass Mary nicht mehr unter uns weilt, aber du darfst die Augen nicht verschließen und die Hoffnung nicht aufgeben! Wenn diese gewisse Marion Boyed wirklich ein Heilmittel gegen diese Krankheit hat, dann haben Tausende von anderen Menschen eine Chance!“
Thomas stand so abrupt auf, dass der Stuhl hinter ihm laut auf die Fliesen aufschlug. Seine sonst so klaren, wunderschönen grünen Augen schimmerten feucht und funkelten voller Hass. „Ich will nicht, dass tausend andere Menschen eine Chance bekommen, sondern diese Chance hätte meine Mary verdient und die Hilfe kommt zu spät.“
„Ja, es ist schrecklich, dass Mary so qualvoll sterben musste. Aber auch ich habe meinen Mann durch die Bestien der Wood Gang verloren. Anstatt in Selbstmitleid zu versinken, solltest du lieber die armen Kinder retten. Mary hätte nicht gewollt, dass du so erbärmlich weiterlebst. Und sie fand die Idee gut, die Waisenkinder am Wochenende hier auf Cylemore Rock Castle zu betreuen und das Waisenhaus zu renovieren“, brauste sie auf.
Thomas kämpfte mit seiner Beherrschung, mit seinen Gefühlen. Er hatte sich entschieden und davon wich er nicht zurück. „Ich habe dir mehrfach gesagt, dass ich noch nicht bereit bin, diesen Wunsch von Mary zu erfüllen.“ Das Brennen in seiner Lunge wurde stärker, er spürte, wie der Husten an die Oberfläche stürmen wollte, um wieder ein Stück seines jungen Lebens zu rauben. Doch heute Nacht würde er das Monster in sich töten.
„Nicht bereit? Mary ist seit einem halben Jahr tot. Und wenn du nicht bald handelst, werden auch die Kinder sterben!“ Eva Jane war wütend.
Thomas hustete und stützte sich auf dem Tisch ab. Er bekam kaum Luft, so hart überfiel ihn die Welle des Schmerzes. Er hielt sich ein Taschentuch vor den Mund, seine Schwester durfte auf keinen Fall sehen, dass auch er von dem Teufel besessen war.
Eva Jane stand auf und ging um den langen Tisch herum. „Thomas … du musst zum Arzt“, sprach sie jetzt mit ihrer lieblichen, besorgten Stimme zu ihm.
Ihr Bruder wehrte ihre Berührungen ab und wandte sich von ihr. „Schon gut, ich habe mich nur erkältet. Ich geh zu Bett.“
Eva Jane ließ verzweifelt die Arme sinken und blickte ihrem Bruder besorgt hinterher.
Thomas drehte sich, als er an der großen, schweren Holztür stand, zu ihr um. Ein zaghaftes Lächeln huschte um seine Mundwinkel. „Alles wird gut, ich liebe dich, Schwesterherz. Gute Nacht.“
Dann verschwand er und Eva Jane spürte, dass irgendetwas geschehen würde, dass sie ihren geliebten Bruder nie wieder sehen würde. Die grausame Vorstellung raubte ihr für einen Augenblick die Luft zum Atmen und sie fühlte sich völlig hilflos. Das Einzige, was ihr jetzt noch blieb, war beten.
Thomas James holte die kleine Flasche aus seinem Versteck und betrachtete sie einige Minuten. Vor ihm stand ein Kelch mit dem Lieblingswein von Mary. Dieser edle Tropfen ist vor zwei Jahren ihr Hochzeitswein gewesen und war den Gästen gereicht worden.
Thomas holte tief Luft, zog den Korken aus der Flasche, ein leises Plopp ertönte und er schüttete den ganzen Inhalt in den Kelch. Er sah Mary genau vor sich, wie schön sie in dem Brautkleid ausgesehen hatte, wie schön der Tag für beide gewesen ist.
Viele Freunde waren zu dieser Feierlichkeit angereist, und einige waren ebenfalls durch die verfluchte Schwindsucht dahingerafft. Genau wie Mary.
Die beiden hatten sich Kinder gewünscht, doch nachdem Mary drei Fehlgeburten überstanden hatte, riet ihr ein Arzt von weiteren Schwangerschaften ab.
Daraufhin besuchte Mary das heruntergekommene Waisenhaus in Tara und plötzlich verankerte sich bei ihr die Idee, dass aus Cylemore Rock Castle ein Zufluchtsort für arme Kinder werden sollte, die das Wochenende am See und am Meer verbringen könnten. Und das Waisenhaus wollte sie auf jeden Fall renovieren lassen.
Thomas hob den Kelch und allein bei diesen Erinnerungen setzte sein Herz für einen kleinen Moment aus. Sein Atem ging schwer, denn er spürte den nächsten Wirbelsturm auf seiner Lunge.
Nein, er hatte keine Hoffnung, keinen Lebenswillen mehr in sich. Seine Hand begann zu zittern, je näher er den Kelch an seinen Mund führte. Tat er wirklich das Richtige? Oder war er feige? Hatte seine Schwester Eva Jane recht und er durfte die Hoffnung nicht aufgeben?
Nein, nein … er hatte nur einen Wunsch und dieser lautete: dass er bei seiner geliebten Mary sein wollte.
Thomas schüttelte sachte den Kopf, um wieder klar denken zu können, und konzentrierte sich auf den Kelch. Er nahm einen Schluck und sofort setzte der Hustenreiz ein. Diesmal traf ihn dieser Reiz so stark, dass er fast die Hälfte aus dem Kelch verschüttete. Er schaffte es gerade noch rechtzeitig und stellte ihn auf den Tisch ab. Dann hielt er sich die Hand vor den Mund und sackte unter Schmerzen zu Boden. Sein Blut klebte schleimig an seinen schlanken Fingern und er weinte, er weinte um Mary, um sein Leben, er weinte vor Wut. Sein Körper bebte unter den schweren Tränen.
Reiß dich zusammen, du hast es ihr geschworen, du musst das Gift trinken …
Thomas wischte sich das Blut vom Mund und stand auf. Er griff sich den Kelch, in dem noch genügend Wein enthalten war, und kippte den Inhalt in einem Zug hinunter. Dann warf er den Kelch fort. Dieser polterte blechern über die Fliesen und blieb in einer dunklen Ecke liegen.
Der Rotwein lief durch seine Speiseröhre und er spürte, wie er in seinem Magen ankam. Eine angenehme Wärme durchströmte ihn. Er verspürte Leichtigkeit und Frieden. Mary, bald bin ich bei dir … hab Geduld.
Thomas zündete eine Kerze auf dem Nachttisch an und legte sich in seiner Kleidung auf das Bett.
Zischende Geräusche erklangen von draußen und Blitze erhellten sein Zimmer. Kündigte sich ein schweres Gewitter an? Im nächsten Moment sprang die Balkontür auf. Die weißen Vorhänge wehten wild im Wind umher.
Die Kerze erlosch und dessen Rauch wehte zu ihm herüber. Trat nicht gerade eine Person in sein Zimmer? Wirkte das Gift so schnell? Halluzinierte er schon?
„Mary?“, hauchte er leicht ängstlich und gleichzeitig hoffnungsvoll. Oder holte ihn der Teufel höchstpersönlich ab?
1. Kapitel
Irgendwo in New York – Gegenwart
Oh Mann, war das langweilig.
Bobby Smith schlug die Rätselzeitung zu und warf sie zur Seite. Seine braunen Augen überprüften die drei Monitore.
Wie immer.
Nur ein Flur, der sich im dreißigsten Stockwerk befand.
Nur zwei Fahrstühle.
Und wie immer?
Nichts.
Bobby seufzte.
Zum Glück wurde dieser Job sehr gut bezahlt. In fast fünf Monaten war Weihnachten und er konnte das Geld gut gebrauchen. Ein neues Auto stand schon seit geraumer Zeit auf seinem Wunschzettel, denn sein alter Ford gab langsam, aber sicher den Geist auf.
Er wusste noch nicht mal, was er hier bewachte, geschweige denn, für wen er hier Wache schob. Es kam niemand, es ging niemand, niemand rief an oder brachte etwas. Komischer Job. Er durfte keine Fragen stellen, das war die Voraussetzung, und diese Voraussetzung wurde sehr gut bezahlt. Andere Kollegen hatte er bis jetzt ebenfalls nie zu Gesicht bekommen. Aber was juckte es ihn, was hier in diesem langweiligen Gebäude gearbeitet wurde oder eben auch nicht.
Bobby lehnte sich in seinem gemütlichen Ledersessel zurück und warf noch einmal einen prüfenden Blick auf die Monitore.
Nichts.
Er schnappte sich wieder das Rätselheft und hatte gerade den Kugelschreiber in der Hand, als er ein Geräusch vernahm, das er noch nie in seiner Schicht vernommen hatte.
Autotüren schlugen zu.
Direkt vor dem Gebäude.
Bobby stutzte und blickte über die Theke auf die eigentlich leere Straße. Er sah zwei schwarze, verspiegelte Wagen. In der nächsten Sekunde knallte es und die gläserne Eingangstür zersplitterte und tatsächlich traf ihn eine Scherbe mitten an der Stirn. Er verzog schmerzerfüllt das Gesicht. Bobby stand abrupt von seinem bequemen Ledersessel auf. „Wer sind Sie?“ Er erhielt keine Antwort und die Männer vor ihm trugen altertümliche Kleidung. Was? Was war denn hier los?
„Wo ist das Labor von Dr. Cooper, bitte“, erklang eine tiefe Männerstimme.
„Von wem?“, krächzte Bobby und fasste sich an die Wunde.
Der Mann lehnte sich auf die Theke. Er hatte leicht gelocktes Haar, einen Drei-Tage-Bart und trug Kleidung, die Bobby an das 19. Jahrhundert erinnerte. Doch seine braunen, bösen Augen stammten eindeutig aus der Gegenwart. „Wir wollen wissen, wo sich das Labor von Dr. Cooper befindet“, wiederholte er grimmig.
„Tut mir leid, ich kenne keinen Dr. Cooper“, stotterte Bobby ängstlich.
Ein anderer Mann, wesentlich größer, trat hervor und blieb vor der Theke stehen.
Bobby rang nach Atem, denn der Mann trug einen sehr eleganten Anzug, der ihn wiederum an den Film „Vom Winde verweht“ erinnerte. Rhett Buttler? Fehlte noch, dass Scarlet O’Hara erschien.
Der Mann hatte längeres, gewelltes Haar. Sein schmales Gesicht wurde durch einen gepflegten Bart gezeichnet und seine Kleidung deutete auf Wohlstand hin. Die Knöpfe an seinem beigefarbenen Jackett sahen sehr nobel aus. Genau wie das gemusterte Halstuch, das mit einer goldenen Brosche verziert war.
War hier irgendwo in der Nähe ein Kostümfest und die Jungs hatten sich einfach in der Hausnummer geirrt?
„Ich glaube Ihnen, Mister …?“ Der zweite Mann trat näher zu ihm, um den Namen auf seinem Schild lesen zu können.
„Mister Smith. Aber Sie können uns doch sicherlich in das Stockwerk bringen, das Sie auf den Monitoren sehen, oder?“
Der erste Mann hielt ihm plötzlich eine Waffe mit Schalldämpfer unter die Nase. Die moderne Waffe passte nun gar nicht zu seinem Kostüm.
Bobby hob langsam die Hände und nickte „Es ist der … der dreißigste Stock. Ich war noch nie da oben.“
„Tja, dann wird es Zeit. Kommen Sie bitte“, bat der große Mann ihn höflich.
Der andere Mann wedelte mit der Waffe in die Richtung der Fahrstühle. „Los, heute noch, wir haben nicht ewig Zeit.“
Bobby spürte, wie ihm die Schweißperlen von der Stirn heiß in seinen Nacken tropften. Vorsichtig lief er um die Theke herum und ging zu einem der zwei Fahrstühle. Er hoffte, dass wenigstens einer der Fahrstühle funktionierte und diese nicht nur zur Tarnung hier waren. Wie gesagt, er hatte hier noch nie jemanden rein- oder rauskommen gesehen.
Sein Finger zitterte, als er den Knopf nach oben drückte, und atmete erleichtert auf, als ein Ping ertönte und die Türen sich sofort öffneten.
Der Mann mit der Waffe schubste ihn in den Lift. „Ihr vier kommt mit, die anderen bleiben hier unten und halten den Eingangsbereich im Auge. Der Lieferwagen muss gleich eintreffen. Wir holen die Maschine und sind gleich wieder unten“, befahl der große Mann den anderen, die stumm nickten und sich im Eingangsbereich positionierten.
Die Lifttüren schlossen sich leise und der Fahrstuhl setzte sich sanft in Bewegung. Der Knopf mit der Zahl Dreißig leuchtete auf.
„Sie haben wirklich keine Ahnung, was Sie hier eigentlich bewachen, nicht wahr, Mister Smith?“ Der große Mann lächelte ihn an.
Bobby schüttelte den Kopf und schwieg. Er dachte unaufhörlich an seinen alten Ford, den er nach Weihnachten verkaufen wollte. Im Moment hatte er das dumme Gefühl, dass er dieses Jahr Weihnachten nicht mehr erleben würde. Und somit auch keinen neuen Wagen mehr benötigte.
Sekunden später erklang erneut ein Ping und die Türen öffneten sich. Ein schmaler Flur lag vor ihnen. Die Personen verließen den Lift und gingen wachsam um die nächste Ecke. Vor ihnen lag ein großer, leerer Raum.
Bobby stutzte. Er bewachte seit Monaten einen leeren Raum?
Der Mann mit der Waffe folgte ihm vorsichtig und sicherte mit den anderen Männern die Räumlichkeiten. „Alles sauber!“, rief er zur Bestätigung „Hier! Hier ist sie!“
Bobby Smith traute sich nicht zu bewegen. Seine Augen suchten den Raum nach irgendeiner Fluchtmöglichkeit ab. Leider konnte er nicht springen, er befand sich immerhin im dreißigsten Stockwerk. Obwohl, vielleicht war diese Art zu sterben angenehmer als die Art, die die kostümierten Typen sich für ihn ausgedacht hatten? Im Moment war es das Klügste, sich ruhig und kooperativ zu verhalten. Denn eigentlich wollte er schon den alten Ford verkaufen und sich das neue Modell zu Weihnachten schenken.
Der Mann mit dem noblen Outfit schritt gemächlich durch den kahlen Raum und verschwand um eine Ecke.
Seine Augen begannen zu strahlen, als er das Gerät entdeckte, das unter einer durchsichtigen Schutzhülle stand. Es sah wie ein Bräunungsgerät aus dem Sonnenstudio aus. Seine Hand zog die Folie sachte von der Maschine und er lachte siegessicher. „Mean! Sag den Jungs unten Bescheid, sie sollen die Tragegurte hochbringen und die Utensilien, die wir für den Testlauf benötigen.“ Er machte eine Geste, dass einer seiner Männer Bobby zu ihm bringen sollte.
Bobby schluckte, als einer der Männer ihn am Ärmel packte und um die Ecke führte. Was war das denn für ein Gerät? Ein Solarium? Und für so einen Quatsch sollte er auf den neuen Wagen verzichten? Ihm wurde mulmig.
„So, Mister Smith, ich werde Sie jetzt aufklären. Mein Name ist Beckett und was Sie hier sehen, ist kein Solarium, wie Sie es vielleicht vermuten, sondern eine Zeitmaschine.“ Er machte eine kurze Pause und lächelte über den verwirrten Gesichtsausdruck von Mister Smith. „Und da Sie es mir sowieso nicht glauben, werden Sie, Mister Smith, unsere Testperson sein und in das 19. Jahrhundert reisen.“
Bobby schüttelte sachte den Kopf. Was hatte der Mann gerade gesagt? Er würde gleich in die Vergangenheit geschickt werden?
Beckett trat zu ihm und blickte zu ihm runter. „Keine Angst, wir werden Sie nicht töten, wenn, dann übernimmt das diese Maschine.“
„Was … was soll ich denn in der Vergangenheit?“ Er erkannte seine eigene Stimme nicht mehr.
„Wir schicken Sie hin, um zu sehen, ob es funktioniert. Sie bekommen eine Digitalkamera mit. Sie fotografieren die Umgebung und nach fünf Minuten sind Sie wieder bei uns. Ganz einfach.“
Kurze Zeit später kamen die über Telefon angeforderten Sachen und die Männer machten sich an die Arbeit, die Maschine zum Laufen zu bringen.
Bobby hockte auf dem kalten Betonboden und beäugte die Sache mit sehr skeptischen Blicken. Die Kerle machten doch sicherlich Witze? Oder würde er gleich tatsächlich ins 19. Jahrhundert gebeamt werden? Er hatte ja alle STAR TREK-Folgen mit Begeisterung angeschaut und natürlich von Zeitreisen geträumt. Aber jetzt? Er hatte wirklich Angst.
Nach circa zwanzig Minuten war es dann so weit. Die Männer hielten ihn fest und schossen ihm einen Sender in den rechten Arm.
Beckett blieb vor ihm stehen und hielt ihm eine Digitalkamera entgegen. „Sie machen so viele Fotos, wie Sie können. In exakt fünf Minuten holen wir Sie zurück.“
„Und wenn die Maschine … also … nicht funktioniert?“ Er spürte den Angstschweiß an seinem Rücken hinunterlaufen.
„Tja, dann werden Sie sich leider dort einen Job als Sicherheitsmann suchen müssen“, scherzte Beckett trocken und drückte ihm die Kamera in die Hand.
Ehe Bobby sich’s versah, zogen zwei Männer ihn zu der Maschine und drückten ihn auf die Liegefläche. Er wurde an Armen und Beinen gesichert.
„Tut … tut das weh?“, fragte er mit panischer Stimme und spürte, wie er am ganzen Körper zitterte. Oh Gott, was für ein beschissener Tag!
„Das werden Sie uns in fünf Minuten mitteilen können, Mister Smith. Entspannen Sie sich und denken Sie an die Fotos“, erinnerte ihn Beckett. Er hob die Hand, worauf Mean einige Knöpfe drückte und alle Daten auf seinem Laptop sehen konnte.
„Es geht in zwei Minuten los.“ Mean kontrollierte die Angaben von Mister Smith. Sein Puls schlug wie verrückt.
„Sie holen mich doch wieder?“ Er drehte seinen Kopf zur Seite.
Beckett nickte und schob den Deckel nach unten. Dann ging er zu Mean und schaute mit auf den Bildschirm.
Die Maschine begann seltsame Geräusche von sich zu geben, so als würde ein Motor schwer anfangen zu laufen. Dann gingen die Röhren überall an und Bobby schloss die Augen, da das Licht ihn schmerzhaft blendete. „Holen Sie mich hier raus!“, schrie er und versuchte sich aus den Fesseln zu lösen.
Das komische Geräusch verwandelte sich, als würden jetzt riesige Turbinen starten, und er spürte, wie sich ein schmerzhaftes Prickeln in seiner Haut ausbreitete. Seine Augäpfel schwollen an und er hatte das Gefühl, sie würden ihm gleich aus dem Kopf springen.
Die Maschine bestand nun aus gleißendem Licht und die Geräusche verstärkten sich in hammerschlagartige Laute.
„Wie lange noch?“, rief Beckett gegen den Lärm an.
„Dreißig Sekunden!“
Bobby hatte nur noch einen Wunsch, dass er gleich aufwachte und alles nur ein böser Traum war.
Die Schmerzen verwandelten sich in ein heißes Brennen und dann hatte er das Gefühl, er würde von innen nach außen explodieren.
Sein schmerzerfüllter Schrei ging Beckett durch Mark und Bein. Dann knallte es! Lichtblitze durchzuckten den ganzen Raum und Bobby Smith war verschwunden.
Beckett ging vorsichtig zu der Maschine und hob den Deckel an. Tatsächlich, der Mann war weg. „Und?“, fragte er Mean.
Dieser strahlte und klatschte in die Hände. „Es hat geklappt! Er befindet sich laut unseren empfangenen Daten im 19. Jahrhundert! Tara 1818. Die Uhr läuft. Er hat noch vier Minuten.“
Beckett rieb sich die Hände. „Dann bin ich gespannt, was unser Mister Smith erlebt hat.“
Nach fünf Minuten rappelte die Maschine, gleißendes Licht blendete sie, es knallte und nachdem die Lichtblitze verschwanden, lag Mister Smith wieder ordnungsgemäß auf der Liege vor ihnen.
Beckett hob den Deckel und löste ihm die Fesseln. „Willkommen in der Zukunft, Mister Smith.“
Bobby hustete und musste sich erst orientieren. Sein Körper schmerzte nicht mehr und die Rückreise war angenehmer als die Hinreise. Er richtete sich langsam auf und hielt Beckett grinsend die Kamera entgegen. „Es hat tatsächlich geklappt, ich war wirklich im 19. Jahrhundert!“ Dann stand er auf und grinste ihn triumphierend an. „Und ich habe noch etwas für Sie.“
Beckett staunte nicht schlecht, als Mister Smith ihm einen kleinen braunen Lederbeutel gab, in dem sich ein Haufen schwerer, goldener Münzen befand. „Sie haben sogar Münzen mitgebracht.“ Er betrachtete die Geldstücke.
„Lassen Sie mich jetzt am Leben?“, fragte er vorsichtig.
Beckett lachte und legte kameradschaftlich einen Arm um ihn. „Sie gefallen mir, Mister Smith. Wie wäre es? Sie arbeiten für mich, aber in der Vergangenheit.“
2. Kapitel
Tage später – London
Neat sah ihren Mitarbeiter ungläubig an. „Wie bitte? Die haben nicht mitbekommen, dass dort eingebrochen wurde?“
Dean Fix schüttelte den Kopf. „Nein, da dieser Gebäudetrakt irgendwo in New York liegt und geheimer als geheim ist, dauerte es Tage, bis wir dahintergekommen sind.“
Neat zog skeptisch eine Braue hoch. „Gab es keinen Wachmann? Keine Kameras? Man muss doch irgendetwas mitbekommen haben!“
„Angeblich gab es einen Wachmann, der zu dem Zeitpunkt des Einbruchs Dienst hatte. Er ist Junggeselle und hat keine Verwandten und somit wurde er auch nicht vermisst.“
„Gab? Ist er nicht mehr da? Wer hat ihn denn eingestellt?“
„Er wurde angeblich von der technischen Forschungsabteilung des MI6 eingestellt. Und die konnten mir lediglich bestätigten, dass sein Name Bobby Smith ist. Er ist ebenfalls spurlos verschwunden. Um dieses Haus zu bewachen, wurden nur Junggesellen eingestellt, die keine Familie vorweisen, damit sie nicht erpresst werden können“, berichtete Dean weiter.
„Mm.“, grummelte Neat. „Wissen wir wenigstens, was dort versteckt wurde?“
„Ist ebenfalls geheimer als geheim.“ Dean grinste schief.
„Anscheinend war es nicht geheim genug, sonst hätte man es ja nicht gefunden, oder?“ Neat seufzte und drehte den Kugelschreiber zwischen ihren schlanken, weißen Fingern. Sie wusste schon, wen sie danach fragen konnte.
„WICK.ED?“, warf Dean das Wort in den Raum.
Sofort verfinsterten sich die grünen Augen von Neat und sie ließ den Kugelschreiber fallen. „Anscheinend, denn wer sonst hat so viel Macht und Beziehungen zu sämtlichen Organisationen?“
„Ein Maulwurf beim MI6?“
„Wäre nicht das erste Mal. Mister Fix, seien Sie auf der Hut, wir können niemandem trauen, niemandem“, sprach sie mit Nachdruck und warf ihrem Kollegen einen unglücklichen Blick zu.
Neat betrat das kleine Café, das in einer Seitenstraße lag. Warme, stickige Luft schlug ihr entgegen und sie nahm ihr braunes Tuch ab. Ihre Augen suchten den schmalen Raum nach ihm ab. Sie entdeckte ihn in der hintersten Ecke. „Hallo, Dr. Cunning.“ Sie blieb vor ihm am Tisch stehen.
Der Mann blickte zu ihr auf und grinste. „Liebe Schwester, bitte setz dich.“ Er machte eine Geste, dass sie doch Platz nehmen sollte. „Der Apfelstrudel soll hier vorzüglich sein. Möchtest du einen?“
Nelly zog ihren Mantel aus, legte ihn über den anderen freien Stuhl und schüttelte sachte den Kopf. „Nein, danke. Aber einen Tee, es ist zu kalt für diese Jahreszeit.“
„Wir haben in fast fünf Monaten Weihnachten, was verlangst du?“ Seine raue Stimme hatte einen belustigten Unterton.
„Nein, wirklich?“, tat sie überrascht.
Beide lächelten sich an.
„Nun, Schwesterherz, was kann ich für dich tun?“, fragte er und legte die Speisekarte beiseite.
„Lexington Straße, Ecke Süd”, sagte sie einfach.
„Was soll da sein?“, tat er unwissend.
Neat verdrehte die Augen. „Das möchte ich sehr gerne von dir erfahren.“
„Nichts“, war seine knappe Antwort.
Sie lehnte sich entspannt zurück und schlug die Beine übereinander. „Hm? Tja, dieses Nichts wurde vor Tagen gestohlen. Hat man dich nicht darüber informiert?“ Sie war auf seine Reaktion gespannt.
Sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig und Sorgenfalten kräuselten seine schmale Stirn. Seine grünen Augen blickten besorgt über den kleinen Tisch. „Nein, hat man anscheinend versäumt“, endete er leise.
Neat beugte sich zu ihm und sah ihren Bruder fest an. „Verdammt, Joseph! Was wurde dort versteckt?“
Er kniff die schmalen Lippen zusammen und seine Hände glitten über sein grau gezeichnetes Haar. „Die Zukunft, die Vergangenheit …“
Die Kellnerin erschien und lächelte die Gäste freundlich an. „Einen schönen guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen?“
Joseph stand abrupt auf. „Danke, nichts“, knurrte er.
Die Kellnerin sah ihn verwirrt an.
Neat stand ebenfalls auf und schenkte der jungen Frau ein entschuldigendes Lächeln. „Wir müssen leider schon wieder dringend weg, schönen Dank.“
Joseph stürmte an ihr vorbei und eilte nach draußen. Er brauchte dringend frische Luft nach dieser Nachricht. Er schlug den schwarzen Trenchcoat so eng es ging zu. Vielleicht fror er plötzlich so stark, weil ihn diese Nachricht völlig schockierte.
Neat folgte ihm. „Also?“
„Nicht hier“, gab er zischend von sich.
Nachdem sie eine Stunde lang quer durch London gefahren wurden, erreichten sie ein altes Landhaus, das etwas außerhalb von London lag. Der Wagen hielt an und beide stiegen aus.
Vor ihnen lagen Kartoffelfelder, die in ihrer vollen Blüte standen, und ein schmaler Weg führte mitten hindurch.
„Wundert mich, dass die Kartoffeln so gut stehen“, sagte er.
„Ich möchte mich nicht über die anstehende Kartoffelernte unterhalten, Joseph!“, ermahnte sie ihn.
„Okay. Ich habe mit einem gewissen Professor Cooper zusammengearbeitet“, begann er.
„Aha? Und an was habt ihr zusammengearbeitet?“
Ihr ruder blieb stehen und blickte sie grinsend an. „Du glaubst mir sowieso kein Wort.“
Sie seufzte genervt. „Joseph, ich bitte dich … das tue ich doch nie“, scherzte sie trocken. Denn diesen Spruch musste sie sich schon seit Jahren von ihrem größeren Bruder vorhalten lassen.
Er ging langsam weiter und holte einen tiefen Atemzug. Die Luft war wirklich sehr kühl für diesen Sommer. Er fröstelte nicht nur von außen, sondern auch von innen. „Wir haben eine Maschine erfunden und der Prototyp wurde in diesem Haus gelagert“, sagte er so, als wüsste Nelly jetzt genau, worum es ging.
Sie zuckte mit den Schultern. „Und? Was ist das für eine Maschine? Ach, Herr Gott noch mal, Joseph! Ich habe keine Zeit, dir jedes Wort einzeln aus der Nase zu ziehen!“, fuhr sie ihn gereizt an.
„Zeitmaschine“, kam es schnell über seine schmalen Lippen.
„Zeitmaschine?“, wiederholte Nelly verwirrt.
„Zeitmaschine“, bestätigte Joseph ihr mit einem großen Nicken.
„Du willst mir doch nicht wahrhaftig erzählen, dass du mit diesem … mit diesem Dr. Cooper eine Zeitmaschine erfunden hast?“
„Tja, ich habe dir gesagt, dass du mir nicht glauben wirst, Schwesterherz“, gab er besserwisserisch von sich.
Nelly blieb auf dem schmalen Landweg stehen und ihre grünen Augen funkelten ihn neugierig an. „Und der Prototyp wurde gestohlen?“
„Also glaubst du mir doch?“ Er zog lächelnd eine Braue hoch.
„Natürlich glaube ich dir“, brachte sie zickig hervor.
„Wenn du mir sagst, dass es sich um die Lexington Road, Ecke Süd in New York handelt und die Maschine sich nicht mehr im dreißigsten Stockwerk befindet, dann wurde wahrhaftig der Prototyp der Zeitmaschine gestohlen.“
„Wenn es sich um den Prototyp handelt, gehe ich davon aus, dass es eine weitere Zeitmaschine gibt, die wo steht?“, kombinierte Neat.
„In der Nähe von Tromsö.“
„Tromsö? Wo liegt das denn schon wieder? Oder ist das auch geheimer als geheim?“ Nelly zog eine Grimasse und hielt sich ihr braunes Tuch näher vors Gesicht. Irgendwie hatte sie das Gefühl, der Wind nahm an Kälte zu. Befanden sie sich tatsächlich in der richtigen Jahreszeit?
„In Norwegen. Vor der Stadt Tromsö ist eine kleine stillgelegte Bohrinsel, dort haben wir eine Forschungsstation eingerichtet“, klärte er sie über die geographischen Daten auf.
„Kann derjenige denn etwas mit dem Prototyp anfangen? Funktioniert diese Maschine?“
„Sie funktioniert, zwar nicht einwandfrei, aber ja, man kann sie benutzen.“
Nelly schloss kurz die Augen und seufzte. „Also kann diejenige Person einfach in die Vergangenheit oder Zukunft reisen und den Lauf der Geschichte verändern?“
„Im Moment haben wir nur das Zeitfenster zur Vergangenheit geöffnet, die Zukunft ist zu gefährlich.“
„Ob mich diese Aussage beruhigt, bezweifel ich.“ Sie legte die Stirn in Falten. „Ich muss mit Dr. Cooper sprechen, vielleicht kann er uns irgendwie weiterhelfen.“
Ihr Bruder sah sie unglücklich an.
Nelly hob eine Augenbraue, sie kannte diesen Blick. „Was?“
Er räusperte sich. „Ähm … nun … es gibt da ein Problem.“
„Ein Problem? Ich schätze mal, deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen sind da noch mehr Probleme. Ich bin ganz Ohr.“
„Cooper ist ebenfalls verschwunden.“
„Wurde er entführt?“, vermutete sie.
„Nein. Er ist in die Vergangenheit gereist, um wichtige Informationen für unsere Forschung zu sammeln. Leider hat er die kompletten Forschungsberichte mitgenommen. Cooper hat sich seit Tagen nicht mehr bei mir gemeldet. Vielleicht funktioniert sein Pager nicht, oder er hat einfach keine Lust zurückzukehren“, gab er kleinlaut von sich.
„Ihr könnt untereinander Kontakt haben? Wie das denn? Schickt er dir ein Fax?“ Sie musste plötzlich über ihre eigenen Worte lachen. Klar, in der Vergangenheit stand zufällig ein Faxgerät.
„Nun, so ungefähr“, druckste Joseph herum.
Nelly blieb stehen. Das Landhaus lag schon viele Meter von ihnen entfernt. „Ich glaube, ich gelange gleich an den Punkt von Unverständnis und Wahnsinn.“
Plötzlich begannen die grünen Augen ihres Bruders zu leuchten und seine bedrückte Miene lockerte sich auf.
„Ja, es ist wirklich so eine Art Fax oder SMS. Die Daten werden in ihre Einzelteile zerlegt, durch den Orbit gesendet, also durch unser Zeitfenster, und Cooper hat einen Pager bei sich. Wir können nicht miteinander sprechen, aber wir können uns Nachrichten schicken.“
„In welchem Jahrhundert befindet er sich denn und wo?“, wollte sie von ihm wissen. So langsam, aber sicher wurde ihr diese Geschichte unheimlich.
Joseph kratzte sich am Hinterkopf. „Im Jahre 1818. Cooper ist in Irland.“
„Irland ist nicht gerade klein, also wo genau befindet er sich?“ Ihre Stimme bekam wieder diesen genervten, kalten Unterton.
„In der Stadt Tara.“
„Tara? Das Tara, wo ganz in der Nähe Cylemore Rock Castle liegt?“ Sie war sichtlich überrascht.
„Genau das Tara und das Schloss, in dem der MI6 seine neue Jugend unterbringt und ein gewisser Tom Fear das Sagen hat“, bestätigte er ihre Worte.
Sie wandte sich von ihm ab und rieb sich ihr schmales, kaltes Kinn. „Oh mein Gott …“
„Ach, Schwesterherz, es kommt noch schlimmer. Möchtest du wirklich die ganze Wahrheit hören?“ Er grinste sie frech an. Es machte ihm mal wieder Spaß, seine Schwester zu ärgern und zu provozieren. Er liebte diesen geschockten Gesichtsausdruck. Schon seit seiner Kindheit.
„Wenn du mir nicht endlich reinen Wein einschenkst, dann glaube mir, werde ich dich persönlich in diese Maschine setzen und dich zur Hölle schicken!“, fluchte sie und wandte ihm ihr böses Gesicht finster zu.
„Dann fliegen wir morgen nach Tromsö“, freute er sich wie ein kleiner Junge.
Im nächsten Augenblick erwischte beide eine sehr starke Windböe und dunkle Regenwolken erschienen am Himmel. Sie machten sich schnell auf den Rückweg zum Wagen. Es war eindeutig zu kalt für August.
3. Kapitel
Die Tage im Krankenhaus waren für Vanity die Hölle. Sie langweilte sich zu Tode, und sie musste unaufhörlich an Tom Fear denken und an all die anderen Personen, die sie während ihres ersten Auftrages kennengelernt hatte und leider auch deren Tod mit ansehen musste.
Ob Parker und Fear wussten, wo sie sich gerade aufhielt? Wohl eher nicht, denn ihr Vater wäre der Erste gewesen, der bei ihr tobend am Bett gestanden hätte. Und Fear? Der Idiot hätte ihr sicherlich ein Malbuch und Buntstifte geschenkt, weil sie sich kindisch benommen hatte. Ihre Wunden waren natürlich innerhalb von einem Tag verheilt und keiner stellte blöde Fragen. Sie mussten es wissen. Es ging gar nicht anders.
Denn welcher Arzt würde keine Fragen stellen, wenn eine Patientin auf seinem OP-Tisch lag, in deren Bauch drei dicke, große Holzsplitter eines Mastes steckten, und diese sich von selbst aus der Haut schoben und keine Verletzungen zurückblieben?
Na gut, es sei denn, es wäre ein Arzt aus einem Marvel-Comic-Heft gewesen. Der würde sich über rein gar nichts wundern. Vanity lachte hart über ihre eigenen blöden Gedanken und strampelte genervt mit ihren Füßen die Bettdecke weg. Ihre schlanken Füße kochten unter der Decke. Und sie kochte vor Langeweile.
Neat hatte recht. Sie musste unbedingt wieder einen neuen Auftrag erhalten und wenn das nicht bald geschah, würde sie hier im MI6-Krankenhaus Amok laufen!
Es klopfte zaghaft und Vanity richtete sofort den Blick auf die Tür. Neat, na endlich! Es war nicht Neat, sondern der gute Doktor Fever.
Sofort erlosch der erwartungsvolle Ausdruck in ihrem hübschen Gesicht und sie zog einen Flunsch.
„Wie geht es dir, Vanity?“, erkundigte sich der ältere Herr mit überschwänglicher Freundlichkeit.
„Wann darf ich gehen?“ Sie überging seine Frage.
„Wir behalten dich noch einen Tag zur Beobachtung und dann kannst du uns verlassen.“ Er blieb direkt neben ihr stehen.
„Was wollen Sie denn bei mir beobachten?“ Sie zog fragend eine Braue hoch.
Der Doktor lächelte. „Dein Blutdruck ist zu hoch. Wir verabreichen dir ein Mittel und morgen Mittag kannst du uns verlassen“, versicherte er seiner ungeduldigen Patientin.
„Hm? Wissen Sie, wer mich operiert hat?“
Dr. Fever stutzte einen kleinen Moment und lächelte sanft. „Du wurdest nicht operiert.“
„Nicht?“, rief sie quietschend und räusperte sich, damit sie mit normaler Stimme weitersprechen konnte. „Oh … ich dachte, bei meinen Verletzungen wäre ich operiert worden?“
„Du hattest lediglich starke Prellungen im gesamten Bauchraum und eine starke Gehirnerschütterung, so steht es jedenfalls in deinem Bericht.“
„Haben Sie mich denn nicht …? Also, waren Sie nicht bei meiner Einlieferung dabei?“ Nun stutzte sie über die Aussage des Arztes.
„Nein, ich hatte keine Schicht.“
„Wissen Sie, wer Schicht hatte?“ Jetzt spürte sie tatsächlich Bluthochdruck!
„Warum willst du das wissen?“
Vanity grinste schief und blies die Backen auf. „Puh … einfach so, ich bin neugierig.“
„Ich glaube, es war Dr. Joseph Cunning“, gab er die gewünschte Auskunft.
Vanity zuckte mit den Schultern und überlegte. Dr. Cunning? Hm? Noch nie gehört. Sie schob den Gedanken beiseite und hielt lieber die Klappe, denn entweder wusste der Blödmann vor ihr nicht, was wirklich Sache war, oder er konnte hervorragend den Blödmann spielen.
Schlafende Hunde sollte man nicht wecken.
Der Arzt legte ihr einen kleinen silbernen Apparat an das linke Handgelenk und nach wenigen Sekunden piepte es und er seufzte. „Siehst du, dein Blutdruck ist zu hoch.“
„Und ich explodiere bald, wenn ich morgen nicht hier rauskomme! Und dann lernt ihr Mal meinen wahren Bluthochdruck kennen“, dachte sie.
Cylemore Rock Castle / Irland
Es war zum Verrücktwerden! Seit Tagen versuchte er seine Tante in London zu erreichen, doch es hieß, sie wäre kurzfristig außer Haus. Ha, außer Haus! Dass er nicht lachte! Und über „Truth“ konnte er ebenfalls nichts mehr in Sachen Vanity in Erfahrung bringen, denn seitdem die blöde Zicke sich eiskalt den Sender aus dem Fuß geschnitten hatte, blieb der große Bildschirm leer, wenn man um Angaben bat. Sobald Vanity wieder in Cylemore Rock Castle war, würde er ihr höchstpersönlich den neuen Sender in den Fuß schießen!
Jason betrat den IT-Raum, er nahm an seinem Schreibtisch Platz und sah zu Tom hinüber. „Und? Noch immer nichts von ihr?“
Die Antwort seines Chefs war ein langsames Kopfschütteln.
„Hm?“, brummte Jason. „Warum hat sie sich auch den Sender entfernt?“
„War sie damals auch schon so durchgeknallt?“, wollte Tom von ihm wissen.
Jason sah ihn überrascht an. „Was? Wann?“
„Nun, du hast mir erzählt, dass du Vanity vom Internat her kennst. Wie hast du sie kennengelernt?“, hakte er nach.
„Na ja … also … so richtig, so richtig kannte ich sie ja gar nicht“, stotterte er umher.
„Das sah aber letztens bei euch ganz anders aus. Da ward ihr sehr vertraulich miteinander“, teilte Tom aus.
Er spürte förmlich, wie ihm das Blut in die Wangen schoss und sein Puls schneller schlug. Er durfte sich auf keinen Fall verraten. Also reiß dich zusammen, Jason, du bist jetzt immerhin beim MI6 tätig und kein Weichei mehr!, ermahnte er sich selbst und spürte, wie die Wangen wieder blasser wurden. „Ich habe Vanity nach einem illegalen Autorennen kennengelernt. Sie hatte das Rennen gewonnen, doch der Typ war ein schlechter Verlierer. Die beiden haben sich geprügelt und ich habe ihr ein Taschentuch gereicht, weil ihre Nase stark geblutet hat.“
Als Tom die letzten Worte vernahm, erhöhte sich sein Puls. Wie? Sie hatte schon damals Nasenbluten? „Wie romantisch“, säuselte er.
„Seit dem Tag waren wir Freunde, doch nicht für lange, sie verließ bei Nacht und Nebel das Internat und ich habe sie Jahre nicht gesehen“, erzählte er die kleine, etwas veränderte Version ihres gemeinsamen Jahres. „Bin aus allen Wolken gefallen, als ich sie ausgerechnet hier wiedergetroffen habe.“
„Würdest du es schaffen, dich in den MI6-Computer zu hacken?“, wechselte Tom schlagartig das Thema.
Jason starrte ihn aus großen Augen an. „Was?“
„Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Ist doch eine einfache Frage.“ Tom erhob sich vom Stuhl und blieb vor seinem Schreibtisch stehen.
Jason zuckte unsicher mit den Schultern. „Schätze ja? Wieso? Was hast du vor?“
Tom grinste ihn breit an. „Du musst sicherlich viele verbotene Sachen machen und ich hoffe sehr, dass ich dir vertrauen kann?“
„Du bist der Boss“, sagte Jason mit Respekt.
„Ich brauche dich in dieser Angelegenheit als Freund, Jason. Kann ich mich hundertprozentig auf dich verlassen?“, fragte er noch einmal mit fester Stimme.
„Aber sicher doch. Was hast du denn in drei Teufelsnamen vor?“
„Phoenix finden. Neat hat Vanity schon wieder für irgendetwas eingeplant, und sie wird es mir unter keinen Umständen erzählen. “
„Hast du denn schon mit Neat gesprochen?“
Er schüttelte langsam den Kopf. „Nein, das brauche ich auch nicht. Allein, dass sie mir als Einsatzleiter nicht den jetzigen Aufenthaltsort von Phoenix verrät, bedeutet nichts Gutes. Also, Jason, bist du dabei?“
„Ich bin dabei.“ Er grinste stolz und freute sich, dass sein Boss ihn als Freund auserwählt hatte.
„Genau das wollte ich hören.“ Er klopfte ihm kameradschaftlich auf die Schulter. „Dann zeig mal, was du kannst.“
Tromsö / Norwegen
Der Flug nach Tromsö dauerte nicht allzu lang. Danach fuhren die beiden mit einem Schnellboot zur alten, verlassenen Bohrinsel hinaus.
Joseph befestigte das Boot und half seiner Schwester beim Ausstieg. Die See war hier draußen vor der Küste schon etwas rauer und ein kalter Wind wehte ihnen um die Ohren, dagegen ist der kühle Sommerwind zwischen den offenen Feldern in London ja ein warmes Lüftchen gewesen.
Joseph lief auf einem schmalen Eisensteg voraus und blieb vor einem Gitterfahrstuhl stehen.
„Wieso habt ihr euch ausgerechnet diesen Ort für eure Forschung ausgesucht?“, wollte Neat wissen.
Es erklang ein lautes Klicken und der Fahrstuhl setzte sich in der oberen Etage in Bewegung.
„Es hat physikalische Gründe. Cooper hat herausgefunden, dass hier die Möglichkeit für ein Zeitfenster wesentlich besser vorhanden ist als sonst wo auf der Welt. Liegt wohl an diesen Polarlichtern.“ Er zuckte unwissend die Schultern. „Das ist seine Aufgabe.“
„Und was ist deine Aufgabe bei diesem Projekt?“
Der Fahrstuhl hielt mit einem weiteren Knatschen und Joseph öffnete die Gitterschiebetüren. „Natürlich bin ich der medizinische Part, denn Zeitreisen sind nicht ungefährlich. Darf ich bitten?“ Er ließ ihr den Vortritt.
Nelly seufzte und warf einen Blick auf den nicht gerade guten Zustand des Lifts. „Ich wusste doch, die Geschichte hat einen Haken.“
Joseph setzte einen Hebel in Bewegung und der Lift fuhr langsam ruckelnd nach oben.
Sobald der Lift die untere Etage der Plattform verlassen hatte, erfasste der kalte Seewind die beiden mit voller Wucht. Neat fröstelte und verschränkte die Arme um ihren Oberkörper, so konnte sie damit einen kleinen Teil der Kälte abschirmen.
Die raue See endete am nebeligen Horizont und sie konnte den Himmel kaum vom Meer unterscheiden.
Der Fahrstuhl ruckelte langsam quietschend vor sich hin und blieb circa zwanzig Meter über dem Anlegesteg stehen. Joseph legte einen Sicherungshebel um und öffnete die schweren Gittertüren. Wieder überließ er seiner Schwester den Vortritt. „Wir müssen rechts lang.“
Sie befanden sich jetzt auf einer sehr großen Plattform, in deren Mitte der riesige Bohrer zu sehen war. Die Umgebung wirkte unheimlich und Neat fühlte sich nicht gerade wohl hier.
Ihr Bruder bemerkte es und lächelte. „Keine Angst, hierher kommt niemand.“
Sie zog skeptisch eine Braue hoch. „Und wenn der Niemand schon längst hier ist? New York war angeblich auch geheim.“
Joseph ging voran und seufzte schwer. „Da hast du auch wieder recht, aber …“ Er machte eine Pause und klopfte gegen seinen Trenchcoat. „Ich habe eine Waffe dabei.“
„Toll, da kann uns ja nichts passieren“, meckerte sie.
„Dir kann man aber auch nichts recht machen.“ Er blieb vor einer Eisentür stehen, die durch einen Türcode gesichert wurde. Er tippte flink eine Kombination ein und musste sich etwas anstrengen, sie zu öffnen.
Neat rümpfte die Nase, als sie den Flur betrat, der jetzt vor ihnen lag. Es muffelte nach altem Eisen, Dreck und …? Ach, sie dachte lieber nicht genauer über die angeblichen Gerüche nach und folgte weiter ihrem Bruder.
Leuchtstoffröhren gaben grelles Licht ab und ließen die Umgebung nicht gemütlicher wirken. Hoffentlich waren sie gleich da. Eine erneute Eisentür mit Code, Fingerabdruckscan und Netzhauterkennung lag vor ihnen. Joseph erledigte die gewünschten Abfragen und öffnete die Tür.
„Wie viele Türen liegen noch vor uns?“, fragte sie mit einem ironischen Unterton.
„Was bist du wieder ungeduldig!“, zickte er und warf ihr einen bösen Blick zu.
Der Flur, der diesmal vor ihnen lag, wirkte schon freundlicher. Die Wände waren in einem blassen Rot gestrichen und der Fußboden war aus grauem Linoleum. Die Leuchtstoffröhren wirkten jetzt nicht mehr so kalt und steril.
„Wir sind gleich da“, sagte er und bog links um eine Ecke. Am Ende sah man wieder eine Tür. Das gleiche Prozedere erfolgte von Joseph. Türcode, Fingerabdruck und Netzhaut.
„Herzlich willkommen auf Cooper Island.“ Er machte eine ausladende Armbewegung.
Neat blieb stehen und pfiff anerkennend, als sie die technischen Gerätschaften entdeckte. Mehrere Monitore und ein großes Schaltpult waren zu sehen sowie ein Raum, der sich hinter einer dicken Glasscheibe befand. Dort standen zwei Maschinen, die sie an Solariumgeräte erinnerten. „Sind das die Zeitmaschinen?“
Joseph hatte inzwischen an dem Mischpult Platz genommen und einige Knöpfe betätigt. „Genau.“
„Sehen aus, als hättet ihr sie aus einem Bräunungsstudio gestohlen“, scherzte sie und wagte sich näher an die Glasscheibe.
Die zwei Maschinen waren mit unzähligen Kabeln verbunden. Auf einem Monitor, der sich bei ihrem Bruder befand, konnte man via Kamera in das Innere schauen.
„Die Person legt sich in die Maschine und wird von einem Computer gescannt. Dieser rechnet die Körperstruktur aus, die Moleküle und DNA. Wir beamen die Person dann weg, so als würde man ein Fax durch die Leitung schicken. Die Daten werden ja auch in Einzelteile zerlegt, sonst würden die Wörter nicht durch die Leitung passen. Am anderen Ende setzt sich der Körper blitzschnell wieder zusammen und man befindet sich in der Vergangenheit“, erklärte er den Vorgang mit wenigen, einfachen Wörtern.
„Aha, und du sagtest, Zeitreisen sind ungesund?“
Er nickte eifrig und holte einige Bilder auf einen anderen Monitor. Sie konnte Röntgenaufnahmen einer Person erkennen. Es war eine Hand. „Wie du siehst, sind alle Knochen da, wo sie hingehören.“ Er fuhr sachte mit seinem Finger über den Bildschirm. Dann erschien ein anderes Foto derselben Hand. Neat konnte deutlich erkennen, dass die Knochen leicht verschoben waren und feine Risse vorwiesen.
„Das ist dieselbe Hand, aber die Person war inzwischen dreimal in der Vergangenheit.“
Nelly näherte sich dem Monitor. „Also verändert sich die ganze Knochenstruktur?“
„Genau. Kennst du den Film Timeline? Dort haben die Forscher genau das herausgefunden. Je öfter man ein Fax sendet, umso schlechter wird die Qualität. Die wussten glaub ich gar nicht, wie recht sie damit hatten. Aber war ja nur ein Film.“ Er lachte leise.
Neat verschränkte ihre Arme und sah ihn fest an. „Und was willst du mir damit sagen?“
„Dass ich Cooper leider nicht mehr in der Vergangenheit suchen kann. Ich war schon dreimal dort, ein weiteres Mal würde ich nicht überleben.“ Er wirkte bedrückt. „Das sind nämlich meine Bilder.“
Nelly rang nach Luft und starrte ihren Bruder aus großen Augen an. „Was? Du warst schon mehrmals in der Vergangenheit?“
„Ja, und wir müssen unbedingt jemanden schicken, denn ich glaube, dass sich Cooper in Lebensgefahr befindet. Sicherlich haben die Leute, die die Prototypen gestohlen haben, längst herausgefunden, wie es funktioniert, und machen sich in der Vergangenheit auf die Suche nach Cooper.“
„Und warum wollen sie ausgerechnet Cooper?“
Er seufzte schwer. „Cooper hat herausgefunden, wie man gesund in die Vergangenheit reisen kann.“
„Was? Er hat herausgefunden, wie sich das hier …“, sie zeigte auf die verschlissene Hand auf dem Monitor, „… vermeiden lässt? Ich dachte, du hast den medizinischen Part?“
Ihr Bruder nickte genervt. „Habe ich auch, aber es hat viel mit der Umsetzung der Strahlen und so zu tun.“
„Dann können sie doch Cooper besser in der Gegenwart entführen und die Formel verlangen“, äußerte sie ihre Gedanken.
„Tja, das ist ja das Problem. Der Depp hat alle wichtigen Unterlagen mitgenommen. Ist so ein blöder Tick von ihm. Ich habe keine Kopien hier. Irgendjemand ist dahintergekommen und will mit aller Gewalt die Formeln haben. Und dafür müssen diese Personen ebenfalls in die Vergangenheit reisen und Cooper suchen. Und wenn sie ihn finden, haben sie alle originalen Aufzeichnung.“
„Wie doof kann man denn sein und schleppt solch wichtige Unterlagen stets mit sich herum?“ Sie schaute ihren Bruder verständnislos an.
„Genie und Wahnsinn liegen halt dicht beieinander.“
Nelly seufzte. „Und wie kommt man wieder zurück?“, wechselte sie das Thema.
Joseph öffnete eine Schublade und hielt einen kleinen Pager in der Hand. Er sah aus wie ein kleines Stück Holz und hatte eine Lederschlaufe an der Seite. „Wir können uns lediglich Nachrichten schicken. Jeder Reisende hat einen Sender im Körper. Wir können ihn damit orten und zurückholen. Das geht aber nicht, wenn sich die Person in einem Gebäude befindet.“
„Dann informiere ihn, dass er sich in Gefahr befindet, oder am besten, beame ihn unverzüglich zurück.“
„Ich habe aber seit Tagen keine Verbindung mehr zu ihm. Ich weiß nicht warum, aber er meldet sich nicht. Wenn ich ihn ganz urplötzlich ohne Vorwarnung zurückhole, können sich seine DNA mit Mauerstücken oder sonst was verbinden“, klärte er sie auf.
„Tja, dann käme er gleich als berühmte Statue wieder und er bekäme einen Ehrenplatz auf dem MI6-Gelände“, scherzte Neat trocken.
Joseph zog eine Grimasse. „Sehr witzig.“
Neat strich sich über ihre Haare und atmete laut aus. Sie blickte ihren Bruder aus besorgten Augen an. „Ihr wisst hoffentlich, dass diese Erfindung, sollte sie in die falschen Hände geraten, der Untergang für die Menschheit bedeuten könnte? Die ganze Geschichte kann verändert werden. Hitler zum Beispiel muss nicht sterben, denn jemand aus der heutigen Zeit könnte den Führer in der Vergangenheit warnen oder ihm Waffen beschaffen, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existierten.“ Sie hielt sich den Magen, denn bei den Gedanken wurde ihr sichtlich schlecht.
„Und genau deshalb müssen wir schnellstens jemanden in die Vergangenheit schicken, um Cooper zu warnen beziehungsweise um die Unterlagen wieder in die Gegenwart zu schaffen“, bestätigte er die erschreckenden Worte seiner Schwester.
Neat wandte sich von ihm ab und blieb direkt vor der Glasscheibe stehen und betrachtete die Geräte.
Joseph war ihr gefolgt und sie konnte sein Spiegelbild in der Scheibe sehen. „Und du weißt ganz genau, wen wir nur schicken können.“
„Sie wird es nicht machen.“