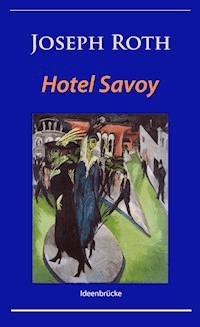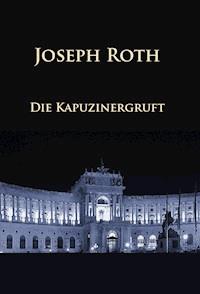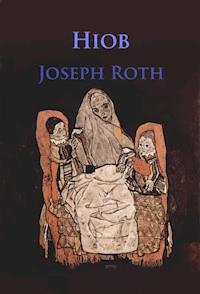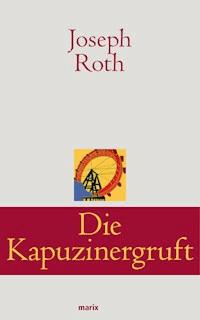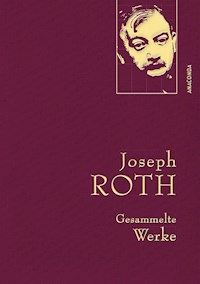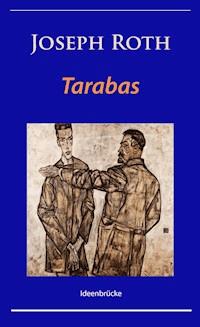
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ideenbrücke Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dem russischen Katholiken Tarabas weissagt eine Zigeunerin in Amerika, er werde ein Mörder und ein Heiliger werden ... Nach der Rückkehr nach Europa gerät er in die Wirren der russischen Revolution. "... eines seiner schönsten Bücher ..." (Hermann Hesse)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tarabas
Ein Gast auf dieser Erde
Erstmals erschienen 1934
ISBN 9783960555926
Erster Teil: Die PrüfungIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVZweiter Teil: Die ErfüllungXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXV
Im August des Jahres neunzehnhundertvierzehn lebte in New York ein junger Mann namens Nikolaus Tarabas. Er war der Staatsangehörigkeit nach Russe. Er entstammte einer jener Nationen, die damals noch der große Zar beherrschte und die man heute als »westliche Randvölker« bezeichnet.
Tarabas war der Sohn einer begüterten Familie. Er hatte in Petersburg die Technische Hochschule besucht. Weniger aus echter Gesinnung als infolge der ziellosen Leidenschaft seines jungen Herzens schloß er sich im dritten Semester seiner Studien einer revolutionären Gruppe an, die sich einige Zeit später an einem Bombenattentat gegen den Gouverneur von Cherson beteiligte. Tarabas und seine Kameraden kamen vors Gericht. Einige von ihnen wurden verurteilt, andere freigesprochen. Zu diesen gehörte Tarabas. Sein Vater verwies ihn von Haus und Hof und versprach ihm Geld für den Fall, daß er sich entschlösse, nach Amerika auszuwandern. Der junge Tarabas verließ die Heimat, unbesonnen, wie er zwei Jahre vorher Revolutionär geworden war. Er folgte der Neugier, dem Ruf der Ferne, sorglos und kräftig und voller Zuversicht auf ein »neues Leben«.
Allein schon zwei Monate nach seiner Ankunft in der großen, steinernen Stadt erwachte das Heimweh in ihm. Obwohl die Welt noch vor ihm lag, schien es ihm manchmal, sie läge hinter ihm bereits. Zuweilen fühlte er sich wie ein alter Mann, der sich nach einem verlorenen Leben sehnt und dem keine Zeit mehr bleibt, ein neues anzufangen. Also ließ er sich denn gehen, wie man sagt, machte keinerlei Versuche, sich an die neue Umgebung anzupassen und nach einem Unterhalt zu suchen. Er sehnte sich nach dem zartblauen Dunst seiner väterlichen Felder, den gefrorenen Schollen im Winter, dem unaufhörlich schmetternden Gesang der Lerchen im Sommer, dem süßlichen Duft bratender Kartoffeln auf herbstlichen Äckern, dem quakenden Lied der Frösche in den Sümpfen und dem scharfen Gewisper der Grillen auf den Wiesen. Das Heimweh trug Nikolaus Tarabas im Herzen. Er haßte New York, die hohen Häuser, die breiten Straßen und überhaupt alles, was Stein war. Und New York war eine steinerne Stadt.
Ein paar Monate nach seiner Ankunft hatte er Katharina kennengelernt, ein Mädchen aus Nischnij Nowgorod. Sie war Kellnerin in einer Bar. Tarabas liebte sie wie seine verlorene Heimat. Er konnte mit ihr sprechen, er durfte sie lieben, schmecken und riechen. Sie erinnerte ihn an die väterlichen Felder, an den heimischen Himmel, an den süßen Duft bratender Kartoffeln auf den herbstlichen Äckern der Heimat. Zwar stammte Katharina nicht aus seiner Gegend. Aber er verstand ihre Sprache. Sie begriff seine Launen und fügte sich ihnen. Sie milderte und verstärkte zugleich sein Heimweh. Sie sang die Lieder, die er auch in seiner Heimat gelernt hatte, und sie kannte Menschen genau von der Art, wie auch er sie kannte.
Er war eifersüchtig, wild und zärtlich, bereit, zu prügeln und zu küssen. Stundenlang trieb er sich in der Nähe der Bar herum, in der Katharina bedienstet war. Er saß oft lange an einem der Tische, die zu ihrem Rayon gehörten, beobachtete sie, die Kellner und die Gäste und ging manchmal in die Küche, um auch noch den Koch zu beobachten. Allmählich begann man, sich in der Anwesenheit Nikolaus Tarabas’ unbehaglich zu fühlen. Der Wirt drohte, Katharina zu entlassen. Tarabas drohte, den Wirt zu erschlagen. Katharina bat ihren Freund, nicht mehr in die Bar zu kommen. Dahin aber trieb ihn immer wieder die Eifersucht. Eines Abends beging er eine Gewalttat, die den Lauf seines Lebens verändern sollte. Vorher aber geschah folgendes:
An einem schwülen Spätsommertag geriet er auf einen der fliegenden Jahrmärkte, die in New York nicht selten sind. Er ging, ohne bestimmtes Ziel, von einem Zelt zum andern. Gegen wertloses Porzellan schleuderte er sinnlos hölzerne Kugeln, mit Flinte, Pistole und altertümlichem Bogen schoß er auf törichte Figuren und versetzte sie in törichte Bewegung, auf zahlreichen Karussells ließ er sich rundum treiben, rittlings auf Pferden, Eseln und Kamelen, auf einem Kahn fuhr er durch Grotten voll mechanischer Gespenster und düster gurgelnder Gewässer, auf einer Berg-und Talbahn genoß er die Ängste jäher Auf-und Abwärtsbewegung, und in den Schreckenskammern betrachtete er grausame Anomalien der Natur, Geschlechtskrankheiten und berühmte Mörder. Er blieb schließlich vor der Bude einer Zigeunerin stehn, die das Schicksal der Menschen aus den Händen zu weissagen versprach. Er war abergläubisch. Er hatte bis jetzt viele Gelegenheiten wahrgenommen, einen Blick in die Zukunft zu tun, Kartenleger und Sterndeuter befragt und sich selbst mit allerhand Broschüren über Astrologie, Hypnose, Suggestion beschäftigt. Schimmel und Schornsteinfeger, Nonnen, Mönche und Geistliche, denen er begegnete, bestimmten seine Wege, die Richtung seiner Spaziergänge und seine geringfügigsten Entschlüsse. Alten Frauen wich er am Morgen sorgfältig aus, ebenso rothaarigen Menschen. Und Juden, die er zufällig am Sonntag traf, hielt er für sichere Unheilsbringer. Mit diesen Dingen füllte er einen großen Teil seiner Tage aus.
Auch vor dem Zelt der Zigeunerin blieb er stehn. Auf dem umgestülpten Faß, vor dem sie auf einem Schemel hockte, lagen allerhand Gegenstände, deren sie zu ihrer Zauberei bedurfte, eine gläserne Kugel, gefüllt mit einer grünen Flüssigkeit, eine gelbe Wachskerze, Spielkarten und ein Häufchen Silbermünzen, ein Stäbchen aus rostbraunem Holz und Sterne verschiedener Größe aus blinkendem Goldlack. Viele Menschen drängten sich vor der Bude der Wahrsagerin, aber keiner getraute sich, vor sie hinzutreten. Sie war jung, schön und gleichgültig. Sie schien nicht einmal die Menschen zu sehen. Sie hielt die braunen, beringten Hände gefaltet im Schoß und ihre Augen auf die Hände gesenkt. Unter ihrer grellroten, seidenen Bluse sah man den lebendigen Atem ihrer vollen Brust. Es zitterten sachte die großen, goldenen Taler ihrer schweren, dreimal um den Hals gelegten Kette. An den Ohren trug sie die gleichen Taler. Und es war, als ginge ein Klirren von all dem Metall aus, obwohl man in Wirklichkeit keinen Klang vernahm. Es war, als sei die Zigeunerin gar nicht darauf bedacht, bezahlte Mittlerin zwischen unheimlichen Gewalten und irdischen Wesen zu sein, sondern vielmehr eine der Mächte, die das Geschick der Menschen nicht deuten, sondern selbst bestimmen.
Tarabas zwängte sich durch die Menge, trat vor das Faß und streckte ohne ein Wort die Hand aus. Langsam hob die Zigeunerin die Augen. Sie sah Tarabas ins Gesicht, bis er, unsicher geworden, eine Bewegung machte, als wollte er die Hand zurückziehn. Nun erst griff die Zigeunerin nach ihr. Tarabas fühlte die Wärme der braunen Finger und die Kühle der silbernen Ringe auf seiner flachen Hand. Allmählich, sehr sanft, zog ihn die Frau zu sich herüber, über das Faß, so daß sein Ellenbogen die gläserne Kugel streifte, sein Gesicht ganz nahe vor dem ihren stand. Die Leute hinter ihm drängten näher, im Rücken fühlte er ihre Neugier. Es war, als stieße ihn diese ihre Neugier zur Wahrsagerin hinüber – und er wäre gerne über das Faß gestiegen, um endlich getrennt von den Menschen zu sein und allein mit der Zigeunerin. Er hatte Angst, sie könnte laut über ihn sprechen, was die anderen vernehmen würden – und schon wollte er sein Vorhaben aufgeben. »Haben Sie keine Angst«, sagte sie in der Sprache seiner Heimat, »keiner wird mich verstehen. Aber geben Sie mir zuerst zwei Dollar, und so, daß es die andern sehn! Viele werden dann weggehn.«
Er erschrak, weil sie seine Muttersprache erraten hatte. Sie nahm mit der Linken das Geld, hielt es eine Weile hoch, damit die Menschen es sähen, und legte es dann auf das Faß. Hierauf sagte sie in Tarabas’ Muttersprache: »Sie sind sehr unglücklich, Herr! Ich lese in Ihrer Hand, daß Sie ein Mörder sind und ein Heiliger! Ein unglücklicheres Schicksal gibt es nicht auf dieser Welt. Sie werden sündigen und büßen – alles noch auf Erden.«
Dann ließ die Zigeunerin Tarabas’ Hand frei. Sie senkte die Augen, verschränkte die Hände im Schoß und blieb unbeweglich. Tarabas wandte sich, um zu gehen. Die Leute machten ihm Platz, voller Hochschätzung vor einem Mann, der einer Zigeunerin zwei Dollar gegeben hatte. Die einzelnen Worte der Wahrsagerin steckten in seinem Gedächtnis, ohne Zusammenhang, er konnte sie wiederholen, so, wie sie ihm gesagt worden waren. Gleichgültig ging er zwischen Schieß- und Zauberbuden einher, kehrte um, beschloß, das Fest zu verlassen, dachte an Katharina, die er bald, wie gewohnt, abholen sollte, glaubte zu fühlen, daß sie ihm fremd geworden war, und wehrte sich gegen dieses Gefühl. Es war Ende August … Der Himmel war bleiern und grau, ein schmaler Himmel aus Stein in schmalen Straßen, zwischen hohen, steinernen Häusern. Gewitter versprach man sich seit Tagen. Es kam nicht. Andere Gesetze herrschten in diesem Land, die Natur ließ sich von den praktischen Menschen dieses Landes bestimmen. Sie brauchten augenblicklich kein Gewitter. Tarabas sehnte sich nach einem Blitz, einem zackigen Blitz aus schweren Wolken, aus einem trächtigen, tief über weiten, goldenen Feldern hängenden Himmel. Es kam kein Gewitter. Tarabas verließ den Rummelplatz. Er ging zur Bar, zu Katharina. Er war also ein Mörder und ein Heiliger. Zu großen Dingen war er ausersehen.
Je näher er der Bar Katharinas kam, desto klarer wurde ihm auch, so glaubte er, der Sinn der Weissagung. Die Worte der Zigeunerin begannen, sich zu einer sinnvollen Kette aneinanderzureihen. Ich werde also dachte Tarabas – zuerst ein Mörder werden und dann ein Heiliger. (Es war nicht möglich, dem Schicksal, das gewiß ohne Rücksicht auf Tarabas seine Fäden spann, gewissermaßen auf halbem Wege entgegenzukommen und also das Leben vom nächsten Augenblick an freiwillig zu verändern.)
Als Tarabas die Bar betrat, auf den ersten Blick unter den bedienenden Mädchen Katharina nicht traf und auf die Frage, wo sie sei, die Antwort erhielt, sie habe heute um einen freien Tag angesucht, auch die Erlaubnis hierzu erhalten und solle gegen neun Uhr abends zurückkommen, war er betroffen; und er sah bereits in diesem Vorfall den Anfang des Schicksals, das man ihm prophezeit hatte. Er setzte sich an einen Tisch und bestellte einen Gin bei der Kellnerin, der er als ein Freund Katharinas wohlbekannt war; und er verbarg seine Unrast hinter einer der üblichen witzigen Wendungen, die alte Stammgäste Kellnern gegenüber anzuwenden belieben. Da ihm aber die Zeit zu lang wurde, bestellte er nach dem ersten auch noch ein zweites und ein drittes Glas. Und da er von Natur ein schwacher Trinker war, verlor er bald den sichern Sinn für die Dinge dieser Welt und für die Umstände, in denen er sich befand, und begann, in überflüssiger Weise Lärm zu schlagen.
Hierauf trat der Wirt, ein kräftiger und wohlgefütterter Bursche, der Tarabas seit langem nicht mehr wohlgesinnt war, auf ihn zu und forderte ihn auf, die Bar zu verlassen. Tarabas fluchte, zahlte, verließ die Bar, blieb aber, zum Kummer des Wirtes, vor der Tür stehn, um Katharina zu erwarten. Ein paar Minuten später kam sie, das Angesicht gerötet, die Haare zerzaust, offenbar in höchster Eile, Angst in den Augen, und, wie es Tarabas schien, schöner als je zuvor. »Wo warst du?« fragte er. »Bei der Post«, sagte Katharina. »Es ist ein Brief gekommen, rekommandiert, ich mußte ihn holen, ich war nicht zu Haus, als der Briefträger kam. Der Vater ist krank. Er wird vielleicht sterben. Ich muß nach Hause! So schnell wie möglich! Kannst du mir helfen! Hast du Geld?«
Eifersüchtig und mißtrauisch versuchte Tarabas, im Auge, in der Stimme und im Angesicht seiner Geliebten eine Lüge und einen Betrug zu erkennen. Er sah sie mit forschender, vorwurfsvoller Wehmut lange an, und da sie, nunmehr völlig verwirrt, den Kopf senkte, sagte er – und schon kochte in ihm der Zorn –: »Du lügst also! Wo warst du wirklich?« Im gleichen Augenblick fiel ihm ein, daß heute Mittwoch war, ein Tag, an dem der Koch frei war – und sein Verdacht ergriff nun etwas Wirkliches, eine lebendige Gestalt. Schreckliche Bilder rollten blitzschnell durch Tarabas’ Gehirn. Schon ballte er die Faust und stieß sie Katharina in die Rippen. Sie taumelte, verlor den Hut und ließ das Handtäschchen fallen. Dieses hob Tarabas hastig auf, durchwühlte es, fortwährend die Frage wiederholend, wo denn der Brief vom Vater sei. Der Brief fand sich nicht. »Ich muß ihn verloren haben! Ich war so aufgeregt!« lallte Katharina, und in ihren Augen standen große Tränen. »So, verloren!« brüllte Tarabas.
II
Tarabas bemerkte bald zu seinem Schrecken, daß er im Begriffe war, sich wieder der Bar zu nähern. Nun kehrte er um, bog um die Ecke, verlor sich in einer Seitenstraße, war überzeugt, daß er die linke Richtung einhalten müsse, und erkannte ein paar Sekunden hierauf, daß er im Rechteck herumgegangen war und sich nun zum zweitenmal in der Nähe der Bar befand. Unterdessen hielt er, wie es seine Art war, Ausschau nach einem der Zeichen, die Glück oder Unheil bringen konnten, einem Schimmel, einer Nonne, einem rothaarigen Menschen, einem rothaarigen Juden, einer Greisin, einem Buckligen. Da sich kein einziges Zeichen begab, beschloß er, anderen Dingen schicksalhafte Bedeutung zuzutrauen. Er begann, Laternen und Pflastersteine zu zählen, die kleinen, viereckigen Netzlöcher der Kanalgitter, die geschlossenen und die offenen Fenster dieser und jener Häuser und die Zahl seiner eigenen Schritte von einem bestimmten Punkt der Straße aus bis zum nächsten Übergang. Also beschäftigt mit der Prüfung verschiedenartigster Orakel, gelangte er vor eines jener langen, schmalen und wohltätig dunklen Kinotheater, die damals noch »Bioskope« oder »Kinematographen« hießen und manchmal die ganze Nacht bis zum Morgengrauen ihr vielfältiges Programm abrollen ließen, ohne Unterbrechung. Weil es Tarabas nun vorkam, daß dieses Theater vor ihm plötzlich auftauchte (und nicht, daß er davorgelangt war), nahm er es als ein Zeichen, kaufte eine Karte und betrat den finsteren Raum, geleitet von der gelblichen Lampe des Billetteurs.
Er setzte sich – und zwar nicht, wie er es sonst gewohnt war, auf einen Eckplatz, sondern in die Mitte, zwischen die anderen, nahe der Leinwand, obwohl er hier die Bilder weniger genau sehen konnte. Er war aber entschlossen, seine ganze Aufmerksamkeit den Vorgängen auf der Leinwand zu schenken. Dies wollte ihm eine Zeitlang nicht gelingen, sei es, weil er gerade in die Mitte der Handlung geraten war, sei es, weil er zu nahe der Leinwand Platz genommen hatte. Er mußte den Kopf recken, weil die Reihe, in der er saß, viel zu tief gelegen war, und bald schmerzte ihn der Nacken. Allmählich nahm ihn die Handlung gefangen, deren Anfang er zu erraten versuchte, als hätte er eines der Rätsel zu lösen, die in den illustrierten Zeitschriften standen und mit denen er sich oft die Stunden zu vertreiben pflegte, in welchen er auf Katharina warten mußte. Nunmehr erkannte er, daß es auf der Leinwand um das Schicksal eines sonderbaren Mannes ging, der unschuldig, und sogar aus edlen Grünen, nämlich um eine schutzlose Frau zu verteidigen, ein Verbrecher geworden war, ein Mörder, Dieb und Einbrecher – und der, unverstanden von der schutzlosen Dame, deretwegen er so viel Grausiges verübt hatte, ins Gefängnis kam in eine fürchterliche Zelle, zum Tode verurteilt wurde und zum Schafott schließlich geführt. Als man ihn, wie es üblich ist, nach seinem letzten Wunsch fragte, bat er um die Erlaubnis, mit seinem Blut den Namen der Geliebten an die Zellenwand malen zu dürfen, und um das Versprechen der Behörde, daß sie niemals diesen Namen auslöschen lassen würde. Er schnitt sich mit dem Messer, das ihm der Henkersknecht geliehen hatte, in die linke Hand, tauchte den rechten Zeigefinger in das Blut und schrieb an die steinerne Wand der Zelle den süßesten aller Namen: »Evelyn«. Die ganze Geschichte spielte, wie an den Kostümen zu erkennen war, nicht in Amerika, auch nicht in England, sondern in einem der sagenhaften Balkanländer Europas. Unbewegt starb der Held auf dem Schafott. Die Leinwand wurde still und leer. Das angenehme Surren des Apparates verstummte, ebenso das Klavier, das die Dramen begleitete. Ein paar Augenblicke war Tarabas der Überlegung überlassen, ob das Stück, das er gesehen hatte, einen so deutlichen Hinweis auf sein eigenes Erlebnis bedeuten mochte, daß er es als eines der besonderen Zeichen nehmen dürfe, die ihm, seiner Meinung nach, der Himmel zu schicken pflegte. Gewiß war jedenfalls ein Zusammenhang zwischen ihm und dem Helden vorhanden, zwischen Katharina und Evelyn. Ehe Tarabas noch dazu gelangen konnte, diesen Zusammenhang genauer festzustellen, belichtete sich wieder die Leinwand, und ein neuer Film begann.
Der behandelte eine biblische Geschichte, nämlich die Art, wie Dalila Simson die Haare abschnitt, um ihn schwach zu machen und gefügig den Philistern. War Tarabas bereits unter dem Einfluß des vorigen Stückes geneigt gewesen, sich der irdischen Gerechtigkeit zu überliefern und das heldenmütige Geschick zu erleiden, das ihn dem Mann auf dem Schafott anzunähern geschienen hatte, so wurde er jetzt durch die Gestalt Simsons, der noch als Geblendeter Rache an den Philistern und an Dalila nahm, verführt, sich eher den viel heroischeren Tod Simsons zu wünschen. Und, eine Beziehung herstellend zwischen Dalila und Katharina, begann er, die beiden zu verwechseln. Er überlegte, auf welche Weise es möglich wäre, unter den gänzlich von den biblischen verschiedenen amerikanischen Umständen an der Welt der Philister Rache zu nehmen, nach der Art des judäischen Helden. Mußte es doch auch in New York Wunder geben wie im alten Lande Israel. Und mit Hilfe Gottes, der wahrscheinlich ein Gönner Tarabas’ war, konnte man die mächtigen Säulen der Gefängnisse und Gerichte stürzen. Kraft fühlte Tarabas in seinen Muskeln. Ein starker Glaube lebte in seinem Herzen. Er war Katholik. Lange schon hatte er nicht mehr die Kirche besucht. Als junger Mann und Student, der Revolution ergeben, hatte er dem gefürchteten Gott seiner Kindheit den Gehorsam und den Glauben gekündigt und war kurz hierauf dem Aberglauben an Schornsteinfeger, Schimmel und rothaarige Juden anheimgefallen. Aber immer noch hegte und liebte er die Vorstellung von einem Gott, der die Gläubigen nicht verließ und der die Sünder liebte. Gewiß: Gott liebte ihn, Nikolaus Tarabas. Er war entschlossen, nach dem Ende des Programms sich der irdischen Gerechtigkeit zu stellen, in frommer Zuversicht auf die himmlische Gnade.
III
Es hatte in der Nacht geregnet. Der Morgen war frisch, die Pflastersteine waren noch naß. Sie trockneten aber schnell im herben, beständigen Morgenwind. Schon ratterte der Spritzwagen durch die Straßen und netzte das Pflaster aufs neue.
Tarabas beschloß, sich dem ersten Polizisten auszuliefern, der ihm begegnen würde. Da aber vorläufig keiner kam, überlegte Tarabas, daß es günstiger wäre, erst den dritten anzusprechen – und zwar der Zahl Drei wegen, die ihm immer Glück gebracht hatte. Ob der Wirt tot war oder am Leben, hing höchstwahrscheinlich davon ab.
Der erste Polizist überholte Tarabas. Es war eigentlich keine Begegnung. Jene, die ihm Angesicht in Angesicht entgegenkamen, waren für Tarabas Begegnungen. Nun kam einer, schlenkernd mit dem Gummiknüppel, morgenmüd und gähnend: der erste also. Um die Begegnung mit dem zweiten so lange wie möglich hinauszuschieben, bog Tarabas in die nächste Seitengasse. Aber hier stieß er auf einen andern, der munter und jugendlich aussah, als hätte er soeben erst den Dienst angetreten. Tarabas lächelte ihm zu und kehrte sofort um. Nicht vor dem Gesetz, das ihn bereits verfolgen mochte, fürchtete er sich, sondern davor, daß die Prophezeiung schneller erfüllt werden könnte, als er gedacht hatte. Nun bleibt mir noch der letzte, dachte Tarabas, und dann ist alles in Gottes Hand!
Auf der Hauptstraße aber, in die er zurückgekehrt war, zeigte sich wohl eine halbe Stunde lang kein Polizist mehr. Schon begann Tarabas, sich geradezu nach einem dritten zu sehnen. In dem Augenblick aber, in dem einer auftauchte, am äußersten Ende der breiten Straße und in deren Mitte – und der schwarze Helm ragte gegen das tiefe Grün des Parks, der die Straße abschloß –, in diesem Augenblick erscholl die helle Stimme eines der ersten Zeitungsjungen von New York.
»Krieg zwischen Österreich und Rußland!« schmetterte die Stimme des Jungen. – »Krieg zwischen Österreich und Rußland!« – »Krieg zwischen Österreich und Rußland!«
Der Polizist kam heran und blickte in die morgenfrische Zeitung, Tarabas über die Schulter.
»Es ist Krieg«, sagte Tarabas zum Polizisten, »und ich werde in diesen Krieg gehn!«
»Dann kommen Sie auch lebendig zurück!« sagte der Polizist, hob die Hand an den Helm und entfernte sich.
IV
Angesichts des gewaltigen Hafens von New York, der großen, bräutlich-weißen Schiffe, vor dem ewigen Anschlag eintöniger, dunkelgrüner Wellen an Planke und Stein, dem Gewoge der Träger, der Matrosen, der Beamten, der Zuschauer, der Händler, verlor Nikolaus Tarabas vollends die Erinnerung an den vorhergegangenen Tag. Die Herzen kühner, törichter und leicht berauschter Menschen sind unergründlich; nächtliche Brunnen sind es, in denen die Gedanken, die Gefühle, die Erinnerungen, die Ängste, die Hoffnungen, ja die Reue selbst versinken können und zeitweise auch die Furcht vor Gott. Tief und dunkel, ein wahrer Brunnen, war Nikolaus Tarabas’ Herz. In seinen großen, hellen Augen aber leuchtete die Unschuld.
Immerhin: als er das Schiff bestieg, kaufte er alle Zeitungen, die in der letzten Stunde erreichbar waren, um nachzulesen, ob sich nicht doch irgendeine Nachricht von dem Mord eines gewissen Tarabas an einem gewissen Wirt einer bestimmten Bar fände. Es war, als suchte Tarabas nach dem Bericht eines Vorgangs, dessen Zeuge lediglich er gewesen wäre. Wichtiger schien ihm das Schiff, die Kabine, die er bewohnen sollte, schienen ihm die merkwürdigen Passagiere, die es führen mochte, der Krieg und die Heimat, denen er entgegenfuhr. Den heimatlichen Feldern fuhr er entgegen, dem Geschmetter der Lerchen, dem Gewisper der Grillen, dem süßlichen Duft bratender Kartoffeln auf den Äckern, dem silbernen Staketenzaun, ringsum geschlungen um das väterliche Gehöft wie ein geflochtener Ring aus Birkenholz, dem Vater, der Nikolaus früher grausam erschienen war und nach dem er sich jetzt wieder sehnte. In zwei mächtigen, schwarzgrauen Hälften lag der Schnurrbart des Vaters über dem Mund, eine gewaltige Kette aus struppigem Haar, oft im Laufe des Tages gebürstet und gekämmt, natürliches Abzeichen häuslicher Allgewalt. Sanft und blond war Tarabas’ Mutter. Liebling des Vaters waren die zwölfjährige Lusia gewesen und die Cousine, Tochter des frühverstorbenen, sehr reichen Onkels Maria. Ein fünfzehnjähriges Mädchen, oft im Streit mit Nikolaus Tarabas, zanksüchtig und hübsch. Alles lag weit, unsichtbar noch, aber schon fühlbar, hinter den dunkelgrünen Wogenkämmen des Ozeans und weiter, dort, wo er sich dem Himmel entgegenwölbte, um sich mit ihm zu vereinigen.
In den Zeitungen stand nichts von einem Mord an einem Barwirt. Tarabas warf sie, alle auf einmal, ins Meer. Wahrscheinlich war der Wirt nicht gestorben. Eine kleine Schlägerei war es gewesen, nichts mehr. In New York und in aller Welt kamen täglich tausende dergleichen vor. Als Tarabas sah, wie Wind und Wasser die Zeitungen davontrugen, dachte er, nun sei Amerika endgültig erledigt. Eine Weile später fiel ihm Katharina ein. Er war gut zu ihr gewesen, sie hatte ihm die Heimat ersetzt – und ihn nur ein einziges Mal belogen. Glücklich war Tarabas in diesem Augenblick. (Glück allein konnte seine Großmut wecken.) Möge sie sehen, dachte er, was ich für ein Mann bin und was sie an mir verloren hat. Trauern wird sie um mich, vielleicht wird sie auch, wenn es wahr ist, was sie mir erzählt hat, ihren kranken Vater besuchen. Trauern soll sie jedenfalls um mich! Und er ging hin und schrieb ein paar Zeilen an Katharina. Der Krieg riefe ihn. Ausharren möchte Katharina. Treue erwarte er von ihr. Geld schickte er ihr eben. Und er schickte ihr in der Tat fünfzig Rubel, die Hälfte des Reisegeldes, das er von der Botschaft bekommen hatte.
Erleichtert (und auch ein wenig stolz) betrieb er dann weiter den Müßiggang eines Schiffspassagiers, spielte Karten mit Fremden, führte Gespräche ohne Sinn; sah die hübschen Frauen oft mit begierigen Augen an, und kam es mit einer von ihnen zu einer Unterhaltung, vergaß er nicht, zu erwähnen, daß er als russischer Leutnant der Reserve in den Krieg ziehe. Hie und da glaubte er auch in den Augen der Frauen Bewunderung – und Verheißungen – zu lesen. Aber dabei ließ er es bewenden. Die Seereise behagte ihm. Sein Appetit war mächtig, sein Schlaf ausgezeichnet. Cognac und Whisky trank er viel. Auf dem Meere vertrug man sie weitaus besser als zu Lande.
Er mußte nach Cherson einrücken, zum Kader seines Regiments. Mit ihm verließen zwei junge Männer das Schiff, Soldaten, Offiziere. Er hatte sie während der Seefahrt nicht gesehn. Nun fragte er sie, ob sie auch einrückten. Jawohl, sagten sie, in die Petersburger Garnison; sie seien aber aus Kiew. Wäre man einmal beim Regiment, wer weiß, ob man da noch Urlaub bekäme, die Heimat zu sehn. Also führen sie zuerst nach Hause, und dann erst zum Regiment. Sie rieten ihm, das gleiche zu tun.
Dies leuchtete Tarabas ein. Der Krieg hatte eine brüderliche Ähnlichkeit mit dem Tode bekommen. Wer weiß, ob man da noch Urlaub erhielt – sagten die beiden. In Tarabas’ Zimmer, im Schrank, hing die Uniform, die er liebte, ähnlich liebte wie Vater, Mutter, Schwester und Haus. Dank seinen Beziehungen und seinem Geld war es dem alten Tarabas gelungen, die Gnade des Zaren anzurufen und dem Sohn die Charge eines Leutnants zu erhalten – ein paar Monate schon, nachdem der unselige Prozeß vergessen worden war. Dies erschien Nikolaus Tarabas nur selbstverständlich. Seiner Meinung nach war er es, der dem Zaren die Gnade erwies, im Dreiundneunzigsten Infanterieregiment als Leutnant zu dienen. Es wäre ein schwerer Schaden der russischen Armee widerfahren, wenn man Tarabas degradiert hätte.
Tarabas stieg also in den Zug, der in seine Heimat fuhr. Er kündigte seine Ankunft nicht an. Überraschungen zu erleben, Überraschungen zu bereiten war seine Lust. Wie ein Befreier wollte er heimkommen! Wie mochten sie sich fürchten, so nahe der Grenze! Sicherheit und Sieg wollte er ihnen bringen!
Frohgemut ließ sich Tarabas im überfüllten Zug nieder, gab dem Schaffner ein überraschendes Trinkgeld, erklärte, er sei ein »besonderer Kurier« in besonderen Angelegenheiten des Kriegs, schob den Riegel vor und betrachtete mit Wollust die Passagiere, die, trotz ihrem unbestreitbaren Recht, in seinem Kupee Platz zu nehmen, dennoch im Korridor stehen mußten. Eine außergewöhnliche Zeit, die Leute hatten die Pflicht, sich mit ihr abzufinden und einem außergewöhnlichen »Kurier des Zaren« die Bequemlichkeit zu lassen, die für seine besondere Aufgabe unentbehrlich war. Von Zeit zu Zeit ging Tarabas in den Korridor, musterte hochmütig die Armen, die da stehen mußten, zwang die Müden, die auf ihren umgestülpten Koffern saßen, aufzustehn und ihm Platz zu machen, stellte befriedigt fest, daß alle ohne Widerspruch seinem blitzblauen Auge gehorchten und ihn sogar mit einigem Wohlgefallen ansahen, und mit übertriebener Strenge gab er dem Schaffner, so daß es alle hören konnten, Befehle, Tee zu kochen und dies und jenes von den Stationen zu holen. Manchmal riß er die Kupeetür auf und beschwerte sich über die allzu lauten Gespräche der Passagiere im Korridor. Sie brachen in der Tat sofort ihre Unterhaltungen ab, wenn sie Tarabas erblickten.
Befriedigt und belustigt von der eigenen Klugheit wie von der Torheit der anderen, verließ Nikolaus Tarabas den Zug am Morgen nach einem ungestörten, gesunden Schlaf. Kaum zwei Werst trennten ihn noch vom väterlichen Hause. Freilich erkannten und begrüßten ihn der Stationschef, der Portier, die Gepäckträger. Auf ihre herzlichen Fragen erwiderte er mit amtlicher Geschäftigkeit, er sei in allerwichtigstem und allerhöchstem Auftrag aus Amerika zurückberufen worden, immer den gleichen Satz wiederholend, ohne das freundliche Lächeln zu verlieren und den Glanz seiner blitzblauen Kinderaugen. Als ihn der und jener fragte, ob er zu Hause angekündigt worden sei, legte Tarabas einen Finger an den Mund. Also gebot er Schweigen und weckte Respekt. Und als er sich ohne Gepäck, so, wie er New York verlassen hatte, vom Bahnhof entfernte und den schmalen Landweg einschlug, der zum Hause des Geschlechtes Tarabas führte, legte einer der Beamten nach dem anderen den Finger an den Mund, genauso, wie es Tarabas getan hatte, und alle glaubten sie zu wissen, daß Tarabas, ihnen seit seiner Kindheit vertraut, ein großes Staatsgeheimnis mit sich trage.
Um die Stunde, in der man, wie er wußte, zu Hause Mittag aß, kam Nikolaus an. Er ging, um die »Überraschung« vollkommen zu machen, nicht den breiten Weg hinan, der zu seinem Hause führte und den die schlanken, zarten und so lang entbehrten Birken zu beiden Seiten begleiteten, sondern über den feuchten, schmalen Pfad zwischen den breiten Sümpfen, den die vereinzelten Weiden, zuverlässige Wegweiser, bezeichneten und der im halben Bogen hinter das Haus führte und unter dem Fenster Nikolaus Tarabas’ endete. Im Dachgiebel lag sein Zimmer. Wildes Weinlaub, alt schon, feste und biegsame Ruten, von hartem Draht durchflochten, wucherten an der Wand, bis zu den grauen Schindeln des Daches. Statt der Stiege die Weinlaubruten zu benutzen war für Tarabas eine Kleinigkeit. Das Fenster – mochte es auch geschlossen sein – mit einem seit der Kindheit geübten Griff zu lockern und lautlos aufzustoßen schien ihm ebensoleicht. Er zog die Schuhe aus und steckte sie in die Rocktaschen, wie er in der Kindheit getan hatte. Und, gewandt, ohne Laut, wie er es als Knabe gewohnt gewesen, klomm er die Wand empor; zufällig war das Fenster offen; einen Augenblick später stand er in seinem Zimmer. Er schlich zur Tür und schob den Riegel vor. Der Schlüssel steckte noch im Schrank. Man mußte sich sachte mit der Schulter gegen den Schrank lehnen, wollte man verhüten, daß er knarre. Jetzt war er offen. Säuberlich über Bügeln hing die Uniform. Tarabas legte den Zivilanzug ab. Er zog die Uniform an. Den Säbel befreite er mit geschwinden Händen von der papierenen Hülle. Der Gürtel knarrte. Schon war Tarabas gerüstet. Er ging auf Zehen die Treppe hinunter, klopfte an die Tür des Speisezimmers und trat ein.
Vater und Mutter, die Schwester und die Cousine Maria saßen auf ihren gewohnten Plätzen. Man aß Kascha.
Zuerst begrüßte er den langentbehrten heißen Duft dieser Speise, einen Duft aus gerösteten Zwiebeln und gleichzeitig eine Wolke gewordene selige Erinnerung an Feld und Getreide. Zum erstenmal, seitdem er das Schiff verlassen hatte, verspürte er wieder Hunger. Hinter dem leisen Dunst, der aus der vollen Schüssel in der Mitte des Tisches aufstieg, verschwammen die Gesichter der Familie. Sekunden später erst bemerkte Tarabas ihr Erstaunen, vernahm er erst das Klirren der hingelegten Bestecke, das Geräusch der rückenden Stühle. Als erster stand der alte Tarabas auf. Er breitete die Arme aus. Nikolaus eilte ihm entgegen und konnte nicht umhin, zwei, drei Körner der langentbehrten Speise im Schnurrbart des Vaters zu bemerken. Dieser Anblick verminderte beträchtlich die Zärtlichkeit des Jungen. Nachdem sie sich geräuschvoll geküßt hatten, begrüßte Nikolaus die Mutter, die sich eben schluchzend erhob, die Schwester, die ihren Platz verließ und rings um den Tisch ging, den Bruder zu erreichen, und die Cousine Maria, die sich ihm, der Schwester folgend, langsamer näherte. Nikolaus umarmte sie. »Ich hätte dich niemals erkannt«, sagte er zu Maria. Durch das feste Tuch seiner Uniform spürte er ihre warme Brust. In diesem Augenblick begehrte er die Cousine Maria so heftig und ungeduldig, daß er den Hunger vergaß. Die Cousine huschte nur mit gespitzten, kühlen Lippen über seine Wange. Der alte Tarabas rückte einen Stuhl herbei und hieß den Sohn, sich an seine Rechte zu setzen. Nikolaus setzte sich. Er lechzte wieder nach der Kascha. Er sah gleichzeitig Maria an und schämte sich seines Hungers. »Hast du gegessen?« fragte die Mutter. »Nein!« sagte Nikolaus; fast rief er es.
Man schob ihm Teller und Löffel hin. Während er aß und erzählte, wie er gekommen, ungesehn in sein Zimmer geklettert war und die Uniform angezogen hatte, beobachtete er die Cousine. Sie war kräftig, ein beinahe gedrungenes Mädchen. Ihre zwei braunen Zöpfe hingen züchtig und zuchtlos zugleich über ihre Schultern und begegneten einander, unter dem Tischtuch, wahrscheinlich im Schoß. Manchmal nahm Maria die Hände vom Tisch und spielte mit den Enden ihrer Zöpfe. In ihrem jungen, bäuerlichen, gleichgültigen und ausdruckslosen Angesicht fielen die sanften, schwarzen, seidigen, langen und aufwärtsgebogenen Wimpern auf, zarte Vorhänge vor den halbgeschlossenen, grauen Augen. Auf ihrer Brust lag ein kräftiges, silbernes Kreuz. Sünde, dachte Tarabas: das Kreuz erregte ihn. Ein heiliger Wächter war es über der lockenden Brust Marias.
Hübsch, breitschultrig, schmalhüftig sah Tarabas in der Uniform aus. Man bat ihn, von Amerika zu erzählen. Man wartete: er schwieg. Man begann, vom Krieg zu sprechen. Der alte Tarabas sagte, der Krieg würde drei Wochen dauern. Nicht alle Soldaten fielen, und von den Offizieren stürben bestimmt nur wenige. Nun fing die Mutter zu weinen an. Darauf achtete der alte Tarabas keineswegs. Als gehörte es zu den selbstverständlichen Eigenschaften einer Mutter, Tränen zu vergießen, dieweil die anderen essen und sprechen, hielt er weitläufige Vorträge über die Schwäche der Feinde und die Stärke der Russen; und nicht für einen Augenblick wurde ihm klar, daß der finstere Tod schon seine hageren Hände über dem ganzen Lande kreuzte und auch über Nikolaus, seinem Sohn. Taub und stumpf war der alte Tarabas. Die Mutter weinte.
Der Staketenzaun aus silbernen Birkenknüppeln umringte noch das väterliche Gehöft; und es war gerade die Zeit, wo die Knechte die Apfelbäume schüttelten, die Mägde hoch hinauf in die Zweige krochen, um die Früchte zu pflücken und auch, um von den Knechten besser gesehen zu werden. Sie hoben die leuchtend roten Röcke und zeigten die weißen, starken Waden und die Schenkel. Die späten Schwalben flogen in großen, dreieckigen Schwärmen nach dem Süden. Die Lerchen schmetterten immer noch, unsichtbar im Blau. Offen standen die Fenster. Und man hörte das scharfe, schwirrende Singen der Sensen – man schnitt schon die letzten Halme von den Feldern – in größter Hast, wie der Vater erzählte. Denn die Bauern mußten einrücken, morgen, übermorgen oder in einer Woche.
All dies gelangte zum heimgekehrten Tarabas wie aus einer unendlichen Ferne. Er wunderte sich, daß Haus, Hof, Land, Vater und Mutter ihm näher gewesen waren im weiten, steinernen New York als hier, und obwohl er doch hierhergekommen war, sie zu umarmen und seinem Herzen nahe zu fühlen. Tarabas war enttäuscht. Daß sie ihn als heimgekehrten verlorenen Sohn begrüßen würden, als Retter und als Helden: so hatte er es sich ausgemalt. Man behandelte ihn allzu gleichgültig. Die Mutter weinte: aber so sei ihre Natur, meinte Tarabas. In New York hatte er eine andere Mutter gesehn, eine zärtlichere, verzweifelte Mutter, wie sie sein eitles Kinderherz brauchte. Hatte man sich während seiner langen Abwesenheit daran gewöhnt, das Haus Tarabas ohne den einzigen Sohn zu sehn? Eine Überraschung hatte er ihnen bereiten wollen, durchs Fenster war er gestiegen, immer noch harmlos wie als Knabe, die Uniform hatte er angezogen und war ins Zimmer getreten, so, als wäre er gar niemals in Amerika gewesen. Ihnen aber schien es ganz selbstverständlich, daß er so plötzlich daherkam!
Er aß, gekränkt, stumm und mit gutem Appetit. Er führte wortlos einen Löffel nach dem andern zum Mund, es war ihm, als äße er nicht selbst, als fütterte ihn ein anderer. Nun war er gesättigt. Mit einem Blick auf die Cousine Maria sagte er: »Ich muß also morgen früh abreisen. Ich muß spätestens übermorgen beim Regiment sein.« Bat man ihn etwa zu bleiben? – Keineswegs! – »Recht, recht!« sagte der Vater. Ein wenig heftiger schluchzte die Mutter auf. Unbewegt blieb die Schwester. Maria senkte die Augen. Das große Kreuz an ihrer Brust glänzte. Man erhob sich schließlich vom Tisch.
Am Nachmittag stattete Tarabas ein paar Besuche ab, beim Pfarrer, bei Gutsnachbarn. Er ließ einspannen. Und im Glanz seiner Uniform, eine großartige Erscheinung aus Blau und Silber, fuhr er, ein wenig fremd, durch das Grün und Gelb des Herbstes, mit der Zunge schnalzend – und sooft er irgendwo hielt, wendete er in einem eleganten und kühnen Bogen, die Zügel straffend, und die Pferde blieben stehen, wie erzene Pferde auf Monumenten. Das war immer schon Tarabas’ Art gewesen. Alle kleinen Bauern grüßten ihn, die Fenster öffneten sich, eine große, sonnendurchglänzte Staubwolke ließ er hinter sich. Seine Fahrt befriedigte ihn, auch gefiel ihm der Respekt, den man ihm überall unterwegs zollte. Dennoch glaubte er eine große, unbekannte Angst in den Gesichtern zu sehen. Der Krieg hatte noch nicht begonnen, und schon wohnte sein Schrecken in den Menschen. Und wenn sie Tarabas etwas Angenehmes sagen wollten, quälten sie sich, und sie sagten ihm nicht alles, was sie im Herzen trugen. Fremd war Tarabas in seinem Lande – der Krieg war hier heimisch geworden.
Der Abend kam. Tarabas zögerte, nach Hause zu fahren. Locker ließ er die Zügel und die Rosse im träumerischen Schritt. Als er den Anfang der Birkenallee erreichte, die geradeaus zum Hause führte, stieg er ab. Die Pferde kannten den Weg. Vor den großen Ställen, linker Hand vom Hause, blieben sie stehen und wieherten klug und gaben ihre Ankunft zu erkennen, und der Hofhund bellte, wenn der Knecht nicht sofort kam. Die Pferde allein hatten Tarabas erkannt. Zärtlichkeit erfüllte ihn, er streichelte die heißen, rostbraunen, glänzenden Leiber, legte seine Stirn an die Stirn jedes Tieres, atmete den Dunst ihrer Nüstern und fühlte die wohlige Kühle der ledernen Haut. In den großen, glänzenden Augen der Pferde glaubte er alle Liebe der Welt zu sehen.
Er schlug zum zweitenmal den Seitenweg ein, zwischen den Weiden, wie am Morgen. Die Frösche lärmten zu beiden Seiten, es roch nach Regen, obwohl der Himmel wolkenrein war und die herbstliche Sonne in glänzender Reinheit unterging. Sie blendete ihn. Er mußte den Blick senken, um auf den Weg zu achten, den Pfad nicht zu verlieren. Also sah er nicht, daß ihm jemand entgegenkam. Überrascht nahm er einen Schatten dicht vor seinen Füßen wahr, ahnte im Nu, wem er gehörte, blieb stehen. Maria kam ihm entgegen. Sie hatte ihn also vermißt. Die hochgeschnürten Stiefel setzte sie zierlich und achtsam auf den schmalen Pfad. Es gelüstete Tarabas plötzlich, die vielfältig geflochtenen Schnüre aufzuschneiden. Wut und Wollust erfüllten ihn. Es gab kein Ausweichen. Er ließ Maria herankommen. Er legte einen Arm um sie und so, sorgfältig und hart aneinandergedrückt aus Angst vor dem Sumpf zu beiden Seiten (und auch aus Heimweh), berührten sich manchmal ihre Füße auf dem schmalen Pfad. Sie kehrten zurück in den Wald. Späte Vögel riefen. Sie sprachen kein Wort. Sie umarmten sich plötzlich. Sie wandten sich, beide gleichzeitig, einander zu, umschlangen sich, taumelten und sanken auf die Erde.
Als sie aufstanden, blinkten die Sterne durch die Baumkronen. Es fröstelte sie. Sie klammerten sich aneinander und kehrten auf dem Hauptweg ins Haus zurück. Vor dem Eingang blieben sie stehen, küßten sich lange, als nähmen sie Abschied für immer. »Du gehst zuerst hinein«, sagte Tarabas. Es war der einzige Satz, der die ganze Zeit über zwischen beiden gefallen war.
Tarabas folgte langsam.
Man sammelte sich zum Abendessen. Wann er weg müsse, fragte der Alte den Sohn. Um vier Uhr morgens, sagte Nikolaus, damit er ja nicht den Zug versäume. Das hätte er also richtig vorausbedacht, sagte der Alte. Man trug das besondere Mahl auf, das er am Nachmittag angeordnet hatte: Grütze in dampfender Milch, gekochtes Schweinefleisch mit Kartoffeln, Wodka und hellen Burgunder dazwischen und weißen Schafkäse zum Beschluß. Man wurde laut. Der Alte fragte. Nikolaus erzählte von Amerika. Er erfand für den Augenblick eine Fabrik, in der er soeben zu arbeiten angefangen hatte, eine Fabrik. Dort stellte man Filme her. Eine recht amerikanische Fabrik. Als er, wie schon seit Wochen, jeden Morgen um fünf Uhr früh im Begriffe war, sich an seine Arbeitsstelle zu begeben, riefen die Zeitungsjungen die Nachricht vom Kriege aus – und also fuhr er dann geradewegs in die russische Botschaft. Einen Abend vorher hatte es noch zwischen ihm, Tarabas, und einem ekelhaften Barwirt eine Schlägerei gegeben. Der Wirt hatte ein unschuldiges Mädchen, wahrscheinlich seine Kellnerin, beschimpft und sogar angegriffen. Solche Menschen gab es in New York.
Selbst die gleichgültige Schwester horchte auf, als Nikolaus diese Geschichte erzählte, und immer wieder sagte die Mutter: »Gott segne dich, mein Junge!« Tarabas selbst war überzeugt, daß er die pure Wahrheit erzählte.
Und man erhob sich. Man feierte im Stehen Abschied. Und der alte Tarabas sagte, daß man den Sohn in vier Wochen wiedersehen werde. Und alle küßten ihn. Er wollte morgen früh niemanden mehr sehn. Maria küßte ihn flüchtig. Die Mutter hielt ihn eine Weile in den Armen und wiegte ihn so im Stehen. Vielleicht erinnerte sie sich an die Zeit, in der sie ihn noch im Schoß gewiegt hatte.
Das Gesinde kam. Mit jedem, Knecht und Magd, tauschte Nikolaus den Abschiedskuß.
Er ging in sein Zimmer. Er legte sich, so wie er war, Schlamm an den Stiefeln, aufs Bett. Er schlief wohl eine Stunde, erwachte dann infolge eines unbekannten Geräusches, sah, daß seine Tür offen war, ging hin, um sie zu schließen. Ein Windstoß hatte sie geöffnet. Auch das Fenster gegenüber war offen.
Er konnte nicht mehr einschlafen. Es kam ihm in den Sinn, daß es nicht just der Wind gewesen sein mußte. Hatte Maria versucht, ihn wiederzutreffen? – Warum schlief sie nicht mit ihm, in der letzten Nacht, die er in diesem Hause verbrachte? Ihr Zimmer kannte er. Im Hemd lag sie nun, das Kreuz über dem Bett. (Es schreckte ihn ein wenig.)
Er öffnete die Tür. Er ließ sich mit beiden Händen das Geländer der Treppe hinuntergleiten, um nicht mit den schweren Stiefeln die Stufen zu betreten. Jetzt öffnete er Marias Tür. Er riegelte sie ab. Er blieb eine Weile reglos. Dort war das Bett, er kannte es, als Knabe hatte er mit Maria und der Schwester die Laken abgezogen, um Leichenzug zu spielen. Eines nach dem anderen hatten sie sich totgestellt. Durch das große Rechteck des Fensters leuchtete die hellblaue Nacht. Tarabas trat ans Bett. Die Diele knarrte, und Maria fuhr auf. Halb noch im Schlaf und ganz vom Schrecken gefangen, breitete sie die Arme aus. Sie empfing Tarabas, so wie er war, gerüstet und gestiefelt, fühlte mit Wonne seine harten Bartstoppeln auf dem Angesicht und haschte mit ungelenken Händen nach seinem Nacken.
Satt, herrisch und lärmend erhob er sich. Sanft und schon ein wenig ungeduldig legte er Marias Hände, die sie ihm entgegenstreckte, auf das Bett zurück. »Du gehörst mir!« sagte Tarabas; »wir heiraten, bis ich zurückkomme. Du bist treu. Du siehst keinen Mann an. Leb wohl!« – Und er verließ das Zimmer, ging, ohne auf den Lärm zu achten, den er verursachen mochte, die Treppe hinauf, um seine Sachen zu holen.
Oben, in der Stube, saß der alte Tarabas. Man spioniert also, dachte Nikolaus im Nu. Man spioniert mich aus. Der alte Grimm gegen den Vater erwachte wieder, der Grimm gegen den Alten, der einen grausam vertrieben hatte, in das grausame New York. Der Vater erhob sich, sein Schlafrock klaffte auseinander, man sah das Bauernhemd und die langen Schläuche der Unterhosen aus Sackleinewand, zusammengebunden über den mächtigen Knöcheln. Mit beiden Händen ergriff der Vater Nikolaus an den Epauletten. »Ich degradiere dich!« sagte der Alte. Oh, man kannte diese Stimme sehr gut, sie war nicht lauter als gewöhnlich. Nur der Adamsapfel bewegte sich auf und nieder, heftiger als sonst und in den Augen stand der kalte Zorn, Zorn aus blankem Eis. Jetzt geschieht was, dachte Nikolaus, die Angst um seine Epauletten verwirrte ihn. »Laß los!« schrie er. Im nächsten Augenblick sauste die väterliche Hand gegen seine Wange. Nikolaus wich zurück, indes der Alte den Schlafrock wieder zusammenraffte.
»Wenn du gesund heimkehrst, heiratest du!« sagte der Alte. »Und nun geh! Sofort! Verschwinde!«
VI
Der Krieg wurde seine Heimat. Der Krieg wurde seine große, blutige Heimat. Von einem Teil der Front zum andern kam er. Er kam in friedliches Gebiet, setzte Dörfer in Brand, ließ die Trümmer kleiner und größerer Städte zurück, klagende Frauen, verwaiste Kinder, geschlagene, aufgehängte und ermordete Männer. Er kehrte um, erlebte die Unrast auf der Flucht vor dem Feind, nahm Rache im letzten Augenblick an vermeintlichen Verrätern, zerstörte Brücken, Straßen, Eisenbahnen, gehorchte und befahl, und alles mit gleicher Lust. Er war der mutigste Offizier in seinem Regiment. Patrouillen führte er mit der Vorsicht und Schlauheit, mit der die nächtlichen Raubtiere auf Beute ausgehn, und mit der zuversichtlichen Kühnheit eines törichten Mannes, der seines Lebens nicht achtet. Mit Pistole und Peitsche trieb er seine zaghaften Bauern zum Sturm, den Mutigen aber gab er ein Beispiel: er lief ihnen voran. In der Kunst, unsichtbar, maskiert durch Pflanze, Baum und Strauch, geborgen von der Nacht oder in den morgendlichen Nebel gehüllt, sich an Drahtverhaue heranzuschleichen, um den Feind zu vernichten, erreichte ihn keiner. Karten brauchte er nicht zu lesen, die Geheimnisse jedes Terrains errieten seine geschärften Sinne. Verhüllte und entfernte Geräusche vernahm sein hurtiges Ohr. Flink ergriff sein wachsames Auge alle verdächtigen Bewegungen. Seine sichere Hand griff zu, schoß und verfehlte kein Ziel, hielt, was sie gefaßt hatte, schlug unerbittlich auf Gesichter und Rücken, ballte sich zur Faust mit grausamen Knöcheln, öffnete sich aber bereitwillig und mit stählerner Zärtlichkeit zu kameradschaftlichem Druck. Tarabas liebte nur seinesgleichen. Er wurde ausgezeichnet und zum Hauptmann befördert. Wer immer in seiner Kompanie Neigung zum Zaudern verriet, geschweige denn Feigheit, war sein Feind, wie der Feind, gegen den die ganze Armee kämpfte. Wer aber, wie Tarabas selbst, das Leben nicht liebte und den Tod nicht scheute, war der Freund seines Herzens. Hunger und Durst, Schmerz und Müdigkeit, durchwanderte Tage und Nächte ohne Schlaf stärkten sein Herz, erfreuten es sogar. Vollkommen außerstande, strategisches Talent zu beweisen und, was man in der Militärsprache »größere Aktionen« nennt, zu begreifen, war er ein außerordentlicher Frontoffizier, ein ausgezeichneter Jäger auf kleinen Jagdabschnitten. Ja, ein Jäger war er, ein wilder Jäger war Nikolaus Tarabas.
Die schwere Trunkenheit lernte er kennen und die flüchtige Liebe. Vergessen waren Haus, Hof, Vater und Mutter und die Cousine Maria. Als er sich ihrer aller eines Tages erinnerte, war es zu spät, ihnen Nachricht zu geben; denn Tarabas’ Heimat war damals vom Feinde besetzt. Wenig bekümmerte ihn dies, der Krieg war seine große, blutige Heimat geworden. Vergessen waren New York und Katharina. Dennoch, in manchen Pausen, zwischen Gefahr und Gefecht, Trunkenheit und Nüchternheit, flüchtigem Rausch und flüchtigem Mord, ward es Tarabas sekundenlang (aber auch nur so lange) klar, daß er seit der Stunde, in der ihm die Zigeunerin auf dem New Yorker Jahrmarkt geweissagt hatte, als ein Verwandelter lebte, ein Verwandelter, ein Verzauberter und wie in einem Traum Befangener. Ach, es war nicht sein Leben mehr! – Zuweilen war es ihm, als sei er gestorben und das Leben, das er jetzt führte, bereits ein Jenseits. Doch verflogen diese Sekunden der Besinnung, und Tarabas versank aufs neue im Rausch des Blutes, das rings um ihn floß und das er fließen ließ, im Geruch der Kadaver, im Dunst der Brände und in seiner Liebe zum Verderben.
So ging er denn, so ließ er sich kommandieren, von Brand zu Brand, von Mord zu Mord, und nichts Böses widerfuhr ihm. Eine höhere Gewalt hielt Wacht über ihn und bewahrte ihn auf für sein merkwürdiges Leben. Seine Soldaten liebten ihn und fürchteten ihn auch. Seinem Blick gehorchten sie und dem leisesten Wink seiner Hand. Und lehnte sich einer unter ihnen gegen Tarabas’ Grausamkeit auf, so hielt fast keiner der anderen zu dem Empörer. Alle liebten sie Tarabas; und alle fürchteten sie ihn.
Auch Tarabas liebte seine Leute, in seiner Art liebte er seine Leute, weil er ihr Gebieter war. Er sah viele von ihnen sterben. Ihr Tod gefiel ihm. Es gefiel ihm überhaupt, wenn man rings um ihn starb, und wenn er, wie er auch mitten zwischen den Schlachten als einziger im Regiment zu tun gewohnt war, durch den Schützengraben ging, die Namen seiner Leute verlas und die Antwort »gefallen« von den Kameraden hörte, so zeichnete er ein Kreuz in sein Notizbuch. In diesen Augenblicken genoß er manchmal die Vorstellung, er sei ja überhaupt selbst schon tot; alles, was er da erfuhr, geschähe im Jenseits; und die anderen, die Gefallenen, seien so gewiß in ein drittes Leben eingekehrt wie er selbst nunmehr in sein zweites.
Er wurde niemals verwundet und niemals krank; er bat auch niemals um einen Urlaub. Der einzige war er im Regiment, der keine Post bekam und keine erwartete. Von seinem Haus sprach er niemals. Und dies befestigte die Meinung, die man von ihm hatte, daß er ein gar Sonderbarer sei.
So verlebte er den Krieg.
Als die Revolution ausbrach, behielt er seine Kompanie ingrimmig in der Gewalt, mit Gebärden, Fäusten, Blick, Pistole und Stock. Es war nicht seine Sache, zu verstehen, was in der Politik vorging. Es kümmerte ihn nicht, ob der Zar abgesetzt war. In seiner Truppe war er selbst der Zar. Es war ihm nur angenehm, daß seine Vorgesetzten, der Stab, das Armeekommando, verworrene und widerspruchsvolle Befehle auszuteilen begannen. Er brauchte sich nicht um sie zu kümmern. Bald gewann er, weil er der einzige im ganzen Regiment war, den die Revolution nicht verwirrt und nicht verwandelt hatte, mehr Macht als der Oberst selbst. Er kommandierte das Regiment. Und er verlegte es nach seinem Gutdünken dahin und dorthin, führte selbständige Kämpfe, brach in gleichgültige Dörfer und Städtchen ein, frisch und munter wie in den ersten Wochen des Krieges.
Eines Tages – es war ein Sonntag – tauchte in seinem Regiment ein Soldat auf, den Tarabas noch niemals gesehen hatte. Zum erstenmal, seitdem er eingerückt war, erschrak er gewaltig vor einem ganz gewöhnlichen Infanteristen. Sie lagen in einem winzigen, halbzerschossenen galizischen Dorf. Der Hauptmann Tarabas hatte sich in einer der noch ziemlich gut erhaltenen Hütten einquartiert, die Nacht mit der vierzehnjährigen Tochter der Bäuerin verbracht, am Morgen bei seinem Burschen Kaffee mit Schnaps bestellt. Es war ein sonniger Tag, gegen neun Uhr morgens. In frischgewichsten Stiefeln, in gesäuberten, lederbespannten, breiten Reithosen, ein Reitstöckchen in der Hand, rasiert und mit dem ganzen Wohlgefühl ausgestattet, das einen Mann wie Tarabas nach einer wohlig verbrachten Nacht an einem glänzenden Herbstmorgen erfüllen konnte, verließ der Hauptmann die Hütte und das Mädchen, das im Hemd vor der Tür hockte. Tarabas schlug es mit seiner Reitgerte zärtlich auf die Schulter. Das Mädchen erhob sich. Er fragte, wie es heiße: »Der Herr hat mich schon gestern abend nach meinem Namen gefragt«, sagte das Mädchen, »als ich ins Bett kam.« In ihren winzigen, grünen, tief in die Wangen gebetteten Augen stand ein schelmisches und böses Feuerchen. Tarabas sah ihre junge Brust unter dem Hemd, ein dünnes Kettchen am Hals, dachte an das Kreuz, das Maria getragen hatte, und sagte, indem er ihren Scheitel mit der Reitpeitsche berührte: »Du heißt Maria, von nun ab, solange ich hierbleibe!« »Jawohl, Euer Gnaden!« sagte das Mädchen. Und pfeifend ging Tarabas von dannen.
Er war, wie gesagt, in herrlicher Laune. Mit seinem Reitstöckchen versuchte er, die blinkenden Fäden des Altweibersommers zu zerteilen. Es gelang ihm nicht; diese merkwürdigen Kreaturen aus Nichts schlangen sich vielmehr um das Stöckchen, umschmeichelten es geradezu. Auch dies gefiel Tarabas. Hierauf drehte er sich eine Zigarette aus dem Tabak, den er lose in der Tasche trug, und verlangsamte den Schritt. Er näherte sich dem Lager seiner Leute. Schon kam der Unteroffizier, ihm Bericht zu erstatten. Sonntag war heute. Die Soldaten lagen faul und matt an den Wiesenabhängen und auf den Stoppelfeldern. »Liegenbleiben!« rief Tarabas, als er sich ihnen näherte. Trotzdem erhob sich einer, einer der ersten, vom Wegrand. Und obwohl dieser Soldat vorschriftsmäßig und sogar ehrerbietig grüßte, unbeweglich wie ein Pfahl, lag in seiner ganzen Erscheinung für das Gefühl des Hauptmanns Tarabas etwas Widerspenstiges, Freches, etwas unbegreiflich Überlegenes. Nein, der war nicht von Tarabas’ Hand erzogen worden! Ein Fremder war’s in dieser Kompanie!
Tarabas trat näher – und gleich darauf einen Schritt zurück. In diesem Augenblick begann die Glocke der kleinen griechischen Kirche zu läuten. Die ersten Bäuerinnen zeigten sich schon auf dem Weg, der zur Kirche führte. Sonntag war es. Tarabas bekreuzigte sich – immer den Blick auf den fremden Soldaten gerichtet. Und es war, als ob er aus Angst vor ihm das Kreuz geschlagen hätte. In diesem Augenblick nämlich sah er es deutlich: der fremde Soldat war ein rothaariger Jude. Ein rothaariger Jude. Rothaarig, Jude – und es war Sonntag!
Zum erstenmal, seitdem er zur Armee gekommen war, erwachte in Nikolaus Tarabas der alte Aberglaube wieder. Sofort wußte er auch, daß von diesem Augenblick an sein Schicksal sich verändern sollte. »Wie kommst du daher?« fragte Tarabas. Der Soldat zog aus seiner Tasche ein Papier. Man ersah daraus, daß er von dem aufgeriebenen, zum Teil desertierten, zum Teil zu den Bolschewiken übergelaufenen Infanterieregiment Nummer zweiundfünfzig gekommen war. »Es ist gut!« sagte der Hauptmann Tarabas. »Bist du Jude?« »Ja!« sagte der Soldat, »meine Eltern waren Juden! Ich aber kenne keinen Gott!«
Nikolaus Tarabas trat noch einen Schritt zurück. Er klopfte mit dem Reitstöckchen gegen die Stiefel. Der Rothaarige hatte grüngraue Augen und flammende, kurze Büschel darüber, statt der Brauen. »Also, ein Gottloser bist du!« sagte der Hauptmann. »So, so!«
VII
Von diesem Tage an begann sich die Welt des Hauptmanns Tarabas zu verändern. Seine Leute gehorchten nicht mehr wie zuvor, schienen ihn weniger zu lieben und weniger zu fürchten. Und züchtigte er einen von ihnen, so verspürte er einen unerklärlichen, unsichtbaren, unhörbaren Groll in den Reihen. Die Männer sahen ihm nicht mehr gerade in die Augen. Eines Tages verschwanden zwei Unteroffiziere, die besten Leute des Regiments, die mit Tarabas seit dem ersten Tage gekämpft hatten. Ihnen folgten eine Woche später ein paar Infanteristen. Aber der rothaarige Gottlose entfernte sich nicht, der einzige, dessen Desertion der Hauptmann Tarabas ersehnte. Es war im übrigen ein Soldat ohne Makel. Pünktlich und gehorsam war er. Aber selten erteilte ihm der Hauptmann Tarabas einen Befehl. Die anderen fühlten es. Ja, sie wußten es. Manchmal beobachtete Tarabas, daß der Rothaarige zu den Soldaten sprach. Sie hörten ihm zu, umringten ihn, lauschten. Tarabas rief einen Beliebigen zu sich. »Was erzählt er denn, der Rothaarige?« »Geschichten!« sagte der Soldat. »Was für Geschichten?« »So, eben lustige Weibergeschichten!« Und Tarabas wußte, daß der Mann log. Aber er schämte sich, daß man ihn belogen hatte, und er fragte nicht weiter.
Eines Morgens fand der Hauptmann bei seinem Burschen eine der bolschewistischen Broschüren, die er noch nie gesehen hatte. Er zündete sie mit einem Streichholz an, die Blätter brannten nur bis zur Hälfte ab, erloschen dann, und Tarabas warf sie wieder hin. Er beobachtete von nun an den Burschen aufmerksamer. »Stepan«, sagte er, »hast du mir nichts zu erzählen? – Wo ist deine Mundharmonika, Stepan, möchtest mir was vorspielen?« »Hab’ sie verloren; Euer Hochwohlgeboren!« sagte Stepan, demütig und traurig.
Auch Stepan verschwand plötzlich, an einem Abend, kein Mensch wußte Auskunft zu geben.
Der Hauptmann Tarabas ließ alle Welt antreten und verlas die Namen seiner Kompanie. Mehr als die Hälfte der Leute war desertiert. Den Rest ließ er eine Stunde exerzieren. Der Rothaarige exerzierte tapfer, fleißig, ohne Fehl, ein tadelloser Soldat.
Ein paar Tage später, in der Stunde, in der Tarabas gerade mit dem Obersten und den übrigen Offizieren beriet, wie man die Desertionen verhindern könnte, erschien der Rothaarige, zwei Handgranaten im Gürtel, eine Pistole in der Hand, begleitet von zwei Unteroffizieren. »Bürger«, sagte der rothaarige Gottlose, »die Revolution hat gesiegt. Geben Sie die Waffen ab, Sie haben freies Geleit. Und Sie, Bürger Tarabas, und was sonst bei uns Ihre Landsleute sind, können in Ihre Heimat zurück. Einen eigenen Staat haben jetzt eure Leute.«