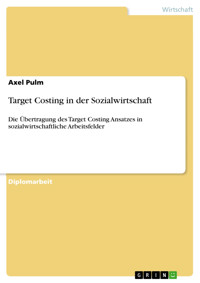
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,1, AKAD-Fachhochschule Leipzig, Sprache: Deutsch, Abstract: Zielkostenmanagement (Target Costing) ist eines der neueren Kostenmanagementsysteme. Die Grundidee fußt darauf, dass eine Kostenkorrektur bei marktreifen Produkten kaum noch sinnvoll möglich ist, da durch die Produktentwicklung wesentliche Kosten schon festgelegt sind. Insofern versucht die Zielkostenrechnung, sowohl den möglichen Kundennutzen eines Produktes wie auch den marktakzeptablen Preis im Vorhinein zu eruieren. Vom festgelegten Preis her werden dann retrograd die Produktionsprozesse so organisiert, dass der Zielpreis erreicht (oder unterschritten) werden kann. Gerade in der Sozialwirtschaft finden wir nun einen Markt vor, der in Teilen sehr stark reguliert ist. Zwar sollen auch hier marktwirtschaftliche Mechanismen eine zunehmend stärkere Rolle spielen, doch steht in der Regel einer Vielzahl von Anbietern ein Oligopol oder gar Monopol auf der Nachfrageseite gegenüber. In manchen Segmenten dieses Marktes ist die Regulierung so stark, dass Preis und Leistungsanforderung einseitig von staatlicher Seite festgesetzt werden. Da der Marktpreis von daher nur begrenzt durch den Anbieter beeinflusst werden kann, bietet sich die Idee des Target Costing als umfassendes Steuerungsinstrument an. Die Frage lautet dann, wie die eigenen Prozesse organisiert sein müssen, damit der festgesetzte Preis (einschließlich eines Gewinns) für den Anbieter auskömmlich ist. Diese Untersuchung zeigt auf, inwieweit die Ideen des Target Costing für die Sozialwirtschaft hilfreich und übertragbar sind und was dies in der Konsequenz bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Anstelle eines Vorworts
Mein Dank gilt allen, die mich bei der Erstellung dieser Diplomarbeit unterstützt haben.
Mein Dank gilt Werner Heister, der mir bei der Erstellung der Gliederung und manch anderem kniffligen betriebswirtschaftlichen Problem stets mit seinem fachkompetenten Rat zur Seite stand.
Mein Dank gilt Andre´ Peters und Pater Bernd Heisterkamp, die sich der formalen, grammatikalischen und orthografischen Korrektheit dieser Arbeit mit Erfolg angenommen haben, und zusätzlich die eine oder andere inhaltliche Anregung gegeben haben.
Mein Dank gilt meinen Eltern, die meinen Lebensweg mit Interesse und Wohlwollen in jeder „Schleife und Wendung“ positiv und aufgeschlossen begleitet haben und „im Hintergrund“ zur Verfügung standen und stehen.
Inhaltsverzeichnis
Anstelle eines Vorworts
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
1.2 Methodisches Vorgehen und wissenschaftstheoretische Einordnung
2 Grundzüge des „klassischen“ Target Costing
2.1 Geschichte und Definition
2.2 Methodik
2.2.1 Zielkostenfindung und Zielkostenfestlegung
2.2.2 Zielkostenspaltung
2.2.3 Zielkostenanalyse und Zielkostenerreichung
2.3 Relevante Merkmale und Zielsetzungen des Target Costing
2.3.1 Kostenmanagement
2.3.2 Produktlebenszyklusorientierung und Vollkostenrechnung
2.3.3 Marktorientierung und Segmentierung
2.3.4 Mitarbeiterbezogene Aspekte
2.4 Ergänzung des Target Costing durch die Prozesskostenrechnung
2.4.1 Geschichte der Prozesskostenrechnung
2.4.2 Methodik und zentrale Grundannahmen der Prozesskostenrechnung
2.4.3 Verknüpfung von Target Costing und Prozesskostenrechnung
2.5 Target Costing im Dienstleistungssektor
2.5.1 Spezifische Merkmale von Dienstleistungen
2.5.2 Die Anwendung von Target Costing im Dienstleistungssektor
2.6 Erste Bewertung des „klassischen“ Target Costing
3 Grundzüge der Sozialwirtschaft
3.1 Sozialwirtschaft – eine Klärung des Begriffs und der damit verbundenen Arbeitsfelder
3.2 Der Kundenbegriff in der Sozialwirtschaft – das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis
3.3 Das „Markt“-Verständnis der Sozialwirtschaft
3.4 Sozialunternehmen als Erbringer personenbezogener sozialer Dienstleistungen
3.5 Kostenmanagement in der Sozialwirtschaft
4 Übertragung des Target Costing-Ansatzes in die Sozialwirtschaft
4.1 Target Costing in der Sozialwirtschaft – Aspekte der Übertragung
4.1.1 Die organisationalen Voraussetzungen einer Target Costing Implementierung
4.1.2 Aspekte des strategischen Kostenmanagements
4.1.3 Das Ziel: Nutzenmaximierung für den Kunden
4.1.4 No Frills! – Nicht das Beste, sondern das Notwendige
4.1.5 Die Verbindung von Target Costing und Prozesskostenrechnung in sozialwirtschaflichen Arbeitsfeldern
4.1.6 Mitarbeiterorientierung und -motivation
4.2 Target Costing – Probleme und Lösungspotentiale in der Übertragung
4.2.1 Vollkostenrechnung vs. Teilkostenrechnung – Das Problem der Fixkostenproportionalisierung
4.2.2 Zielkostenspaltung – eine kritische Bewertung
4.2.3 Das un-dynamische Target Costing – Kritik aus investitionsrechnerischer Perspektive
4.2.4 Der unbekannte Dritte – Wie kalkulieren Sozialunternehmen im Dienstleistungs-Target Costing den „externen“ Faktor“ und die Leistungsbereitschaft
4.2.5 Schwierigkeiten und Fehler bei der Zielpreisbildung
4.3 Der MEHR-Wert des Target Costing – eine analoge Übertragung mit erweiterten Ziel-Perspektiven
4.3.1 Outcome statt Output – eine andere sozialwirtschaftliche Zielgröße für das Target Costing
4.3.2 Target Costing als handlungsleitende Idee einer „wert“-orientierten Sozialwirtschaft
4.3.3 Zum Schluss – der Ausstieg
4.4 Handlungsempfehlungen zur Einführung des Target Costing in sozialwirtschaftliche Arbeitsfelder
5 Fazit
Literaturverzeichnis
Persönliche Erklärung
1 Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
Zielkostenmanagement (Target Costing) ist eines der neueren Kosten-managementsysteme.[1] Die Grundidee fußt darauf, dass eine Kostenkorrektur bei marktreifen Produkten kaum noch sinnvoll möglich ist, da durch die Produktentwicklung wesentliche Kosten schon festgelegt sind.[2] Insofern versucht die Zielkostenrechnung, sowohl den möglichen Kundennutzen eines Produktes wie auch den marktakzeptablen Preis im Vorhinein zu eruieren. Vom festgelegten Preis her werden dann retrograd die Produktionsprozesse so organisiert, dass der Zielpreis erreicht (oder unterschritten) werden kann.[3]
Gerade in der Sozialwirtschaft finden wir nun einen Markt vor, der in Teilen sehr stark reguliert ist.[4] Zwar sollen auch hier marktwirtschaftliche Mechanismen eine zunehmend stärkere Rolle spielen, doch steht in der Regel einer Vielzahl von Anbietern ein Oligopol oder gar Monopol auf der Nachfrageseite gegenüber. In manchen Segmenten dieses Marktes ist die Regulierung so stark, dass Preis und Leistungsanforderung einseitig von staatlicher Seite festgesetzt werden.[5]
Da der Marktpreis von daher nur begrenzt durch den Anbieter beeinflusst werden kann, bietet sich die Idee des Target Costing als umfassendes Steuerungsinstrument an. Die Frage lautet dann, wie die eigenen Prozesse organisiert sein müssen, damit der festgesetzte Preis (einschließlich eines Gewinns) für den Anbieter auskömmlich ist.[6]
Diese Untersuchung möchte der Frage nachgehen, inwieweit die Ideen des Target Costing für die Sozialwirtschaft hilfreich und übertragbar sind und was dies in der Konsequenz bedeuten könnte.
Hierzu erfolgt zunächst eine wissenschaftstheoretische Einordnung, die den Rahmen für die dargestellte Übertragung liefert. Im 2.Kapitel folgt eine komprimierte Darstellung des „klassischen“ Target Costing Ansatzes,[7] anschließend wird in Kapitel 3 das Themenfeld „Sozialwirtschaft“ und der hierin verwendete Markt- und Kundenbegriff ausgeleuchtet. Das 4. Kapitel widmet sich den Übertragungsmöglichkeiten in die Sozialwirtschaft (Kapitel 4.1) und deren Grenzen und Problemen (Kapitel 4.2), entwickelt aber gleichzeitig – wo möglich – auch Lösungsideen. Kapitel 4.3. stellt denkbare Erweiterungen der Target Costing Idee vor. In Kapitel 4.4. werden dann als Quintessenz dieser Untersuchung zusammenfassende Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Target Costing in der Sozialwirtschaft gegeben.
1.2 Methodisches Vorgehen und wissenschaftstheoretische Einordnung
Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive ist der Ansatzpunkt dieser Arbeit, das Zielkostenmanagement auf sozialwirtschaftliche Arbeitsfelder zu übertragen, unproblematisch. Mag ein Unternehmen der Sozialwirtschaft auch etwas andere Rahmenbedingungen haben als Unternehmen im privatwirtschaftlichen Bereich – nie würde dies dazu führen, eine Übertragung betriebswirtschaftlicher Instrumente in die Sozialwirtschaft von vorneherein in Zweifel zu ziehen.[8] Letztlich geht es auch in sozialwirtschaftlichen Unternehmen darum, mit knappen Mitteln zu haushalten und die immer wieder neuen Anforderungen und Herausforderungen im Marktgeschehen zu gestalten.[9]
Anders sieht dies aus sozialwirtschaftlicher Perspektive aus. Hier ist die Übernahme betriebswirtschaftlicher Methoden und Instrumente ständiger Reibungs- und Diskussionspunkt.[10] Und auch wenn sich diese Arbeit aus betriebswirtschaftlicher Perspektive dem Thema nähert, so hat sie doch einen interdisziplinären Anspruch, so dass die notwendige wissenschaftstheoretische Einordnung zu Beginn vorgenommen werden muss.
Hilfreich sind hier zwei Zugänge: zum einen die Betrachtung der gemeinsamen historischen Wurzeln von Sozialwirtschaft und Betriebswirtschaft[11] und zum anderen ein Verständnis der Betriebswirtschaft als angewandter Sozialwissenschaft[12].
Geschichtlich gibt es durchaus einen gemeinsamen Ursprung beider Disziplinen, wenngleich dieser nicht auf den ersten Blick einsichtig ist. Um die Jahrhundertwende des 19./20.Jahrhunderts hatten die zentralen (national-) ökonomischen (also volkswirtschaftlichen) Fragestellungen gleichzeitig die Situation der sozial benachteiligten Menschen im Blick.[13] Heruntergebrochen auf die Situation des Individuums wird gerade das soziale Miteinander und die „sachverständige Führung von Menschen durch Menschen“[14] als der ursprüngliche Gegenstand des Wirtschaftens gesehen.[15]
Neben der Historie spricht aber insbesondere die wissenschaftstheoretische Einordnung der Betriebswirtschaftslehre selbst für eine Konvergenz mit der Sozialwirtschaft.
Nach Ulrich bedarf die handlungsleitende Grundidee der Betriebswirtschaftslehre einer kritischen Überprüfung,[16] da die Orientierung an der klassischen positivistischen Ausrichtung der Naturwissenschaften nicht zielführend ist.[17] Vielmehr ist Betriebswirtschaft als anwendungsorientierte Sozialwissenschaft zu verstehen,[18] die notwendigerweise interdisziplinär aufgestellt sein muss, um ihrem Gegenstand gerecht werden zu können.[19] Betriebswirtschaft hat eine technische, eine biologisch-ökologische und eine humane Dimension und nimmt dadurch den Menschen als zentrales Objekt in all seinen Bezügen in den Blick.[20] Damit ist es auch das Ziel der Betriebswirtschaft, Handlungsalternativen zu analysieren und „Gestaltungsempfehlungen für soziale und technische Systeme zu geben“[21].
Ebenso wie die Betriebswirtschaft versteht sich auch die Sozialwirtschaft als Teil des sozialwissenschaftlichen Fächerkanons und hat damit - analog zur Betriebswirtschaft - den Menschen in seinen vielfältigen Bezügen zum Thema.[22] Die Betriebswirtschaft fokussiert hierbei die Gewinnmaximierung für einzelne Unternehmen im Rahmen einer Volkswirtschaft, während sich die Sozialwirtschaft mit der Wohlfahrtsproduktion der Volkswirtschaft beschäftigt.[23]
Wissenschaftstheoretisch verstehen sich beide als angewandte Sozialwissenschaften. Somit ist die Verbindung zwischen Sozialwirtschaft und Betriebswirtschaft sowohl auf der Grundlage gemeinsamer geschichtlicher Wurzeln wie auch auf der Basis des gemeinsamen sozialwissenschaftlichen Ausgangs- und Bezugspunktes gegeben.
2 Grundzüge des „klassischen“ Target Costing
Für den Target Costing Ansatz gibt es weder eine einheitliche Vorgehensweise[24] noch eine einheitliche Definition[25]. Als „Väter“ des Target Costing in Deutschland werden in der Literatur übereinstimmend Horváth und Seidenschwarz genannt.[26]. Der hier dargestellte Ansatz des „klassischen“ Target Costing fußt demnach auf dieser Übertragung, aber auch den in Folge vorgenommenen Konkretisierungen und Vertiefungen.
Methodisch trennt diese Untersuchung die Darstellung des Target Costing Ansatzes in seiner „ersten“ Übertragung in Deutschland in den 1990er Jahren (hier als „klassisches“ Target Costing bezeichnet) von den Weiterentwicklungen aber auch den kritischen Anfragen, die im 4. Kapitel dargestellt und erörtert werden. Das „klassische“ Target Costing ist somit kein trennscharf definierter Begriff, sondern dient in dieser Arbeit lediglich dazu, die Grundzüge und Grundideen des Target Costing Ansatzes von der Kritik und den Weiterentwicklungen der Übersichtlichkeit halber abzugrenzen.
2.1 Geschichte und Definition
Die Idee des Target Costing kommt aus Japan, wo sie als „Genka Kikaku“ eingeführt ist.[27] Der oft verwendete Begriff „Zielkostenrechnung“ wird dabei weder dem japanischen Begriff in der korrekten Übersetzung noch dem damit verbundenen Inhalt eines Kostenmanagementsystems gerecht.[28]Horváth und Seidenschwarz schlagen daher den Begriff „Zielkostenmanagement“ vor, der sich in der wissenschaftlichen Literatur durchgesetzt hat und somit auch dieser Arbeit zugrunde liegt.[29]
Auch wenn Toyota schon in den 1960er Jahren erste Ansätze des Target Costing eingeführt hat,[30] so erfolgte eine umfassende Umsetzung in Japan doch erst mit der Ölkrise 1973.[31] Ausgangspunkt war die Notwendigkeit zur Kontrolle im Bereich Einkauf und Beschaffung sowie der Wunsch, partielle Kostenrechnungsansätze in einem Gesamtkonzept zu bündeln.[32]
Die im japanischen Ursprung noch vorhandene Differenzierung in einen marktorientierten, ingenieursorientierten und produktfunktionsorientierten Target Costing Ansatz[33] wurden in der deutschen Rezeption zu einem gemeinsamen Verständnis integriert.[34] Infolge dessen legt auch diese Arbeit eine Target Costing Definition zugrunde, die diese Integration impliziert und die strategie- und marktorientierten Aspekte in den Vordergrund stellt. Hierbei greifen wir zurück auf die Definition von Niemand:
„Das System des Target Costing beschreibt einen teamorientierten Ansatz marktorientierten Kostenmanagements, der unter Beachtung von Unternehmensstrategie und –kontext eine den Marktanforderungen entsprechende Entwicklung und Gestaltung eines Leistungssystems durch den integrierten Einsatz vielfältiger Instrumente des Kostenmanagements von Beginn des Entwicklungsprozesses an sicherstellt.“[35]





























