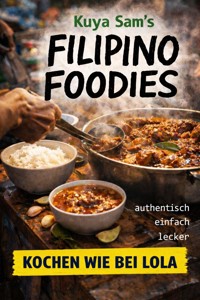Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein zufälliges Zusammentreffen mit Filipina Riza und das Beobachten einer konspirativen Sitzung nach einem Abend in Hamburg erwecken bei Journalist Steffen Raupner den Verdacht auf schwerwiegende Manipulationen durch die Mainpharma AG. Als er nach erster Recherche von dieser bestochen und bedroht wird, verstärkt das Steffens Neugier nur. Er folgt Riza auf die Philippinen, wo der Pharmakonzern die Zulassungsstudien für ein neues Medikament durchgeführt hatte. Der Versuch, Steffen zu töten, und ein grauenvoller Mord sollen nur der Anfang seiner abenteuerlichen und gefährlichen Reise in das Chaos von Manila und die Wildnis der Provinzen des für ihn unbekannten Landes sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Texte: © Copyright by Stefan Ammon
Umschlag:© Copyright by Stefan Ammon
Webseite:www.targeted-therapies.de
Email:[email protected]
ISBN 978-3-7418-549-41
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorbemerkungen und Dank
Alle Handlungen und Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder Personen wären rein zufällig. Wer sich selbst als Person oder bildgebender Charakter in diesem Buch entdeckt, ist selber schuld.
Anders die Handlungsorte. Die sind sehr real und Teil meines Lebens.
Ich hätte dieses Buch nicht ohne die Hilfe von euch fertig stellen können. Mehr als nur Dank …
... meiner Tochter Mara für ihre ewig strahlenden Farben, ihre Ehrlichkeit, Sensibilität und Liebe
Kapitel 1
Steffen schloss die Augen und wunderte sich darüber, dass er auch weiterhin Bilder sah. Er betrachtete seine Frau Pauline, die bald fünfundvierzig Jahre alt würde und wunderschön war. Nach fast zwanzig Jahren Ehe war am Schluss nicht mehr viel gemeinsames Eheleben übrig geblieben. Die Schuld daran gaben beide ihrer beruflichen Karriere, hatten sich das gegenseitig oft vorgeworfen und trotzdem immer wieder das Engagement des Partners bewundert und geachtet. Steffen fühlte sich schlecht. Er bereute es, nicht mehr Zeit für Pauline gehabt zu haben. Mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Er sah ein fast jugendliches Bild seiner Frau, verliebte sich erneut und empfand ein drückendes Gefühl der Reue und der Wehmut, das sich zu einem stechenden Schmerz unter dem rechten Rippenbogen manifestierte. Er krümmte sich und wie ein Vorhang überzog Schwärze das Bild von Pauline. "Scheiße, so fühlt es sich also an zu sterben", dachte er. Schweißperlen, die er nicht spürte, sammelten sich auf seiner Stirn und rannen sein Gesicht hinab. Steffen konzentrierte sich auf das Bild hinter dem Vorhang und schaffte es nur mühsam, das Schwarze zur Seite zu schieben. Seine Gedanken überschlugen sich wie Steine bei einem Erdrutsch, und es war, als ob sein Gehirn die Gedankenblitze als Schlüssel nutzte, um gespeicherte Informationen abzurufen und ihm in Sekundenbruchteilen als komplette Geschichten zu servieren. Er las ein komplettes Buch in Sekunden. Das Buch seines Lebens. Mit Kommentaren, Anmerkungen und Kritiken vom ihm selbst. Steffen wand sich verzweifelt, ohne sich zu bewegen, hilflos in seinen Gedanken den Abhang herunterstürzend, bis er wie durch eine Seitentür entkam und das nächste Kapitel aufschlug. Er spürte die Vollkommenheit und Glückseligkeit, die Pauline und er in der Gewissheit empfunden hatten, dass sich nichts perfekter vereinen konnte als ihre beiden Körper und Seelen, er schmeckte die Süße des Schweißes, der sich am Rand ihrer Lippen gebildet hatte und genoss den Kontrast zwischen den weichen Berührungen ihrer Brüste auf seinem Brustkorb und dem leichten Kratzen, dass ihre harten Brustwarzen verursachten, wenn sich ihre Umarmungen nur leicht trafen. Steffen schwankte zwischen Glück und Wut über sich selbst. "Zu spät", versuchte er zu sagen und bemerkte, dass sein Mund mit Blut gefüllt war. Seine unausgesprochenen Worte hörte er selbst nur als gurgelnde Laute, er spuckte Blut aus und versuchte die Worte zu wiederholen. Es gelang nicht, da sich das Blut immer wieder in seinem Mund sammelte und ihn überkam zeitgleich die Erkenntnis darüber, wie unsinnig es war, die Worte "zu spät" unbedingt wiederholen zu wollen und grenzenlose Panik.
Hilflosigkeit hatte schon immer Panik bei ihm ausgelöst. Er sah sich in der Kernspintomographie, festgeschnallt mit fixiertem Kopf, langsam in das Gerät einfahren. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er die Erfahrung machen musste, anderen Menschen ausgeliefert zu sein, fremden Menschen vertrauen zu müssen. Eine korpulente Arzthelferin hatte Steffen freundlich über die Untersuchung aufgeklärt, ihn gebeten, ganz still zu liegen und dann mit weißen Riemen fast liebevoll auf der Liege fixiert. Anschließend betätigte Sie die Steuerung des Geräteschlittens, und Steffen fuhr mit dem Kopf voran in die weiße, metallene Röhre. Sein Leben hing von der dicken Arzthelferin ab. Sie konnte das Licht ausmachen, nach Hause gehen und ihn allein lassen. Allein mit den Ratten des Krankenhauses, die die Gelegenheit nutzen würden, mit seinen Genitalien zu spielen und seine Ohren abzubeißen. Oder ihre Bekannten der Organmafia würden kurz nach ihrem Verschwinden auftauchen und alle verwertbaren Organe ohne Betäubung aus ihm herausschneiden. Steffen hatte sich bei der Untersuchung für seine eigene Schwäche verflucht und gegen die Panik gekämpft. Er hatte versucht, sich auf einen fiktiven Punkt in der Röhre zu konzentrieren. Er hatte versucht, mit geschlossenen Augen gegen seine Angst zu kämpfen. Vergeblich. Nach nur wenigen Sekunden hatte er die Panik-Klingel gedrückt und war schnell von der Arzthelferin gerettet worden.
Dieses Mal gab es keine Panik-Klingel. Noch nicht einmal eine dicke Arzthelferin. Steffen spürte das Blut in seiner Luftröhre und den Schmerz in seiner Lunge, als er hustete. Dann spürte er nichts mehr.
Kapitel 2
Es musste ein genetischer Unterschied zwischen Menschen asiatischer Herkunft und Europäern sein. Aber er konnte es sich trotzdem nicht erklären. Maximilian Woltner-Lentek hatte sich schon in der Schulzeit für Medizin interessiert. Sein überdurchschnittlicher Intellekt hatte ihm gute Noten beschert und Türen geöffnet. Ein Stipendium an der Universität, Abschluss des Studiums als Landesbester seines Jahrgangs, drei Jahre Forschungsarbeit im Team seines Doktorvaters, dann fünf Jahre in der renommierten Mayo-Klinik in den USA und anschließend zwei Jahre als Oberarzt in der Abteilung Hämatologie / Onkologie in Jena hatten ihn zu einem der erfahrensten Ärzte auf dem Gebiet der Krebserkrankungen werden lassen. Jetzt, als Chefarzt der Medizinischen Klinik für Innere Medizin in Köln, hatte er sein persönliches Karriereziel erreicht. Der Preis dafür war hoch. Für einen Professor mit seinen Funktionen gab es keine geregelten Arbeitszeiten. Er war Manager und Chef von mehreren Hundert Angestellten, Arzt und Forscher in einer Person. Er trug Verantwortung für die Versorgungsqualität in seiner Abteilung und man verlangte von ihm, als Lehrstuhlinhaber seine Studenten gut auszubilden. Seine Freizeit beschränkte sich auf theoretisch dreißig Tage Urlaub im Jahr und Feiertage. Realistisch waren es nur wenige Feiertage, die heilig genug waren, um die Zeit nicht für ein wichtiges Meeting zu nutzen und von den dreißig Tagen Urlaub verfielen jedes Jahr zehn bis zwanzig Tage, weil Woltner-Lentek sie nicht nehmen konnte oder wollte. Mit achtundvierzig Jahren war er körperlich fit und gesund. Oft wunderte er sich selbst darüber, wie gut sein Körper den Stress und die zeitlichen Strapazen verkraftete. Er fühlte sich wohl. Ganz anders als die Patientin, bei der er zur Visite war.
Eva war ihm während ihres Aufenthaltes in der Klinik ans Herz gewachsen. So etwas kam immer wieder mal vor. Patienten sterben zu sehen, damit war Woltner-Lentek oft konfrontiert. Alle Menschen müssen irgendwann sterben, und Krebs ist eine Erkrankung, die meistens im Alter auftritt. Allerdings hatte Woltner-Lentek schon von seinem Doktorvater gelernt, dass Menschen sehr unterschiedlich sterben. Die meisten alten Menschen fanden sich irgendwann damit ab, dass das Ende gekommen war und besannen sich auf ihr gelebtes Leben, das ihnen dann positiver erschien, als es vermutlich gewesen war. Fast ebenso leicht starben Kinder. Erstaunlicherweise fassten sie es oft als ebenso natürlich auf zu sterben wie alte Menschen. Am schwersten hatten es die jüngeren Erwachsenen. Die, die gerade dabei waren ihre Karrieren aufzubauen, Familien zu gründen und Häuser zu bauen. Menschen wie Eva, die jetzt sechsundzwanzig Jahre alt war und als Zugbegleiterin gearbeitet hatte. Sie hatte ihren Job gemocht und es geliebt, immer wieder auf unterschiedliche Menschen zu treffen, von positiven Gesprächen überrascht zu werden, aber auch unangenehmen Reisenden begegnen zu müssen und Probleme zu lösen. War Eva durch den Zug gegangen, dann hatte sie immer voller Erwartung auf die nächste Überraschung gewartet, die ihr das nächste Abteil bringen würde. Auf die Überraschung, die ihr das Leben dann offenbart hatte, war sie nicht vorbereitet gewesen und hätte sie gerne verzichtet. Nach monatelangem Husten hatte ihr behandelnder Hausarzt festgestellt, dass sie an Lungenkrebs erkrankt war. Ungläubig hatten sie und ihr Lebensgefährte einige Zeit gebraucht, um zu realisieren, dass die Diagnose kein Irrtum, kein Scherz und kein böser Traum war.
Woltner-Lenteks Blick verweilte auf dem auf der Bettkante sitzenden Mann, dessen Hände leicht zitterten, und er fragte sich, ob das Paar wohl schon über Dinge wie Hochzeit oder Kinderkriegen nachgedacht hatte. "Bin ich im Weg?", fragte Evas Lebensgefährte und wollte aufstehen. "Nein, das geht schon", antwortete Woltner-Lentek und drückte ihn behutsam wieder auf das Bett zurück. "Wenn hier jemand stört, dann bin ich das", ergänzte er. "Es dauert nicht lange. Wie geht es Ihnen heute, Eva? Haben Sie noch Probleme mit Ihrer Haut?" "Hey - Sie haben etwas gegen meine Haut, Doc? Ich investiere seit Jahren Unsummen in revitalisierende Nachtcremes, Gurkenmasken und Vitaminpillen, und Sie finden meine Haut nicht schön?" Eva lachte. "Nein, ernsthaft, es ist viel besser geworden. Schauen Sie mal hier."
Eva zeigte dem Arzt ihre Handflächen, die an einigen Stellen gerötet waren. "Ich spüre fast nichts mehr davon". Woltner-Lentek untersuchte Hände und Füße von Eva, die rote, verbrennungsähnliche Hautirritationen aufwiesen. "Tatsächlich, viel besser. Das kommt durch die Dosisreduktion. Manche Patienten vertragen diesen Wirkstoff nicht so gut, aber die Hautreaktionen sind auch ein Indiz für die Wirksamkeit der Therapie. Ich schlage vor, wir lassen die Dosierung für ein paar Tage niedrig und erhöhen dann stufenweise wieder ein bisschen. Meistens treten die Probleme am Anfang der Therapie auf und verschwinden dann." "Und der Rest? Verschwindet der dann auch?" fragte Eva und sah Woltner-Lentek mit einem Blick an, der ihm klar machte, dass sie die Antwort kannte. "Sie haben Lungenkrebs, Eva, aber sie sprechen auf die Therapie an. Das ist erst einmal gut. Mit dem Verschwinden dauert das schon ein bisschen. Sie müssen Geduld haben."
"Versprechen Sie mir, dass Eva wieder gesund wird".
Der Lebensgefährte von Eva war aufgestanden und sah Woltner-Lentek flehend und voller Verzweiflung an. Jetzt sah Woltner-Lentek, dass er geweint hatte. "Das kann er nicht, Martin", sagte Eva, "aber wir hören nicht auf zu hoffen und klammern uns an jeden Strohhalm, den wir erreichen".
Der Professor bestätigte kaum hörbar: "Ich kann es nicht versprechen".
Kapitel 3
Die flackernden Lichter der zahlreichen Laternen und Leuchtreklamen spiegelten sich im nassen Kopfsteinpflaster wider, und es schien, als ob die enge Straße zwischen den Gebäuden Teil eines Gesamtkunstwerks war, das Dunkelheit und Regen nutzte und sich stolz zu präsentieren versuchte. Trotz aller Bemühungen bemerkten die Besucher der Straße weder die Schönheit der Lichtreflektionen, noch die Einzigartigkeit mit der das Kunstwerk die besondere Atmosphäre dieser nächtlichen Szenerie schuf. Sie huschten mit gesenktem Kopf von Fenster zu Fenster oder wandelten ziellos und doch an allem interessiert wie ein streunender Hund die Straße entlang, nicht um die beste Ecke zum Markieren des Reviers zu suchen, aber doch auf der Suche. Auch eine Horde angetrunkener, noch jüngerer Ausländern nahm die eigentliche Schönheit nicht wahr und beschränkte sich, Bierflaschen in die Luft reckend und laut grölend darauf, die Schönste der Schönheiten hinter Schaufenstern zu suchen.
Steffen sah die Herbertstraße in Hamburg zum ersten Mal. Nach einem anstrengenden Tag auf dem Gesundheitskongress Deutschland hatten ihm Hamburger Kollegen wirklich sehr außerordentliche Insider-Kneipen gezeigt. Er hatte nicht erwartet, gerade im nordischen Hamburg so viel Stimmung und gute Laune zu erleben, da er Hamburger bislang eher als reserviert kennengelernt hatte. Dies schien sich mit Einbruch der Dunkelheit zu ändern. Die Besucher übervoller uriger Kneipen hatten lautstark und mit viel Hingabe zusammen gesungen und gefeiert, wie er es bis dahin selten erlebt hatte. Dass Hamburger stur sind und eher kühl, wenig Emotion zeigen und sich reserviert verhalten, schien ihm nach diesem Abend ein unbegründetes Vorurteil gewesen zu sein. "Vielleicht hat es auch am Alkohol gelegen", dachte er und lächelte bei dem Gedanken daran, dass sie in dem Irish Pub einen übergroßen Hut durch das Trinken von angeblich 20 Guinness in einer Stunde gewonnen hatte. Tatsächlich waren es deutlich weniger, doch die etwas mollige, aber durchaus attraktive Bedienung hatte wohl Gefallen an dem heiteren Journalistentisch gefunden und sichtlich viel Freude daran, die Runde mit diesem Gewinn zu überraschen. Steffen war nicht wirklich betrunken, aber hatte sich gegen ein Taxi entschieden und einen Spaziergang durch die erfrischende Kühle des sanften Nieselregens zu seinem Hotel vorgezogen. Der Weg war zwar weit, aber Luft und Regen taten gut nach den verräucherten Räumen der letzten Stunden. Steffen fühlte sich bestens und genoss auch den letzten Teil der Nacht. Der Abstecher in die Herbertstraße kam ungeplant und geschah aus Neugier, als er das Straßenschild und den Hinweis sah, dass der Zutritt für Frauen in dieser Straße verboten sei.
Zahlreiche mehr oder weniger attraktive, leicht oder gar nicht bekleidete Damen präsentierten sich größtenteils offenkundig gelangweilt hinter Fenstern. Beguckt von relativ wenigen Freiern, die sich bei der Ansprache der Damen meistens auf die Worte "wie viel" beschränkten, manchmal gefolgt von "und was machst du dafür?". Wurde man sich einig, öffneten die Damen eine Tür und baten den erwartungsvoll grinsenden Herrn herein. Gekaufte Liebe, Glück für eine Stunde. Was kostet eine Stunde Glück? Whatever - best things in life are for free. Wahre Liebe, Freundschaft und tatsächliches Glück. Hier würde er all das nicht finden. Steffen schlenderte weiter und ärgerte sich, dass seine Kamera im Hotel lag. Gern hätte er die nächtliche Szene festgehalten. Ohne Kamera loszugehen, war immer schlecht. Ob man hier wohl fotografieren durfte?
Seine Gedanken wurden durch den Aufschrei einer Frau abgelenkt. "Don't touch me - ok?" schrie sie und ergänzte ein die einzelnen Worte betonendes "Fuck you". Steffen sah sich um. Eine hübsche Asiatin war von sichtlich amüsierten, jugendlichen Gockeln umringt und versuchte verzweifelt, der Gruppe zu entkommen. "Scheiße", dachte Steffen, "geh einfach weiter", aber er befand sich schon auf dem Weg zu der Ansammlung. Dort angekommen, wurde er mit drohenden Gesten und einem "Was willst Du" begrüßt. Steffen ging durch den Kreis der Männer, nahm den Arm der jetzt verwundert und ängstlich schauenden Asiatin und sagte "Hey Mary, here you are. Come on, hurry up. We need to go". Er zog sie aus dem sich jetzt öffnenden Kreis der überraschten Männer, legte seinen Arm um sie und ging mit ihr in Richtung Straßenende. Erst als sie zirka zwanzig Meter entfernt waren, hörten sie lautstarke Drohungen der Trunkenbolde hinter sich. "Don't look back", sagte Steffen und ging ruhig aber zügig weiter. Er fühlte sich keineswegs wohl in seiner Haut und horchte auf jedes Geräusch hinter sich, aber sie hatten Glück. Augenscheinlich fand man sich mit dem Verlust ab und wendete sich jetzt wieder den Damen hinter den Glasscheiben zu.
Hinter den Absperrungen der Herbertstraße atmeten beide tief auf, sahen sich an und lösten die Umarmung. "Thank you so much", sagte die hübsche Asiatin. Sie war zirka 1,60 m groß, hatte auffällig schöne Augen, lange schwarze Haare, einen vollen geschwungenen Mund und eine flache, aber niedliche Nase. Ihr langer beigefarbener Mantel aus festem Stoff und die fellbesetzten Winterschuhe schienen für diese Jahreszeit etwas zu warm, trotzdem zitterte die junge Frau, während sie in flüssigem Englisch erzählte, dass sie auf dem Weg zu ihrem Hotel gewesen sei und die Verbotsschilder für Frauen vor der Absperrung der Herbertstraße für einen Scherz gehalten hatte. Dass das ein Irrtum war, hatte sie schnell erkannt, als eine der Prostituierten wassergefüllte Plastiktüten nach ihr geworfen und die aufdringliche Männerrunde sie umringt hatte.
"Sie sieht nicht wirklich asiatisch aus", dachte Steffen, "und auch nicht wie eine der Damen des horizontalen Gewerbes". Ihre Gesichtszüge wirkten edel, und das Lächeln, das sie jetzt zeigte, war offen und herzlich. "Schon gut. Ich bin Steffen", sagte er. Sie stellte sich als Riza vor und bedankte sich immer wieder für ihre Befreiung. "Kein Problem", sagte Steffen und lächelte insgeheim bei dem Gedanken an seinen kalten Schweiß auf der Stirn und seine nur mühsam verborgene Furcht, die er gehabt hatte. "Wo ist dein Hotel?" fragte er. "Oh, es ist nicht weit. Das Hotel Venusberg - gleich da vorne". "Tatsächlich? Gut, da muss ich auch hin" antwortete Steffen, freute sich über die angenehme Gesellschaft und ärgerte sich darüber, dass der Weg zum Hotel nur kurz war. Sie wechselten kaum ein Wort in den folgenden Minuten. Am Hotel angekommen, träumte Steffen kurz, seine Begleiterin würde sich zu einem längeren Gespräch auf seinem Zimmer entscheiden, doch er wagte nicht, sie zu fragen. "Oh - dort wartet man schon auf mich", sagte sie und deutete durch die Glastür zum kleinen Frühstücksraum des Hotels auf einen Mann der einen langen schwarzen Lodenmantel und großem schwarzen Indiana Jones Hut trug". Steffen erkannte den Mann sofort, obwohl er ihm den Rücken zukehrte. "Sieh mal einer an", dachte er, wandte sich dann wieder der schönen Riza zu, die ihm nochmals überschwänglich dankte und ein "God bless you" zum Abschied wünschte. Sie verschwand durch die Glastür, und Steffen wendete sich ab, um von dem Mann nicht erkannt zu werden.
Professor Berger war einer der renommiertesten Spezialisten für Krebserkrankungen in Deutschland. Er war als Individualist und Querdenker bekannt und auch in seinem äußeren Bild hob er sich von der Masse ab. Gut aussehend mit imposantem Schnauzbart und immer bestens gekleidet, imponierte er allein durch seine Erscheinung, wenn er am Rednerpult stand. Als Steffen ihn das erste Mal traf, war er überrascht, als Berger das Rednerpult verließ. Er war sehr klein. Zu klein, um wirklich männlich zu wirken. Aber trotz seiner nicht zum restlichen Äußeren passenden Körpergröße, war seine Wirkung im Raum überragend. Berger war ein Machtmensch, aber ein sympathischer. Er war hoch intelligent und hatte zweifellos Großes in seinem Fach geleistet, aber er war auch jemand, der das Leben, das Essen, einen guten Wein oder Champagner und nicht zuletzt Geld nicht verachtete. Und hübsche Frauen.
Steffen spähte noch einmal durch die Glastür. Berger und die Asiatin hatten jetzt ein Glas Champagner in der Hand und sprachen nur wenig miteinander. "Also doch ein Callgirl", dachte Steffen und hätte jetzt, den Geruch ihres lieblichen Parfums noch in der Nase, gern mit Berger getauscht. Er wendete sich ab und ging in Richtung Fahrstuhl. Das Glück war mit ihm. Der Fahrstuhl war im Erdgeschoss und öffnete sich umgehend. Er drückte den Knopf für die dritte Etage und kurz bevor sich die Fahrstuhltüren komplett schlossen, sah er durch den Spalt, wie drei ihm vertraute Männer die Glastür zum Frühstücksraum öffneten und sich Berger und der jungen Frau anschlossen.
Steffen warf einen Blick auf sein Handy. Ein Uhr zwanzig morgens, Professor Berger, Mainpharma-Vorstandsvorsitzender Vosse, eine attraktive Asiatin und der Geschäftsführer der Agentur, die Gesundheitskongresse in Deutschland organisierte, trafen sich in dem leeren und wenig gemütlichen Frühstücksraum eines Hotels im verregneten Hamburg. "Scheiße, Steffen. Du kannst jetzt nicht schlafen gehen". Er verließ den Fahrstuhl nicht, betätigte den Erdgeschoss - Knopf und spürte, wie der Fahrstuhl mit einem leichten Surren wieder nach unten fuhr.
Kapitel 4
Professor Woltner-Lentek war müde. Seine Augen brannten, er hatte seit Stunden nicht gegessen und getrunken. Er war allein im Labor und sah sich vor einer unlösbaren Aufgabe. Immer und immer wieder hatte er die Krankenakte von Eva gelesen und sich gefragt, warum der Verlauf so negativ war. Manche Patienten waren einem näher als andere. Er wusste nicht, warum gerade Eva ihn berührte. Vielleicht wegen der Bilder, die sie malte. Sehr ausdrucksstark und immer das gleiche Motiv. Pferde. Viel Rot, viel Schwarz. Die Psychologin seiner Abteilung hatte gemeint, es wäre viel Kraft und Willen in den Bildern, aber auch Verzweiflung. "Die Eva packt das", hatte sie gesagt. Er war angepiepst worden, in einer dieser sinnlosen Gesprächsrunden mit Vertretern verschiedener Organisationen. Verlassen hatte er diese Besprechung nicht können. Woltner-Lentek hatte auf 1,5 Millionen Euro Fördermittel gehofft. Damit könnte er endlich effektiver forschen. Der Geschäftsführer einer großen Hilfsorganisation war persönlich anwesend. Welch Ehre. Also war Lächeln angesagt, Schulterklopfen und Scherze machen. Als er auf die Station kam, war Evas Zimmer bereits leer. Ihr Lebensgefährte war dabei gewesen, als die anwesenden Ärzte verzweifelt um das Leben der Sechsundzwanzigjährigen gekämpft und schließlich den Kampf verloren hatten. Woltner-Lentek wusste, dass auch er nicht hätte helfen können. Aber das nahm ihm nicht die Schwere, die jetzt auf ihm lastete. Er fühlte sich schuldig. Schuldig, seine Zeit damit verbracht zu haben, das zu tun, was die Verwaltung von ihm forderte. Geld einzutreiben, kosteneffizient zu arbeiten, Politik zu machen.
Eva war mit Trufenib behandelt worden. Einem der neuen Wirkstoffe, auf die man so viel Hoffnung setzte. Die Studienlage zur Behandlung des NSCLC, dem nicht kleinzelligem Lungenkrebs, war mehr als eindeutig. Eine signifikante Gesamtüberlebensverlängerung, die sich sehen lassen konnte. Die sogenannte Trufu-Studie seines Kollegen Berger in Zusammenarbeit mit Professor Rodriguez von der National Health Clinic in Manila hatte für Schlagzeilen gesorgt. Die Studie war in sechs asiatischen Kliniken durchgeführt worden und nach Veröffentlichung der Ergebnisse war der Wirkstoff in Windeseile für Asien zugelassen worden und galt dort jetzt als Goldstandard in der Behandlung von Patienten wie Eva. Es war eine Monotherapie mit dem neuen Wundermittel Trufenib, einem Tyrosinkinaseinhibitor, der oral eingesetzt wurde und dafür sorgte, bestimmte Wachstumssignale im Zellkern zu unterbinden, so dass die Krebszellen durch diese gezielte Hemmung das Wachstum einstellten oder verlangsamten. Ein logisches und geniales Prinzip, allerdings konnte Woltner-Lentek die Behandlungserfolge bei seinen Patienten nicht erzielen. Auch er stellte anfangs eine Verbesserung der Lebensqualität und des allgemeinen Zustands der Patienten fest. Dann allerdings verschlechterte sich die Situation schnell, und die zu Beginn der Therapie noch als positiver Indikator für ein besseres Therapieansprechen interpretierten Hautreaktionen an Händen und Füßen eskalierten kurz vor Eintreten des Todes der Patienten.
Woltner-Lentek hatte die Studie immer und immer wieder gelesen. Die Ergebnisse waren eindeutig und die Anzahl der behandelten Patienten war groß genug, um aussagekräftig zu sein. Er zweifelte an sich selbst und stand vor der Entscheidung, die Mitwirkung seines Hauses an einer angekündigten Folge - Studie in Deutschland absagen zu müssen. Er fühlte sich im Kampf. Im Kampf gegen ein System, dass es ihm nicht erlaubte, sinnvoll zu forschen. Im Kampf gegen die Interessen der pharmazeutischen Industrie, der Fachverbände und der Politik, die alle beteuerten, nur im Sinne der Patienten und des Fortschritts in der Behandlung zu agieren, aber letztlich nur sich selbst dienten. Die Industrie war der einzige Mittelgeber. Allerdings gab es fast ausschließlich Mittel für Studien, die zur Einführung neuer Wirkstoffe wie Trufenib dienten. Gelder von der Regierung gab es so gut wie keine und die finanziellen Zuschüsse nicht staatlicher Organisationen waren zwar hilfreich, aber letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Woltner-Lentek hatte immer wieder zum Thema gemacht, dass auch Therapieoptimierungsstudien ein effizienter Weg seien, um die Optionen für Krebserkrankte deutlich zu verbessern und Überlebensverlängerung zu erreichen. Er hatte Applaus dafür erhalten, Zustimmung und viele Schulterklopfer. Doch geändert hatte sich nichts. Er wusste, dass er Jahre, wenn nicht Jahrzehnte brauchen würde, um zu Ergebnissen zu kommen, die vielleicht in wenigen Jahren möglich wären, wenn er nur die Mittel für größere Studien zur Verfügung hätte.
An Tagen wie diesen fühlte Woltner-Lentek das dringende Bedürfnis, alles hinzuschmeißen. Er ekelte sich vor sich selbst, wenn er eine Laudatio zur feierlichen Übergabe des Bundesverdienstkreuzes zur besonderen Anerkennung von selbstloser Leistung hielt und er wusste, dass der so Ausgezeichnete letztlich nur seinem Ego gedient hatte. Vielleicht würde auch er eines Tages das Bundesverdienstkreuz bekommen oder eine andere der zahlreichen Ehrungen, die es für Forscher gab. Würde er diese Ehrung ablehnen? Oder würde er sich mit einem Lächeln auf dem Gesicht feiern lassen und die Auszeichnung als eine besondere Ehrung seiner Leistungen empfinden? Woltner-Lentek wusste es nicht. Er wandte sich wieder seinen Akten zu, stellte aber fest, dass er die Buchstaben nicht mehr erkennen konnte und entschloss sich, den Rest der nur noch kurzen Nacht zu Hause zu verbringen. Früh morgens würde er bereits im Zug nach Hamburg sitzen. Vielleicht könnte er im Zug noch etwas Schlaf nachholen. Diesen Tag beendete er ohne einen Fortschritt. Wieder einmal.
Kapitel 5
Warum nachts um ein Uhr zwanzig? Warum in diesem drittklassigen Hotel, in dem mit Sicherheit weder Berger noch Vosse ein Zimmer gebucht hatte? Und wer war die deutlich nicht in die Runde passende Asiatin? Steffen hatte sich im Foyer einen verdeckten Platz gesucht und beobachtete die jetzt an einem Tisch sitzenden Gesprächspartner aufmerksam. Er kam sich vor wie ein Paparazzo oder ein heruntergekommener Privatdetektiv und stellte sich die Frage, ob er nicht besser in seinem Bett sein sollte. Die Müdigkeit war jetzt fast größer als seine Neugier. Dann aber hatte Vosse seinen Aktenkoffer geöffnet und der Asiatin einen Umschlag überreicht. Der Umschlag war prall gefüllt und die junge Frau warf nur einen kurzen Blick hinein und legte ihn dann vor sich auf den Tisch. Steffen war sich fast sicher, dass eine nicht unbeträchtliche Menge Geld in dem Umschlag war, und jetzt war seine Müdigkeit mit einem Schlag verflogen. Sicher - vor einigen Jahren war es nichts Ungewöhnliches, daß Vertreter der pharmazeutischen Industrie jede Gelegenheit ergriffen, die verschreibenden Ärzte zu beschenken oder ihnen die eine oder andere Gefälligkeit zu erweisen. Auch Steffen war immer wieder eingeladen worden. Oft im Rahmen von Fachtagungen und Kongressen, manchmal aber auch zu Veranstaltungen, die sich als reine Unterhaltungs - Events entpuppt hatten. Exklusives Essen, gute Musik und nette Gespräche hatten allen gute Laune bereitet und für die, denen das nicht genug war, hatten die Produktmanager genug Geld in ihren Hosentaschen, um zusätzliche Wünsche aller Art zu erfüllen. So hatte man die mentale Ausgeglichenheit und innere Zufriedenheit geschaffen, die Journalisten benötigen um gute Artikel zu schreiben und Ärzte verschreibungswilliger für ein Medikament machte.
Aber die Zeiten hatten sich geändert. Und bei dem Bündel, das hier überreicht wurde, handelte es sich um mehr als das Geld für ein Taxi oder eine erotische Nacht mit der asiatischen Schönheit.
Als die Runde das Restaurant verließ, drehte Steffen der Tür den Rücken zu. "Dankeschön und Auf Wiedersehen", verabschiedete Berger sich von der Asiatin und fügte hinzu: "See you in Manila". Dann verschwanden er und die anderen. Nur Riza blieb zurück und ging zur Rezeption. "Wann ist bei Ihnen Frühstückszeit?", fragte sie. Steffen wunderte sich, dass Riza Deutsch sprach.
Aber was nun? Steffen war kein Privatdetektiv. Er war Medizinjournalist mit dem Spezialgebiet der hämatologischen und onkologischen Erkrankungen. Noch nicht einmal Sensationsreporter bei der BILD-Zeitung. Und er war auch nicht James Bond, der jetzt mit Sicherheit in das Zimmer von Riza gegangen wäre und sie mit Charme und Einsatz seines Körpers überzeugt hätte, ihm zu erzählen, worum es ging. Sie war inzwischen mit dem Fahrstuhl in die oberen Etagen verschwunden, und Steffen fragte sich, wie er sie ansprechen könne.
Er hatte bereits in der Herbertstraße geschwitzt, aber jetzt schwitzte er noch mehr, als er zur Rezeption ging, dem auf dem Computer Solitär spielenden Portier fünfzig Euro auf den Tresen legte und sagte: "Ich hätte gern den Namen der jungen Dame, die gerade auf ihr Zimmer gegangen ist. Können Sie mir dabei behilflich sein?". Der Portier sah ihn lange an, nahm das Geld und verschwand in ein Hinterzimmer. "Scheiße", dachte Steffen und spürte wie der Schweiß über sein Gesicht rann. Doch dann kam der Portier zurück, legte eine Kopie des Anmeldeformulars auf den Tresen und widmete sich wortlos wieder seinem angefangenen Spiel.
Riza Mae Arlene Valenzuela, Jay Tom Agency Inc., Jupiterstreet 67, Makati, Manila. Sie hatte sogar artig ihre Telefonnummer, die Email-Adresse und ihren Geburtstag aufgeschrieben. Achtundzwanzig Jahre alt war sie, man hätte sie auch auf zwanzig schätzen können. Steffen war zufrieden mit sich. Ein toller Abend mit Freunden, ein heldenhafter Einsatz im Rotlichtviertel und eine erfolgreiche Beschaffung von Informationsmaterial, die er sich selbst nicht zugetraut hätte. Er lag noch lange wach und plante, am nächsten Morgen das Gespräch mit Riza zu suchen. Er würde sie zufällig beim Frühstück treffen.
Kapitel 6
Das Telefon schreckte ihn aus dem Schlaf. "Ja - Raupner", murmelte er in den Hörer. Die Stimme am anderen Ende war freundlich: "Herr Raupner, möchten Sie Ihren Aufenthalt in unserem Hotel verlängern?" fragte sie. Steffen war plötzlich hellwach. "Wie spät ist es?" fragte er und erfuhr, dass es bereits halb eins war. "Check-out war um zwölf", sagte die Stimme jetzt etwas zickiger. "Ich bin gleich unten", sagte Steffen, legte den Hörer auf und sprang aus dem Bett. Zehn Minuten brauchte er für eine unvollständige Körperpflege und das hastige Zuammenräumen seiner Sachen, dann stand er vor der Rezeption und checkte aus.
"Meine Kollegin, Frau Valenzuela, ist die noch da?"
Die Dame an der Rezeption sah ihn aus fragenden Augen an. "Nein. Taxi zum Flughafen. Aber schon lange her", sagte sie mit osteuropäischem Akzent und lächelte ihn an. Ihre Zähne waren gelb, und eine große Zahnlücke klaffte in ihrer oberen Zahnleiste. "Verdammte Scheiße" entfuhr es Steffen und er eilte zum Ausgang.