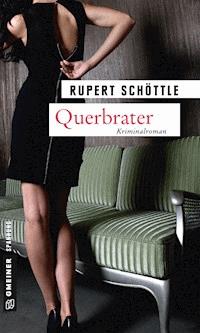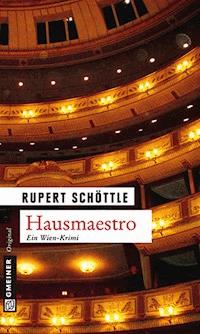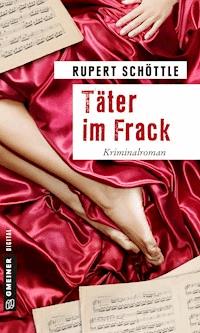
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektoren Vogel und Walz
- Sprache: Deutsch
Ein Mann wird in Wien von der U-Bahn überrollt. Was anfangs wie Selbstmord aussieht, entwickelt sich für die Bezirksinspektoren Vogel und Walz zu einem brisanten Fall, als sich der Wiener Staatsoperndirektor Münch für den Toten Stefan Sallai zu interessieren beginnt. Sallai hatte Münch die verschollen geglaubte Originalpartitur von »Hoffmanns Erzählungen« angeboten, die dieser als Weltsensation uraufführen wollte. Doch mit dem Tod Sallais ist die Partitur verschwunden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rupert Schöttle
Täter im Frack
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: © Lorado – istockphoto.com und © wragg – istockphoto.com
Umschlaggestaltung: Alexander Somogyi
ISBN 978-3-7349-9362-6
Prolog
Dienstagabend
»Wegen der Erkrankung eines Fahrgastes kommt es auf der Linie U 4 in Richtung Hütteldorf derzeit zu unregelmäßigen Zugfolgen …«, der Rest des Satzes ging im ärgerlichen Gemurmel der schon ungeduldig wartenden Fahrgäste auf dem überfüllten Perron der Station Schwedenplatz unter.
Es war bereits die fünfte Durchsage dieser Art. Deren dramatische Wirkung durch die Tatsache verstärkt wurde, dass die Trost spendenden Anzeigetafeln, die sonst die verbleibende Zeit bis zum Eintreffen des nächsten Zuges ankündigen, in diesem Fall schwarz blieben, somit also noch kein Ende dieses Missstandes abzusehen war. Daher blieb der wartenden Menge nichts anderes übrig, als tatenlos herumzustehen. Und Müßiggang ist ja, wie der Volksmund es so treffend formuliert, aller Laster Anfang. Folgerichtig begann des Volkes Seele gleichsam aus Langeweile zu kochen, was nicht unbedingt fatale Folgen zeitigen muss, hat doch eine derart allgemeine Empörung etwas ungemein Verbindendes. Einander völlig unbekannte Menschen finden plötzlich zueinander, zucken verständnisinnig mit den Schultern, verziehen theatralisch das Gesicht oder beginnen gar ein Gespräch mit dem Nachbarn. Denn gemeinsames Unglück verbindet und verbündet. Gegen den Verursacher nämlich. Und wenn ein solcher in der Menge gefunden wird, dann gnade ihm Gott.
Heinz Swoboda, seines Zeichens Zugsführer bei den Wiener Linien und als solcher unschwer an seiner blauen Dienstjacke mit dem Logo seines Arbeitgebers zu erkennen, war sich in diesem Moment der Gefahr durchaus bewusst. Dabei hatte er gerade Dienstschluss und befand sich auf dem Heimweg, war also gleichsam ex Obligo. Außerdem ahnte er, was es mit dieser Durchsage auf sich hatte. Schon allein aus diesem Grund war er höchst erbost und stellte sich, die drohende Gefahr vor Augen, breitbeinig auf den Perron, wild entschlossen, jedem Angriff der ihn verärgert musternden Fahrgäste heldenhaft zu trotzen.
Solchermaßen in sich selbst verbarrikadiert, war er nicht wenig überrascht, als ein jüngerer, etwas verwahrlost aussehender Mann, dessen vom Revers baumelnde Berechtigungskarte ihn als Verkäufer einer Obdachlosenzeitung auswies, ihn in einer plötzlichen Aufwallung von Solidarität leutselig ansprach:
»Hoffentlich ist kana gsturben.«
Doch anstatt zu beschwichtigen, wie es ihm als städtischem Beamten wohl angestanden wäre, brach es aus Swoboda geradezu heraus:
»Des ist sicher scho wieder so a Scheiß-Selbstmörder!«
Diese doch sehr undiplomatische Ausdrucksweise zog einen unerwarteten Stimmungswandel nach sich. Die allgemeine Wut wich auf der Stelle sensationslüsternem Interesse. Der soeben noch Geschmähte mutierte unversehens zur Auskunftsperson.
»Ja, glauben Sie wirklich?«, ergriff nun ein mit Lodenmantel und ebensolchem Hut bekleideter Mittfünfziger das Wort.
Swoboda, der von diesem unerwarteten Stimmungsumschwung völlig überrascht wurde, realisierte mit einem Mal diese abrupte Wandlung vom Omega zum Alpha und reagierte sofort. Mit herrischer Miene breitete er theatralisch seine Arme aus und schob fordernd sein Kinn nach vorne:
»Was glauben Sie, wie oft uns aner vor den Triebwagen hupft? Letztes Jahr waren es 40 Stück – und wir müssen damit fertig werden, aber des interessiert ja kanen.«
»Warum sprechen Sie dann immer von der ›Erkrankung eines Fahrgastes?‹«, wollte der Herr weiter wissen.
»I net. Wenns nach mir ging, i würd des glatt sagen. Mit dem Text: ›Weil sich ein Selbstmörder wieder einmal vor die U-Bahn geworfen hat, müssen Sie jetzt leider warten!‹ Und wissen S’, warum wir das net sagen dürfen? Wegen der Nachahmungstäter. Als würd irgendjemand vor an Zug hupfen, bloß weil er die Durchsage g’hört hat. Und überhaupt, haben Sie schon einmal in der Zeitung gelesen, wenn aner vor an Zug gsprungen is? Natürlich net. Und warum net? Aus genau dem gleichen Grund. Weil vielleicht irgendan Leser sich denken könnt: ›Des muss ja super sein, vor die U-Bahn zu hupfen. Des mach ich jetzt auch!‹«
Plötzlich begann Swoboda aufgrund der ungewohnten Tätigkeit heftig zu schwitzen. Rasch zog er die verräterische Windjacke aus und legte sie sich über den Arm. Diese Unterbrechung nutzte der Herr im Lodenmantel zu einem weiteren Einwand:
»Aber es muss doch nicht immer ein Selbstmörder sein. Es kann ja wirklich einmal ein Fahrgast einen Herzinfarkt erleiden oder in Ohnmacht fallen, so was gibt es doch.«
»Ja, scho, des passiert manchmal a. Meistens san des eh Giftler, die a Überdosis gnommen ham und dann im Zug zammenklappen. Dann kann man des ja a sagen, dass aner krank worden is.«
Swoboda, um den sich unterdessen eine regelrechte Menschentraube gebildet hatte, erhob nun die Stimme, damit auch die etwas weiter entfernten Passanten etwas verstehen konnten.
»Also, ich persönlich glaube, dass es viel mehr Sinn hätt, wenn ma die Bilder von de Toten veröffentlichen tat. Da, hierher, an jedem U-Bahnsteig sollten sie die hängen, mit allen Einzelheiten. Glauben Sie, dann wirft sich noch jemand vor den Zug? Sicher net. Und daneben sollt man, von mir aus, noch ane Gebrauchsanleitung hängen, wie man sich umbringen kann, ohne dass andere mit hineingezogen werden. Schauen Sie, in Osaka hat der Magistrat vor ein paar Jahren Plakate aufgestellt, wo die Selbstmörder gebeten wern, net in der Stoßzeit auf die Schienen zu hupfen. Des war genau richtig. Aber na, da san wieder a paar Linke aufgstanden und ham gsagt, des ist unmenschlich, dass die das da hinschreiben. Und wenn uns Fahrern des passiert, ist das vielleicht net unmenschlich? Nur weil de Selbstmörder zu feig san, sich gemütlich in der Badewanne die Pulsadern aufzuschneiden oder sich die Kugel zu geben? Jeder red von de armen Opfer, aber haben Sie sich scho amol Gedanken darüber gemacht, was in an Fahrer vorgeht, der ahnungslos in an Bahnhof einfährt, um dann plötzlich in das Gesicht von am Menschen zu schauen, der sich Sekunden später in eine grausliche Melange aus Knochen und umanandspritzende Innereien verwandelt? Die meisten springen doch aus Verzweiflung, weil sich niemand um sie kümmert – in unserem sogenannten Sozialstaat.«
Beifälliges Gemurmel mischte sich mit vereinzelten »Bravo«-Rufen, was Swoboda geradezu berauschte. Heute war sein Tag, das spürte er genau. Immerhin war es die erste öffentliche Rede, die er außerhalb seines Stammbeisls hielt. Wie in Trance sprach er weiter, während er kämpferisch die Faust ballte.
»Wie kum i als unterbezahlter Fahrer eigentlich dazu, an Menschen zu töten und muss mir dann a no Vorwürfe machen, ob i net besser anders reagiert hätt? Schauen Sie, a paar von unsern Chefs waren letztens auf aner Tagung in Athen, wo sich die U-Bahn-Verantwortlichen aus der ganzen Welt getroffen ham. Und dort ham die studieren können, was die Japaner gegen ihre Selbstmörder machen, die haben ja dort noch viel mehr als mir. Die ham afach ihre Bahnsteige umbaut. Die Gleise hams mit aner Wand abgschirmt, die sich erst dann öffnet, wann der Zug zum Stehen kummen is. Seitdem gibts bei diese Stationen kane Toten mehr. Daraufhin haben wir dem Magistrat vurgschlagen, des a in Wien zu machen. Und was ham die gsagt? Zu teuer! Wann Sie aber bedenken, wie viel so a Toter im Endeffekt kost. Die Rettung muss kumme, die Feuerwehr a, der Bahnsteig wird abgsperrt, des Putzkommando kummt daher. Und das alles von unsam Steuergeld! I bin sicher, nach der zwahundertsten Leich, also in etwa … fünf Jahren würd sich des rechnen!«
»Ist Ihnen so etwas auch schon einmal passiert?«, wollte nun eine wohlbeleibte Dame wissen, die schon eine ganze Weile mit dem Finger aufgezeigt hatte, bis Swoboda ihr mit einer Handbewegung das Wort erteilte.
»Na, mir glücklicherweise net. Aber viele meiner Kollegen ham net so a Massel ghabt wie i. Da gibts anen bei uns, der scheint die Lebensmüden geradezu anzuziehen. Zuerst is ihm a blutjunges Ding auf die Schienen gsprungen, deren hilfloser Blick ihn dann prompt nimma losglassen hat. Die Augen sans, die kannst net vergessen. Ausgsprochen hübsch is sie gwesen, die Kleine – vor dem Unfall. Kaum hat er sich nach monatelanger Betreuung und einstweiliger Versetzung in den Innendienst wieder an den Regler von an Triebwagen traut, is ihm schon der Nächste vor die Füß gfallen. Diesmal ein Giftler, der im Vollrausch den Zug anhalten wollt – was ihm schließlich a glungen is, nur hat er nix mehr davon ghabt. Der Junkie war dem Kollegen ziemlich egal, aber der Schock, den das erste Opfer ausglöst hat, is so wieder zrückkummen. Wieder psychologische Behandlung, wieder Innendienst. Des war vor an Jahr. Als wär des net gnug, verliebt er sich in sei Therapeutin, die von ihm jedoch nix wissen wollt, so dass er scho fast selber so weit war wie sei Opfer. So a Blödsinn, als Fahrer a Studierte … Glücklicherweise is er dann doch wieder normal gworden und sitzt seit einige Wochen wieder am Regler. I kann nur hoffen, dass er mit dem jetzt nix zu tun hat.«
Während Heinz Swoboda das Publikum mit seinen Erzählungen hinriss, herrschte auf dem Bahnsteig der Station Schottenring tatsächlich eine ziemliche Sauerei. Laut Augenzeugenberichten war ein ziemlich junger, auffallend gut gekleideter Mann gerade in dem Moment auf die Gleise gesprungen, als der Zug mit beträchtlicher Geschwindigkeit in die Station eingefahren war. Da zur Zeit des Vorfalls ein enormes Gedränge auf dem Bahnsteig geherrscht hatte, schließlich war Stoßzeit, widersprachen sich die Aussagen der wenigen Passanten, die das Geschehen verfolgt hatten. Ein älterer, sichtlich erregter Herr, der sehr nahe bei dem Unglücklichen gestanden war, sagte aus, dass der Tote mit Sicherheit selbst gesprungen sei. Leider habe er dessen Absicht zu spät bemerkt, um ihn noch zurückhalten zu können.
Eine junge Frau wiederum sagte aus, dass sich auf diesem Teil des ohnehin vollen Perrons auffallend viele Menschen aufgehalten hätten und dass das Opfer unmöglich aus einer derartigen Menge heraus hätte ungehindert springen können. Allerdings hatte sie weiter weg gestanden und war somit als Zeugin nur bedingt zu gebrauchen.
Es gab also das übliche Malheur mit den Beobachtern. Jeder behauptete etwas anderes. Und dabei konnten die Inspektoren noch froh sein, wenigstens zwei Aussagen aufnehmen zu können. Zuweilen kam es auch vor, dass sich gar niemand meldete, um ja nicht mit der Polizei in Berührung zu kommen.
Nach Beendigung der Zeugenrekrutierung baten die Polizisten jene, die keine Aussage zu machen hätten, sich nach einem alternativen Verkehrsmittel umzuschauen. Tatsächlich fanden sich jedoch nicht allzu viele dazu bereit, den Ort des grausigen Geschehens zu verlassen. Die meisten warteten vielmehr geduldig darauf, dass der Zug endlich weggezogen werde, damit sie wenigstens das Resultat des Versäumten näher studieren konnten. Schließlich ergab sich für sie so die willkommene Gelegenheit, den Feierabend ein wenig bunter zu gestalten.
Nachdem der Unglückszug auf ein Seitengleis verbracht worden war, machte sich angesichts der blutigen Masse ein lustvolles Entsetzen breit, dessen Manifestationen dem Reinigungspersonal im Übrigen erheblich mehr Arbeit bereitete als die eigentliche Ursache. Tatsächlich hatte der Zug dem Körper ziemlich übel zugesetzt. Das Opfer war noch im Sprung vom Triebwagen erfasst worden. Dadurch brach der Körper zuerst in der Mitte, bevor die Räder den Kopf und die Beine vom Rumpf trennten, den der Zug bis zu seinem endgültigen Stillstand vor sich her rollte. Alles in allem lagen etwa vier Meter zwischen Herzmassage und Beatmung.
Als wäre das nicht genug, sah sich die Rettungsmannschaft mit einem weiteren Problem konfrontiert. Da das Opfer zu Lebzeiten über eine respektable Größe verfügt hatte, stellte sich nun die Frage, wie der Torso in angemessener Form abzutransportieren wäre. Die nach den Maßen des Durchschnittsösterreichers eigens für solche Vorkommnisse konzipierte Leichenwanne erwies sich nämlich für den Verunglückten als eindeutig zu kurz. Pragmatisch, wie Mitarbeiter der Rettung nun einmal sind, legten sie kurzerhand den Kopf zwischen die Beine. Als wäre dies nicht Unglück genug, hatten die Feuerwehrleute gerade diesmal den Deckel für die Wanne vergessen und mussten den grotesk verbauten Leichnam notgedrungen an den nichts ahnenden Passanten vorbei durch den Bahnhof in ihr bereitgestelltes Fahrzeug tragen. Der städtische Reinigungsdienst hatte an diesem Abend wahrlich alle Hände voll zu tun.
Nachdem die Mannschaft fürs Grobe, die sogenannten »Entweser«, ihr Geschäft endlich beendet hatte, nahmen die überfüllten U-Bahnen ihren Dienst wieder auf – womit Heinz Swoboda seiner neu entdeckten Rolle als Volksredner verlustig ging, wenigstens vorläufig. Denn dieser Abend sollte ein Schlüsselerlebnis für den klein gewachsenen Zugsführer sein. Nur wenige Tage nach seinem so erfolgreich verlaufenen ersten öffentlichen Auftritt trat er der Partei bei, die für ihn am glaubwürdigsten vorgab, die Interessen der kleinen Leute zu vertreten. Und sein Gefühl trog ihn nicht. Genau diese politische Gemeinschaft verbuchte bei den bald darauf folgenden Wahlen einen überraschend großen Stimmengewinn, der Swoboda unversehens auf einen verheißungsvollen Platz in der parteiinternen Hierarchie spülte.
In einer der U-Bahn-Garnituren, die im Tunnel vor dem Unglücksort zum Stillstand gekommen war, befand sich auch Bezirksinspektor Kajetan Vogel. Eigentlich wollte der smarte Enddreißiger heute pünktlich zu Hause sein und war eben deswegen mit dem üblicherweise zuverlässigen Nahverkehrsmittel gefahren. Es gab schließlich, so befand wenigstens seine Frau Martina, einen Grund zu feiern, war er doch auf der Titelseite der auflagenstärksten Österreichischen Tageszeitung, der »Wiener Tagespost«, als »besonders fähiges Mitglied der Wiener Exekutive« bezeichnet worden (mit seinem Bild im Innenteil). Sein letzter Mordfall nämlich, eine Aufsehen erregende Familientragödie in Wien, in deren Verlauf ein Sohn seine verhassten Eltern bestialisch umgebracht hatte, war durch Vogels »geschickte« Führung des Verhörs ziemlich rasch gelöst worden. Seine »Geschicklichkeit«, die in der Tagespresse so großspurig gepriesen wurde, hatte zwar lediglich darin bestanden, dass er sich bei dem als Zeuge vorgeladenen Sohn erkundigt hatte, ob er vielleicht nicht selbst der Täter gewesen sein könnte – woraufhin das etwas minderbemittelte Bürschlein den überraschten Inspektor fragte, wie er ihm denn so schnell auf die Schliche gekommen sei –, doch waren diese recht prosaischen Umstände der Presse völlig egal gewesen. In der heutigen Zeit des Autoritätsverfalls, so befand wenigstens der Chefredakteur der einflussreichen Zeitung, sind Helden im Staatsdienst notwendig, weil auflagenfördernd.
Und nun saß unser Held in der U-Bahn fest und fluchte, denn in Kürze sollte ein Festessen im Kreise der Familie beginnen, und Lauras wegen, seiner gerade fünf Jahre zählenden Tochter, an der der eher trockene Inspektor mit einer affenartigen Liebe hing, bereits um 18 Uhr …
Der Zug hatte jetzt schon seit mehr als einer Viertelstunde im Tunnel gewartet. Ähnlich wie Swoboda packte Vogel bei dem Hinweis auf die »Erkrankung eines Fahrgastes« die schiere Wut. Doch er hatte nicht das Glück des U-Bahn-Fahrers, dessen Leben durch den Zwischenfall eine vielleicht entscheidende Wendung genommen hatte. Nein, Kajetan Vogel hatte nicht die Möglichkeit, seinem Zorn ein Ventil zu bieten. Zumal der Akku seines Mobiltelefons erschöpft war und er seiner wartenden Frau keine Nachricht über den Grund seiner Verspätung geben konnte. So musste er sich denn notgedrungen mit einem innerlichen Schimpfen begnügen, hätte aber damit durchaus auch in jener Partei reüssieren können, die Swoboda später so gastlich aufnahm. Aber Vogel hatte von den Politikern die denkbar schlechteste Meinung. Er glaubte vielmehr an die Unabänderlichkeit des Schicksals, dessen übelste Vertreter bekanntlich die Politiker sind. Und damit versuchte er sich ebenso abzufinden wie es einem österreichischen Beamten gebührt, wie auch mit dem anderen Übelstand in seinem Leben, seiner Frau Martina.
Diese, ganz süßes Wiener Mädel, war aufgrund der mangelhaften Reißfestigkeit eines von ihm benutzten Kondoms schwanger geworden und hatte es mit Hilfe ihrer gutbürgerlichen Eltern verstanden, einen derartigen Druck auf Vogel auszuüben, dass er sich schon bald außerstande sah, diesem zu widerstehen, denn in seinem Innern war er ein schwacher Mensch. Oft genug hatte er während ihrer nun schon fünfjährigen Ehe erwogen, sich von seiner Frau zu trennen, doch der damit drohende Verlust seiner geliebten Tochter hatte ihn bisher davon abgehalten.
Als Vogel endlich in seiner Hietzinger Mietwohnung ankam, war es bereits 15 Minuten nach sechs. Ein Blick genügte, um ihn davon zu überzeugen, dass seine Frau Martina keine wie auch immer geartete Entschuldigung für sein Zuspätkommen akzeptieren würde. Die Hände in die Seiten gestützt und den langsam wiegenden Kopf schief gelegt erwartete sie ihn im Vorzimmer. Es fehlte nur noch das sprichwörtliche Nudelholz.
»Wie du dich vielleicht erinnerst, war unser Tisch auf sechs bestellt. Das können wir jetzt wohl vergessen. Und du weißt, wie sehr sich deine Tochter darauf gefreut hat. Was hast du heute dazu zu sagen?«
Die Betonung im letzten Fragesatz war eine gezielte Frechheit, zählte doch die Pünktlichkeit zu Vogels größten Tugenden. Ungerechtigkeiten jedweder Art indes erbosten ihn zutiefst. So war er schon nahe daran, einfach und ohne weitere Erklärung zu behaupten, die U-Bahn habe Verspätung gehabt. Dann hätte er nach einem kurzen bösen Wortgefecht einen Abend lang seine Ruhe gehabt und sich an seinen Computer zurückziehen können, wo er, als leidenschaftlicher Kartenspieler, des Öfteren recht erfolgreich an den virtuellen Turnieren eines Internet-Bridge-Clubs teilnahm. Vor dieser lockenden Aussicht bewahrte ihn jedoch – wie schon so oft – der verschreckte Gesichtsausdruck seiner kleinen Tochter Laura, in deren Miene sich bereits die Furcht vor einem familiären Donnerwetter abzeichnete. Seufzend beschloss Vogel also, für den heutigen Abend die alternative Variante zu wählen.
»Es tut mir furchtbar leid, aber stell dir vor, es ist einer vor die U-Bahn gesprungen – und ich saß drin«, teilte er, nicht ganz der Wahrheit entsprechend, seiner überraschten Frau mit, während er seinen Hals mühsam von der Tochter befreite. »Du kannst dir ja vorstellen, was das für eine Sauerei war.«
Mit einem Schlag hatte ihr Entsetzen die Wut verdrängt – ein Dummer war der Vogel wirklich nicht.
»Kajetan, doch nicht vor dem Kind!«
Verraucht der Zorn, vergessen die Wut. Ein dramatischer Todesfall verfehlte bei Martina nie seine Wirkung. Effektvoller wäre es nur noch gewesen, wenn er erzählt hätte, dass ein Kind vor der einfahrenden U-Bahn in den Spalt gefallen sei, aber diese Version wollte er sich lieber für ein andermal aufheben.
1. Akt
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!