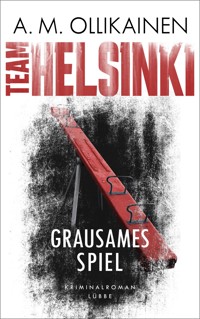9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Paula Pihlaja-Serie
- Sprache: Deutsch
Am Morgen des Mittsommertags werden Kommissarin Paula Pihlaja und ihr Team zu einem grauenvollen Fund westlich von Helsinki gerufen. Vor dem Gutshof einer Unternehmerfamilie wurde ein Container abgestellt, in dem eine ermordete dunkelhäutige Frau liegt. Sie ist qualvoll darin ertrunken, nachdem Meerwasser eingefüllt wurde. Niemand scheint die Frau zu kennen. Die Ermittler misstrauen jedoch den allzu geschliffenen Antworten der Unternehmerfamilie. Kurze Zeit später kann die Identität der Toten geklärt werden: Die Universitätslehrerin Rauha Kalando war wenige Stunden vor ihrem Tod aus Namibia eingeflogen. In ihrem Hotelzimmer liegt ein Dokument, unterschrieben vom ehemaligen Unternehmenschef.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorenTitelImpressumJANUARMAITEIL I1234567891011121314151617181920TEIL II123456789101112131415161718TEIL III12345678910111213141516171819202122AUGUSTJANUARÜber dieses Buch
Band 1 der Reihe »Paula Pihlaja-Serie«
Am Morgen des Mittsommertags werden Kommissarin Paula Pihjala und ihr Team zu einem grauenvollen Fund westlich von Helsinki gerufen. Vor dem Gutshof einer Unternehmerfamilie wurde ein Container abgestellt, in dem eine ermordete dunkelhäutige Frau liegt. Sie ist qualvoll darin ertrunken, nachdem Meerwasser eingefüllt wurde. Niemand scheint die Frau zu kennen. Die Ermittler misstrauen jedoch den allzu geschliffenen Antworten der Unternehmerfamilie. Kurze Zeit später kann die Identität der Toten geklärt werden: Die Universitätslehrerin Rauha Kalando war wenige Stunden vor ihrem Tod aus Namibia eingeflogen. In ihrem Hotelzimmer liegt ein Dokument, unterschrieben vom ehemaligen Unternehmenschef …
Über die Autoren
A. M. Ollikainen ist das Pseudonym des Ehepaars Aki und Milla Ollikainen. Aki Ollikainen hat bereits drei Romane veröffentlicht und den Literaturpreis der größten finnischen Tageszeitung gewonnen, den »Helsingin Sanomat Literture Prize 2012«. Seine Romane standen zudem auf der Longlist des Man Booker Prize und des Prix Femina. Auch Milla Ollikainen ist eine renommierte Autorin. Auch von ihr sind schon drei Romane erschienen und sie hat 2012 den Preis der »Finish Detective Society's Crime novel« gewonnen.
Das Ehepaar lebt mit seinen zwei Kindern in Lohja, im Süden Finnlands.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der finnischen Originalausgabe:
»Kontti«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2021 by A.M. Ollikainen
Original edition published by Otava Publishers, 2021
German edition published by arrangement with Aki Ollikainen, Milla Ollikainen and Elina Ahlback Literary Agency, Helsinki, Finland.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Frauke Meier, Hannover
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Billeunter Verwendung von Motiven von © shutterstock: Jojje | Yanchous
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-2105-9
luebbe.de
lesejury.de
JANUAR
In der abgasgeschwängerten Luft scheint die Morgensonne zu flimmern. Sie überzieht das Vorstadtviertel mit schmutzig gelbem Licht und schiebt einen unsauberen Mann um die Ecke des Einkaufszentrums auf die Hauptstraße.
Für die schneidende Kälte ist der Mann viel zu leicht gekleidet. Die zerknitterte aschgraue Anzugjacke und die Hose, die ihre Bügelfalten verloren hat, sind mit kleinen und größeren Flecken übersät, über deren Ursprung man lieber nicht nachdenkt. Selbst der aufmerksamste Passant würde nicht vermuten, dass der Anzug, den nicht einmal das Recyclingzentrum nehmen würde, vor einiger Zeit eine vierstellige Summe gekostet hat.
Der Mann taumelt durch einen Nebel, der sich nur langsam lichtet. Er begreift, dass er eine fremde Straße entlanggeht. Sonst begreift er eine Weile kaum etwas. Er hat die Dunstschwaden in seinen Kopf gesogen, wo erst dann Platz für Gedanken frei wird, wenn der Nebel mit den schweren Atemzügen in die Frostluft ausgedünstet ist.
Als Erstes kommen ihm Dinge in den Sinn, die er nicht weiß: wo er ist, woher er kommt, wie lange er schon gegangen ist – er ist sich nicht einmal sicher, wer er ist. Seine Umgebung will einfach keine feste Form annehmen, sie wogt und schwankt. Gerade so, als würde der Autofokus einer Kamera keinen Fixpunkt finden.
Der Mann lehnt sich an das kalte Schaufenster des Supermarkts. Eine widerwärtige Geruchsmischung aus Urin, Magensäure und Alkohol dringt ihm in die Nase. Im Fenster sieht er, dass sein Spiegelbild die Handfläche gegen seine Hand drückt. Aber das Spiegelbild scheint ihm fremd.
Die Gestalt in der Fensterscheibe hat seine Gesichtszüge, aber die Augäpfel, die zwischen den geschwollenen Lidern hervorlugen, sind gerötet, als hätte jemand Glassplitter hineingerieben. Auf dem Kopf des Spiegelbilds sitzt eine Mütze mit dem Logo einer Bank, die schon vor Jahren pleitegegangen ist.
Er war auf dem Sofa einer schäbigen Zweizimmerwohnung aufgewacht. Durch die angelehnte Schlafzimmertür drangen gedämpfte Geräusche, die andeuteten, dass sich dort etwas bewegte. Im Doppelbett schliefen zwei Menschen, die der Mann nicht erkannte. Sie gehörten zur falschen Gesellschaftsschicht. Zwischen den leeren Flaschen auf dem Küchentisch fand der Mann eine nur halb ausgetrunkene Flasche Finnland-Schnaps. Er nahm einen großen Schluck und steckte die Flasche in seine Manteltasche.
Er hatte mit Calvados, XO-Cognac und rauchigem Whisky angefangen. Das ist allerdings schon lange her – Tage, vielleicht Wochen. Je klarer die Getränke wurden, desto verschwommener wurde sein Zeitgefühl. Den Bartstoppeln nach könnte man auf eine ungefähr neuntägige Sauftour schließen.
Seine Hand, die an der Fensterscheibe liegt, ist vom Frost gerötet. Die Fingergelenke sind geschwollen und lassen sich nicht geradebiegen, obwohl er seine ganze Willenskraft darauf konzentriert. Plötzlich merkt der Mann, wie kalt ihm ist. Das ist kein Wunder, denn er hat seinen Mantel gerade eben in eine Mülltonne gestopft, weil ein falsch gelenkter Harnstrahl die Mantelschöße durchnässt hat.
Der Mann versucht Kontakt zu den Vorbeigehenden aufzunehmen, um Hilfe zu bitten, begreift aber bald, dass er keine verständlichen Worte hervorbringt, geschweige denn einen ganzen Satz. Er sieht Menschen an einer Bushaltestelle und will zu ihnen gehen, doch die Beine gehorchen ihm nicht. Sie tragen ihn erst seitwärts, dann geht jedes in eine andere Richtung, und schließlich, als er schon fast bei der überdachten Haltestelle ist, werfen sie ihn auf die Knie.
Man reicht ihm Blumen. Der Strauß ist viel zu bunt und wirkt deshalb knallig. Das verletzt ihn ein wenig, denn er hat einen Blick für Ästhetik. Dennoch flüstert er der jungen Frau im Kostüm lächelnd einen Dank zu. Er legt die Blumen auf das Rednerpult, beugt sich zum Mikrofon, ohne den Blick vom Publikum abzuwenden, und spricht das Zauberwort: Mitgefühl.
Die Menschen an der Haltestelle treten einen Schritt zurück. Sie schauen beflissen weg, und in der Luft hängt ein lautloser Seufzer der Erleichterung, als der Stadtbus sie endlich aufsammelt.
Ich bin Hannes Lehmusoja, erinnert sich der Mann auf einmal. Ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein internationaler Wohltäter. Ein Mäzen zeitgenössischer Kunst. Im selben Moment versagt sein Schließmuskel, und er spürt, wie eine dicke, warme Flüssigkeit zwischen seine Arschbacken rinnt. Das gibt ihm die Kraft, das erste erkennbare Wort hervorzupressen: Scheiße.
Hannes entdeckt einen kleinen Park auf der anderen Straßenseite. Er sammelt seine Kräfte und steht auf. Die Hände auf die Oberschenkel gestützt, beginnt er die Straße zu überqueren.
Mitten auf der Fahrspur bleibt Hannes stehen. Seine Sinne werden eine Spur klarer. Er hört Bremsen quietschen. Ein Lastwagen hält zwei Meter vor ihm. Er betrachtet das Volvo-Zeichen am Kühler. Ich habe auch einen Volvo, denkt er. Er schafft es, die Hände von den Oberschenkeln zu lösen, richtet sich auf und geht mit schleppenden Schritten weiter. Als er auf die zweite Fahrspur tritt, rauscht vor ihm etwas vorbei, ein Auto, natürlich ist es ein Auto, und es streift ihn beinahe, er spürt den Luftstrom durch den dünnen Stoff seines Hemdes. Jemand hupt, es ist der Fahrer des Lasters, der sich nicht mit Hupen begnügt, sondern das Fenster herunterdreht, den Oberkörper nach draußen streckt und losbrüllt. Hannes wird aus den Worten nicht schlau. Er wankt vorwärts, wäre beinahe über einen Pflasterstein gestolpert, bleibt wie durch ein Wunder auf den Beinen und peilt eine Parkbank an, auf die er sich fallen lässt.
Mitgefühl. Und dann das zweite Zauberwort, die Zwillingsschwester des Mitgefühls: Solidarität.
Wenn man eine Rede hält, ist es wichtig, Blickkontakt zu suchen, seine Worte an irgendwen im Publikum zu richten. So bleibt die intime Stimmung erhalten. So schafft man den Eindruck, dass man nicht auf allgemeiner Ebene zur großen Masse spricht, sondern jeden Anwesenden persönlich anredet. Man kann die Blickrichtung wechseln, aber nicht zu oft.
Es wird oft behauptet, echte Solidarität könne man nur für eine begrenzte Gruppe von Menschen empfinden.
Hannes verwendet in seiner Rede ungern das Passiv, das hier war ein Ausrutscher. Ein Stilfehler. Er legt eine Pause ein und schaut dem Zuhörer tief in die Augen. Die blicken unter einer fest zugebundenen Pelzmütze ängstlich zurück. Ein Kindergesicht. Das Kind entfernt sich einen Schritt. Jemand stubst Hannes vorsichtig an die Schulter.
»Alles in Ordnung? Soll ich einen Krankenwagen rufen?«
Hannes hebt die Hand. Damit will er den Zuhörern signalisieren, dass die Pause eingeplant ist, kein Blackout.
»Ich werde … abgeholt.«
»Ganz sicher?«
»Nur eine kleine Pause.«
Die Frau und das Kind gehen weiter. Sie blicken immer wieder über die Schulter. Die Frau hat ihr Handy aus der Handtasche geholt, steckt es aber wieder ein.
Hannes sieht ihnen nach. Die Pause zieht sich in die Länge, er muss schnell zu seiner Rede zurückfinden. War ihm gerade kalt? Jetzt nicht mehr. Er möchte nur hier sitzen. Er muss eine Rede halten, muss das interdisziplinäre Kunstprojekt Mitgefühl lancieren, das von der Stiftung finanziert wird, die seinen Namen trägt. Er fängt ein neues Augenpaar im Publikum ein.
Worauf können wir die Solidarität begrenzen, fragt Hannes das Eichhörnchen im Winterfell. Auf die Familie? Auf das engere Umfeld? Endet sie an den Grenzen des Nationalstaats? Kann sich ein echtes Solidaritätsgefühl nur auf Menschen unserer Art richten, auf diejenigen, mit denen wir uns identifizieren können? Endet die Solidarität am Meeresufer? Müssten nicht gerade wir Finnen aus der Geschichte gelernt haben, dass Gewässer uns nicht trennen, sondern im Gegenteil entfernt voneinander lebende Menschengruppen verbinden?
Das Eichhörnchen legt den Kopf schräg, und Hannes ahmt die Bewegung instinktiv nach.
Genügt als Ausgangspunkt des Mitgefühls nicht der kleinste gemeinsame Faktor? Die Tatsache, dass wir, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Alter und Geschlecht, alle Menschen sind? Du und ich, wir sind gleichartig, sagt Hannes und blickt dem Eichhörnchen tief in die dunklen Augen.
Das Eichhörnchen schrickt auf, hüpft auf den Schneewall und springt über den Schnee zu einer bereiften Birke.
Hannes blickt ihm nach. Er sieht einen schmalen Pfad, der an der Birke vorbeiführt, steht auf und folgt dem Eichhörnchen. Er kommt an einem Rosenstrauch vorbei, auf dem der Schnee sich so verklumpt hat, dass er einem großen Blumenkohl gleicht.
Jetzt ist ihm überhaupt nicht mehr kalt. Im Gegenteil, es ist warm, er fühlt sich wohl. Er liebt das Klima auf dieser Seite des Äquators. Liebt es, seit er zum ersten Mal hier war. Wenn er wegreisen musste, hat er sich immer zurückgesehnt.
Der kleine Affe, dem er gefolgt ist, sitzt auf dem Ast einer Akazie und beobachtet ihn neugierig. Hannes setzt sich in den Schatten des Busches.
Das hier ist seine geistige Heimat, seine Seelenlandschaft. Der tiefblaue Himmel, die Kumuluswolken, die über dem südlichen Atlantik entstanden sind und langsam vom Ozean her über die Savanne wandern. Eine gleichmäßige Landschaft, hier und da schöne Akazien. Jetzt würde er gern eine Antilope sehen, die in ihrem Schatten herumstreift.
Hannes schaut zum Himmel. Die Sonne, die gerade noch blass unter einem seltsamen Schleier schimmerte, ist nun klar umrissen und ockergelb. Ihr Licht blendet Hannes.
Er ahnt eine Antilope in der Umgebung.
Sie nähert sich ihm.
Er sieht sie nicht, spürt ihre Anwesenheit aber intensiv. Schließlich zeichnet sich ihr Gesicht ab. Es ist schwarz-weiß, doch dann merkt Hannes, dass das Fell vom Gesicht abgefallen ist.
Das Weiße ist Knochen, und aus dem Schädel der Antilope starren ihn große schwarze Eichhörnchenaugen an.
MAI
Der Prozess begann um neun Uhr am Morgen nach dem Maifeiertag. Trotzdem wirkte niemand im Gerichtssaal verkatert.
Der Frühling war spät dran, er hatte auch hier auf sich warten lassen, und die von der Jahreszeit vergessene Stadt wirkte von Tag zu Tag trauriger, geradezu beleidigt. An bewölkten Tagen sahen die Betonfassaden der Häuser so trübsinnig aus wie das Gesicht eines Arbeiters, der gerade entlassen wurde.
Am Vorabend des Ersten Mai hatte sich die Sonne kurz blicken lassen, doch dann war Schneeregen gefallen, und der nachfolgende freie Tag war auch nicht schöner geworden. Solche Feiertage liebte die Polizei.
Oder zumindest die Polizisten, die im Dienst waren.
Der junge Schutzmann an der Tür hatte die Daumen in die Taschen seiner Uniformhose gesteckt. Die Tür war geschlossen, und der einzige Fotograf, der sich herbemüht hatte, war aus dem Saal geschickt worden. Der jugendliche Angeklagte saß der Richterin gegenüber, einen halben Meter tiefer, am vordersten Tisch, mit gesenktem Kopf, die Kapuze ins Gesicht gezogen.
Die Richterin, eine Frau mittleren Alters mit straffem Haarknoten, hielt ihren Gesichtsausdruck sorgfältig unter Kontrolle. In ihrer Position konnte sie sich kein mitleidiges Mienenspiel leisten.
Die Kapuze des Angeklagten reichte bis über die Nase, aber dass er kindliche Gesichtszüge besaß, konnte man allein schon am Kinn erkennen, das ganz hell und glatt war.
In der Gerichtsverhandlung waren für niemanden Überraschungen zu erwarten. Es ging um ein Gewaltverbrechen, das kaum auch nur durchschnittliche Aufmerksamkeit erregte, schwerlich interessant und in keiner Weise speziell – ein simpler Totschlag, der nichts enthielt, wofür die Abendzeitungen eine ganze Seite reservierten oder worüber in Realzeit getwittert würde.
Hinten im Saal saßen der Kriminalreporter eines Provinzblattes und der Mitarbeiter einer Abendzeitung, deren Mienen dienstliches Interesse signalisierten. Die Nachricht über das Urteil würde höchstens zwei Spalten füllen und der Prozess höchstens zwei Tage dauern.
Der Angeklagte hatte kein Geständnis abgelegt, hatte aber seiner Aussage nach keinerlei Erinnerung an den Tatzeitraum und konnte auch nicht beweisen, dass er anderswo gewesen war. Das Opfer war ein bekannter Kleinkrimineller, mehrfach vorbestraft für Drogendelikte. Der Anklage zufolge hatte der 21-jährige Mann, der sich unter seiner Kapuze versteckte, das Opfer erstochen, um ihm das Amphetamin abzunehmen, das die Polizei später in der Brusttasche des Angeklagten gefunden hatte. Die Stichwaffe war am Tatort in der Mietwohnung des Opfers gefunden worden und wies Fingerabdrücke des Angeklagten auf, an dessen Kleidung zudem das Blut des Opfers festgestellt werden konnte.
Es hatte keinerlei Mühe erfordert, den Täter zu finden, denn er hatte nahezu bewusstlos im Schlafzimmer des Opfers gelegen. Das Opfer, das im Wohnzimmer zu Boden gegangen war, hatte selbst noch den Notruf alarmiert, war aber gestorben, bevor Hilfe kam.
Plötzlich nahm der Angeklagte die Kapuze ab, als hätte ihm jemand befohlen, den Kopf zu entblößen und sich vor Gericht demütig zu zeigen.
Die Augen, die nun sichtbar wurden, waren die eines Kindes, das bei einer Missetat ertappt wurde, vor Scham aber noch nicht bereit war, seine Schuld einzugestehen, obwohl ihm klar war, dass die Erwachsenen Bescheid wussten.
Niemand im spärlichen Publikum machte den Eindruck, der Vater, die Mutter oder die Freundin des Täters zu sein. Die ehemalige Lebensgefährtin des Opfers war dagegen auch früher im Gerichtssaal gewesen, als das Opfer noch auf der Anklagebank gesessen hatte. Ein Mädchen, das sich in den bösen Jungen verliebt und mit aller Kraft versucht hatte, aus ihrer Jugendliebe einen tauglichen Vater für die beiden gemeinsamen Kinder zu machen, die inzwischen das Schulalter erreicht hatten. Als ihre Kräfte angesichts der unmöglichen Aufgabe versiegt waren, hatte die junge Frau den leichteren Weg der Alleinerziehenden gewählt, aber ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Ex beibehalten, damit die Kinder einen Vater hatten.
Nun hatten sie keinen mehr. Ihr Vater war nur noch ein Name auf dem Stein in der Ecke des Friedhofs, wo er vor zwei Wochen beerdigt worden war.
Neben der Ex-Gattin saß die Schwester des Opfers, die beiden Frauen hielten sich an der Hand. Ihre Augen waren verweint. Die Kinder des Opfers hatte man immerhin nicht in den Gerichtssaal mitgenommen, und auch seine Mutter war nicht anwesend.
Die Mütter von Mordopfern erkannte man immer, die Trauer zerfraß ihr Fleisch und hinterließ dunkle Schatten unter den Augen, die vielleicht nie mehr verschwinden würden. Auch diese Junkies hatten fast immer Angehörige – jemanden, der ihnen nachtrauerte.
Die Sonne strahlte plötzlich durch die Fenster hoch oben in der Seitenwand, und die Deckenlampen warfen raumschiffartige Schatten an die Täfelung der gegenüberliegenden Wand. Unvermutet sah alles anders aus, auch die Menschen, als hätte das Licht ihnen ein Zeichen gegeben, auf das sie schon lange gewartet hatten.
In der linken hinteren Ecke des Saals saß eine Frau mit einer großen, billig aussehenden Sonnenbrille. Sie hockte mit hängenden Schultern da, als würde sie sich bemühen, nicht aufzufallen. Ihr schwarzer Pagenkopf war viel zu dick und glatt, um echt zu sein. Auch sah die Perücke billig aus, wie aus dem Angebot eines Sexshops. Die Frau saß reglos da, und aus ihrer Kopfhaltung konnte man nicht schließen, wohin sie blickte.
Die Richterin warf einen Blick auf ihre Papiere und klopfte mit dem Hammer auf den Tisch. Der junge Staatsanwalt hatte bereits eine offizielle Miene aufgesetzt, bald würde er zu Wort kommen.
Die Frau mit der Perücke schreckte bei dem Hammerschlag auf. Sie hatte die Augen geschlossen gehalten, seit der mittelalte, dickbäuchige Fotograf mit seiner Arbeit begonnen hatte, und auf das leise Rattern der Kamera gelauscht. Es klang im Gerichtssaal immer gleich, wie ein Regen von spitzen Pfeilen, dem die Angeklagten schutzlos ausgesetzt waren.
Von schräg hinten sah sie den dunkelgrauen Hoodie und den gesenkten Kopf des Angeklagten, die unter der Kapuze zum Vorschein gekommenen Haare, die dieselbe Farbe hatten wie eine Landstraße nach dem Regen. Die Hände des jungen Mannes lagen auf dem Tisch, dann hob sich seine Rechte und zog die Kapuze wieder über den Kopf. Die Frau erhaschte einen kurzen Blick auf eine unter dem Ärmel verborgene, bläuliche Tätowierung. Aber die Haut am Handrücken war sauber und glatt.
Der Staatsanwalt begann sein Plädoyer, die Frau hörte ihm zu, wie man dem Pfarrer bei einer Beerdigung zuhört, ohne sich etwas einzuprägen. Abgesehen von ihr und diesem Wesen mit der Kapuze waren alle in diesem Saal Außenstehende, die ein Ritual vollzogen und nur ihre Arbeit taten, oder Trauernde, deren Los auf andere Weise schwer war als das der Frau und des Kapuzenburschen. Der Gerichtssaal war nach finnischem Brauch schmucklos, aber in seiner stillen Art ehrwürdig, ein wenig wie ein Gemeindesaal, und die Vollzieher des Rituals sprachen auch dann zurückhaltend, wenn das Verbrechen besonders brutal oder widerlich oder ekelerregend war. So blieb alles im Lot, das Böse wurde auf ein Gestell gesetzt, begutachtet und dann abgeheftet. Persönliche Tragödien reduzierten sich in diesem Saal zu Angelegenheiten, zu Aufgaben, die in der Dienstzeit erledigt wurden.
Die Kopfhaut der Frau begann zu jucken, doch sie wagte nicht, sich zu kratzen. Ihre langen, dicken Haare schmorten unter der Perücke. Sie wusste, dass die Perücke lächerlich aussah, hatte aber das Risiko gescheut, erkannt zu werden. Oder vielleicht hatte sie sich nur in eine andere verwandeln wollen, damit all das, was so schwer zu tragen war, ihr nicht zu nahe kam.
Dennoch hatte sie nicht fortbleiben können.
Sie blickte wieder von schräg hinten auf den glatten Handrücken, stellte sich die Hand kleiner und rundlicher vor, stellte sich vor, wie sie warm und weich in ihrer eigenen Hand lag. So, wie sie sie in Erinnerung hatte.
Das war einundzwanzig Jahre her.
Sie begriff, dass sie ein anderer Mensch sein würde, wenn sie diesen Saal verließ.
TEIL I
1
Wo bin ich?
Die Frage schoss ihr durch den Kopf, noch bevor sie die Augen aufgeschlagen hatte, an der Grenze zwischen Schlaf und Wachsein.
Eigentlich war es eher ein Gefühl als eine Frage, gerade so, als wäre es ihr gelungen, etwas Abscheuliches aus ihren Gedanken zu vertreiben, aber das Gefühl wäre zurückgeblieben.
Allmählich, gleitend, wurde sie sich ihrer Umgebung bewusst, und sie atmete langsam durch die Nase. Zuerst war es ganz still. Dann glaubte sie, Möwengeschrei zu hören, das gleichzeitig von nah und fern kam, wie aus einer anderen Welt. Die Vögel waren nur mit Mühe zu hören, und sie war sich nicht sicher, ob sie sich die Geräusche nur einbildete.
Sie öffnete die Augen. Die Angst rumorte in ihrem Bauch, instinktiv.
Es war völlig dunkel.
Sie hielt die Hand vor ihre Augen, bewegte sie und mühte sich ab, um die Bewegung zu sehen, eine Form zu erkennen, die ihre Hand sein könnte. Dann hob sie den Kopf von der Unterlage. Es war eine Art Matratze ohne Kopfkissen.
In diesem Land war es ihrer Meinung nach unnatürlich hell gewesen, und jetzt war es unnatürlich dunkel. War es Nacht oder Tag? Einen Augenblick lang fürchtete sie, sie wäre blind geworden, doch bald begriff sie, dass sie die Dunkelheit sah. Sie schwamm vor ihr wie das Meer, tief und bodenlos.
Vielleicht schlief sie noch und träumte nur, sie wäre aufgewacht. Solche Träume hatte sie gelegentlich gehabt; zuerst Träume, in denen sie eine unwiderrufliche böse Tat begangen hatte, etwas so Entsetzliches, dass es ihr beim Aufwachen erschien, als wäre es wirklich geschehen – dabei war sie in Wirklichkeit nur aus einem Albtraum in den nächsten geglitten. Darauf folgte immer Entsetzen, ein Aufschrecken und schließlich die befreiende Erkenntnis, dass alles tatsächlich nur ein Traum gewesen war.
Die Frau legte ihren Kopf wieder auf die Matratze und versuchte an etwas Angenehmes zu denken, das ihre Gedanken aus dieser Situation trug und sie wieder in die Traumwelt fallen ließ, aus der sie in ihrem Bett erwachen würde, wenn die Sonnenstrahlen über den Fußboden gewandert waren und ihr Gesicht erreicht hatten. Aber die Rückkehr in die Geborgenheit des Traums blieb aus, und sie konnte sich auf nichts konzentrieren.
Das war kein Traum, sie war wach.
Vergeblich suchte sie mit dem Blick nach einem Fixpunkt in der Dunkelheit. Doch da war weder ein fahler Streifen unter der Tür noch Phosphorlinien eines Weckers oder das Licht des Handys.
Das Handy, wo ist es?
Die Frau tastete sich vorsichtig ab. Sie lag auf dem Rücken und war vollständig bekleidet, eine dünne Hemdbluse, darunter ein Top, dazu Jeans und Stoffschuhe ohne Socken.
Das Handy müsste in der Handtasche sein, in dem kleinen Lederbeutel, in dem außerdem gerade noch das winzige Portemonnaie und die Zigaretten Platz fanden. Sie tastete die Unterlage ab. Es war eine schmale Matratze für eine Person, ihre Hand berührte schon bald den Fußboden.
Der Boden fühlte sich seltsam an, zu kühl. Überhaupt war die merkwürdige Mischung aus Kühle und Muffigkeit beklemmend. Die Frau ließ ihre Hand weitergleiten, strich dann mit den Fingern über den Boden auf der anderen Seite der Matratze. Er war nicht aus Beton, wie sie zuerst geglaubt hatte, sondern aus irgendeinem Metall, dessen Lackierung ungleichmäßig verschlissen war.
Die Handtasche lag weder auf der einen noch auf der anderen Seite der Matratze. Da war nur diese widerliche Fläche, feucht und irgendwie dreckig.
Jetzt war die Frau vollkommen wach. In ihrer Brust kribbelte es, ihr Hals schnürte sich zusammen. Die Augen gewöhnten sich überhaupt nicht an die Dunkelheit, kein einziger Gegenstand nahm langsam Gestalt an. In diesen Raum kam ganz einfach kein Licht. War sie bei irgendwem im Keller?
Sie bemühte sich, gleichmäßig zu atmen und ihre letzte Erinnerung vor dem Erwachen wiederzufinden.
Das Treffen in der schattigen Ecke eines Parks.
Alle gesagten Worte – und gezeigten Bilder. Die Frau ging sie in Gedanken durch. Sie erinnerte sich deutlich an jedes Bild.
Sie erinnerte sich an die Erleichterung und an die unendliche Müdigkeit, die ihr folgte.
An die Dankbarkeit, mit der sie die Wasserflasche angenommen hatte.
Die Flasche war voll gewesen, aber war sie auch ungeöffnet?
Sie hätte auf ihre Mutter hören sollen. Wenn man zu weit weggeht, weiß man selbst nicht mehr, wer man ist.
Man ist isoliert wie ein Spaziergänger im All, der sich zu weit vom Mutterschiff entfernt hat.
Can you hear me, Major Tom?
Warum fiel ihr der Song gerade jetzt ein? Jedenfalls gab er ihr neue Kraft.
Vielleicht hatte sie ganz umsonst Teufel in diese Finsternis gemalt. Vielleicht war sie nur ohnmächtig geworden, und man hatte sie zum Ausruhen an irgendeinen ruhigen Ort gebracht.
Die Frau setzte sich auf und hätte im selben Moment beinahe das Bewusstsein verloren. Hinter ihren Augen blitzte es, im Kopf spürte sie einen bösen Schwindel, als hätte jemand in ihrem Gehirn Fechtübungen gemacht. Sie schnappte im Dunkeln nach Luft.
Das war kein normaler Kopfschmerz, das begriff sie sofort.
Panik überkam sie, sie kämpfte sich auf die Beine und schwenkte die Arme durch die Dunkelheit, machte ein paar tastende Schritte, trat mit dem Fuß auf den Boden neben der Matratze.
Tum.
Sie erstarrte und versuchte zu verstehen, was das dumpfe Geräusch bedeutete.
Sie stampfte noch einmal mit demselben Fuß auf den Boden, diesmal erheblich fester.
Tum.
Tum tum tum.
2
Tum tum tum.
Tum tum tum tum.
Das Echo des letzten Schlags verhallte in der Sporthalle, als der Ball auf Paulas Hand ruhte, in der Schale, die die Finger ihrer Rechten bildeten.
Die linke Hand hob sich, um den Ball seitlich zu stützen. Dann leicht in die Knie gehen, Absprung, Arme strecken, Handgelenk drehen und mit den Fingern Rückwärtsdrall geben. Über die einzelnen Elemente des Wurfs brauchte sie nicht nachzudenken, sie waren ins Muskelgedächtnis eingebrannt.
Der Ball begann seinen Flug hinter der Dreipunktelinie und flog durch den Korb, ohne den Ring zu berühren.
»All net!«, rief Karhu anerkennend. Er schnürte sich gerade am Spielfeldrand die Schuhe.
Alle anderen hatten Verspätung. Oder besser gesagt, sie glaubten, es würde reichen, wenn sie zur vereinbarten Zeit in der Umkleide waren.
»Das Training beginnt nicht in der Umkleide, sondern auf dem Feld«, hatte Paula einmal zu Hartikainen gesagt.
Der hatte daraufhin eine Geschichte aus seiner Rekrutenzeit vom Stapel gelassen, die nicht lustig war, sondern bloß ein oberfauler Witz. Kaum zu glauben, dass der Mann früher komplizierte Wirtschaftsverbrechen untersucht hatte.
Allerdings spielte Hartikainen gut, was man nicht von jedem in der Mannschaft sagen konnte. Paula hatte es schon vor Jahren aufgegeben, Technikübungen anzubieten oder andere Versuche zu machen, um die Kollegen in der Amateurmannschaft zu trainieren. Die meisten von ihnen waren Männer, denen Ratschläge noch verhasster waren als das demütigende Erlebnis, einer Frau im Sport unterlegen zu sein.
Paula holte den Ball mit langsamen, übertrieben schweren Basketballerschritten und dribbelte abwechselnd mit der linken und der rechten Hand, während sie sich rückwärts zur Freiwurflinie bewegte. Das Geräusch, das der Ball beim Aufprallen machte, kreiste durch die fensterlose, kahle Turnhalle, die im jahreszeitlosen Licht der Neonröhren lag, das alle Farben blass und die Menschen grau machte.
Paula hatte nahezu ihre ganze Jugend unter mehr oder weniger hellen Neonröhren in den engen Turnhallen maroder Schulen auf dem Land verbracht. Bei Turnieren hatte sie die Hallen großer Schulen in den Städten kennengelernt, in denen sie anfangs gar kein Gespür für die Größe des Spielfelds bekommen hatte, weil es nicht bis zu den Wänden reichte.
Zwar drang kein Sonnenlicht in die Halle, doch die Klimaanlage konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es draußen heiß war. Schon seit vielen Tagen, und die Wettervorhersage versprach auch für den Rest der Woche Hitze.
Wenn es an Mittsommer so heiß ist, werden viele ertrinken, dachte Paula und bereitete sich auf den nächsten Wurf vor.
Tum tum tum.
Tum tum tum tum.
Sieben Aufpraller vor dem Freiwurf. Immer sieben. Eine Routine, die so tief im Rückenmark saß, dass Paula nicht dagegen ankam.
Sie ging leicht in die Knie, sprang hoch und streckte den Arm aus.
»Gwendoline!«
Das war Hartikainen.
Sein Ruf durchschnitt die Luft genau in dem Moment, als Paula den Ball losließ. Er kam nur ganz wenig von seiner Bahn ab, aber doch genug, um den Rand des Korbes zu treffen und abzuprallen.
»Winter is coming«, sagte sie, ohne sich ihren Ärger anmerken zu lassen, und drehte sich um.
Hartikainen platzte mit einer unpassenden Antwort heraus.
»Wenn er doch käme. Diese Hitze hält doch keiner mehr aus. Hier drinnen ist man wenigstens eine Weile von der verdammten Sonne abgeschottet. Ich wünsch mir bloß, dass es bald anfängt zu regnen und bis zum Urlaub nicht mehr aufhört«, jammerte er und wischte sich den nicht vorhandenen Schweiß von der sonnenverbrannten Stirn.
Er hatte Paula nach der hochgewachsenen Schauspielerin seiner Lieblingsserie getauft. Paula hatte daraufhin versucht, Game of Thrones zu schauen, konnte sich für die Fantasy aber nicht begeistern. Sie hatte nie verstanden, wieso erfundene Welten interessanter sein sollten als die reale. Selbst die schrecklichste Grausamkeit in einer irrealen Welt berührte einen nicht so wie wirkliches, erlebtes oder mögliches Leid, ob es nun Fakt oder Fiktion war.
Nun kamen weitere Spieler herein, Leute aus verschiedenen Abteilungen der Helsinkier Polizei. Diesmal nur Männer, obwohl außer Paula noch ein paar weitere Frauen in der Mannschaft waren.
Paula kannte jeden mit Namen und wusste auch, welche Schwächen jeder Einzelne auf dem Spielfeld hatte; wer schnell, aber im Umgang mit dem Ball miserabel war, wer immer zum Korb wollte, aber nie traf, wem man den Ball wegnehmen konnte wie einem Kind.
Als Letzter kam Aki Renko aus der Umkleide. Paula hätte beinahe laut aufgestöhnt.
Renko war nicht nur ein grauenhafter Spieler, sondern auch viel zu redselig für Paulas Geschmack. Besonders ätzend war, dass sein Redefluss selbst auf dem Spielfeld nicht unbedingt versiegte. Und jetzt kam er direkt auf sie zu.
Paula wandte sich ab, um den Ball zu holen, aber irgendjemand war ihr zuvorgekommen. Der Ball flog in hohem Bogen über sie hinweg ans andere Ende der Halle, direkt zu Hartikainen, der einen Dreier warf.
»Toll, Hartsu!«, rief Paula.
»Guter Wurf«, lobte Renko. »Ich hab noch nie einen Dreier geschafft.«
»Aha. Na, irgendwann klappt es schon.«
»Vielleicht könntest du mir irgendwann beibringen, besser zu werfen.«
»Vielleicht.«
»Wo wir doch jetzt Partner sind.«
»Ja«, antwortete Paula. Erst dann ging ihr auf, was Renko gerade gesagt hatte. »Wieso denn Partner?«
»Wir übernehmen Mittsommer.«
»Wir beide?«
»Ja«, sagte Renko.
Paula hatte bereitwillig zugestimmt, an Mittsommer zu arbeiten, weil sie gerade erst aus einer zweimonatigen Beurlaubung zurück war. Renko hatte der Chef allerdings nicht erwähnt, als er sie gebeten hatte, den Dienst zu übernehmen.
Renko merkte offenbar, dass Paula von der Nachricht nicht begeistert war, trotzdem wirkte er nicht verärgert, also bemühte Paula sich, eine freundlichere Miene aufzusetzen.
»Fein, dann sehen wir uns also«, sagte sie und lief ans andere Ende der Halle, um den Ball zu holen, den Hartikainen ins Netz geworfen hatte.
»Das ist bloß eine vorübergehende Regelung«, erklärte Renko, der sich an ihre Fersen heftete. »Es gibt zu wenig Leute.«
Das hatte Paula sich schon gedacht, denn Renko und sie arbeiteten nicht im selben Team und hatten noch nie gemeinsam ermittelt.
»Wahrscheinlich passiert an Mittsommer sowieso nichts«, fuhr Renko fort. »Es scheint zwar gutes Wetter zu geben, da hat die Schupo bestimmt genug zu tun, aber bei dieser Hitze plant wohl keiner einen Mord …«
Glaubt er etwa, mein Hinterkopf würde ihm antworten, dachte Paula.
Ihr brach der Schweiß aus, in der Halle war es wirklich heiß. Vielleicht war die Klimaanlage kaputt. Als Paula den Ball aufhob und sich umdrehte, stand Renko breit lächelnd vor ihr.
»Die Schwarzen gegen die anderen«, rief sie über seinen Kopf hinweg.
Fünf hatten ein schwarzes Hemd an, fünf irgendeine andere Farbe. Paulas Vorschlag war ganz vernünftig. Er passte ihr allerdings auch gut in den Kram, denn sie trug ein schwarzes T-Shirt, Renko ein hellblaues.
»Vier gegen vier. Einer zum Auswechseln«, verkündete sie, und Renko trabte gefügig zum Spielfeldrand und setzte sich auf die Bank.
»Gut«, sagte Paula unwillkürlich. »Gut, legen wir los! Die Schwarzen fangen in der Richtung an. Mann-Mann-Verteidigung, sucht euch die Gegenspieler aus. Ich übernehme Karhu.«
Karhu hieß eigentlich ganz anders, aber er hatte beim Sonderkommando Karhu gearbeitet, als er zu Paulas Basketball-Gruppe gestoßen war. Als er später in die Mordkommission versetzt worden war, hatte Hartikainen ihn kurzerhand umgetauft.
Paula hatte Gefallen an Karhu gefunden und dazu beigetragen, dass er in die Mordkommission berufen wurde.
Mit seinen fast zwei Metern überragte Karhu Paula um rund zehn Zentimeter, wirkte aber noch größer, als er war. Seine Bewegungen schienen immer durchdacht. Wenn der Ball das Board traf, riss er zwar nicht als Erster die Arme hoch, schaffte es aber durch gutes Timing fast immer, in Ballbesitz zu kommen.
Paula war zufrieden, dass Karhu auf der Gegenseite spielte. So wurde sie ernsthaft herausgefordert und konnte sich über Erfolge umso mehr freuen.
Hartikainen – im schwarzen Hemd – warf Paula den Ball zu. Sie trat an die Grundlinie und gab den Ball an Hartikainen zurück, der daran ging, ihn nach vorn zu bringen. Paula sprintete los, überholte Hartikainen und scherte zum Korb. Der Pass landete genau an der richtigen Stelle, Paula brauchte ihn nur in den Korb zu befördern.
»Danke«, rief sie Hartikainen zu und rannte in die Verteidigungszone. Karhu brachte den Ball schnell über die Mittellinie, Paula lief ihm entgegen. Karhu gab an den Rand ab und stürmte selbst in die andere Richtung, Paula schloss hautnah zu ihm auf, ließ den Ball nicht aus den Augen, blieb dicht an Karhu dran und versuchte, seine Bewegungen zu erahnen.
Sie spürte, wie ihr Körper funktionierte und sich streckte. Er hatte alle Bewegungsabläufe gespeichert. Nachdem sie als Jugendliche plötzlich in die Höhe geschossen war, hatte sie zuerst wieder lernen müssen, ihren Körper zu beherrschen. Allmählich hatte sie gewagt, sich zu ihrer vollen Größe aufzurichten, die Arme auszustrecken und sich mit den Beinen vom Boden abzustoßen. Sie hatte ihren für ein Mädchen seltsam großen Körper nicht mehr als Feind empfunden, sondern als einen starken Teil ihrer selbst. Seither geriet jeglicher Kummer beim Spielen in Vergessenheit, sie dachte keine Sekunde darüber nach, wie sie aussah, und alles außerhalb des Spiels verlor an Bedeutung – Vergangenes und Künftiges. Zwar hatte sie ihre Sportkarriere schon in jungen Jahren aufgeben müssen, doch das Bedürfnis danach war immer noch stark.
Jetzt versuchte Karhu, durch ein Täuschungsmanöver an ihr vorbeizukommen. Paula ahnte seine Absicht und kam ihm zuvor. Karhu stolperte über seine eigenen Füße, schwankte und verzog das Gesicht, stürzte zum Glück aber nicht. Der Ball knallte gegen die Wand.
»Wechsel«, rief Karhu und humpelte zur Bank.
Seine Stelle nahm Renko ein, gegen den Paula nun also verteidigen musste, und offenbar würde Renko gegen sie verteidigen. Jedenfalls nahm er neben ihr Aufstellung, unternahm aber keinen Versuch zu verhindern, dass sie Hartikainens Pass auffing, sondern zog sich hinter die Mittellinie zurück. Nach seiner Meinung begann das Spiel erst im eigenen Verteidigungsraum; er hielt es wohl für unhöflich, den Gegner vorher zu behelligen.
Paula dribbelte, während Renko anderthalb Meter vor ihr stand und die Arme schwenkte, als würde er bei der Märchengymnastik einen im Wind schwankenden Baum darstellen.
Paula verstand sich darauf, das Spiel zu leiten. Sie hatte es nicht nötig, den anderen Anweisungen zuzubrüllen, sondern brachte sie mit kleinen Gesten dazu, sich so zu bewegen, wie sie es wollte. Davon hatte sie schon in den Juniorenmannschaften geträumt und zu ihrer Freude und Verwunderung festgestellt, dass ihre Methode in der Hobbymannschaft der Bullen funktionierte.
Hartikainen löste sich von seinem Verteidiger und machte einen Screen vor Renko. Paula schaffte es, an Renko vorbeizukommen. Sie warf den Ball dem Kollegen zu, der unter dem Korb stand, aber nur den Rand traf. Er schnappte sich den Ball jedoch und passte ihn zu Paula zurück.
Wieder tauchte Renko vor ihr auf. Jetzt wirkte er wie ein zitternder Busch. Paula wollte zum Korb, sie machte einen kleinen Ausfallschritt nach rechts und versuchte dann, links an Renko vorbeizukommen. Renko konnte jedoch nicht so schnell auf das Täuschungsmanöver reagieren, sondern lief aus Versehen genau in die richtige Richtung. Er schlug Paula den Ball aus der Hand und streifte dabei ihre Finger. Als Hartikainen daraufhin »Fehler« brüllte, hob er brav die Hände.
Paula ärgerte sich, sie hätte das Spiel lieber weiterlaufen lassen. Der Schlag auf die Finger war minimal gewesen, und sie bevorzugte ein hartes Spiel an den Grenzen der Regeln. Außerdem zollte sie Renko Anerkennung dafür, dass er es geschafft hatte, sie zu überraschen.
Als Renko den Ball nach oben brachte, ließ Paula ihm absichtlich Raum. Renko gab frühzeitig ab, als wollte er eine Situation vermeiden, in der er eine rasche Entscheidung treffen und handeln musste. Gleich darauf landete der Ball jedoch wieder in seinen Händen. Er stand nah an der Freiwurflinie und fand keine freie Richtung für einen Pass.
Paula sah Renkos verängstigte Miene. Er warf den Ball, der das Rückbrett traf, abprallte und im Korb landete. Renko jubelte.
Paula musste lächeln. Sie dachte daran, wie körperliche Anstrengung sich in Genuss verwandelte, wenn Körper und Geist unter dem Einfluss von Endorphin zu einem Ganzen verschmolzen. Aber das Beste war immer der Moment, in dem man sah, dass man in einem wichtigen Spiel einen Treffer erzielt hatte. Ein prickelndes Gefühl, das sich irgendwo im Unterleib ausbreitete.
Mit den Jahren war es allerdings fast verschwunden. Nur eine Art Nachhall war geblieben.
3
Die Frau schrie. Der Schrei prallte zurück und geisterte durch die dreidimensionale Finsternis, bis er schließlich verstummte, nachdem er oft genug an dieselben unsichtbaren Wände gestoßen war.
Die Frau machte zwei Schritte zur Seite, vorsichtig, denn sie wollte das dumpfe Geräusch nicht wieder hören. Dann hob sie die Hand und streckte sie aus. Ihre Finger berührten eine Wand.
Zuerst verspürte sie Erleichterung. Der Raum bekam so etwas wie eine Dimension, sie befand sich nicht in einer grenzenlosen Dunkelheit. Aber als sie die Wand abtastete, schwappte die Furcht wieder hoch.
Die Wand fühlte sich genauso an wie der Boden. Metallisch.
Mit den Fingerspitzen folgte sie der Wand. Bald kam sie an eine Ecke. Sie drehte sich und ging weiter, die nächste Ecke folgte schon nach fünf Schritten, wieder eine Drehung, nun ging sie schneller, irgendwo musste eine Tür sein, bald würde sie aus diesem seltsamen Raum entkommen, und dann würde sich alles klären.
Eine Ecke, eine Drehung nach rechts. Und fast sofort stießen ihre Finger auf eine Art Fuge in der Wand.
Sie fuhr mit der Hand an der Fuge auf und ab, dann über die Wand neben der Fuge. Keine Klinke, nichts. Also ging sie weiter, vielleicht war die Tür doch auf der anderen Seite. Sie tastete die Wand mit beiden Händen ab, entschlossen und systematisch, so vollständig wie möglich. Es war eine Art Wellblech.
Erneut traf ihre Hand auf eine Fuge. Sie fuhr darüber und stellte fest, dass sie eine Runde durch den ganzen Raum gemacht hatte, es war dieselbe Fuge, und auch jetzt fand sie nichts, womit man die Tür hätte öffnen können.
Sie suchte nach einer vernünftigen Erklärung für ihre Wahrnehmungen.
Ein dröhnender Fußboden.
Wände aus Wellblech.
Eine Tür, die sich von innen nicht öffnen ließ.
Eine Tür, die sich nicht öffnen ließ.
War es nicht gefährlich, sie in einen Raum einzuschließen, dessen Tür man nicht von innen öffnen konnte? Wer würde so etwas tun?
An einem heißen Tag könnte sie schnell verdursten. Wie ein Kind, das man im Auto zurückgelassen hat, oder ein Hund oder …
Oder wie Flüchtlinge in einem Container.
Der Gedanke war so ungeheuerlich, dass er nur langsam Einlass in ihr Bewusstsein fand.
Ich bin in einem Container.
Sie war in einer Metallkiste eingesperrt.
Vorsichtig trat die Frau ein paar Schritte zurück. Sie stieß gegen die Matratze, setzte sich hin, um nachzudenken, und bemühte sich mit aller Kraft, die Panik zu zügeln.
Here am I sitting in a tin can.
War sie entführt worden? Würde man sie in irgendein anderes Land bringen und als Hure verkaufen, sie gefangen halten und irgendwann umbringen?
In ihrem Kopf dröhnte es, ihr wurde übel. Verzweifelt suchte sie nach angenehmeren Erklärungen für ihre Lage.
Draußen polterte etwas.
Die Frau sprang auf und horchte. Ein weiteres Poltern, diesmal näher an der Tür.
Wenn das der Entführer war, musste sie jetzt möglichst leise sein, in die Ecke neben der Tür gehen und darauf warten, dass sie geöffnet wurde. Aber wenn es irgendein Unbeteiligter war, wenn sie in einem von Hunderten Containern im Hafen steckte und dies ihre einzige Chance war, nach draußen zu gelangen?
Der Wunsch, rauszukommen, wuchs ins Unerträgliche, er überstieg jedes Urteilsvermögen. Die Frau schlug gegen die Wand neben der Tür und schrie, es war ein wortloses Brüllen, sie wollte nur raus hier, raus und ans Licht.
Sie wollte Sonne, dieselbe Sonne, die zu Hause schien, wenn auch ganz anders.
Inmitten ihres Geheuls hörte sie irgendwo unten etwas klappern. Dann drang Licht herein. Die Frau tastete sich zu der Stelle. Unten, in der Nähe der Ecke, war eine Art Luke. Sie ging in die Knie und betrachtete die Öffnung, sie war klein und rund, die Frau schob ihr Gesicht ganz dicht davor, und wenn das Licht ihr auch in die Augen stach, weckte es doch eine unbändige Hoffnung. Sie schrie erneut, diesmal mit heller Stimme, hier ist ein Mensch, human, öffnet die Tür, ich will raus, hier ist ein Mensch!
Plötzlich verschwand das Licht wieder. Die Luke war geschlossen. Die Frau sah nichts mehr und führte erschrocken die Hand an die Luke heran. Ihre Finger stießen gegen einen runden Gegenstand aus Metall, der durch das Loch geschoben worden war.
Es war das Ende eines Rohrs, und in dem Moment, als ihr das klar wurde, begann Wasser aus dem Rohr zu strömen. Mit voller Kraft.
Sie kreischte auf, rutschte zur Seite und saß nun auf dem Boden, der schon von Wasser bedeckt war, ihre Schuhe und ihre Hose waren im Nu durchnässt.
Das Wasser war kalt. Und es wurde ständig mehr. Sie spürte, wie es um ihre Beine wirbelte.
Sie begriff von all dem nur eins: Bald würde sie sterben.
Der Container würde sich mit Wasser füllen, und wenn er voll war, würde sie tot sein.
Bald würde sie in diesem Container treiben wie eine Ratte, die sich in eine Fischreuse verirrt hat.
Nie mehr würde sie die Sonne sehen.
Nicht die Sonne, nicht ihre Mutter.
And I’m floating in a most peculiar way.
And the stars look very different today.
4
Die Last der Sonne lag schwer auf den Schultern der Stadt. Alle bewegten sich langsam, als wollten sie verhindern, dass die Hitze ihnen auf den Kopf krachte und alles unter sich begrub.
Aki Renko wartete an der Bushaltestelle. Er trug Jeans-Shorts, Turnschuhe und ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift System Of A Down.
Mit seinen etwas zu langen Haaren und seiner Sonnenbrille sah er nicht unbedingt wie ein Polizist aus, sondern eher wie jemand, auf den die Polizei ein Auge hat.
»Warst du auf dem Weg zu einem Festival?«, fragte Paula, als Renko hereinschlüpfte, kaum dass der Wagen hielt.
»In Parikkala war gestern der heißeste Tag des Sommers«, antwortete Renko.
Paula fuhr zurück auf die Autobahn, mit verkniffenem Gesicht, obwohl ihr der Freizeitlook ihres Kollegen völlig egal war. Sie merkte, dass Renko sie ansah; vermutlich überlegte er, wie ernst er ihren Kommentar nehmen sollte. Paula hütete sich, ihm einen Hinweis zu geben. Sie hielt den Blick auf die Straße geheftet und verzog keine Miene. Es war besser, Typen wie Renko ein bisschen zu verunsichern. Sonst fingen sie an, sich Freiheiten herauszunehmen und die Grenzen des zulässigen Benehmens zu überschreiten.
»Ich war mit meiner Frau einkaufen, als dein Anruf kam. Du hättest warten müssen, wenn ich mich umgezogen hätte. Was ist dir lieber, dass ich zu spät komme oder dass ich falsch gekleidet bin?«
Die Frage klang so aufrichtig, dass Paula beschloss, Gnade walten zu lassen.
»Besser pünktlich«, sagte sie.
Renko entspannte sich sofort, schob die Sonnenbrille auf die Stirn und streckte seine Beine aus.
»Einen tollen Saab hast du, die werden heute gar nicht mehr gebaut. Eine Schande, dass sie Saab aus Schweden nach China verkauft haben. Auch wenn ich nichts gegen die Chinesen hab. Oder besser gesagt, ich hab mehr gegen die Schweden als gegen die Chinesen. Ist das ein Neun-fünf der zweiten Generation?«
»Mehr als zehn Jahre alt.« Paula umging die Frage, weil sie die Antwort nicht wusste.
Autos hatten sie nie interessiert – sie hatte nicht einmal mit dem Gedanken gespielt, die alte Karre gegen eine neue einzutauschen. Ihr Vater hatte ihr den Saab zu einem Spottpreis verkauft, als sie nach ihrer letzten Scheidung umgezogen war.
»Was hast du gegen die Schweden?«, fragte sie.
»Mats Sundin. Die letzte Minute. Das erste Eishockeyspiel im Fernsehen, an das ich mich erinnere. Mein Vater hat geweint, ich hatte Angst.«
Paula lachte auf. Auch sie hatte sich das Spiel mit ihrem Vater angeschaut. Ihr Vater hatte allerdings mit höhnischer Überheblichkeit reagiert, nachdem er bis zum Schluss immer wieder gesagt hatte, das wird ja doch nichts. Macht euch nichts vor. Was hab ich gesagt. Geweint hatte er erst Jahre später, als die Finnen gewannen.
Der Urlaubsverkehr hatte schon abgenommen. Paula lenkte den Wagen abrupt über zwei Fahrspuren auf die Ausfahrt und von dort auf die Umgehungsstraße Richtung Westen.
»Der Meldung nach befindet sich die Leiche auf einem Grundstück, das der Lehmus-Stiftung gehört. Weißt du, was für eine Stiftung das ist?«, fragte sie.
»Keine Ahnung«, sagte Renko.
»Guck mal bei Google.«
Renko angelte das Handy aus der Tasche seiner Shorts und öffnete den Webbrowser.
»›Die Lehmus-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung‹ bla, bla, bla …«, begann er, nachdem er die Webseite gefunden hatte. »›Die Stiftung vergibt Stipendien an Künstler sowie für die Forschung über Entwicklungsländer und internationale Projekte. Sie verwirklicht auch eigene künstlerische und gesellschaftspolitische Projekte. Wir wollen eine bessere Welt aufbauen‹ bla, bla, bla …«
»Lies auch die Blablas«, unterbrach Paula.
»Okay, sorry. ›Wir wollen eine bessere Welt aufbauen, indem wir das Wissen über und das Verständnis für die in den Entwicklungsländern bestehenden Probleme und deren Ursachen erweitern und auch unseren Beitrag zu ihrer Lösung leisten.‹ Entwicklungsländer«, wiederholte Renko langsam. »Das Wort habe ich immer als seltsam empfunden. Es schreibt nicht nur fest, dass man in diesen Ländern der Entwicklung nachhinkt, sondern diktiert auch von außen, dass sie …«
»Wer hat die Stiftung gegründet?«, fragte Paula ungeduldig.
»Moment, die Kontaktdaten … Die Vorstandsvorsitzende der Stiftung ist Mai Rinne, die Vizevorsitzende Elina Lehmusoja.«
»Lehmusoja? Den Namen habe ich schon mal gehört.«
»›Die Lehmus-Stiftung wurde im Jahr zweitausend von Hannes Lehmusoja gegründet. Er wollte einen Teil der Erträge der Lehmus-Unternehmensgruppe für gemeinnützige Zwecke einsetzen‹«, las Renko vor.
»Lehmusoja, Lehmus-Unternehmensgruppe, Lehmus-Stiftung«, wiederholte Paula. »Klingt ziemlich familienzentriert.«
»Es ist auch ein Familienunternehmen, der Geschäftsführer ist derzeit ein gewisser Juhana Lehmusoja. Vielleicht der Sohn von Hannes?«
»Was machen die Unternehmen?«
»Hier ist ein Link auf deren Seite … Baugewerbe und Infrastruktur.«
»Infrastruktur.«
»Ja. Warum hat man eigentlich keine finnische Entsprechung für das Wort erfunden? Infrastruktur, das geht einem Finnen nicht so leicht über die Zunge. Aber andererseits, was wäre denn das passende Wort für etwas, das alles bedeutet, worüber und womit alles Mögliche sich zu allen möglichen Zielen bewegt, Autos, Menschen, Abwässer, Daten, Strom, Züge. Schiffe, Laster, Lebensmittel, Waren, und dann gibt es noch die soziale Infrasruktur …«
»Infrastruktur. Muss ich an der nächsten Abzweigung links abbiegen?«, fragte Paula, um Renkos Monolog zu stoppen.
Auf die Umgehungsstraße war eine gut gepflegte, aber schmale Landstraße gefolgt, die sich durch sonnenbeschienenes Ackerland schlängelte. Nun machte sie einen scharfen Bogen nach rechts und tauchte in das Zwielicht eines dichten Laubwalds ein. Die Kreuzung, von der der Weg zur Villa der Lehmus-Stiftung abging, kam erst im allerletzten Moment in Sicht.
Auf der anderen Straßenseite stand kurz vor der Kreuzung die Zugmaschine eines Lasters mit leerem Anhänger. Der LKW versperrte die Fahrspur fast völlig; um an ihm vorbeizukommen, musste man auf die Gegenspur ausweichen, ohne den Gegenverkehr sehen zu können.
»Schreib die Nummer auf«, wies Paula Renko an, der sich immer noch seinem Handy widmete.