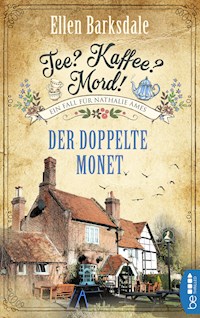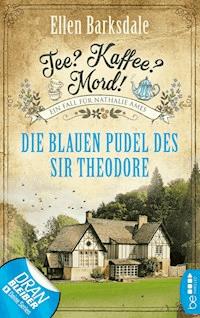4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nathalie Ames ermittelt
- Sprache: Deutsch
Folge 5: Ein gemütlicher Abend im Black Feather ... Doch plötzlich fasst sich ein Gast an den Hals, röchelt und fällt vom Stuhl - und Nathalie und Louise schauen ungerührt zu! Aber natürlich gibt es eine Erklärung. Das "Opfer" gehört zum sogenannten "Club der Giftmischer": Etwa zwei Dutzend Apotheker halten ihr jährliches Treffen in Earlsraven ab und der Höhepunkt ist eine große Show mit "Heiterem Symptome-Raten" , "Tabletten-Bingo" und dem überaus beliebten "Rate das Gift" . Doch aus dem heiteren Spaß wird tödlicher Ernst, als der Apotheker Travis Bertram tot auf der Bühne umfällt - vergiftet.
Nathalie und Louise helfen Constable Strutner bei den Ermittlungen und diesmal gibt es jede Menge Verdächtige - nämlich den gesamten Club! Und je mehr die beiden sich mit dem Fall beschäftigen, desto klarer wird, dass Liebe und Gier oftmals nah beieinander liegen ...
Über die Serie: Davon stand nichts im Testament ...
Cottages, englische Rosen und sanft geschwungene Hügel - das ist Earlsraven. Mittendrin: das "Black Feather". Dieses gemütliche Café erbt die junge Nathalie Ames völlig unerwartet von ihrer Tante - und deren geheimes Doppelleben gleich mit! Die hat nämlich Kriminalfälle gelöst, zusammen mit ihrer Köchin Louise, einer ehemaligen Agentin der britischen Krone. Und während Nathalie noch dabei ist, mit den skurrilen Dorfbewohnern warmzuwerden, stellt sie fest: Der Spürsinn liegt in der Familie ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Tee? Kaffee? Mord! – Die Serie
Über diese Folge
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Epilog
Leseprobe
Tee? Kaffee? Mord! – Die Serie
Davon stand nichts im Testament …
Cottages, englische Rosen und sanft geschwungene Hügel: das ist Earlsraven. Mittendrin: das »Black Feather«. Dieses gemütliche Café erbt die junge Nathalie Ames völlig unerwartet von ihrer Tante – und deren geheimes Doppelleben gleich mit! Die hat nämlich Kriminalfälle gelöst, zusammen mit ihrer Köchin Louise, einer ehemaligen Agentin der britischen Krone. Und während Nathalie noch dabei ist, mit den skurrilen Dorfbewohnern warmzuwerden, stellt sie fest: Der Spürsinn liegt in der Familie …
Über diese Folge
Ein gemütlicher Abend im Black Feather … Doch plötzlich fasst sich ein Gast an den Hals, röchelt und fällt vom Stuhl – und Nathalie und Louise schauen ungerührt zu! Aber natürlich gibt es eine Erklärung. Das »Opfer« gehört zum sogenannten »Club der Giftmischer«: Etwa zwei Dutzend Apotheker halten ihr jährliches Treffen in Earlsraven ab und der Höhepunkt ist eine große Show mit »Heiterem Symptome-Raten«, »Tabletten-Bingo« und dem überaus beliebten »Rate das Gift«. Doch aus dem heiteren Spaß wird tödlicher Ernst, als der Apotheker Travis Bertram tot auf der Bühne umfällt – vergiftet. Nathalie und Louise helfen Constable Strutner bei den Ermittlungen und diesmal gibt es jede Menge Verdächtige – nämlich den gesamten Club! Und je mehr die beiden sich mit dem Fall beschäftigen, desto klarer wird, dass Liebe und Gier oftmals nah beieinander liegen …
Über die Autorin
Geboren wurde Ellen Barksdale im englischen Seebad Brighton, wo ihre Eltern eine kleine Pension betrieben. Von Kindheit an war sie eine Leseratte und begann auch schon früh, sich für Krimis zu interessieren. Ihre ersten Krimierfahrungen sammelte sie mit den Maigret-Romanen von Georges Simenon (ihre Mutter ist gebürtige Belgierin). Nach dem jahrelangen Lesen von Krimis beschloss sie vor Kurzem, selbst unter die Autorinnen zu gehen. »Tee? Kaffee? Mord!« ist ihre erste Krimireihe.
Ellen Barksdale lebt mit ihrem Lebensgefährten Ian und den drei Mischlingen Billy, Bobby und Libby in der Nähe von Swansea.
Ellen Barksdale
Tee? Kaffee?Mord!
DER CLUB DERGIFTMISCHER
Aus dem Englischen von Ralph Sander
beTHRILLED
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dorothee Cabras
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock/SJ Travel Photo and Video, © Mary Ro/Shutterstock, © Mary Ro/Shutterstock, © SScott514/Shutterstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5937-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Dieses eBook enthält eine Leseprobe der in der Bastei Lübbe AG erscheinenden »Vorhang auf für einen Mord«, der ersten Folge der Serie »Bunburry. Ein Idyll zum Sterben« von Helena Marchmont.
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Übersetzung: Sabine Schilasky
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © JeniFoto/Shutterstock, © FreeProd33/Shutterstock, © Canicula/Shutterstock, © Sk_Advance studio/Shutterstock, © ivangal/Shutterstock, © Nikola Barbutov/Shutterstock
Prolog, in dem sich Beängstigendes abspielt
»Hier, trink das, dann geht es dir gleich besser«, sagte die Frau, die, in ein langes lila Gewand gehüllt, vor ihm stand und ihm einen Becher hinhielt.
»Was ist das?«, fragte er.
»Es wird dir guttun.«
»Aber das ist keine Antwort auf meine Frage«, beharrte er.
»Manchmal ist keine Antwort die bessere Antwort«, tat die Frau in Lila seinen Einwand ab.
»Was soll denn das heißen?«, gab er verständnislos zurück.
»Es soll heißen, dass sie dich vergiften will. Mit Arsen«, warf eine andere Frau in einem hellblauen Gewand ein, die ebenfalls mit einem Becher zu ihm kam. »Trink das, dies wird dir wirklich guttun«, versicherte die Frau in Hellblau. Auch sie hatte ein Tuch in der gleichen Farbe wie ihr Kleid so über den Kopf gelegt, dass ihr Gesicht in tiefe Schatten getaucht wurde.
»Aber … was ist das?«, wollte er wissen und zeigte auf diesen Becher.
»Sie bringt dir Zyankali«, sprach eine dritte Frau ganz in Rot.
»Wer bist du, und was …?«, begann er, wurde aber von einer weiteren Frau unterbrochen, die in helles Grün gewandet war.
»Sie bringt dir Strychnin«, verkündete sie.
Von allen Seiten kamen immer mehr Frauen, deren Gewänder alle Farben des Spektrums abdeckten. Alle trugen sie einen Becher vor sich her, und alle wollten sie zu ihm.
Er wandte sich ab und lief los, doch der breite Korridor wurde umso schmäler, je weiter er rannte, bis er schließlich spitz zusammenlief und es kein Entkommen mehr gab.
Er drehte sich um; die Frauen waren dicht hinter ihm. Es waren Dutzende … nein, Hunderte. Vielleicht sogar Tausende. Sie alle stürmten auf ihn zu, rissen ihn zu Boden, warfen sich auf ihn, um ihn am Entkommen zu hindern. Eine hielt seinen Kopf fest, eine andere öffnete ihm den Mund, dann hoben sie die Becher über ihm und neigten sie zur Seite, bis der Inhalt über den Rand schwappte und …
»Ha!« Der Mann schreckte aus dem Traum hoch und schnappte nach Luft. Er war stets froh, wenn der Tag gekommen war. Dann hörten endlich diese Albträume auf. Sein Blick wanderte zu der Frau, die neben ihm lag und fest schlief. Er fragte sich, ob sie auch von Träumen heimgesucht wurde. Von Albträumen …
Erstes Kapitel, in dem merkwürdige Gäste das Black Feather heimsuchen
Drei Männer und eine Frau saßen an Tisch vier im Pub Black Feather und unterhielten sich angeregt, während sie zu Abend aßen. Die Frau beugte sich vor und erzählte einen Witz, der ihre drei Begleiter zu schallendem Gelächter veranlasste. Es war nicht das erste Mal an diesem Abend, und nicht zum ersten Mal warfen andere Gäste der allzu ausgelassenen Gruppe irritierte Blicke zu.
Die vier schienen sich nicht daran zu stören, dass sie den Unmut einiger anderer Leute auf sich zogen, sondern machten weiter, indem nun einer der Männer im Flüsterton etwas erzählte, was bei den übrigen drei einen Lachanfall auslöste. So ging es eine Weile hin und her, bis der Nachtisch serviert wurde.
Die Frau nahm einen Löffel von dem Karamellpudding, der mit einer kleinen Sahnehaube verziert war, und nickte anerkennend. »Köstlich«, sagte sie und lächelte Louise Cartham zu, der Köchin des Black Feather.
»Das war das Stichwort«, raunte Louise ihrer Chefin Nathalie zu.
»Oh ja, gleich geht’s los«, stimmte die ihr zu und sah auf die Uhr. »Maximal zwei Minuten gebe ich ihr noch.«
Die Frau aß noch drei oder vier Löffel Pudding, dann zuckte sie leicht zusammen und riss die Augen auf. Sie verkrampfte sich, ließ den Löffel fallen, der vom Tisch rutschte und klirrend auf dem Boden landete. Die Frau verzog schmerzhaft das Gesicht und stöhnte angestrengt auf, dabei presste sie die Arme auf ihren Bauch, da sie offenbar Todesqualen durchlebte. Sie keuchte und schnappte nach Luft; sie versuchte, etwas zu sagen, brachte aber vor Schmerzen nur ein gequältes Röcheln über die Lippen. Ihre drei Begleiter beobachteten zwar aufmerksam ihr Leiden, unternahmen jedoch nichts, außer dass jeder von ihnen mit Genuss seinen Pudding aß. Die Frau wand sich unterdessen vor Schmerzen, verlor den Halt und rutschte von ihrem Stuhl. Auf dem Boden zuckte sie noch ein paarmal heftig, dann sank ihr Kopf zur Seite, der Körper erschlaffte.
Einer der Männer, ein schlaksiger Mittsechziger mit einer weißen Mähne, die Andy Warhol vor Neid noch mehr hätte erblassen lassen, sah in die Runde. »Arsen?«, fragte er die anderen, die zustimmend nickten.
Nathalie stand nur drei Meter entfernt an die Theke gelehnt. »Das ist heute Abend schon der vierte Gast, der tot vom Stuhl fällt«, merkte sie gelassen an. »Wetten, dass das heute nicht die letzte Tote im Black Feather sein wird? Louise, deine Kochkünste lassen wirklich zu wünschen übrig.« Sie empfand es als angenehm, dass sie sich nicht länger mit dem förmlichen »Miss« anredeten. Constable Strutner war dann auch noch gleich mit einbezogen worden, nachdem sie gemeinsam schon so manchen Fall gelöst hatten.
»Ach, die Ärmste hat bestimmt nur einen überempfindlichen Magen«, meinte die Köchin und winkte beiläufig ab. »Oder eine Karamellallergie.«
Der weißhaarige Gast beugte sich unterdessen zur Seite und rief der auf dem Boden liegenden Frau zu: »Debbie, wir sind uns einig. Es war Arsen.«
Die Frau setzte sich auf und brachte ihre zerzausten langen dunklen Haare in Ordnung, dann stellte sie sich hin und zog die verrutschte Bluse gerade, ehe sie sich wieder an den Tisch setzte. »Das war ja auch nur zum Aufwärmen gedacht«, sagte sie grinsend und aß den Pudding kurz entschlossen mit dem Kaffeelöffel weiter, da der andere Löffel unter einen der anderen Tische gerutscht war. »Wenn ich am Samstag meinen großen Auftritt habe, kommen da noch Lichteffekte und Geräusche dazu, und dann werdet ihr euch wünschen, ihr wärt in meinem Team.«
»Lichteffekte und Geräusche?«, wiederholte einer der anderen Männer lachend. »Das klingt nach einem LSD-Trip.«
»Ha, das musst du ja wissen«, konterte der Weißhaarige amüsiert. »Was hast du eigentlich noch nicht ausprobiert?«
»Lacht ihr nur«, gab der Mann mit dem schwarzen Vollbart zurück. »Vom bloßen Angucken weiß niemand, welche Wirkung eine dieser Pillen wirklich hat.«
Nathalie schüttelte den Kopf und drehte sich zu Louise um, aber die sagte: »Ich gehe wieder in die Küche, dann muss ich diesen Leuten nicht länger beim Sterben zusehen.« Was sie auch prompt in die Tat umsetzte und dabei den Eindruck erweckte, einen sechsten Sinn zu besitzen, denn sie hatte noch keine zwei Schritte gemacht, da ertönte aus der Küche ein flehendes »Louiiiiise«, das von einer ihrer Helferinnen stammte.
»Bin schon unterwegs«, gab die Köchin zurück und verschwand nach nebenan.
Das mit dem sechsten Sinn konnte durchaus zutreffen, immerhin war die Frau früher einmal als Geheimagentin aktiv gewesen. Auch wenn Nathalie Agenten nur aus Serien und Filmen kannte und wusste, dass man in diesem Job nicht jeden Tag die Welt vor irgendwelchen Superschurken retten musste, brauchte man dennoch zweifellos ein gewisses Gespür für drohende Gefahren.
»Sie scheinen sich nicht viel daraus zu machen, dass in Ihrem Lokal die Gäste umfallen wie die Fliegen, nicht wahr, Miss Ames?«, hörte sie eine belustigt klingende Stimme.
Nathalie drehte sich zur Seite und sah, dass ein Gast von einem der hinteren Tische mit seinem leeren Bierglas nach vorn gekommen war und es soeben auf die Theke stellte.
»Haben Sie keine Angst, man könnte Sie wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht stellen?« Der Mann zwinkerte ihr zu und gab dem Barkeeper ein Zeichen, damit der ihm noch ein Glas einschenkte.
Nathalie hatte den Mann in den letzten Wochen höchstens ein- oder zweimal gesehen, aber sie wusste sofort, wer er war: Martin Lazebnik, ein Rechtsanwalt, der sich erst vor Kurzem in Earlsraven niedergelassen hatte. Mit seinen nach hinten gekämmten und mit viel Gel in Form gehaltenen pechschwarzen Haaren und dem bleichen Gesicht erinnerte er sie unweigerlich an den Schauspieler Bela Lugosi in seiner Paraderolle als Graf Dracula. Ob Lazebnik das überhaupt bewusst war oder ob er als Anwalt ganz gezielt auf das Blutsauger-Image anspielte, wusste Nathalie nicht, doch sie würde ihn auch nicht darauf ansprechen – zumindest vorläufig noch nicht, denn dafür kannte sie den Mann nicht gut genug.
»Ach, wissen Sie, solange die umgefallenen Fliegen nach zwei Minuten wieder quicklebendig sind, mache ich mir da keine Sorgen, Mr Lazebnik«, erwiderte sie mit einem Zwinkern und stellte sein benutztes Glas ins Spülbecken.
»Wir können den Spieß auch umdrehen«, schlug er vor und grinste sie an, wobei ihr auffiel, dass dieser Mann einen ungewöhnlich breiten Mund hatte. Seltsamerweise passte es zu seinem ganzen Erscheinungsbild, ebenso wie diese wasserblauen Augen, die ihm etwas eigenartig Sanftes verliehen. »Wenn Sie wollen, drohe ich dieser Truppe mit einer Anzeige wegen Rufschädigung und verklage sie auf zweihunderttausend Pfund Schadenersatz. Außergerichtlich einigen wir uns auf die Hälfte, und Sie und ich machen dann halbe-halbe. Leichter können Sie fünfzigtausend Pfund nicht verdienen.«
Nathalie nahm dem Barkeeper das volle Bierglas ab und stellte es dem Anwalt hin. »Mr Lazebnik«, erwiderte sie mit einem Lächeln. »Ich weiß Ihre Bemühungen zu schätzen, und ich verstehe auch, dass Sie zeigen wollen, wie wir von Ihrer Anwesenheit in Earlsraven profitieren können. Aber ich finde, wenn Ihre Bürozeiten vorbei sind, sollten Sie einfach den Anwalt in Ihnen auch in den Feierabend schicken. Sonst enden Sie noch mal wie diese Truppe da drüben.«
Der Anwalt zuckte mit den Schultern, als wäre er von ihren Worten nicht überzeugt. »Apropos diese Truppe. Was hat das eigentlich zu bedeuten, dass immer wieder irgendeiner von ihnen wie vom Schlag getroffen vom Stuhl fällt und gleich wieder aufsteht?«
»Soweit ich das verstanden habe …«, begann sie und geriet gleich darauf ins Stocken. »Eigentlich habe ich das gar nicht richtig verstanden, weil Louise beim Erklären unterbrochen wurde. Es hatte irgendwas mit Giftmischern zu tun. Augenblick!« Sie ging zur Durchreiche, steckte den Kopf hindurch und fragte: »Louise, ist die Küchenkrise ausgestanden?«
»Ja, ja, wir haben alles im Griff«, antwortete die Köchin. »Es war nur ein Eisbergsalat, der meinen Leuten in die Quere gekommen ist, aber kein Eisberg.«
»Gestern Abend lief wohl Titanic im Fernsehen, richtig?«, hakte Nathalie nach und fügte sofort an: »Kannst du noch mal nach vorn kommen? Ich weiß noch immer nicht, was es mit den Giftmischern auf sich hat. Und da Mr Lazebnik mich gerade eben genau danach gefragt hat, wäre es vielleicht praktisch, wenn du es uns beiden erklären könntest. Dann muss ich nicht alles weitersagen, als spielten wir ›Stille Post‹.«
»Und dabei alles verdrehen, weil du die Hälfte vergessen hast«, zog Louise sie auf. »Ich komme gleich nach vorn.«
Als sie zu Lazebnik zurückkehrte, hatte der Anwalt Gesellschaft bekommen. Stammgast Eddie Hogarth war eingetroffen und hatte seinen Stammplatz am Ende der Theke eingenommen, womit er genau neben dem Anwalt stand und ihn nachdenklich ansah.
»Guten Abend, Eddie«, sagte Nathalie, als sie zu Lazebnik zurückkehrte. »Ich nehme an, Sie bekommen das Übliche?«
»Miss Ames«, erwiderte der freischaffende Künstler, dem Nathalie schon nach kurzer Zeit mit einem gewinnenden Lächeln das beharrliche Anschreiben abgewöhnt hatte, »wie lange führen Sie das Black Feather jetzt schon?«
»Seit März, also gut sieben Monate«, antwortete sie und beugte sich vor, um Hogarth ganz tief in die Augen zu sehen. »Und trotzdem werde ich Sie auch weiterhin fragen, ob Sie das Übliche bekommen.«
»Warum? Sie wissen doch, was ich bestellen werde«, hielt Hogarth dagegen. »Da können Sie doch einfach ein Bier zapfen und es mir hinstellen.«
»Ist doch ganz logisch«, warf Lazebnik ein. »Wenn Sie nichts bestellen und Miss Ames stellt Ihnen einfach ein Bier hin, kommt kein Kaufvertrag zustande. Das Bier ist dann ein Geschenk von Miss Ames an Sie, und Sie müssen es nicht bezahlen. So wie Sie meine Rechtsberatung nicht bezahlen müssen, weil Sie mich nicht darum gebeten haben.« Dann ließ er dieses auffallend breite Lächeln folgen.
»Tatsächlich?«, sagte Eddie Hogarth mit sichtlich gespieltem Erstaunen. »Das wusste ich noch gar nicht.«
»Tja, man lernt eben nie aus«, kommentierte Nathalie gut gelaunt und brachte Eddie das Bier.
Louise kam dazu und nickte Eddie Hogarth zu. »So, mein Wissen ist gefragt, habe ich gehört?«
»Ja, es geht um unsere Giftmischer.« Nathalie wischte sich die feuchten Hände an dem Geschirrtuch ab, das sie wie eine Schürze trug. »Wer sind die Leute noch mal?«
»Die gehören zum Club der Giftmischer«, erklärte Louise, während sie sich durch die kurzen grauen Haare fuhr, die sie immer ein wenig nach Judi Dench aussehen ließen. »Das sind alles Apotheker aus dem ganzen Land, die sich einmal jährlich treffen …«
»Zu einer Konferenz? Einer Tagung?«, fragte Eddie. »Oder einem Kongress? So wie Ärzte?«
»Nein, Dr. Francis hat mir davon erzählt, er kennt zwei von ihnen noch aus der Studentenzeit. Dieser Club besteht zu gleichen Teilen aus Apothekern aus der nördlichen und der südlichen Hälfte des Landes, die sich in verschiedenen Disziplinen messen.«
»Tablettenweitwurf?«, scherzte der Anwalt.
Louise schüttelte den Kopf. »Sie liegen zwar falsch, Mr Lazebnik, aber gleichzeitig doch ziemlich richtig. Diese Disziplin gibt es wohl nicht, soweit ich weiß … Jedenfalls hat Dr. Francis nichts davon gesagt. Doch es muss da Wettbewerbe geben, die so seltsame Bezeichnungen wie ›Heiteres Symptome-Raten‹ oder ›Welches Gift bin ich?‹ tragen. Das scheint eine ganz lustige Truppe zu sein.« Sie zuckte mit den Schultern. »Das ist jedenfalls Dr. Francis’ Meinung. Wenn das alles so ›lustig‹ ist wie diese Aktionen, die wir hier schon den ganzen Abend erleben, dann … na ja, dann bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich für Außenstehende auch so unterhaltsam ist.«
»Ach, lass die Leute mal machen, Louise«, sagte Nathalie. »Zumindest gerät seit dem dritten scheinbaren Gifttod hier im Pub niemand mehr in Panik, und die Jungs da drüben schließen inzwischen schon untereinander Wetten ab, wann wieder jemand mit Zyankali im Kartoffelbrei vom Stuhl fällt.« Sie zeigte auf eine Gruppe von fünf jungen Männern in Motorradkleidung, die sich seit ihrem Eintreffen vor gut zwei Stunden immer noch mit alkoholfreiem Bier begnügten.
»Na ja, solange sie auch brav für das bestellte Essen bezahlen, ist es ja okay«, meinte die Köchin.
»Außerdem können wir die Aktion auf Twitter verbreiten«, fügte Nathalie hinzu, während sie die Kellnerin Cathy auf einen der hinteren Tische aufmerksam machte, an dem ein Paar saß, das wohl Essen bestellen wollte, dessen Handzeichen aber keiner Bedienung aufgefallen war. Sie musste ihren Leuten in dem Punkt unbedingt noch mal ins Gewissen reden, dass man die Gäste nicht warten ließ, wenn die bestellen oder bezahlen wollten. Allerdings war heute auch ein Ausnahmetag, da normalerweise nicht immer wieder scheintote Apotheker auf dem Boden herumlagen.
»Wie kommt denn das an, was wir twittern?«, fragte Louise leise genug, damit weder der Anwalt noch Eddie Hogarth etwas von der Unterhaltung mitbekommen konnten.
»Ganz gut«, meinte Nathalie. »Jedenfalls wenn man bedenkt, dass wir erst seit drei oder vier Wochen auf dem Weg Neuigkeiten verbreiten. Ich schätze, ›Vier Gifttote im Black Feather‹ ist eine Meldung, die die Leute aufhorchen lässt.«
Louise verzog den Mund. »Ich halte nicht sehr viel von diesen irreführenden Meldungen. Vor allem nicht, wenn dann ein Zusatz in der Art von ›Sie werden nicht glauben, wer der Täter ist‹ folgt. So was klicke ich grundsätzlich nicht an. Warum sollte ich auch? Mir wird ja schon von vornherein gesagt, dass ich es nicht glauben werde«, fügte sie grinsend an.
»Die mag ich auch nicht«, gab Nathalie zu und überlegte kurz. »Na klar, wir melden einfach ›Keine vier Gifttoten im Black Feather‹, dann steht da die Wahrheit, und die Leute werden trotzdem neugierig.«
»Damit kann ich leben«, antwortete die Köchin und kam auf das ursprüngliche Thema zurück, wobei sie sich auch wieder an den Anwalt und den Künstler wandte. »Die Giftmischer fangen heute mit verschiedenen Qualifikationsrunden an, und am morgigen Freitag beginnen dann die Finalrunden vor Publikum. Das Ganze findet in Preston-on-Thellis statt, in der ehemaligen Kirche St. Stephen’s.«
»Preston-on-Thellis? Ist das weit von hier?«, fragte der Anwalt.
»Nein, das liegt sozusagen hinter dem nächsten Hügel«, antwortete Louise. »Wenn der Bus nicht erst diesen Schlenker über drei andere Dörfer machen würde, wäre es von hier aus die nächste Haltestelle in südlicher Richtung. Der Eintritt zum fröhlichen Giftmischen ist übrigens frei.«
»Das sollte man wahrnehmen«, fand Eddie.
Als Nathalie zu ihm sah, bemerkte sie, dass sein Glas leer war. »Noch mal das Gleiche?«
Der Künstler versuchte, sich mit einem vagen Schulterzucken aus der Affäre zu ziehen, doch der Anwalt hob daraufhin mahnend den Zeigefinger.
»So etwas nennt man ›konkludentes Handeln‹, Mr Hogarth. Das ist jetzt praktisch so etwas wie ein Abonnement, bei dem Sie schon deutlich widersprechen müssen, wenn Sie nicht weiter mit Bier ›beliefert‹ werden wollen.«
Nathalie sah ihren Stammgast abwartend an, der sich nach kurzem Zögern wie gegen seinen Willen mit einem Nicken einverstanden erklärte, den Bierstrom doch nicht versiegen zu lassen. Sie nahm sein Glas und wollte sich eben zu ihrem Barkeeper Harold umdrehen, um ihm zu sagen, dass Eddie noch ein Bier bekam, da wäre sie mit dem jungen Mann fast zusammengestoßen. »Tut mir leid, Harold, ich wollte Sie nicht umrennen.« Sie sah den dunkelhaarigen Barkeeper mit dem Dreitagebart und dem permanent verschmitzten Lächeln einen Moment lang an, dann schüttelte sie den Kopf über ihre Bemerkung und fügte an: »Und auch nicht umgerannt werden.« Immerhin war der Mann fast einen Kopf größer als sie.
»Keine Sorge, Miss Ames, ich hätte Sie schon noch rechtzeitig festgehalten«, versicherte er und lächelte so, dass seine Zähne aufblitzten. »Meine Reflexe sind hervorragend, das können Sie mir glauben.«
»Ja, ich weiß«, erwiderte sie und nickte anerkennend. Mehr als einmal hatte sie miterlebt, wie Harold alles stehen und liegen gelassen und blitzschnell über die Theke gegriffen hatte, um einen Gast zu fassen zu bekommen, der über den Durst getrunken hatte und im Begriff war, von seinem Hocker zu kippen.
»Hier, dieses Fax kam eben für Sie rein«, sagte Harold und drückte ihr ein Blatt Papier in die Hand.
»Oh, danke«, murmelte sie irritiert, da sie den Absender gleich erkannte. Sie nahm das Blatt und lehnte sich an den Tresen, dann las sie das Schreiben durch.
»Guten Abend, zusammen«, ertönte eine vertraute Stimme, begleitet von einem hellen Bellen. Constable Ronald Strutner war in Begleitung seines Zwergschnauzers eingetroffen, der auf den Namen Colonel Jackson hörte. Der schien sich auf seinen Dienstgrad nur in dem Punkt etwas einzubilden, dass er ständige Streicheleinheiten forderte. Der Constable hatte zwar eigentlich Dienstschluss, aber wie fast immer war er in Uniform unterwegs.
»Hallo, Ronald«, antworteten Louise und Nathalie gleichzeitig, während er neben Lazebnik Platz nahm und Colonel Jackson auf den freien Hocker zu seiner Rechten setzte, damit der Schnauzer auf Augenhöhe mit der Theke das Geschehen von einem Platz aus verfolgen konnte, der garantierte, dass ihn kein Gast versehentlich treten würde.
»Eddie«, sagte Ronald und nickte dem Künstler zu, der als Erwiderung zwei Finger hob und dann das nächste Glas Bier annahm, das ihm der Barkeeper zwischen den beiden Frauen hindurch anreichte.
»Constable.« Lazebnik sah Strutner an, dann beugte er sich vor, damit er um seinen Platznachbarn herumschauen konnte. »Colonel«, sagte er dann zu dem Schnauzer, der den Kopf schräg legte und mit einem leisen »Wuff« antwortete.
»Was ist los, Nathalie? Hat jemand seine Reservierung abgesagt?«, fragte Strutner, während Louise schnell einen prüfenden Blick in die Küche warf, ob dort alles in Ordnung war. »Du schaust so betrübt drein.«
»Eine abgesagte Reservierung wäre mir ehrlich gesagt lieber als das hier«, murmelte sie, dann sah sie Louise und den Constable an. »In frühestens vier Wochen wird darüber entschieden, ob und wann ich meine Möbel zurückbekomme.«
»Oh nein, vier Wochen?« Louise legte den Arm um Nathalies Schultern. »Das ist ja frühestens Anfang November.«
»Und dann fällt erst eine Entscheidung, Louise. Die werden dann wohl kaum sagen, dass ich am nächsten Tag meine Sachen bekomme. Da gehen bestimmt noch mal zwei Wochen ins Land, bis was passiert.« Sie seufzte frustriert. »Da wird wohl ein Wunder passieren müssen, sonst sitze ich bestimmt noch an Weihnachten in einer leeren Wohnung.«
»Was ist denn mit Ihren Möbeln passiert, Miss Ames?«, wollte Hogarth wissen, nachdem er einen Schluck getrunken hatte. »Sind Sie bestohlen worden, oder was?«
»Nein, nein, ich habe meine Wohnung in Liverpool verkauft und …« Sie stutzte. »Wissen Sie das nicht?«
»Was?«
»Dass ich meine Wohnung verkauft habe und meine Möbel herkommen lasse?«
Hogarth schüttelte den Kopf. »Ist mir neu.«
»Wie ist denn das möglich? In Earlsraven spricht sich doch so gut wie alles innerhalb von zwei Tagen rum«, sagte sie verwundert.
Der Künstler winkte ab. »Ach, ich war in den letzten Wochen in ein Projekt vertieft, da bin ich kaum aus dem Atelier gekommen.«
»Aber Sie waren doch praktisch jeden Abend im Pub«, wandte Strutner ein, der gerade nach einem kräftigen Schluck sein Glas Bier absetzte. »Sonst hätten mich die Leute spätestens am dritten Tag zu Ihnen geschickt, damit ich mich vergewissere, ob Sie noch leben.«
Hogarth nickte. »Ja, das ist wahr. Ich war hier, daran kann ich mich erinnern. Doch an mehr eigentlich nicht. Hm.« Er verzog das Gesicht. »Dann war dieser Hinweis auf den Farbeimern wohl kein blöder Witz, dass das Einatmen zu Wahrnehmungsstörungen führen kann.« Er schüttelte flüchtig den Kopf. »Da muss ich wohl beim nächsten Mal öfter lüften.« Nach einem Schulterzucken wandte er sich wieder an Nathalie: »Und was ist nun mit Ihren Möbeln?«
»Ende August habe ich die Wohnung aufgelöst, und am einunddreißigsten kamen die Möbelpacker«, erzählte sie, während sie das Geschirrtuch abnahm, das sie sich um die Hüften gebunden hatte, und die Spüle abzuwischen begann. »Abends war der Wagen randvoll mit Möbeln und Umzugskartons gepackt und über Nacht bei der Spedition auf dem Hof geparkt. Tja, und zwei Stunden später steht der Gerichtsvollzieher dort vor der Tür und pfändet alles, was er nur pfänden kann, weil der Chef der Spedition Sozialabgaben und Lohnsteuer seiner Angestellten einbehalten, aber nie an die zuständigen Behörden abgeführt hat. Außerdem hat er über Jahre hinweg Umsatzsteuer und Gewerbesteuer durch gefälschte Erklärungen hinterzogen. Da sind etliche Hunderttausend Pfund zusammengekommen, und die wollte sich der Staat doch mal holen – natürlich ausgerechnet an dem Tag, an dem alle meine Möbel bei der Spedition darauf warteten, nach Earlsraven gefahren zu werden. Das Gelände ist jetzt versiegelt, niemand darf auch nur eine Büroklammer von da wegschaffen, wenn er sich nicht strafbar machen will.«
»Und das lassen Sie sich bieten?«, fragte Lazebnik erstaunt.
»Wie meinen Sie das?«
»Da müssen Sie einen Anwalt einschalten, der es versteht aufzutrumpfen«, erklärte er. »Jemand, der bei den zuständigen Leuten ins Büro marschiert, auf den Tisch haut und jedem mit Schadenersatzklagen droht, der die Sache nicht sofort in Angriff nimmt!«
»Jemand wie Sie, richtig?«, meinte Strutner grinsend und stieß den Anwalt mit dem Ellbogen an.
»Zum Beispiel. Miss Ames, überlassen Sie mir die Angelegenheit, und am Montagmorgen werden Sie wieder in Ihrem Bett schlafen können«, verkündete Lazebnik selbstbewusst.
Nathalie schüttelte das Geschirrtuch aus und faltete es neu zusammen, um mit einer noch unbenutzten Stelle über die Theke zu wischen. »So einfach ist das leider nicht. Ich habe zwar die Auftragsbestätigung, aber an dem Abend war das Formular nicht auffindbar, mit dem ich die Bestätigung erhalten hätte, dass alles auftragsgemäß aus der Wohnung geschafft und in den Wagen geräumt worden war. Es war spät, und das Büro der Spedition hatte ohnehin schon geschlossen; also haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das gleich am nächsten Morgen nachholen.« Sie hob die Hände zu einer hilflosen Geste. »Wer rechnet denn damit, dass genau dann etwas passiert?«
»Miss Ames, es passiert gerade etwas, wenn man nicht damit rechnet«, sagte der Anwalt.
»Ja, ich weiß. Doch ich habe ja auch einen Anwalt eingeschaltet …«
»… der aber wohl nicht energisch genug auftritt. Sonst hätten Sie …«
»Keine Sorge, Mr Lazebnik«, unterbrach sie ihn freundlich, aber bestimmt. »Wie der Zufall es will, ist mein Anwalt mit dem Sachbearbeiter in derselben Klasse gewesen. Die zwei kennen sich seit Jahrzehnten, und die Angelegenheit wird zügiger bearbeitet als üblich. Ein energisch auftrumpfender Anwalt würde nur bewirken, dass der Vorgang nach Reihenfolge Bearbeitung findet, und dann kann ich vielleicht zu Ostern mit meinen Möbeln rechnen.«
Lazebnik zuckte kapitulierend mit den Schultern. »Ich gebe mich geschlagen, Miss Ames. Ich hoffe nur, dass Ihr Anwalt wirklich etwas bewirkt.«
»Das tut er, Mr Lazebnik, das tut er«, versicherte sie ihm und warf das Geschirrtuch in den kleinen Korb unter der Theke, in dem alle Tücher und Lappen landeten, die in die Wäsche gehörten.
Sie sah auf ihre Armbanduhr und wollte sich eben zum Gehen wenden, da fügte der Anwalt an: »Entschuldigen Sie meine Neugier, Miss Ames, aber Sie haben zu Mr Hogarth gesagt, dass Sie seit sechs oder sieben Monaten hier sind. Wieso holen Sie jetzt erst Ihre Möbel nach?«
»Das ist eine lange Geschichte, Mr Lazebnik.« Nathalie bemühte sich um eine freundliche Miene, obwohl sie nach dem Fax von ihrem Anwalt wenig Grund hatte, gut gelaunt zu sein.
»Ach, eigentlich ist es gar keine so lange Geschichte«, warf Eddie ungefragt ein und reagierte auch nicht auf den mahnenden Blick, den Nathalie ihm zuwarf.
Am liebsten wäre sie ihm ins Wort gefallen und hätte ihn aufgefordert, sich nicht einzumischen, aber das konnte sie schlecht vor allen Gästen machen. Also ließ sie ihn gewähren.
»Miss Ames hat das Black Feather von ihrer Tante Henrietta geerbt, einer reizenden Frau«, redete Eddie ungerührt weiter. »Allerdings mit der Maßgabe, mindestens ein Jahr lang das Café, den Pub und das Hotel zu führen, bevor ihr das Erbe zufällt und sie darüber verfügen kann. War doch richtig so, oder?«, fragte er und sah Nathalie an.
»Als hätte ich ein Buch geschrieben, aus dem Sie nur noch vorlesen mussten«, entgegnete sie und musste unwillkürlich lächeln. Daheim in Liverpool hätte es sie wahnsinnig gemacht, wenn jeder über ihr Privatleben Bescheid gewusst hätte. Hier auf dem Land war genau das der Fall, und kurioserweise störte es sie nicht. Allerdings hatte sie hier in Earlsraven auch das Gefühl, dass die Menschen einfach Anteil am Leben ihrer Nachbarn nehmen wollten, anstatt nebeneinanderher zu leben, und dass sie nicht darauf aus waren, einen anderen auszuhorchen. An Lazebnik gewandt sagte sie dann: »Jetzt wissen Sie das auch, Herr Anwalt. Zufrieden?«
»Nicht ganz, wenn ich ehrlich sein soll«, erwiderte er. »Eine solche Bedingung in einem Testament bedarf einer gründlichen Prüfung. In vielen Fällen sind das reine Schikanen oder für die Erben wirtschaftlich ruinöse Bedingungen, und dann kann man …«
»Man muss nicht alles tun, was man tun kann, Mr Lazebnik«, unterbrach sie ihn freundlich, aber bestimmt. »Wenn ich einen Anwalt brauche, werde ich mich an Sie wenden, doch die Initiative geht von mir aus, okay?«