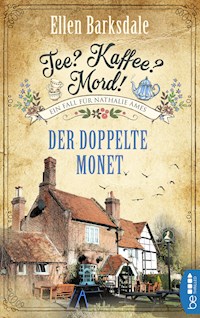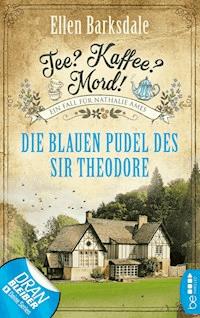4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nathalie Ames ermittelt
- Sprache: Deutsch
Folge 2: "Leb wohl, tristes Dasein." Der berühmte Schriftsteller Ian O’Shelley wird tot in seinem Cottage in Earlsraven aufgefunden - neben ihm liegt ein Abschiedsbrief. Aber war es tatsächlich Selbstmord? Oder wurde der sympathische Bestsellerautor umgebracht? Nathalie ist ein großer Fan des Autors und fängt an, sich genauer mit dem Fall zu befassen. Sie entdeckt schnell, dass O’Shelley eine ganze Reihe an Geheimnissen hatte - findet sich hier das Motiv für einen Mord? Doch während Nathalie O’Shelleys Leben durchleuchtet, muss sie feststellen, dass es auch in ihrem Privatleben drunter und drüber geht und ihr Umzug nach Earlsraven nicht ohne Folgen bleibt ...
Über die Serie: Davon stand nichts im Testament ...
Cottages, englische Rosen und sanft geschwungene Hügel - das ist Earlsraven. Mittendrin: das "Black Feather". Dieses gemütliche Café erbt die junge Nathalie Ames völlig unerwartet von ihrer Tante - und deren geheimes Doppelleben gleich mit! Die hat nämlich Kriminalfälle gelöst, zusammen mit ihrer Köchin Louise, einer ehemaligen Agentin der britischen Krone. Und während Nathalie noch dabei ist, mit den skurrilen Dorfbewohnern warmzuwerden, stellt sie fest: Der Spürsinn liegt in der Familie ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Tee? Kaffee? Mord! – Die Serie
Über diese Folge
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Epilog
Wie es weitergeht …
Tee? Kaffee? Mord! – Die Serie
Davon stand nichts im Testament …
Cottages, englische Rosen und sanft geschwungene Hügel: das ist Earlsraven. Mittendrin: das »Black Feather«. Dieses gemütliche Café erbt die junge Nathalie Ames völlig unerwartet von ihrer Tante – und deren geheimes Doppelleben gleich mit! Die hat nämlich Kriminalfälle gelöst, zusammen mit ihrer Köchin Louise, einer ehemaligen Agentin der britischen Krone. Und während Nathalie noch dabei ist, mit den skurrilen Dorfbewohnern warmzuwerden, stellt sie fest: Der Spürsinn liegt in der Familie …
Über diese Folge
»Leb wohl, tristes Dasein.« Der berühmte Schriftsteller Ian O’Shelley wird tot in seinem Cottage in Earlsraven aufgefunden – neben ihm liegt ein Abschiedsbrief. Aber war es tatsächlich Selbstmord? Oder wurde der sympathische Bestsellerautor umgebracht? Nathalie ist ein großer Fan des Autors und fängt an, sich genauer mit dem Fall zu befassen. Sie entdeckt schnell, dass O’Shelley eine ganze Reihe an Geheimnissen hatte – findet sich hier das Motiv für einen Mord? Doch während Nathalie O’Shelleys Leben durchleuchtet, muss sie feststellen, dass es auch in ihrem Privatleben drunter und drüber geht und ihr Umzug nach Earlsraven nicht ohne Folgen bleibt …
Über die Autorin
Geboren wurde Ellen Barksdale im englischen Seebad Brighton, wo ihre Eltern eine kleine Pension betrieben. Von Kindheit an war sie eine Leseratte und begann auch schon früh, sich für Krimis zu interessieren. Ihre ersten Krimierfahrungen sammelte sie mit den Maigret-Romanen von Georges Simenon (ihre Mutter ist gebürtige Belgierin). Nach dem jahrelangen Lesen von Krimis beschloss sie vor Kurzem, selbst unter die Autorinnen zu gehen. »Tee? Kaffee? Mord!« ist ihre erste Krimireihe.
Ellen Barksdale lebt mit ihrem Lebensgefährten Ian und den drei Mischlingen Billy, Bobby und Libby in der Nähe von Swansea.
Ellen Barksdale
Tee? Kaffee?Mord!
DIE LETZTEN WORTEDES IAN O’SHELLEY
Aus dem Englischen von Ralph Sander
beTHRILLED
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Julia Feldbaum
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock/SJ Travel Photo and Video, © Mary Ro/Shutterstock, © mubus7/Shutterstock
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5127-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog, in dem telefonisch eine blutige Tat verabredet wird
»Ja?«, meldete sich die Frauenstimme, nachdem ein paar Mal das Freizeichen ertönt war.
»Ich bin es«, sagte der Mann. »Sie wissen Bescheid?«
»Natürlich«, erwiderte die Frau. »Haben Sie die Daten?«
»Es ist der besprochene Reisetermin, es hat sich nichts daran geändert.«
»Gut«, sagte sie. »Dann ist er also zuverlässig.«
»Wie das berühmte Schweizer Uhrwerk«, meinte der Mann.
»Oh, die sind gar nicht so zuverlässig, wie gern behauptet wird«, gab die Frau zurück. »Wirklich zuverlässige Uhrw…«
»Denken Sie wirklich, ich will das wissen?«, unterbrach er seine Gesprächspartnerin ungehalten.
»Es kann nie schaden, Dinge zu wissen«, sagte die Frau unbeeindruckt. »Aber es kann schaden, Dinge nicht zu wissen.«
»Haben Sie Philosophie studiert?«
»Man muss nicht studiert haben, um intelligente Konversation zu betreiben«, machte sie ihm klar.
»Können wir zum Geschäftlichen zurückkommen?«
Sie lachte amüsiert auf. »Sie haben es eilig, nicht wahr?«
Er atmete frustriert durch. »Ich habe es nicht eilig, aber ich möchte dieses Gespräch trotzdem gern zu Ende bringen.«
Die Frau schwieg.
»Wie werden Sie vorgehen?«, wollte er wissen.
»Das werden Sie schon sehen«, antwortete sie, schien aber immer noch nicht über seine Art oder seinen Tonfall verärgert zu sein.
»Ich würde es gern wissen«, beharrte er.
»Umso größer wäre das Risiko, dass Ihnen eine falsche Bemerkung rausrutscht, wenn Sie mit jemandem sprechen«, sagte sie. »Haben Sie nie Columbo gesehen? Der Täter verrät sich am Ende immer selbst, weil er unentwegt versuchen muss, Ahnungslosigkeit vorzutäuschen. Ahnungslos geben kann sich nur, wer auch wirklich ahnungslos ist. Darum wissen Sie ja auch so gut wie nichts über mich.«
»Wie Sie meinen«, sagte der Mann. »Aber ich kann mich darauf verlassen, dass Sie den Auftrag erledigen werden?«
»Ich habe noch nie ein Ziel lebend zurückgelassen.«
»Gut. Das Geld ist auf dem Weg zu Ihnen.«
»Es ist schon da«, sagte die Frau, dann legte sie auf.
Der Mann hielt das Smartphone noch einen Moment lang ans Ohr, dann schaltete er das Gerät aus und legte es in die Schublade. Bald würde das Problem gelöst sein, und zwar für immer.
Erstes Kapitel, in dem es zu verschiedenen, zum Teil folgenreichen Begegnungen kommt
»Nein, Detective, ich streite es nicht ab. Ich habe Robert Tennant ermordet«, sagte Christine Langley ruhig und gelassen, dabei strich sie sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Ich habe es gemacht, weil es sein musste. Sehen Sie, Detective, Tennant war ein schlechter Mensch, er hat seine Schüler drangsaliert, er hat zwei von ihnen vor der ganzen Klasse bloßgestellt, nur weil sie beim Hundertmeterlauf die langsamsten waren. Er hat sie beschimpft und lächerlich gemacht. Er hat die anderen Schüler dazu aufgefordert, die beiden mit Missachtung zu strafen. Er ist schuld, dass Mickey und Stuart von der Brücke gesprungen sind. Von der Brücke … genau vor den heranrasenden Zug.« Sie schüttelte den Kopf. »Und wissen Sie, was fast noch schlimmer war als die Tatsache, dass er die Jungs in den Tod getrieben hat?« Christine sah mit eindringlichem Blick vor sich hin. »Dass er sie anschließend auch noch verhöhnt hat. Dass er erklärt hat, er sei stolz auf sie, weil sie wenigstens Mumm genug gehabt hätten, um ihrem kläglichen Dasein ein Ende zu setzen … und … und es ihren Mitschülern zu ersparen, mit solchen Jammergestalten in eine Klasse zu gehen.« Sie nickte nachdrücklich. »Ja, Detective, deshalb musste Tennant sterben. Nicht nur, um den Tod der beiden Jungen zu rächen, die bestimmt nicht die Einzigen gewesen sind, denen er so zugesetzt hat. Sondern um vor allem zu verhindern, dass er noch mehr Menschen zu Opfern macht.«
Sie rollte mit den Augen. »Nein, Detective, da hätten keine disziplinarischen Maßnahmen mehr geholfen. Tennant trainierte seit fünfzehn Jahren die Cricketmannschaft der Schule, und seit acht Jahren hatte er auch das Rugbyteam unter sich. Beide Mannschaften sind seitdem jährlich Jahr Commonwealth-Meister gewesen. Diese Siege zählen bei der Schulleitung mehr als eine Handvoll Schüler, die dabei auf der Strecke bleiben. Ihn zu töten war der einzige Ausweg.«
Sie schaute auf die Liste, die vor ihr auf dem Tisch lag. »Claire Tennant … na ja, sie wollte mich davon abhalten, ihren Mann umzubringen.«
Christine zuckte mit den Schultern. »Was soll ich sagen, Detective? Wer schlechte Menschen davor schützen will, dass sie angemessen bestraft werden, der kann selbst kein guter Mensch sein. Und Sie wissen ja, was mit solchen Leuten passieren muss.«
Eine Weile saß sie da und hielt inne, als würde sie auf eine Stimme in ihrem Kopf lauschen, dann deutete sie nach links. »Das Gleiche, was auch ihm passiert ist. Warum konnte Sean die kleine Kelly auch nicht in Ruhe lassen? Er könnte jetzt noch leben.« Sie seufzte mitfühlend. »Aber wenigstens konnte ich so die kleine Kelly vor dem Schlimmsten bewahren.«
Plötzlich versteinerte sich ihre Miene, sie sah dem Detective starr in die Augen. »Ihnen ist doch klar, dass Sie vorhin fast verhindert hätten, dass ich Sean für sein Verhalten bestrafe, oder? Sie wissen auch, was ich von Menschen halte, die verhindern wollen, dass schlechte Menschen bestraft werden, nicht wahr? Natürlich wissen Sie das, Sie haben schließlich gut zugehört. Es tut mir leid, dass es so enden muss.«
Dann griff sie nach der Pistole, die rechts von ihr auf dem Tisch lag, und feuerte drei Schüsse ab.
Das Licht ging aus, und … tosender Beifall brandete auf.
»Wow, das war ja sehr beeindruckend«, sagte Nathalie zu ihrer Köchin Louise, die mit einer kleinen Taschenlampe an den Lichtschaltern stand, mit denen die diversen Lampen im Pub ein- und ausgeschaltet werden konnten.
Sie legte bedächtig einen Schalter nach dem anderen um, als wollte sie die Zuschauer ganz langsam und behutsam aus dem Theaterstück in die Realität zurückholen. »Beeindruckend ist das richtige Wort«, stimmte Louise ihr zu. »Ich hätte einer so zierlichen Person nicht zugetraut, dass sie die Rolle richtig verkörpern kann. Aber, ehrlich gesagt, nach zehn Minuten war ich völlig gefesselt.«
Nathalie nickte und sah sich um. »Dem Applaus nach zu urteilen, ging es dem übrigen Publikum nicht anders.« Mit den gut achtzig Gästen, die sich im Schankraum des gemütlichen Pubs eingefunden hatten, war die Vorstellung so restlos ausverkauft gewesen, dass sich rund ein Dutzend Nachzügler sogar mit Stehplätzen hatten zufriedengeben müssen. Louise wollte konsequent bleiben und die angemeldete Zahl an Besuchern einhalten, aber Nathalie hatte sich schließlich gegen sie durchgesetzt. Immerhin handelte es sich bei den Nachzüglern um Stammgäste, die dem Pub durch diverse Familienfeiern immer wieder gute Einnahmen bescherten. Diese Gäste abzuweisen, wäre nicht im Sinne des Black Feather gewesen. Um Ärger zu vermeiden, weil gegen die Brandschutzvorschriften verstoßen wurde, hatte sie die Nachzügler kurzerhand als ehrenamtliche Helfer deklariert. Ob das einer Prüfung tatsächlich standgehalten hätte, stand auf einem anderen Blatt.
Die Gäste strahlten ausnahmslos begeistert und unterhielten sich angeregt, die ersten zog es zu den Stehtischen, die auf der Fläche vor dem Pub aufgestellt worden waren. »War doch eine gute Idee, den Parkplatz heute Abend zur Terrasse umzufunktionieren«, stellte Louise erfreut fest, als sie sah, wie die Leute nach draußen strömten, wo die Bedienungen schon darauf warteten, die Getränkebestellungen aufzunehmen.
Nathalie nickte zustimmend. »Das ist zwar eigentlich nur eine Notlösung, aber die Gäste nehmen das Angebot an. Das haben Sie gut gemacht, Louise.«
»Alles nur für Pub und Vaterland, meine Liebe«, gab sie zurück.
Lächelnd betrachtete Nathalie die ältere Frau, die ihr auch etwas mehr als sechs Wochen nach der Übernahme des Black Feather immer noch ein Rätsel war. Wenn es stimmte, was sie sagte, war sie eine ehemalige Agentin für einen nach wie vor namenlosen Geheimdienst des Landes. Wie hatte sie das noch formuliert: An einem Geheimdienst ist nichts geheim, wenn jeder von seiner Existenz weiß.
So ungefähr hatte ihre Antwort gelautet, und die Internetsuche nach anderen als den bekannten Geheimdiensten war ergebnislos verlaufen. Zumindest, wenn man von etlichen Dutzend Verschwörungstheorien absah, die alles und jeden verdächtigten, das Volk auszuspionieren, die Wirtschaft zu unterwandern oder die Politik zu beeinflussen. Irgendwann, so sagte sich Nathalie, würde Louise schon etwas mehr dazu sagen. Davon war sie überzeugt. Wenn sie sich erst einmal länger kannten und Louise einschätzen konnte, inwieweit sie ihrer Chefin vertrauen durfte, würde sie ganz bestimmt ein paar Details enthüllen. Für den Augenblick wollte sich Nathalie mit dem begnügen, was sie über Louise wusste.
»Abgesehen davon«, fügte Louise anerkennend an, »war dieser Theaterabend Ihre Idee, Nathalie, und da kann ich nur lobend meinen imaginären Hut ziehen, dass das so hervorragend gelaufen ist.«
Louise konnte sich nicht vorstellen, wie erleichtert Nathalie über den Verlauf des Abends war. Gekommen war ihr die Idee nach einer Aufführung im kleinen Gemeindesaal. Dieser gehörte eigentlich zur Kirche, die aber seit Jahren geschlossen war. Eine Theatertruppe, die mit einer Bühnenfassung eines Poirot-Krimis auf Tournee war, hatte vor halb leerem Saal spielen müssen. Das lag nicht daran, dass kein reges Interesse an der Veranstaltung bestanden hätte. Vielmehr war der Saal für heutige Verhältnisse schlicht überdimensioniert, während er vor fünfzig oder sechzig Jahren noch genau richtig gewesen sein mochte, da Kirchen zu der Zeit noch mehr Zulauf hatten und Theateraufführungen mehr Besucher anzogen. Das Fernsehen hatte damals ja noch nicht rund um die Uhr für Unterhaltung gesorgt.
Beim Anblick der leeren Stühle hatte Nathalie überlegt, dass die tatsächliche Auslastung in etwa so bemessen war, dass man die Leute auch in den Pub setzen könnte, damit die Vorstellung vor ausverkauftem Haus stattfand. Das Black Feather bot die räumlichen Verhältnisse, die nötig waren, um von den Plätzen im Lokal aus die Bühne sehen zu können.
Ihre Einschätzung war bestätigt worden, wenngleich niemand sagen konnte, ob sich so ein Erfolg überhaupt wiederholen ließ. Immerhin hatte es heute Abend ein weitgehend unbekanntes Stück des Schriftstellers Ian O’Shelley gegeben, was nichts Alltägliches war und vielleicht automatisch mehr interessierte Zuschauer anlockte als die x-te Bühnenfassung von Arsen und Spitzenhäubchen.
»Miss Langley, Sie waren einsame Klasse«, sagte Louise plötzlich und holte damit Nathalie aus ihren Gedanken. Sie sah, dass die Hauptdarstellerin des Stücks inzwischen zu ihnen getreten war.
»Vielen Dank«, erwiderte die Angesprochene fast verlegen. Sie war mehr als einen halben Kopf kleiner als Nathalie, etwa Mitte zwanzig und dazu so zierlich gebaut, dass man Angst haben musste, sie bei einer etwas enthusiastischeren Umarmung zu zerquetschen. »Das ist nett von Ihnen.«
Noch während sie redete, wurde sie von einigen Besuchern angesprochen, die ihr die Hand schüttelten und ein Selfie mit ihr machen wollten. Schließlich erreichte die junge Frau die Theke und nahm Platz. Das viele Lob hatte dafür gesorgt, dass sie auf dem Weg durch die Zuschauer sichtlich errötet war.
»Ein Bier?«, fragte Nathalie.
»Nein, ein Wasser, bitte«, sagte die Schauspielerin und löste den Haargummi aus ihren hochgebundenen, langen honigblonden Haaren, damit sie sie neu fassen und abermals hochbinden konnte, diesmal allerdings so, dass sie besser hielten. »Alkohol vertrage ich nicht gut, und wenn mir so warm ist wie jetzt gerade, noch viel weniger.« Sie lächelte flüchtig. »Außerdem war das da auf der Bühne schon Rausch genug für einen Tag.«
»Und das ist wirklich das erste Mal, dass Sie so ein Stück spielen, bei dem Sie ganz allein auf der Bühne stehen?«, erkundigte sich Louise, die ihr das Glas Wasser hinstellte.
Christine nickte und fächerte sich Luft zu. »Das ist richtig. Und ich war ja so nervös. Bei einem normalen Theaterstück hat man wenigstens noch zwei oder drei Kollegen, die einem helfen können, wenn man mal nicht weiterweiß. Aber so … so konnte ich nur improvisieren und hoffen, dass es niemand merkt.«
»Aber das haben Sie gut gemacht«, lobte Nathalie sie.
Die junge Frau verzog den Mund. »Eigentlich nicht, wenn Sie es gemerkt haben.«
Nathalie winkte ab. »Das habe ich nur gemerkt, weil Überführt die erste Geschichte war, die ich als Jugendliche gelesen habe, die aber nicht für Jugendliche geschrieben war.«
»Sie waren wohl frühreif?«, warf Louise grinsend ein und beugte sich vor, um sich mit den Ellbogen auf der Theke abzustützen.
»Nein, ich war nur nie Fan von Enid Blyton und Co.«, gestand sie ihr. »Ich fand’s seltsam langweilig, Geschichten über Kinder und Jugendliche zu lesen. Ich war ja selbst in dem Alter, da hat mich das nicht gereizt. Und Pferderomane sind überhaupt nicht mein Ding, also musste ich mir was Erwachseneres suchen. Tja, und da bin ich in der Schulbibliothek auf eine Kurzgeschichtensammlung von O’Shelley gestoßen und habe als Erstes Überführt gelesen. Danach bin ich ihm verfallen.« Nathalie schaute versonnen durch das offene Fenster auf die improvisierte Terrasse, wo sich die Gäste an den Tischen drängten. »Bis heute.«
»Dann war Ihr erstes Buch, das Sie sich als Erwachsene gekauft haben, bestimmt diese Sammlung von O’Shelley«, vermutete Christine.
Nathalie schaute ein wenig betreten drein. »Nein, diese Sammlung war das erste und, wie ich betonen möchte, auch das einzige Buch, das ich aus der Bibliothek habe mitgehen lassen.«
»Was!?«, riefen Christine und Louise ungläubig.
»Ja, ich weiß, das sollte in meinem polizeilichen Führungszeugnis vermerkt sein«, sagte Nathalie mit gespielt bestürzter Miene. Dazu schürzte sie demonstrativ die Unterlippe. An Louise gerichtet, ergänzte sie dann aber: »Mich wundert, dass keiner Ihrer Kontakte davon wusste.«
»Dabei war der verschwundene O’Shelley seit Jahren eines der größten Rätsel unserer Abteilung«, konterte die ältere Frau in einem dazu passenden Tonfall. »Wir haben das Verschwinden immer einigen bekannten radikalen Elementen zugeschrieben, aber nie eine Verbindung zwischen denen und besagter Bibliothek herstellen können.«
»Tja, was sagt das denn wohl über die Befähigung Ihrer Abteilung aus?«, spottete Nathalie.
»Ähm, warten Sie mal«, unterbrach die Schauspielerin das Gespräch und sah etwas besorgt zwischen den beiden hin und her. »Habe ich da eben irgendetwas Falsches gesagt?«
Nathalie und Louise mussten beide lachen, dann sagte Letztere: »Nein, nein, keine Angst, hier geht alles ganz gesittet zu. Das ist nur ein Geplänkel zwischen Eingeweihten.«
»Genau«, warf Nathalie gut gelaunt ein. »Und um es verstehen zu können, müssten wir Ihnen erst mal zwanzig Minuten oder länger alles erklären, und wenn wir das geschafft hätten, würde das für Außenstehende nicht halb so witzig wirken. Wenn überhaupt.«
Christine nickte beruhigt. »Dann habe ich ja nichts verkehrt gemacht. Aber … wieso haben Sie das Buch denn überhaupt mitgenommen, anstatt es irgendwo zu kaufen?«
»Weil ich das Buch schon damals nirgendwo mehr bestellen konnte. Und was Antiquariate im Internet anbieten, das ist so teuer, dass ich es mir damals nicht leisten konnte. Und bei den meisten Titeln bin ich heute auch noch nicht bereit, so viel Geld hinzublättern. Es kommt ja nicht dem Autor zugute, sondern irgendjemandem, der das Buch damals für zwei Pfund gekauft und nichts weiter gemacht hat, als es so zu verwahren, dass nichts drankommen kann. O’Shelleys Bücher sind seit zig Jahren vergriffen, und eine neue Ausgabe ist nicht zu erwarten, weil die Nachfahren des Verlegers die Titel nicht wieder auflegen. Sie wollen die Rechte, die der Autor wohl seltsamerweise dem Verlag übertragen hat, aber auch nicht verkaufen. Überführt ist eines von O’Shelleys frühen Stücken, das kennt kaum jemand.«
»Verstehe ich nicht«, warf Louise ein. »Dieser Verlag sitzt auf einem Vermögen. Das betrifft ja bestimmt nicht nur O’Shelleys Bücher, oder?«
»Sagt Ihnen der Name Harfort & Harfort etwas?«, fragte Nathalie.
Louise verdrehte die Augen. »Was? Bei denen sind die alten O’Shelleys erschienen? Oh Mann, die haben mal mit einer illustrierten Neuausgabe der Bücher von H.G. Wells angefangen, Band eins und zwei habe ich gekauft, dann wurde Band drei verschoben und Band vier vorgezogen, den ich auch gekauft habe. Dann ist der alte Harfort gestorben, und seine vierzig Jahre jüngere Ehefrau hat angefangen, das gesamte Programm umzubauen, weil sie Kochbücher verlegen wollte. Seitdem klafft in meinem Bücherregal eine Lücke zwischen Band zwei und Band vier.«
»Wie überaus schade!« Christine schüttelte den Kopf. »Auf jeden Fall danke ich Ihnen dafür, dass Sie mir die Chance für diesen Auftritt gegeben und mich auf den Text aufmerksam gemacht haben. Es gibt gar nicht so viele Stücke für nur eine Person. Meistens muss man aus anderen Stücken Monologe raussuchen und versuchen, sie sinnvoll zu verbinden.«
»Das war mir ein Vergnügen«, entgegnete Nathalie. »Ich meine, wenn wir schon eine echte Schauspielerin in unserem schönen Earlsraven haben, dann soll die auch eine Gelegenheit für einen Auftritt bekommen.«
»Danke«, sagte die junge Frau und wurde wieder rot. »Aber so eine wirklich echte Schauspielerin bin ich auch noch nicht.«
»Also bitte, Miss Langley«, protestierte Louise. »Wer drei Wochen lang in London in der Mausefalle mitspielen kann, sollte sich schon als echte Schauspielerin bezeichnen dürfen.«
»Ich war die Krankheitsvertretung der Urlaubsvertretung«, machte sie klar.
»Na und? Also waren Sie die Drittbeste. Damit haben Sie zwei Bessere vor sich«, sagte Louise. »Oder Sie haben zwei vor sich, die beide mit dem Produzenten geschlafen haben. Auf jeden Fall haben Sie noch hundert hinter sich, die alle viel schlechter sind als Sie.«
Christine trank einen Schluck Wasser.
»Na, wen haben wir denn da?«, ertönte eine Männerstimme hinter der Schauspielerin. »Wenn das nicht die berüchtigte Serienmörderin Olivia McDonnell ist.«
Nathalie kannte die Stimme und konnte sie gleich dem Gesicht zuordnen, das einen Moment später neben Christine auftauchte. Ein recht kleiner, unauffälliger Mann, den sie sich jahrelang viel größer und beeindruckender vorgestellt hatte, bis sie ihn einmal in London bei einer Autogrammstunde live erlebt hatte. Das Gesicht war seitdem etwas hagerer und blasser geworden, aber in seinem Fall bedeutete das nicht, dass er sich mit irgendeiner Krankheit herumplagte. Sie wusste aus einem Interview, dass er vor einer Weile seine Ernährung radikal umgestellt hatte und so gesund lebte wie möglich, ohne aber gleich auf jeden Genuss zu verzichten. Als Folge dieser Umstellung hatte er etliche Kilogramm abgenommen, wodurch sein Gesicht nicht mehr so rundlich war wie früher. Das hatte auch gegen seinen hohen Blutdruck geholfen, der der Grund für seinen damals noch geröteten Kopf gewesen war.
»Mr O’Shelley, ich wusste gar nicht, dass Sie unter den Zuschauern waren«, sagte Nathalie und reichte ihm über die Theke hinweg die Hand. »Es ist mir eine Ehre, Sie persönlich kennenzulernen.«
O’Shelley drückte ihr die Hand und musterte sie nachdenklich. »Ich vergesse nie ein Gesicht«, murmelte er, »aber Sie … Sie kenne ich nicht. Sie könnten mir aber trotzdem ein Bier zapfen.« O’Shelley grinste sie an.
»Das ist Nathalie Ames, die neue Eigentümerin des Black Feather«, erklärte Louise.
»Die neue Eigentümerin?« O’Shelley stutzte. »Hat Mrs Wilkeson etwa doch verkauft? Hat einer dieser Konzerne Sie hier hingesetzt, damit wir von Ihrem Lächeln geblendet werden? Sollen wir …«
»Henrietta Wilkeson ist gestorben«, unterbrach Nathalie ihn ruhig, aber bestimmt, bevor er sich noch in etwas hineinsteigerte. »Meine Tante Henrietta hat mir das Black Feather vererbt. Ich bin seit nicht ganz zwei Monaten die neue Eigentümerin.«
»Hm«, machte der Schriftsteller. »Kein Konzern?«
»Kein Konzern«, bestätigte sie.
»Okay«, meinte er nur. »Dann möchte ich Ihnen mein Beileid zum Tod Ihrer Tante aussprechen. Sie war ein guter Mensch.«
Nathalie lächelte ein wenig betrübt und stellte ihm das gewünschte Bier hin. »Danke. Das habe ich in den letzten Wochen so oft gehört, dass ich es sogar dann glauben würde, wenn ich das Gegenteil davon persönlich miterlebt hätte.«
»Und?«, fragte er.
Nathalie zuckte mit den Schultern. »Was genau wollen Sie wissen, Mr O’Shelley?«
»Wie es Ihnen hier gefällt, zum Beispiel. Was sagen Sie zu den Menschen hier? Woher kommen Sie?«
»Ziemlich viele Fragen auf einmal«, erwiderte sie. »Wenn ich darauf ausführlich antworten soll, wird es eine Weile dauern, bis ich fertig bin. Die Kurzfassung würde lauten: gut, nett, Liverpool.«
»Ich glaube, die Langfassung wäre interessanter«, sagte ihr Gegenüber lächelnd.
Sie grinste ihn an. »Ach, ich weiß nicht, ob die wirklich so viel interessanter wäre. Ich würde lieber …«
»Ich weiß«, fiel er ihr ins Wort und hielt eine Hand hoch. »Sie würden viel lieber mir ganz viele Fragen stellen, die Sie mir schon immer stellen wollten. Da sind Sie nicht die Einzige, muss ich leider sagen.«
»Leider?«, wiederholte sie verdutzt.
»Ja, leider«, bestätigte O’Shelley. »Es ist nicht persönlich gemeint, aber während meine Leser am liebsten alles wissen möchten, weiß ich im Gegenzug normalerweise so gut wie nichts über meine Leser. Ich bekomme zu hören, dass sie mein größter Fan sind und dass sie all meine Bücher gelesen haben. Das ist aber auch schon alles. Meine Fans können mir im Gegenzug aber aufzählen, welches meiner Bücher wann erschienen ist, was ich selbst längst nicht mehr auf die Reihe bekomme, weil es bedeutungslos für mich ist. Es zählt, dass ein Buch da ist, nicht, seit wann es das ist. Meine Fans wissen sogar die Namen aller Hunde, die ich in meinem Leben besessen habe. Das weiß ich zwar selbst auch noch, aber ich habe keine Ahnung, ob meine Leser Goldfische oder Piranhas oder irgendwelche Papageien ihr Eigen nennen.«
»Das interessiert Sie?«
»Warum sollte es mich nicht interessieren, Miss Ames? Warum sollte es mir egal sein, was die Menschen tun und denken, die meine Bücher kaufen und lesen?«
Nathalie sah ihn sekundenlang an, weil sie der Meinung war, darauf eine Antwort zu wissen, die er als Tatsache akzeptieren musste. Aber sosehr sie sich auch bemühte, es kam ihr nichts in den Sinn, sodass sie letztlich diejenige war, die akzeptieren musste, dass er eigentlich recht hatte. Sie gab sich geschlagen, aber dann kam ihr eine Idee, wie sie ihm seinen Wunsch erfüllen und gleichzeitig etwas für den Pub tun konnte.
»Mr O’Shelley, Sie haben völlig recht. Sie sollten mehr über das erfahren, was in Ihren Lesern vorgeht. Was halten Sie davon, wenn wir einen Termin vereinbaren, an dem Sie zu einer Lesung vorbeikommen, und im Anschluss gibt es eine Fragerunde für Sie? Dass also die Gäste wissen, dass sie nach der Lesung noch Rede und Antwort stehen müssen.«
»Das würde keinen interessieren«, meinte er und winkte ab.
»Ganz im Gegenteil«, beharrte sie. »Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar sehr interessant werden würde. Und zwar für beide Seiten. Wenn wir das ankündigen, werden die Leute natürlich erst mal stutzen und sich fragen, was dahintersteckt. Aber dann werden sie Gefallen daran finden und neugierig werden, was ein berühmter Autor von ihnen wissen wollen könnte.«
»Ich mache keine Lesungen«, wehrte er ab. »Ich mag es nicht, den Kram vorzulesen, den ich selbst geschrieben habe. Wenn ich dann sehe, was da steht, möchte ich am liebsten alles ändern und neu machen.«
»Umso besser«, rief Nathalie hastig, da sie eine Gelegenheit sah, ihn doch noch dafür zu begeistern. »Dann machen wir daraus eine Spontan… nein, etwas anderes … ja, genau, eine Improvisationslesung, bei der die Leute wissen, welcher Text sie eigentlich erwartet, aber niemand eine Ahnung hat, in welcher Version sie den zu hören bekommen. Wir könnten den Gästen eine Art … na ja, Textheft geben, oder wir projizieren den ursprünglichen Text hinter Ihnen an die Wand, während Sie improvisieren. Auf die Weise lesen die Besucher das Original und hören, wie Sie das heute schreiben würden.«
»Ach, das würde doch nur Chaos geben«, wandte er ein. »Wenn wir damit anfangen, bin ich nach drei Zeilen weg vom Original und erzähle irgendwas komplett anderes. Da bringt ein Textheft auch nichts.«
Zum Glück verstand Christine den bittenden Blick, den Nathalie ihr zuwarf, da sie nach kurzem Überlegen vorschlug: »Was halten Sie davon, wenn ich Sie auf die Bühne begleite und Sie davon abhalte, völlig von der Ursprungsidee abzuweichen?«
»Wie soll das funktionieren?«, wollte er wissen.
Die Schauspielerin zuckte mit den Schultern. »Wenn Sie einen Text mit einem Dialog aussuchen, kann ich vorlesen, was Sie geschrieben haben, und wenn Sie mit Ihrer improvisierten Antwort völlig abschweifen, beschwere ich mich, dass das keine Antwort auf meine Frage ist, und ich bestehe darauf, eine vernünftige Antwort zu bekommen. Und dann können wir ja weitersehen. Wir können das ja einfach unter vier Augen ausprobieren.«
»Und Sie würden mich auf die Bühne begleiten?«, hakte er nach.
Nathalie entging das begeisterte Leuchten in O’Shelleys Augen nicht. Sie musste sich ein Grinsen verkneifen und wollte unauffällig Louise zuzwinkern, da hielt die bereits den Daumen nach oben gestreckt und lächelte strahlend.
»Das wäre mir sogar eine Ehre«, versicherte Christine ihm.
»Hm«, brummte der Mann missmutig und scheinbar desinteressiert, obwohl sein Blick etwas ganz anderes verriet. »Na ja, ich werde mal vorsichtig zusagen, aber unter größtem Vorbehalt, damit Sie mich ja nicht darauf festnageln können. Vielleicht habe ich ja Glück und sterbe vorher, dann hat sich das Problem von selbst erledigt.«
»Sagen Sie so was nicht, das bringt Unglück«, rief Nathalie.
O’Shelley lachte amüsiert auf. »Wenn das wirklich Unglück bringen würde, dann wären meine drei Exfrauen schon vor Jahren vom Blitz erschlagen worden, so wie ich es ihnen immer gewünscht habe.«
»Mr O’Shelley!« Nathalie musste nach Luft schnappen. »So was sagt man einfach nicht! Man wünscht nicht anderen Leuten den Tod, ob sie es nun verdient haben oder nicht, aber schon gar nicht, wenn sie rechtschaffene Leute sind!«
»Womit bewiesen wäre, dass Sie meine Exfrauen noch nicht kennengelernt haben. Die machen sich auf meine Kosten ein schönes Leben, tun keinen Handschlag und warten nur auf die nächste Unterhaltszahlung. Aber dafür habe ich sie enterbt. Irgendwo muss auch mal eine Grenze sein.«
Nathalie lag die Frage auf der Zunge, wieso sich gleich drei Frauen von ihm hatten scheiden lassen, aber das verkniff sie sich. Sie wollte O’Shelley in ihrem Pub eine Lesung halten lassen, aber ihn nicht mit ihren Argumenten zugunsten seiner Exfrauen in die Defensive drängen und ihn damit vergraulen.