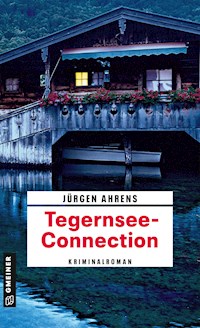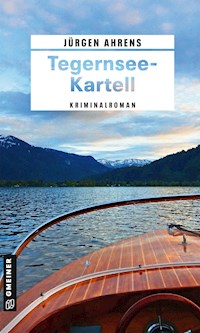
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalkommissar Markus Kling
- Sprache: Deutsch
Eine Serie dramatischer Vorfälle hält das Tegernseer Tal in Atem: Beim Dreh eines Heimatfilms bricht TV-Star Michael Fromberger zusammen und stirbt. Ein entscheidender Zeuge wird für immer kaltgestellt und ein Multimillionär befördert sich mit Schlaftabletten ins Jenseits. Drei lose Enden - gibt es zwischen ihnen einen Zusammenhang? Kommissar Markus Kling und seine Münchner Kollegen stehen vor einem Rätsel. Erst nach vielen Irrwegen bringt ein Zufallsfund die Ermittler schließlich auf die richtige Spur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Jürgen Ahrens
Tegernsee-Kartell
Kriminalroman
Zum Buch
Jagd auf ein Phantom Auch am Tegernsee spuken bisweilen die Gespenster der Vergangenheit – und Hauptkommissar Markus Kling wird jäh mit den Folgen konfrontiert, ohne den Zusammenhang zu ahnen. Drei Todesfälle innerhalb kurzer Zeit, jeder davon im Milieu der Stars und Millionäre: Was steckt dahinter, wo ist die Lösung verborgen? Nach vielen Irrwegen bringt der Zufallsfund eines Journalisten die Ermittler schließlich in die Nähe der Wahrheit, doch der Hintergrund bleibt ein Mysterium. Erst als es schon fast zu spät scheint, entdeckt Kling das Bindeglied zwischen den Geschehnissen. Ein Kartell von Geschäftemachern, die sich am Tegernsee zusammengefunden haben, hat ebenfalls von diesem Geheimnis Wind bekommen und wittert eine Goldgrube – die Verlockung schmutzigen Reichtums, der jedes Verbrechen wert zu sein scheint.
Jürgen Ahrens, geboren in Bremen, studierte Germanistik, Musikwissenschaft und Fotodesign. Im Anschluss arbeitete er acht Jahre als Texter in internationalen Werbeagenturen, bevor er sich selbstständig machte. Neben seiner werblichen Tätigkeit arbeitete er auch journalistisch, unter anderem für das BMW Magazin und die Süddeutsche Zeitung, und veröffentlichte mehrere Autobücher und Romane. Mit Kommissar Markus Kling hat er seine erste Serienfigur erschaffen. Jürgen Ahrens lebt mit seiner Ehefrau in seiner Wahlheimat München. Seit 2005 ist er aktives Mitglied der Autorengruppe KaLiber, seit 2020 gehört er auch dem »Syndikat« an, einem Verein deutschsprachiger Kriminalautoren. Weitere Informationen unter: www.juergen-ahrens.com
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Jürgen Ahrens
ISBN 978-3-8392-7214-5
Zitat
Wie der starke Mann sich seiner körperlichen Kraft freut und besonderes Vergnügen an allen Übungen findet, die seine Muskeln in Tätigkeit setzen, so erfreut sich der Analytiker jener geistigen Fähigkeit, die das Verworrene zu lösen vermag.
Edgar Allan Poe
Prolog
Mai 1937
»Also, was ist jetzt? Verdammt noch mal, mir reicht es langsam mit dem Palaver!«
Dr. Emil Grotekamp war von seinem Platz aufgesprungen und lief im Zimmer hin und her, während er immer wieder heftig an seiner Muratti paffte. Graue Schwaden vernebelten den Raum, doch die Fenster zu öffnen, verbot sich. Von dieser Diskussion durfte kein Wort nach außen dringen.
Dr. Walter Gillessen, der Mieter der Wohnung in Frankfurt-Höchst, ließ sich von der Unruhe seines Kollegen nicht beirren; er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und streckte die Beine aus, während er den dahintreibenden Tabakdunst beobachtete. Bedächtig zog er an seiner Meerschaumpfeife und blickte auf seine Armbanduhr. »Wie viel Zeit bleibt uns denn eigentlich?«, fragte er in seiner gewohnt stoischen Art.
Grotekamp blieb stehen und sah ebenfalls reflexhaft auf die Uhr. »Ungefähr 42 Stunden. Abflug, ist, wie Sie wissen, übermorgen um … Aber das sind doch alles Kinkerlitzchen!«, unterbrach er sich ungehalten. »Wie lange sollen wir noch herumeiern? Meine Argumente habe ich mehrfach geäußert, und an ihrer Plausibilität hat sich nichts geändert.«
»Ja. Für den Fall eines Interkontinentalkriegs«, sagte Sebastian Krüger, der sich bislang eher zurückgehalten hatte. »Für mich klingt das immer noch utopisch. Nicht mal ein Vabanquespieler wie Hitler würde sich mit den USA anlegen, nach all der Scheiße vor 20 Jahren im Atlantik.«
»Aber er wird sich mit ganz Europa anlegen«, ereiferte sich Grotekamp. Mit seinen 32 Jahren war er zwar der Jüngste der drei, dennoch hatte ihm Dr. Goebbels wegen seiner speziellen Fachkenntnisse damals die Leitung des Geheimprojekts übertragen, und so betrachtete er sich nach wie vor als Wortführer. »Und danach«, fuhr er fort, »ist Asien dran, dann Nordafrika und so weiter und so weiter. Sie hätten ›Mein Kampf‹ lesen sollen, ich hab’s oft genug gesagt.«
»Diesen fürchterlichen Schinken.« Krüger verzog angewidert das Gesicht.
»Diesen fürchterlichen Schinken«, wiederholte Grotekamp erregt und zerdrückte den Rest seiner Zigarette im Aschenbecher. »Ja, Sie haben vollkommen recht. Leider ist das sein Programm, und der Schlussakt, oder besser die Tragödie, wird eine Konfrontation zwischen dem Deutschen Reich und Amerika sein. Warum hat sich denn von Blomberg in das Projekt eingemischt? Und warum hat er uns einen fürstlichen Etat spendiert? Bestimmt nicht wegen der nächsten Olympischen Spiele. Im Nachhinein wünsche ich mir, wir hätten unsere Finger nicht in diesen Morast gesteckt. Tun wir wenigstens jetzt das Richtige. Wozu hab ich mir sonst die Mühe gemacht, extra einen Brief an Roosevelt aufzusetzen?«
Nach seinen Worten breitete sich Schweigen in der Runde aus. Krüger wischte sich Schweißperlen von der Stirn und entledigte sich umständlich seiner Krawatte.
»Glauben Sie denn allen Ernstes, dass Hitler die Weltherrschaft anstrebt?«, fragte Gillessen.
»Ja«, erwiderte Grotekamp kurz angebunden. »Vielleicht nicht für sich selber, aber für die germanische Edelrasse, bekanntermaßen sein Lieblingsthema. Berlin letzten Sommer, das war nur das Vorspiel auf dem Theater. 33 Goldmedaillen, auch dank unserer schäbigen Mithilfe, geschenkt. In ein paar Jahren wird es um 33 Länder gehen, und eins nach dem anderen kommt dazu. Nur die Amerikaner sind in der Lage, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.« Er entnahm seinem silbernen Etui eine neue Zigarette, zündete sie an und sog energisch den Rauch in seine Lungen ein.
»Haben Sie für mich auch eine?«, fragte Krüger.
Grotekamp hielt ihm das Etui hin. »Bitte. Vielleicht hilft es.«
Krüger nickte, griff sich eine Zigarette und ließ sich von Grotekamp Feuer geben. Erneut schwiegen die drei. Die Wanduhr in der Diele nebenan ließ vier helle Glockentöne und danach zwölf tiefe, nachhallende Schläge vernehmen. In diesem Moment klangen sie wie die Glocken des Jüngsten Gerichts in ihren Ohren.
»Meine Güte, Grotekamp«, seufzte Krüger, mit einem bemüht lockeren Unterton, als wollte er das allgemeine Unbehagen auflösen. »Haben Sie’s denn nicht ’ne Nummer kleiner? Sie malen ja immer schwärzer, je länger wir über Hitler diskutieren.«
»Aus gutem Grund«, entgegnete der Angesprochene.
»Aus guten Gründen hatten wir uns auch geschworen, keine Monstren zu erschaffen. Egal, ob deutsche oder amerikanische.«
»Das gilt nach wie vor. Es wäre ja nur die Ultima Ratio, bevor alles zu spät ist.«
»Warum stimmen wir nicht einfach ab?«, schlug Gillessen vor. »Wir sind zu dritt, somit ist die Sache klar. Ein Patt ist ausgeschlossen.«
Krüger klatschte zustimmend in die Hände. »Jawohl, machen wir endlich Schluss mit der Rederei. Die Mehrheit entscheidet, und damit basta. Also, wer ist dafür, das Mikrofiche und alle sonstigen Unterlagen ins Feuer zu werfen?«
Seine Frage war noch nicht ganz ausgesprochen, als er schon den Arm erhob. Weil sein rechtes Schultergelenk infolge einer Kriegsverletzung in seinem Radius beschränkt war, wirkte es fast wie ein Hitlergruß. Keiner folgte seinem Beispiel.
»Und der guten Ordnung halber, wer ist dafür, dass Dr. Grotekamp den Film seiner Kontaktperson in Washington zuspielt?«
Zwei Arme schnellten in die Höhe.
»Na schön«, resümierte Krüger. »Ich stelle hiermit fest, dass eine Zweidrittelmehrheit entschieden hat, die Substanz den Amerikanern zu überantworten.«
Die drei Wissenschaftler sahen sich wortlos an. Krüger verzog zweifelnd das Gesicht. »Glauben Sie mir, es ist besser so«, beschwor Grotekamp seinen Kollegen.
»Jaja«, bekam er zur Antwort. »Das war ein demokratischer Beschluss, nicht wahr? Also, Ende der Debatte.«
»Es ist gut, wenn wir alle dahinterstehen«, sagte Grotekamp. »Noch mal zum Test: Wie lautet der Schlüssel? Herr Dr. Gillessen?«
Gillessen nannte den Zahlencode.
Grotekamp nickte befriedigt. »Gut, wir drei haben die Zahl im Kopf. Sollte der Film in die falschen Hände geraten, kann niemand etwas damit anfangen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass er in die richtigen gelangt.«
»Trinken wir darauf«, sagte Gillessen. »Ich habe einen sehr guten Courvoisier im Schrank. Napoléon, zwölf Jahre alt.«
»Ja, trinken wir darauf«, antworteten die beiden anderen unisono.
Gillessen klopfte seine Pfeife aus, öffnete die Wohnzimmervitrine und entnahm ihr eine Kristallkaraffe mit Cognac und drei Weinbrandschwenker. Während er die goldbraune Flüssigkeit im Schein der Deckenlampe in die Gläser goss, blickte er seine Kollegen an und sagte leise: »Möge es nie dazu kommen.«
Sie alle wussten, was gemeint war.
»Möge es nie dazu kommen«, wiederholten seine Kollegen ernst, und bevor sie anstießen, fügte Grotekamp hinzu: »Mir geht es nicht ums Rechthaben. Gebe Gott, dass ich falschliege. Wohlsein.« Mit feinem Klirren trafen sich die Glasränder und besiegelten seine Worte.
1
Über 80 Jahre später
»Zum letzten Mal: Die Fanny gehört mir!«
Den rechten Arm abgewinkelt, die Faust drohend erhoben, bewegte sich der Hüne mit dem Jägerhut auf Christian zu. »Ich meine es ernst. Wenn du nicht deine Finger von ihr lässt, bringe ich dich um!«
»Und du glaubst, das ändert irgendwas?« Christian stemmte die Arme in die Hüften und verzog spöttisch den Mund. »Mach dich doch nicht lächerlich! Fanny hat … Fanny will … würde … Herrgott! Scheiße!«
Er fasste sich an die Stirn, als hätte er einen Migräneanfall, drehte sich zum Kamerateam um und winkte heftig ab.
»Stopp!«, ertönte eine ungehaltene Stimme. Klaus Beckmann, Regisseur der TV-Vorabendserie »Schicksalswege«, verließ seinen Posten und stapfte durch den Schnee auf die Kontrahenten zu. Seine rechte Hand wedelte mit dem Skript.
»Michi, was ist mit dir los?« Halb besorgt, halb freundschaftlich knuffte er seinen Star und hielt ihm den Text vor die Nase. »Du verhaust dich doch sonst nicht am laufenden Band! Schlecht geschlafen, oder was?«
»Quatsch.« Michael Fromberger, als Darsteller des Christian Sebald das zentrale Gesicht der Serie, schüttelte energisch den Kopf. »Mit mir ist alles in Ordnung.«
Es klang nicht überzeugend. Wie zur Bestätigung hob er erneut die Hände und presste sich beide Daumen an die Schläfen. »Ist vielleicht der Föhn«, sagte er entschuldigend.
»Föhn?« Beckmann blickte zum Himmel über der Schwarzentenn-Alm, an dem sich milchiges Blau mit dünnen Wolkenfeldern abwechselte. Für den späteren Nachmittag waren Plusgrade und Regen vorhergesagt. »Du spinnst ja«, gab er zurück. »Wir haben ganz normales Tiefdruckwetter.«
»Fühlt sich für mich aber nicht so an. Irgendwie bin ich heute nicht frei im Kopf.«
»Ja, das merke ich. Brauchst du ’ne Pause … vielleicht einen Kaffee?«
Fromberger schüttelte erneut den Kopf, so vehement, dass seine rotbraune Mähne herumwirbelte. »Naa, bloß koan Kaffee!« Wie immer, wenn er grantig wurde, verfiel er in seine heimische Mundart. »Mir is’ eh scho zu warm.«
»Zu warm? Mach keine Witze.«
»Doch, es ist warm. Scheißwetter. Lass mich mal kurz durchschnaufen.«
»Okay, dann schnauf halt durch. Und danach versuch bitte, dich auf deinen Text zu konzentrieren. Hier«, er tippte auf die Stelle im Skript, »›Fanny hat sich längst entschieden, oder glaubst du etwa, sie würde mit einem Mörder zusammen sein wollen?‹«
»Es ist ein komplizierter Satz, das musst du zugeben.«
»Na und? Bist du Profi oder nicht?«
Florian Winzer, der Hüne mit dem Jägerhut, im richtigen Leben Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele, stand mit zweifelndem Gesicht daneben. »Und wenn wir Take drei nehmen?«, fragte er. »Der war doch fehlerfrei und gar nicht so schlecht.«
»›Gar nicht so schlecht‹ ist dasselbe wie ›gar nicht gut‹«, widersprach Beckmann. »Entweder wir machen es perfekt oder wir lassen es. Also, Michi, komm, reiß dich zusammen.«
Die beiden Schauspieler nickten stumm und nahmen ihre ursprünglichen Positionen wieder ein. Beckmann stapfte zurück zum Aufnahmeteam.
»Können wir loslegen?«
»Alles klar«, bestätigte Fromberger und reckte den Daumen hoch. Beckmann warf erneut einen Blick zum Himmel. Die Wolken wurden dichter. Er holte tief Luft und schickte ein stummes Stoßgebet nach oben. Lieber Gott, lass die Szene im Kasten sein, bevor das Dreckwetter kommt. Dann gab er seiner Assistentin ein Zeichen.
»Achtung, wir drehen!«, rief die Regieassistentin, und das Team spulte die übliche Routine ab.
»Ton läuft!«
»Kamera eins läuft!«
»Kamera zwei läuft!«
»Schicksalswege, Folge dreizehn, Einstellung neun, Take sieben«, sagte der zweite Kameraassistent und betätigte die Synchronklappe.
»Und bitte!«, gab Beckmann das Kommando.
Florian Winzer erhob seine Faust. »Zum letzten Mal: Die Fanny gehört mir!«
Super, dachte Beckmann. Das klang noch eine Spur drohender als in den sechs Takes zuvor.
»Ich meine es ernst. Wenn du nicht deine Finger von ihr lässt, bringe ich dich um!«
So, jetzt dein Auftritt, Michi. Versieb es nicht schon wieder.
»Und du glaubst, das ändert irgendwas? Mach dich doch … mach doch … Oh Scheiße, was ist das?«
Ja, Scheiße, dachte Beckmann wütend. »Stopp! Zefixhalleluja, das darf ja wohl nicht wahr sein!«
Fromberger schien ihn überhaupt nicht wahrzunehmen. »Was ist das?!«, wiederholte er, nun schreiend, und fuchtelte mit beiden Händen in der Luft herum, als wollte er einen Hornissenschwarm abwehren.
»Was ist was?«, fragte Winzer konsterniert, während Beckmann erneut auf die Schauspieler zustürmte.
»Michi! Bist du völlig meschugge?«
Michael Fromberger starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Seine Pupillen verdrehten sich, und in seinem Gesicht stand nackte Panik. »Da … da!«
»Was? Wo?« Beckmann packte seinen Darsteller am Arm, aber der riss sich los und fing plötzlich an zu rennen, ziellos, stolpernd und rutschend im pappig feuchten Schnee. »Hilfe«, schrie er mit überschnappender Stimme, »ich verbrenne! Helft mir doch!«
»Der ist verrückt geworden«, sagte Winzer und blickte ihm verstört nach. Beckmann schwieg, auch die Mitglieder des Aufnahmeteams beobachteten die Szene stumm wie in Schockstarre. Die traumhafte Bergwelt ringsum wirkte plötzlich wie die Kulisse eines Horrorfilms.
Michael Fromberger hatte seine Jacke in den Schnee geworfen, riss sich das Hemd auf und versuchte vergeblich, es ebenfalls loszuwerden, auf seiner kopflosen Flucht vor etwas Unsichtbarem, das in ihm selber war. 50, 100 Meter, dann trugen ihn seine Füße nicht mehr. Er begann zu torkeln, erbrach sich schwallweise, als hätte er einen Vollrausch, und kreiselte mit verdrehten Beinen um die eigene Achse, bis er der Länge nach in den Schnee fiel und reglos liegen blieb. Ein vielstimmiger Aufschrei ertönte.
»Michi!!« Beckmann und Winzer rannten zu der Stelle, beugten sich über den reglosen Körper und drehten ihn auf den Rücken. Frombergers Anblick ließ beide zusammenfahren. Was da lag, glich einem Zombie. Das Gesicht war wachsbleich, der Mund stand offen, und sein toter Blick verlor sich im Nichts, während die Augäpfel regellos herumirrten, als hätten sie sich aus dem Kopf gelöst.
»Hey, Michi!«, rief Beckmann, tätschelte ihm die linke Wange und zog seine Hand erschrocken zurück. »Oh verdammt, ist der heiß!«
»Du meinst, er hat Fieber? So plötzlich?«
»Ja, fühl doch selber!«
Winzer berührte vorsichtig Frombergers Stirn und zuckte ebenfalls zurück. »Oh Gott! Der kocht ja fast!«
»Dreh bitte nicht durch!« Beckmann versuchte vergeblich, seine aufsteigende Panik zu unterdrücken. »Ganz ruhig. Immerhin atmet er noch.«
»Ja, stimmt«, sagte Winzer. »Aber … ganz komisch.«
Erst jetzt wurde Beckmann bewusst, dass Fromberger in flachen, hechelnden Zügen Luft einsog und ausstieß. »Ja, ich seh’s. Scheiße, ist das Schnappatmung oder was? Keine Ahnung, was man da macht.«
»Als Erstes stabile Seitenlage«, schlug Winzer vor. »Das ist aus der Fahrschule bei mir hängen geblieben. Los, hilf mir.«
Er winkelte Frombergers rechten Arm an, kreuzte ihn mit dem linken vor der Brust, und gemeinsam legten sie den schlaffen Körper auf die Seite. Dann schlug Winzer die Beine des Bewusstlosen übereinander und überstreckte dessen Hals.
»So erstickt er nicht, falls er wieder kotzen muss«, erklärte er.
»Okay, sieht richtig aus«, konstatierte Beckmann aufatmend. Seine eigene Führerscheinprüfung lag fast 30 Jahre zurück; zu Erster Hilfe hätte man ihn nicht fragen dürfen. »Sag den anderen, sie sollen sofort den Rettungsdienst rufen. Oder nein, ich kümmere mich darum.«
Er fingerte nach dem Smartphone in seiner Anoraktasche und prüfte die Netzverbindung. Nur ein mickriger Balken ganz links auf der Skala, aber der würde für einen Notruf ausreichen. Mit zitternden Fingern tippte er die 112 auf seinem Telefon ein. Die Leitstelle meldete sich nach wenigen Sekunden, und Beckmann bemühte sich, seine Stimme unter Kontrolle zu bringen, während er das Vorgefallene schilderte.
»Verstanden. Der Rettungshubschrauber wird in zehn Minuten bei Ihnen sein. Lassen Sie den Mann so lange in stabiler Seitenlage, der Arzt wird dann das Nötige veranlassen.«
Inzwischen hatte sich fast das gesamte Aufnahmeteam um die Stelle versammelt. »Sollten wir ihn nicht besser in die Almhütte bringen?«, drängte der Mann mit der Handkamera.
»Oder wenigstens ins Wohnmobil«, mischte sich einer der Lichttechniker ein. »Im Schnee erfriert er uns womöglich, so ohne Jacke.«
»Bei der Körpertemperatur?« Beckmann schüttelte heftig den Kopf. »Er glüht ja förmlich. Ich finde, wir sollten ihn nicht unnötig bewegen. Sagt auch der Mann vom Rettungsdienst. Womöglich hat er ein … ein Hirnaneurysma oder so …«
»Ein was?«
»Ach, vergiss es, hab ich nur mal aufgeschnappt. Jedenfalls ist es besser, wenn er liegen bleibt. Wir haben doch Isomatten dabei. Das muss reichen, bis der Notarzt hier ist. Verfluchter Mist aber auch!«
Keine acht Minuten später warf das Echo der Berghänge ein anschwellendes knatterndes Dröhnen zurück. Über dem nahen Fichtenwald erschien ein Hubschrauber. Er blieb sekundenlang in der Luft stehen und sank dann langsam in Fontänen aufspritzenden Altschnees auf die Alm herunter.
Fromberger lebte, aber sein Atem ging hektisch, seine Augen blickten noch immer ins Leere, und in unregelmäßigen Abständen durchliefen krampfhafte Zuckungen seinen Körper. Beckmann hatte seine Jacke zusammengerollt und ihm unter den Kopf gelegt. Winzer, der zweite Kameramann und die Regieassistentin standen mit bangen Gesichtern daneben.
Der Notarzt näherte sich in Begleitung von zwei Sanitätern, die eine Trage mit Notfallausrüstung transportierten. »Dr. Klapproth«, stellte er sich vor, als er die Gruppe erreicht hatte. »Was genau ist passiert?«
Beckmann zuckte die Schultern. »Keine Ahnung. Herr Fromberger ist plötzlich durchgedreht, hat wirres Zeug geschrien und ist weggerannt. Dann hat er gekotzt, und auf einmal lag er da und rührte sich nicht mehr.«
»Ohne erkennbaren Anlass?« Dr. Klapproth kniete sich neben Fromberger und horchte auf seine Atemgeräusche.
»Ja, da war überhaupt nichts. – Das heißt … irgendwie wirkte er schon vorher … ein bisschen seltsam. Neben der Spur, verstehen Sie? Ich dachte, er ist vielleicht übermüdet oder so.«
»Das dürfte leider etwas ernster sein«, entgegnete der Arzt. Er prüfte mit einer Lampe Frombergers Pupillen, tastete nach dem Puls, maß Blutdruck und Temperatur.
»Pupillenerweiterung, 42 Grad Fieber, Hypertonie, extrem beschleunigter Puls«, fasste er zusammen. »Sieht nicht gut aus. Er weist Symptome einer akuten Intoxikation auf. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann.«
»Und was heißt das genau?«, fragte Beckmann angstvoll.
»Drogenüberdosis, wahrscheinlich Amphetamin«, erklärte Dr. Klapproth knapp, während er einem seiner Helfer winkte. »Ringerlösung, schnell!«
Beckmann und seine Teammitglieder vernahmen den Befund wie vom Donner gerührt.
»Amphetamin? Das gibt’s doch nicht!«, entfuhr es Beckmann.
»Sieht ganz danach aus.«
Der Sanitäter öffnete den Notfallkoffer und bereitete das Infusionsbesteck vor. Dr. Klapproth legte dem Bewusstlosen einen Venenzugang, schloss den Beutel an, und während die Kochsalzlösung in Frombergers Kreislauf rann, begann sich dessen hektischer Atem leicht zu beruhigen.
»Ich hatte schon mehr solcher Fälle«, kommentierte der Arzt. »Wir können von Glück sagen, dass der Mann noch lebt. Offensichtlich ist er völlig dehydriert.«
Er verabreichte Fromberger eine Spritze in den Oberarm, fühlte erneut seinen Puls, nickte und gab seinem zweiten Begleiter ein Zeichen, die Trage zum Abtransport vorzubereiten. Inzwischen hatten sich auch einige Gäste der Schwarzentenn-Alm eingefunden, alarmiert durch den Hubschrauberlärm. Die Gruppe stand um die Szene herum wie Trauergäste um ein offenes Grab.
»Zur Sicherheit werde ich noch ein EKG machen«, sagte Dr. Klapproth, »aber dazu müssen wir seinen Oberkörper entkleiden. Wir packen ihn jetzt in den Helikopter …«
»Und wo fliegen Sie ihn hin?«, wollte Beckmann wissen.
»Ins Krankenhaus Agatharied. Die sind auf alle Notfälle vorbereitet. Keine Sorge, wir werden ihn schon durchbringen.«
Was soll er auch sonst sagen, dachte Beckmann. Folge 13 ist jedenfalls im Arsch. Und wenn Michi nicht überlebt? Stirbt die ganze Sendereihe, aus und Amen.
»Schicksalswege«, murmelte Florian Winzer.
»Wie bitte?«, fragte der Arzt.
»So heißt die Serie, die wir hier drehen. Kommt mir inzwischen vor wie ein böses Omen.«
2
Alles Bemühen des Ärzteteams hatte den Patienten nicht retten können; in der Notaufnahme des Krankenhauses war Michael Fromberger gestorben, gerade mal 29 Jahre alt. Hauptkommissar Markus Kling saß an seinem Schreibtisch in der Polizeiinspektion Miesbach und las noch einmal den Obduktionsbericht durch. Demnach hatte sich Fromberger mit einer illegalen Droge aufgeputscht, die überdies halluzinogen war. Und tückisch, weil die volle Dröhnung erst mit einer guten Stunde Verzögerung einsetzte. Paramethoxyamphetamin, kurz PMA. Der Name klang so teuflisch, wie die Wirkung es war.
Sofort nach Bekanntgabe des Laborbefunds hatte sich das Münchner Drogendezernat der Sache angenommen, denn es war naheliegend, dass Fromberger sich das Zeug in irgendwelchen Münchner Schwarzmarktkreisen besorgt hatte. Und das vermutlich, ohne zu ahnen, was man ihm da angedreht hatte.
»Aus freien Stücken schluckt so etwas niemand«, hatte der zuständige Kollege vom Münchner Präsidium erklärt. »Er dachte wahrscheinlich, es ist Ecstasy. In Osteuropa wird das manchmal mit PMA gepanscht, weil das viel billiger ist. Aber eben auch lebensgefährlich. Die Opfer dehydrieren, weil sie aufhören zu trinken, kriegen Krämpfe und fallen ins Delirium. Und zu allem Überfluss bekommen sie extrem hohes Fieber, weil ihre Temperaturregulierung nicht mehr funktioniert. Sie werden buchstäblich zu Tode gekocht.«
Grauenvoll, dachte Kling. Den Medien gegenüber hatte man sich so drastische Formulierungen zwar wohlweislich verkniffen; in der Pressemitteilung des Präsidiums Oberbayern Süd war als Todesursache »Ischämischer Schlaganfall infolge akuter Hyperpyrexie« angegeben, aber die Boulevard- und Gesellschaftsreporter waren ja nicht blöd. Ischämisch, akute Hyperpyrexie – beides konnte man auf die Schnelle googeln und sich seinen eigenen Reim darauf machen. »TV-Star im eigenen Saft gekocht«, lautete dementsprechend der Aufmacher des Platzhirschs. Die Sensationsgier des Verfassers troff aus jeder Zeile des Berichts. Seit Tagen beherrschte Frombergers Tod die Schlagzeilen, nicht nur in der Region, sondern in ganz Bayern und darüber hinaus. Immerhin gehörte »Schicksalswege« zu den erfolgreichsten Vorabendproduktionen, die der Sender in den letzten Jahren ins Programm genommen hatte. Zu allem Überfluss hinterließ Fromberger zwei Geliebte, zuvor eher B- oder C-Promis, die sich in den einschlägigen Blättern publikumswirksam ausweinten.
Kling hatte keine einzige Folge der Serie gesehen. Solche Schmonzetten ersparte er sich aus Prinzip, der Fall Fromberger selbst hätte ihn allerdings brennend interessiert. Einen Tag nach dem Vorfall auf der Alm hatte es ein zweites Opfer gegeben, eine 23-jährige Fabrikantentochter aus Sankt Quirin; die Sache zog also größere Kreise. Das gepanschte Ecstasy stammte zweifellos aus derselben Quelle wie bei Fromberger. Aber wo war die? Aus den sichergestellten Resten der Chemikalie hatte sich keinerlei Hinweis auf deren Herkunft ergeben, und die Befragten im Familien- und Freundeskreis der Betroffenen waren aus allen Wolken gefallen, als sie die Todesursache erfahren hatten. Der Spürhund in Markus Kling zerrte schon an der Leine, um Witterung nach Indizien aufzunehmen. Doch da war nichts zu machen; hier ging es um ein Drogendelikt mit vermutlich internationalen Verwicklungen, und das fiel in die Zuständigkeit des Münchner Kommissariats 82. Die Miesbacher Kripo blieb außen vor. Vielleicht war es besser so. Markus Kling befand sich gerade auf Wohnungssuche. Er stand kurz vor einem erfolgreichen Mietabschluss und damit auch vor dem Umzug, da wäre ein Haufen komplizierter Ermittlungsarbeit eher zur Unzeit gekommen. Seine neue Liebe, Veronika Sommer, die er im Zusammenhang mit dem Fall Menzl im Vorjahr kennengelernt hatte, war nicht nur zielstrebig, sondern auch entwaffnend pragmatisch.
»Was meinst du, wollen wir nicht zusammenziehen?«, hatte sie schon nach sieben Monaten gefragt. »So ist das doch auf die Dauer kein Zustand. Und überhaupt … Für zwei Wohnungen Miete zu zahlen ist für mich rausgeworfenes Geld.«
Ja, das klang absolut vernünftig. Und wenn nicht mit Vroni, mit wem sonst hätte Kling auf Dauer zusammenleben wollen? Nach den diversen Beziehungskisten der letzten Jahre, allesamt nach ein paar Wochen oder Monaten auseinandergegangen, war sie die Erste, die sein Ideal vom Junggesellendasein ernsthaft ins Wanken gebracht hatte. Es war eben meist kompliziert gewesen, die Balance zwischen Frauen und Freiheit zu finden. Er liebte beides.
Bei Vroni fanden die Gegenpole endlich zueinander. Zum einen war sie schön, warmherzig, offen und verständnisvoll. Zum anderen, und das war das Tüpfelchen auf dem i, teilte sie seine sportlichen Vorlieben: Mountainbiking, Bergwandern, Skifahren, Schwimmen. Es war fantastisch, das alles jetzt mit einer Frau tun zu können, die sich fast hundertprozentig mit seiner Wunschvorstellung deckte. Mit Vronis Eltern hatte er sich ebenfalls auf Anhieb gut verstanden; der Vater war Revierförster, die Mutter Naturfotografin, und beide verband ein immenses Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt der Alpen. Das gefiel Kling außerordentlich gut.
Es fragte sich nur, bis zu welcher Konsequenz er sich in dieses Leben einfügen wollte. Oder konnte. Beim ersten Mal war Vronis Vorstoß mit der gemeinsamen Wohnung über ihn gekommen wie ein rutschendes Schneebrett auf einem Skihang, und er war ihm erfolgreich ausgewichen. Beim zweiten Versuch war ihm das schon weniger gut gelungen, beim dritten hatte er sich langsam mit dem Gedanken anzufreunden begonnen. Zusammenziehen – komisches Wort –; er fremdelte noch damit, aber bedeutete es wirklich, seine Freiheit aufzugeben? Eigentlich nein. Wir müssen deswegen ja nicht gleich heiraten, hatte Kling sich beruhigt. Also probieren wir es halt aus.
Die Suche nach einer passenden Mietwohnung hatte sich hingezogen, doch schließlich waren sie über einen Tipp aus Vronis Bekanntenkreis auf ein Objekt gestoßen, das nahezu vollständig bot, wovon sie träumten. Knapp 90 Quadratmeter in Gmund, nahe dem Bergfriedhof, wo sich ein schöner Ausblick bot, wenn auch nicht auf den Tegernsee. Für Vroni hatte den Ausschlag gegeben, dass ihre zwei Katzen, Bonnie und Sunny, über den Balkon problemlos ein und aus gehen konnten. Man brauchte nur eine Katzentreppe anzubringen. Ein anderer praktischer Vorteil bestand darin, dass die Wohnung in etwa gleich weit von ihrem jeweiligen Arbeitsplatz entfernt lag. Für Vroni und das Team der Gemeindeverwaltung hatte sich dort alles zum Besseren verändert, seit die Grundstücksaffäre der »Tegernsee-Connection« bereinigt war. Kreuth hatte einen neuen Bürgermeister, Mitte 60, altersmild und beliebt. Es hatten noch ein paar weitere Personalwechsel stattgefunden mit dem erfreulichen Ergebnis, dass Vroni bald darauf zur Büroleiterin avanciert war. Eine Entwicklung, die auch der privaten Haushaltskasse guttun würde.
Am 1. Juni, etwa eineinhalb Jahre nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht, würde das künftige Domizil bezugsfertig sein. Wenn sie denn den Zuschlag bekamen. Der Besitzer hatte allerdings durchblicken lassen, dass ihm ein Beamter im gehobenen Dienst und eine Verwaltungsangestellte als Mieter überaus sympathisch seien. Die Chancen standen also nicht schlecht.
Noch eine Dreiviertelstunde bis zum Ende der Spätschicht. Viel würde sich heute nicht mehr tun. Markus Kling würde also pünktlich und entspannt nach Tegernsee fahren, um Vronis beruflichen Aufstieg mit einem Abendessen im Westerhof-Café zu feiern. Dachte er.
Das Klingeln des Telefons auf seinem Schreibtisch machte ihm jäh einen Strich durch die Rechnung.
»Hallo, Markus«, meldete sich die Kollegin Eva Krainer aus der Zentrale. »Du, ich hab hier den Manager von Michi Fromberger in der Leitung, einen Herrn Borell. Klingt ziemlich aufgewühlt. Mit dem Fall warst du doch befasst.«
»Ja, vorübergehend, am Rande. Und was will der Mann?«
»Eine wichtige Aussage machen, sagt er. Angeblich kennt er die Hintermänner.«
»Was?« Markus Kling war elektrisiert. »Das wäre ja … Okay, stell ihn durch. Oder warte, sag Lenz Bescheid. Er soll rüberkommen und mithören.«
»Lenz ist schon weg.«
»Dann … Schick mir Murad, der müsste noch da sein.«
Mit seinem Kollegen Murad Özkan bildete Kling ein eingespieltes Duo, spätestens seit der Aufklärung der spektakulären Brandserie im Jahr zuvor. Die beiden verstanden sich exzellent und dachten ähnlich, was die Herangehensweise an schwierige Fälle betraf.
Als Özkan das Büro betrat, war der Anruf gerade durchgestellt worden. Kling schaltete den Lautsprecher ein.
»Ja, hallo? Bin ick jetzt in der zuständigen Abteilung, die mit dem Fall Fromberger zu tun hat?«
Borell klang rau und sprach mit unüberhörbarem Berliner Akzent. Saupreiß, würden die Alteingesessenen sagen. Einer von diesen Neureichen, die das Tegernseer Tal Stück für Stück okkupierten und in Anlagevermögen umwandelten.
»Ja, bei mir sind Sie richtig«, bestätigte Kling wahrheitswidrig. Warum sollte er diesen fetten Fisch gleich dem K 82 überlassen? Erst mal abwarten, was er zu sagen hat.
»Ja, also …«, fuhr der Anrufer zögernd fort, »mein Name ist Rainer Borell, ick bin seit zwee Jahren der Manager von Michael Fromberger.«
»Ja, ich weiß.«
»Und … äh … ick will … ick möchte …«
Pause. Es wirkte, als bereute Borell seinen Anruf und würde innerlich auf die Stopptaste drücken.
»Ja, was denn nun?«, drängte Kling. »Sie möchten zu dem Fall aussagen? Bitte, ich höre.«
»Ja … also, es ist nämlich so … Ick hab ihm det Ecstasy besorgt.«
»Was?! Sie selber?« Das wurde ja immer toller.
»Ick selber, ja.«
»Das fällt Ihnen reichlich früh ein. Wir ermitteln seit Tagen, was das Zeug hält, und heute rücken Sie damit heraus.«
»Ick weeß«, antwortete Borell zerknirscht. »Ehrlich gesagt, ick musste mit mir kämpfen … Aber det Gewissen hat mir dann keine Ruhe gelassen.«
»Aha, das Gewissen. Drei Tage, nachdem Sie Herrn Frombergers Tod verschuldet haben.«
»Nein! Ick meine …« Borells Stimme nahm einen flehenden Tonfall an. »Det war so ’ne Art Freundschaftsdienst. Der Michi und ich, wir waren ja auch privat … Und er brauchte immer irgend’nen Stoff … verstehen Sie?«
»Nicht ganz.«
»Er konnte nicht ohne Drogen, wenn er in Hochform sein wollte. Da fehlte ihm der Kick. Ja, ick habe ihm Ecstasy-Pillen beschafft. Schon ’ne janze Weile. Na ja, die sind doch harmlos!«
»Harmlos? Ist das Ihr Ernst?«
»Ick meine, nicht lebensgefährlich«, schob Borell hastig nach. »Die nehmen doch viele, wenn se jut drauf sein wollen.«
»Ich zum Beispiel nicht.«
»Ja … klar … Aber wat er da zuletzt jeschluckt hat, war ja keen Ecstasy. Det hat jemand jepanscht, det war pures Gift! Davon wusste ich nichts, det müssen Sie mir glauben!« Jetzt klang die Stimme schrill.
»Dass Sie nichts davon wussten, glaube ich Ihnen gern«, erwiderte Kling sachlich, obwohl 10.000 Volt in ihm vibrierten. »Sie hatten wohl kaum vor, Ihren Goldesel umzubringen. Ihnen ist klar, dass Sie gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben, oder?«
»Jaja. Sicher.«
»Und auch, dass Sie dieses Geständnis mindestens ein Jahr hinter Gitter bringt? Es sei denn, Sie liefern uns brauchbare Hinweise auf den Dealer oder die Bande, die dahintersteckt.«
»Det will ick ja! Ick sag Ihnen allet! Namen, Telefonnummer, Treffpunkt, was Sie wollen.«
Bingo! Kling spürte, wie sein Spannungsmesser einen weiteren Sprung nach oben vollführte.
»Aber bitte nicht am Telefon«, sagte Borell.
»Dann kommen Sie halt persönlich vorbei und erzählen uns, was Sie wissen.«
»Nein! Nein! Womöglich beobachtet mich jemand und dann …«
»Wieso glauben Sie das?«
»Det erklär ick Ihnen später. Kommen Sie zu mir. Am besten gleich.«
»Geht klar«, sagte Kling. »Ich fahre sofort mit einem Kollegen zu Ihnen, wenn Sie mir die Adresse durchgeben. Sind Sie allein?«
»Ja, ick bin … Seit meiner Scheidung bin ick Single. Außer mir ist niemand im Haus.«
Unwillkürlich schoss Kling seine eigene Zukunft durch den Kopf; in Sekundenbruchteilen lief ein imaginärer Film ab – Zusammenziehen, Heirat, Scheidung, Single, allein im Haus … Cut! Energisch rief er sich zur Ordnung und sagte: »Gut, wir sind in einer halben Stunde bei Ihnen.«
»Aber um Himmels willen nicht in einem Streifenwagen!«
»Die Kriminalpolizei kommt niemals im Streifenwagen«, belehrte ihn Kling. »Und Uniformen tragen wir auch nicht, also keine Sorge.«
Borell nannte seine Adresse, und Kling beendete das Gespräch.
»Wow!«, platzte Özkan heraus, der den Dialog atemlos verfolgt hatte. »Wenn der uns wirklich die Hintermänner liefert … Das würde ja bedeuten …«
»Wir könnten dem K 82 die Lösung auf dem Silbertablett servieren«, nahm Kling ihm die Worte aus dem Mund. »Und wir hätten bei der Staatsanwaltschaft einen Stein im Brett.«
Kling kannte die Staatsanwältin, die mit dem Fall Fromberger befasst war. Melanie Böse. Der Nachname passte überhaupt nicht zu ihr; sie hatte eine gewinnende, freundliche Art, und obendrein sah sie umwerfend aus. Kling war ihr erst einmal begegnet, vor fast zwei Jahren, und sie hatte ihn schwer beeindruckt. Leider war sie schon verheiratet und Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern. Das hatte ihm ein Kollege aus dem Münchner Präsidium verraten. Er hätte sonst womöglich versucht, mit ihr zu flirten, trotz des Altersunterschieds, denn sie war zu jener Zeit bereits Mitte 40 gewesen.
Kling instruierte die Kollegen, den Einsatz vorerst nicht nach München zu melden. Danach verließen die beiden das Büro und stiegen in den Dienstwagen. Özkan nahm hinter dem Steuer Platz. »Das Navi zeigt 22 Minuten an«, sagte er, während der BMW vom Hof fuhr und in die Carl-Fohr-Straße einbog. »Mit Blaulicht wären wir schneller.«
Kling winkte ab. »Nicht nötig, dem K 82 sind wir eh schon um Längen voraus. Sag, was du willst, aber ein bisschen fühlt sich das für mich an, als würde der SV Miesbach gegen den FC Bayern in Führung gehen.«
Im selben Moment fiel ihm siedend heiß ein, dass er dabei war, ein Eigentor zu schießen. Seine Verabredung mit Vroni. Vor Euphorie und Diensteifer hätte er sie um ein Haar vergessen. Das hätte den Haussegen in spürbare Schieflage gebracht, weit mehr, als die jetzt fällige Absage es tun würde. Pläne konnten durchkreuzt werden, deshalb machte Vroni kein Drama daraus. Dass Polizeiarbeit kein Nine-to-five-Job war, verstand sie sehr gut und nahm die Folgen in Kauf.
»Ich muss schnell was regeln«, sagte Kling und suchte nach ihrer Nummer auf dem Handy.
Özkan erriet seine Gedanken. »Deine neue Freundin, oder? Die Vroni.«
»Ja. Zum Glück ist es erst das zweite Mal, dass ich sie versetzen muss. Nächste Woche ziehen wir zusammen, dann wird alles etwas einfacher.«
»Ah ja, das hattest du schon angedeutet. Willkommen im Club!«