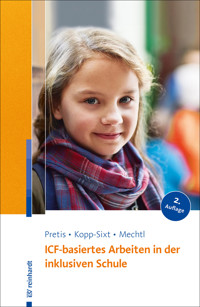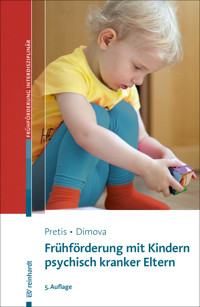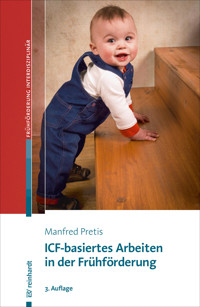27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten sollen in größtmöglichem Umfang an der Gesellschaft teilhaben. Das ist heute Ziel aller Förder- und Therapiemaßnahmen. Das Bundesteilhabegesetz sowie die ICF sehen vor, dass in allen pädagogischen Handlungsfeldern Teilhabeziele für diese Kinder erarbeitet werden. Dafür sollen Fachkräfte gemeinsam mit Eltern in Teilhabezielen denken und handeln. Viele Fachkräfte müssen sich umstellen. Für sie standen bisher oft fachlich begründete Maßnahmen im Vordergrund anstelle der aktiven Perspektive des Kindes. Beispiele zeigen, wie kontextorientierte Teilhabeziele für Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Entwicklungsschwierigkeiten aussehen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Manfred Pretis
Teilhabeziele planen, formulieren und überprüfen
ICF leicht gemacht
2. Auflage
Mit 8 Abbildungen und 26 Tabellen
Ernst Reinhardt Verlag München
Prof. Dr. Manfred Pretis, Heilpädagoge und klinischer Psychologe, lehrt transdisziplinäre Frühförderung an der Medical School Hamburg und ist EU-Projektkoordinator zur Implementierung der ICF in Schulen (www.icf-school.eu) sowie UNICEF Berater.
Im Ernst Reinhardt Verlag ebenfalls erschienen:
Pretis, M: Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis (1. Aufl. 2020; ISBN 978-3-497-02945-7)
Pretis, M.: ICF-basiertes Arbeiten in der Frühförderung (3. Aufl. 2020; ISBN 978-3-497-02999-0)
Brandau, H., Pretis, M., Kaschnitz, W.: ADHS bei Klein- und Vorschulkindern (4. Aufl. 2020; ISBN 978-3-497-02931-0)
Pretis, M., Dimova, A.: Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern (4. Aufl. 2019; ISBN 978-3-497-02866-5)
Pretis, M., Kopp-Sixt, S., Mechtl, R.: ICF-basiertes Arbeiten in der inklusiven Schule (1. Aufl. 2019; ISBN 978-3-497-02805-4)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03156-6 (Print)
ISBN 978-3-497-61614-5 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61615-2 (EPUB)
2. Auflage
© 2022 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i. S. v. § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Printed in EU
Cover unter Verwendung eines Fotos von iStock.com / AleksandarNakic (Agenturfoto. Mit Models gestellt)
Satz: Katharina Ehle, Leipzig
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
1 Was ist Teilhabe?
1.1 Definition
1.2 Eigenschaften der Teilhabe
1.3 Verwandte Begriffe
1.4 Teilhabe als Zielperspektive
1.5 Teilhabe und Aktivitäten
2 Was braucht Teilhabe?
2.1 Die ICF als Hilfsmittel
2.2 Teilhabeziele und die Big 6 der ICF
2.2.1 Teilhabe und Gesundheitssorgen
2.2.2 Teilhabe und personbezogene Aspekte
2.2.3 Teilhabe und Umwelt
2.2.4 Teilhabe und Körperstrukturen
2.2.5 Teilhabe und Körperfunktionen
3 Von der Teilhabe zu Teilhabezielen
3.1 Messen und Bewerten der Teilhabe
3.1.1 Einschätzung mittels WHO-Beurteilungsmerkmalen
3.1.2 Messinstrumente zur Einschätzung von Teilhabe
3.1.3 Beobachten und kommunizieren
3.2 Teilhabeziele formulieren
3.3 Worauf beziehen sich Teilhabeziele?
3.4 Sprachliche Kennzeichen
3.4.1 Menschen als Akteure ihrer Entwicklung
3.4.2 Teilhabe als Aktivität
3.4.3 Teilhabe in konkreten Kontexten
3.4.4 „Absolute“ Teilhabeziele
3.4.5 Zu erreichende Ziele
3.4.6 Teilhabeziele als Leistung (Performanz)
3.4.7 Sinn- bzw. Zweckorientierung
3.4.8 Teilhabe „weiter“ verstanden
3.4.9 Die Anzahl von Teilhabezielen
4 „Teilhabeziele“ nach ICF
4.1 Lernen
4.1.1 Bewusste sinnliche Wahrnehmungen
4.1.2 Elementares Lernen
4.1.3 Wissensanwendung
4.2 Allgemeine Aufgaben und Anforderungen meistern
4.3 Sich verständigen
4.3.1 Kommunizieren als Empfänger
4.3.2 Kommunizieren als Sender
4.3.3 Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken
4.4. Sich fortbewegen
4.4.1 Die Körperposition ändern und aufrechterhalten
4.4.2 Gegenstände tragen, bewegen und handhaben
4.4.3 Gehen und sich fortbewegen
4.4.4 Sich mit Transportmitteln fortbewegen
4.5 Sich selbst versorgen
4.6 Häusliches Leben
4.7 Mit anderen auskommen, miteinander umgehen
4.8 An bedeutenden Lebensbereichen (Bildung, Beruf, am wirtschaftlichen Leben) teilhaben
4.9 Am Gemeinschafts-, sozialen und staatsbürgerlichen Leben teilnehmen
5 Teilhabeziele evaluieren
5.1 Instrumente zur Messung der Zielerreichung
5.1.1 Augenscheinliche Validität
5.1.2 Partizipationstests
5.1.3 Verwendung der WHO-Beurteilungsmerkmale
5.2 Indirekte Messung
5.2.1 Entwicklungstests
5.2.2 Zielerreichungsskalen
5.3 Evaluation mit Eltern und im Team
Literatur
Sachregister
1 Was ist Teilhabe?
1.1 Definition
Der Begriff der Teilhabe ist in hohem Maße mit der ICF, der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (WHO 2001) verbunden. Wenn auch nicht als Zielperspektive ausdrücklich in der ICF formuliert, so zieht sich der Aspekt, dass sich in der Behandlung, Förderung oder Therapie aus der ICF Teilhabeziele ableiten lassen, doch wie ein roter Faden durch dieses grundlegende Werk.
DEFINITION
In der ICF wird Teilhabe als „Einbezogensein in eine Lebenssituation“ definiert (WHO 2011, 16).
Obwohl dieser Satz einfach scheint, fällt es vielen Fachkräften schwer, die praktische Bedeutung dieser Definition zu verstehen beziehungsweise dies im Alltag umzusetzen.
DEFINITION
Aus diesem Grund schlagen Pretis, Kopp-Sixt und Mechtl (2019) vor, im Kinderbereich Teilhabe zu verstehen als all das, was Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsschwierigkeiten in relevanten Lebenszusammenhängen tun können, was auch andere Kinder und Jugendliche ohne Gesundheitsprobleme im Regelfall tun.
Teilhabe orientiert sich somit an
atypischen Entwicklungsanforderungen und Aufgaben eines Kindes oder Jugendlichen in einem gewissen Altersabschnitt: Diese Entwicklungsaufgaben unterliegen in der Regel größeren „Wachstums- und Veränderungsprozessen“ als im Erwachsenenalter.
bder Eingebundenheit in Familiensystemen (WHO 2011) sowie deren kulturellen und sozialen Werten – auch innerhalb der jeweiligen Peergruppen, was als alterstypische Teilhabe wichtig ist.
Deutlich wird bei diesem Definitionsversuch, dass gerade im Kinder- und Jugendalter Teilhabe sehr dynamisch sein kann: Für ein zweijähriges Kind bedeutet es etwas anderes als für einen 14-jährigen Jugendlichen. Teilhabe verweist auch auf einen statistisch normativen Hintergrund, auch wenn dies im Einzelfall hoch individuell zu betrachten ist. Teilhabe zielt im Regelfall darauf ab, was eine gewisse Referenz- oder Vergleichsgruppe an Teilhabeerwartungen oder -leistungen zeigt.
!
Vereinfacht kann davon ausgegangen werden, dass Teilhabe auf all das abzielt, was eine Referenzgruppe oder Altersgruppe in der aktiven Auseinandersetzung mit sozialen Anforderungen tun kann oder tun sollte, um sich als mitgestaltendes Mitglied dieser Gruppe oder Gesellschaft zu erleben.
Teilhabe bedeutet somit, eigene Lebensentwürfe im Vergleich mit Referenzgruppen aktiv mitgestalten zu können, und zwar in dem Ausmaß, in dem dies im Regelfall alle anderen Mitglieder dieser Gruppe tun. Ein- und derselbe Bereich der Teilhabe am sozialen Leben, um ein Beispiel zu nennen, kann somit inhaltlich je nach Lebensalter extrem unterschiedliche Aspekte umfassen. In Tabelle 1 finden sich auch Bezüge zu Gesundheitsproblemen bzw. -sorgen.
!
In Kategorien der Teilhabe zu denken, bedeutet, alterstypische Entwicklungsaufgaben vor dem Hintergrund jeweiliger gesellschaftlicher Werte und individueller Ziele zu reflektieren. Je älter Kinder und Jugendliche werden, desto individualisierter sind auch ihre Teilhabeaspekte.
In der konkreten Arbeit kann es somit wichtig sein, die Kinder und Jugendlichen zu befragen, was sie selbst erreichen wollen beziehungsweise was sie aktiv mitgestalten wollen, und zwar im Vergleich zu ihrer Altersgruppe oder zu ihren persönlichen Werten und Zielen sowie den Erwartungen ihrer Eltern. Bei Kleinkindern werden Teilhabeziele häufig von den Eltern als Wunsch beschrieben, was mit Fördermaßnahmen oder einer Therapie erreicht werden sollte.
Tab. 1: Teilhabe am sozialen Leben nach Lebensalter
Gesundheitssorge
Alter
Möglicher wichtiger Teilhabeaspekt für das Kind bzw. die Familie
Extrem frühgeborenes Kind
2 Monate
Aufwachsen im eigenen Familiensystem (im Vergleich zur Frühgeburtenstation)
Kind mit Down-Syndrom
2 Jahre
Gemeinsam an Familienfesten teilnehmen oder mit den Eltern einen Kirchentag besuchen
Kind mit Autismus
4 Jahre
Mit den Eltern eine Familienfeier in einem Restaurant besuchen
Kind aus Syrien mit Fluchterfahrung
6 Jahre
Mit anderen Kindern in einem Fußballverein Fußball spielen
Jugendliche mit Adipositas
14 Jahre
Gemeinsam mit anderen Gleichaltrigen ein Jugendzentrum besuchen und dort Zeit verbringen
Jugendlicher mit Lernschwäche
18 Jahre
Seiner Wahlpflicht nachkommen
1.2 Eigenschaften der Teilhabe
Generell erscheint der Begriff der „Teilhabe“ im deutschen Sprachraum in der Alltagssprache weniger gebräuchlich als der Begriff der „Partizipation“ im internationalen Kontext. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass im Deutschen „Teilnehmen“ sehr viel häufiger verwendet wird als „Teilhaben“. Letzteres wird unter Umständen auch als veraltet empfunden. Daher ist die Umsetzung im deutschen Sprachraum möglicherweise herausfordernder als anderswo. Gleichzeitig sollte dieser Begriff im Deutschen nicht vorschnell durch das Fremdwort „Partizipation“ ersetzt werden, da zu befürchten ist, dass viele Menschen wenig damit anfangen können. Am ehesten drängt sich noch der Vergleich zum wirtschaftlichen Begriff des „Teilhabers / der Teilhaberin“ auf. Im Geschäftsleben ist ein Teilhaber jene Person, die über einen Teil des Geschäftsvermögens verfügt und somit auch aktiv Geschäftsprozesse mitbestimmen kann.
!
Die aktive Mitgestaltung und Mitbestimmung von Lebenssituationen ist eine zentrale Eigenschaft von Teilhabe.
Kinder, Jugendliche oder Personen mit einem Gesundheitsproblem haben dann an der Gesellschaft teil, wenn sie sich genauso wie andere oder bestmöglich als „Besitzer und Mitgestalter eines Stückes der Gesellschaft und ihrer Prozesse“ verstehen.
!
Förderung, Begleitung, Therapie oder Behandlung zielen darauf ab, größtmögliche Teilhabe zu erreichen.
Teilhabe zeichnet sich dabei sowohl durch individuelle als auch durch gesellschaftliche Erwartungswerte aus (was z. B. ein Kleinkind mitbestimmen darf oder soll), wobei diese Teilhabe mit zunehmendem Alter immer mehr individualisiert wird und somit verstärkt auch zu einem personbezogenen Aspekt wird (siehe 2.2.2). Für viele zwölf Monate alte Kinder stellt es einen wichtigen Teilhabeaspekt dar, frei zu laufen und somit Orte in einem definierten Raum selbst erreichen und Gegenstände handhaben zu können. Bei einem 16-jährigen Jugendlichen besteht dieser Aspekt der Teilhabe an Mobilität möglicherweise darin, einen Führerschein zu besitzen und entfernte Orte selbstständig zu erreichen. Beim Sport als ein Aspekt des Teilhabebereichs der Mobilität mag es für manche wichtig sein, Strecken so schnell wie möglich hinter sich zu legen oder sich mit anderen zu messen. Diese Beispiele verdeutlichen, dass sich die Teilhabewünsche mit zunehmendem Lebensalter sehr viel stärker nach dem Individuum richten können. Gleichzeitig kontrastiert diese Individualisierung auch mit stärker normierten Erwartungen: eine Berufsausbildung abzuschließen, selbstständig für seinen Lebensunterhalt auszukommen, …
Teilhabe wohnt auch ein sozial-politischer Aspekt der Emanzipation inne – bedeutet dies doch auch, relevante gesellschaftliche Prozesse mitbestimmen zu können. Teilhabe befreit somit Menschen (mit und ohne Gesundheitsprobleme) aus erlebter Unmündigkeit, Hilflosigkeit und einem Gefühl des „Ausgeliefert-Seins“.
1.3 Verwandte Begriffe
Teilhabe ist zwar aufgrund des Bundesteilhabegesetzes sozialpolitisch in vieler Munde, trotzdem muss darauf hingewiesen werden, dass das Konzept selbst kaum klar definiert ist. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes wird zwar gefordert, in Kategorien der Teilhabe zu denken oder Teilhabeziele zu formulieren, gleichzeitig stellt das Einschätzen oder Messen, in welchem Ausmaß ein Mensch an gesellschaftlichen Prozessen teilhat oder eben nicht, ein bislang kaum gelöstes Problem dar (Kap. 3.1.2). Dazu kommt, dass „Teilhabe“ im Deutschen in einem sprachlichen Näheverhältnis zur „Teilnahme“ steht. Auch hier ist es schwierig, alltagssprachlich eine klare Trennlinie zu ziehen. Unterscheidbar sind die beiden Begriffe im Grad der Mitgestaltungsmöglichkeit der Person. Evolutionsbiologisch ist der Mensch auf Teilhabe ausgelegt: Mittels seiner Sinnesorgane und seiner effektorischen Systeme (seiner Motorik etc.) ist er so ausgestattet, dass er sich vor jeder Erfahrung mit seiner Umwelt auseinandersetzen und diese aktiv mit gestalten kann, wenn auch mit unterschiedlichen Abstufungsgraden (Tab. 2)
Tab. 2: Stufen der Teilhabe
Aktivität
Teilhabeaspekt
Vom Teilhnehmen zum Teilhaben
Musik hören, die in einer gewissen Alters- und Kulturgruppe als modern gilt
Sich zugehörig fühlen
Ein Konzert einer Musikgruppe besuchen
Etwas gemeinsam erleben
An einem Workshop oder einer Konferenz über eine Musikrichtung oder -gruppe teilnehmen
Sich am Diskurs beteiligen, sich einbringen
Selbst ein Instrument spielen oder in einer Band mitspielen
Aktiv zur Musikszene beitragen
Das in Tabelle 2 gezeigte Beispiel verdeutlicht auch, dass es keine richtige oder falsche Teilhabe gibt. Die vier Szenarien spiegeln jeweils unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten wider. Teilhabe sollte somit auf einem Kontinuum gesehen werden, wobei als Ziel selbstbestimmten Lebens je nach Interessenslage durchaus versucht werden sollte, ein höchstmögliches Maß der altersabhängigen Mitgestaltung (Tab. 3) zu erreichen.
Tab. 3: Stufen bzw. Aspekte der Teilhabe beim gemeinsamen Essen bzw. bei der Zubereitung
Lebens- bzw. Entwicklungsalter
Aktivität
Teilhabeaspekt
2-jähriges Kind
Gemeinsam mit seinen Eltern bei Tisch sitzen und essen
Rituale kennen und umsetzen
3-jähriges Kind
Den Eltern helfen, den Tisch zu decken
Teilhabe im Haushalt
4-jähriges Kind
Gemeinsam mit den Eltern Zutaten vorbereiten (z. B. Obst schneiden)
Teilhabe in der Selbstversorgung
5-jähriges Kind
Gemeinsam eine Mahlzeit planen
Teilhabe beim Lernen (Planungsprozesse)
Wenn es für eine Familie schwierig ist, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Tisch zu treffen und gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen, kann der erste Schritt in Richtung Teilhabe darin bestehen, dass sich die Familie (als Ritual) wenigstens einmal am Tag am Tisch trifft, um gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen. Ein höherer Teilhabelevel könnte für eine andere Familie darin bestehen, dass die Familienmitglieder in die Essensvorbereitung eingebunden sind. Das Formulieren eines jeweiligen Teilhabeziels hängt somit in hohem Maße vom jeweiligen Ausgangspunkt, der Baseline, ab.
!
Die individuellen Fähigkeiten eines Kindes oder einer Familie sowie deren Interessen und Werte spielen in der Teilhabeplanung eine zentrale Rolle: Eltern können in Bezug auf die Erreichung von Teilhabezielen nur das tun, was sie tun können.
1.4 Teilhabe als Zielperspektive
Trotz der teilweise konzeptionellen Unschärfe des Begriffs und der für Fachkräfte damit verbundenen Unsicherheiten, was genau damit gemeint ist, lässt sich Teilhabe als zweckorientierte oder finale Perspektive verstehen. Praktisch mag dabei hilfreich sein, für ein Kind, eine Familie oder einen Jugendlichen „zweckgerichtet“ zu denken. Sprachlich kann dies in einem sogenannten Zweck- oder Finalsatz erfolgen „damit / sodass“ oder „um zu …“. Eine Fördermaßnahme für Paul (um personbezogen einem Kind einen Namen zu geben) verfolgt immer einen bestimmten teilhabeorientierten Zweck, z. B.:
■„um zu Hause selbstständig Spielmaterialien zu erreichen“
■„damit er in der Kita selbstständig den Löffel zum Mund führt und somit selbstständig isst“
■„sodass er mit anderen Kitakindern am Spielplatz unterschiedliche Gemeinschaftsspiele spielt“
■„um alle Familienmitglieder kennenzulernen“
■„damit er in Stresssituationen sein Verhalten kontrolliert und von anderen Kindern als Spielkamerad akzeptiert wird“
Diese Finalsätze spiegeln in hohem Maße altersabhängige Teilhabeperspektiven wider. Für medizinisch-therapeutische Dienste zeichnet sich dabei ein Paradigmenwechsel ab: Es geht nicht primär um die Behandlung von Störungen oder Symptomen, sondern um die darüber hinausgehenden sinnhaften Ziel- und Zweckperspektiven, was ein Kind nach seiner Therapie in relevanten Lebenskontexten im Vergleich zu anderen Kindern ohne Gesundheitsproblem tun kann. Diese gesundheitlichen Probleme können dabei unterschiedlich sein (Tab. 4).
Tab. 4: Zusammenhang zwischen Gesundheitsproblemen und Teilhabe
ICD-10-Diagnose
Gesundheitsproblem
Teilhabeaspekt
Struktureller Aspekt
Funktionaler Aspekt
Persönlicher Aspekt
Karies
K02
Zerstörung des Zahnschmelzes
Schmerz
Hohe Schmerzempfindlichkeit
Sodass ich wieder Warmes und Kaltes essen kann
G81
Kontraktur der Wadenmuskulatur rechts
Spitzfuß
Ich tanze gerne
Sodass ich mich wieder im Rhythmus der Musik mit den anderen bewegen kann
H33
Netzhautablösung
Einschränkungen im Sichtfeld
Großes Interesse an Büchern
Sodass ich im Kaffeehaus die Tageszeitung selbstständig lesen kann
!
Teilhabe schließt immer strukturelle, funktionale oder umweltorientierte Aspekte ein. Teilhabe verleiht den jeweiligen Interventionen die eigentliche Sinnperspektive, zu welchem Zweck etwas verändert werden soll.
1.5 Teilhabe und Aktivitäten
Eine eindeutige Unterscheidung zwischen „Teilhabe“ und „Aktivitäten“ ist schwierig, da im Regelfall jegliche Teilhabe durch Einzelaktivitäten zustande kommt. Teilhabe ohne zugrunde liegende Aktivitäten ist im Regelfall nicht oder kaum denkbar. Selbst die ICF benutzt beide Begriffe fast synonym, indem sie im Regelfall von „Aktivitäten“ und „Partizipation“ spricht. Teilhabe kennzeichnet dabei die (personzentrierte) sinnhafte Perspektive in einem konkreten Kontext. Einzelne Aktivitäten sind Einzelschritte, die zu einer solchen Teilhabeperspektive führen. Das selbstständige Essen des Frühstücksbrots in der Kita (als Teilhabe in der Selbstversorgung) kann beispielhaft auf Aktivitäten „heruntergebrochen“ werden:
■sich diejenigen Nahrungsmittel aussuchen, die schmecken (Aktivität 1)
■sich Nahrungsmittel auf einen Teller legen (Aktivität 2)
■eine Gabel oder einen Löffel handhaben (Aktivität 3)
■diesen zum Mund führen (Aktivität 4)
■kauen (Aktivität 5)
■schlucken (Aktivität 6) usw.
All diese Einzelaktivitäten zusammen ergänzen sich zum Teilhabeaspekt „selbstständig das Frühstücksbrot in der Kita einnehmen“.
!
Teilhabe funktioniert also nicht ohne Aktivitäten. Die einzelnen Aktivitäten repräsentieren im Regelfall Einzelaspekte einer Teilhabeperspektive. Häufig sind dabei Aktivitätshierarchien zu beobachten, die in ihrer Gesamtheit Teilhabe ergeben.
Eine solche Hierarchie von Aktivitäten wird in weiterer Folge wichtig sein, vor allem wenn es um das Verhältnis zwischen Teilhabezielen und smarten Zielen geht (Kap. 3.4). Smarte Ziele bezeichnen dabei jene Aktivitäten, die ein Kind oder ein Jugendlicher am Ende eines definierten Förder- oder Therapiezeitraumes durchführt (Pretis 2020b, 153 f.). Das Akronym „SMART“ bedeutet, dass Zieleformulierungen folgende Eigenschaften aufweisen sollen:
■spezifisch (d. h. detailliert)
■messbar
■attraktiv, aktivierend oder im Rahmen des Wertesystems einer Familie akzeptabel
■realistisch und
■terminierbar (d. h. mit einem definierten Zeithorizont)
Einige der oben beschriebenen vorbereitenden Aktivitäten können bereits smarte Ziele darstellen.
!
Teilhabe und Aktivitäten widersprechen einander nicht: Teilhabe repräsentiert im Regelfall die Gesamtheit der (koordinierten) Aktivitäten in einem jeweiligen Kontext.
Gerade bei Kindern erscheint es somit hochgradig unwahrscheinlich, reine Einzelaktivitäten „üben“ zu wollen, da sie im Normalfall an sinnhafter Teilhabe interessiert sind und nicht am Wiederholen einzelner Aktivitätsschritte. Ein solches Üben einzelner Bewegungsabläufe oder Aktivitäten kann bei erwachsenen Menschen (z. B. nach einem Schlaganfall) durchaus zielführend sein, da erwachsene Patienten im Regelfall die Sinnhaftigkeit solcher Übungen einsehen. Bei Vorschulkindern ist diese Fähigkeit der Einsicht jedoch reduziert. Es muss vielmehr versucht werden, Aktivitäten in sinnhafte Kontexte zu integrieren. Es mag in einer Förderstunde sinnvoll sein, die Einzelaktivität des „Auffädelns von Perlen“ gemeinsam mit dem Kind durchzuführen, gleichzeitig wird der Therapeut aber auch versuchen, einen sinnhaften Zusammenhang herzustellen, indem die Kette z. B. für ein Fest als Schmuck oder als Geschenk für ein Familienmitglied hergestellt wird. Das Herstellen einer Kette betrifft dann den Teilhabeaspekt der „Beziehungsgestaltung zu engsten Familienmitgliedern“. Genauso mag es in einzelnen Förderstunden angebracht sein, am „Lernbären“ Knöpfe in Löcher zu stecken. Im Regelfall geht es aber nicht um das reine Auf- und Zuknöpfen, sondern um die Teilhabe an der Selbstversorgung durch selbstständiges An- und Ausziehen (z. B. in der Kita).
!
Teilhabe spiegelt sich im Regelfall durch koordinierte einzelne Aktivitäten wider, lässt sich jedoch nicht auf diese Aktivitäten reduzieren, da sich Teilhabe auf den übergeordneten Sinn und Zweck in einer Situation bezieht.
Um ein drastisches Beispiel zu nennen: Der Teilhabeaspekt „selbstständig zu Hause am Tisch essen“ benötigt zwar die koordinierte Bewegung einer Hand und eines Armes sowie Auge-Hand-Koordination, um den Löffel zum Mund zu führen. Das alleinige Führen des Löffels zum Mund spiegelt jedoch noch kein „Essen“ wider. Nur bei der Formulierung hierarchischer smarter Ziele kann es sinnvoll sein, Zwischenschritte auf Aktivitäten herunterzubrechen.
2 Was braucht Teilhabe?
2.1 Die ICF als Hilfsmittel
Der Begriff der Teilhabe ist beinahe untrennbar mit der ICF verbunden. In diesem Klassifikationssystem stellt Teilhabe / Partizipation eine relevante Gesundheitskomponente dar. Dies fußt auf Vorläufermodellen (WHO 1980), die erstmals in den 1980er Jahren darauf verwiesen, dass Behinderung vor allem ein soziales Konstrukt darstellt (als Ausgeschlossensein von gesellschaftlicher Teilhabe). Bei älteren WHO-Klassifikationssystemen, wie der ICD-10 (WHO 2015), der Klassifikation gesundheitlicher Störungen, taucht dieser Mitgestaltungsaspekt an sozialen Wirklichkeiten kaum auf. Das Formulieren von Teilhabezielen ist ursprünglich auch in der ICF nicht explizit erwähnt. Wie bei Pretis, Kopp-Sixt und Mechtl (2019) bereits diskutiert, scheint die WHO-Grafik somit in der Zielperspektive jeglicher Intervention unvollständig. Wenn Teilhabe die Hauptzielkategorie von Fördermaßnahmen für Menschen mit einem Gesundheitsproblem darstellt, dann müssten sich aus den Wechselwirkungen der einzelnen Gesundheitskomponenten bzw. resultierenden Teilhabebeeinträchtigungen logischerweise Teilhabeziele ergeben. Abbildung 1 bildet diese Schlussfolgerung als Ergänzung der WHO-Grafik ab.
Um in diesen Zielperspektiven zu denken und zu handeln, darf nicht übersehen werden, dass Teilhabe nur einen Aspekt der Hinwendung zu Menschen mit einem Gesundheitsproblem darstellt und dass die fünf weiteren relevanten Aspekte nicht vernachlässigt werden dürfen. Die Reihenfolge der Auseinandersetzung (womit im Gespräch mit den Eltern beginnen?) ist grundsätzlich frei wählbar. Meist wird der Ausgangspunkt, von dem aus sich Fachkräfte gemeinsam mit den Eltern mit der ICF auseinandersetzen, das Gesundheitsproblem des Kindes sein, da dieses meist der Auslöser ist, warum sich Eltern überhaupt an Fachkräfte wenden.
2.2 Teilhabeziele und die Big 6 der ICF
Als die BIG 6 der ICF (Abb. 1), teilweise auch als Big 5 (unter Weglassen der Gesundheitssorge oder Diagnose) bezeichnet, werden jene Gesundheitskomponenten beschrieben, die in der Selbstbefähigung von Menschen (mit einem Gesundheitsproblem) eine relevante Rolle spielen (Pretis et al. 2019). Zwischen diesen Gesundheitskomponenten sind dabei, wie in Abbildung 1 dargestellt, unzählige Wechselwirkungen zu beobachten, repräsentiert durch die Pfeile in beide Richtungen.
Abb. 1: WHO-Grafik ergänzt durch Teilhabeziele (Pretis 2020a, 154)
2.2.1 Teilhabe und Gesundheitssorgen
Wenn im Folgenden von Teilhabebeeinträchtigungen und relevanten Teilhabezielen die Rede ist, beziehen sich diese Ziele in der Regel auf Gesundheitsprobleme oder auf bestehende Diagnosen. Das können beispielsweise von den Eltern erlebte Auffälligkeiten oder Sorgen sein: „Unser vierjähriger Sohn spricht zu Hause noch nicht.“ Das kann auch Diagnosen betreffen wie z. B. Q87, das Prader-Willi-Syndrom (sonstige angeborene Fehlbildungssyndrome) oder Sorgen von Fachkräften, z. B. von der Kita-Erzieherin, dass der Junge in der Kita so unaufmerksam wirkt. Werden in weiterer Folge Teilhabeziele für ein Kind formuliert, so sollte ein logischer Zusammenhang mit der Gesundheitssorge bestehen. Die Gesundheitssorge der Kita-Erzieherin (hier: die Aufmerksamkeitsspanne des Kindes) hängt somit logisch mit einem möglichen Teilhabeziel in der Kita (z. B. Einzelaufgaben abzuschließen) zusammen. Wenn die Diagnose F80 (umschriebene Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache) vorliegt, so liegt der Fokus der Teilhabe auf der Kommunikation. Wenn die Diagnose Prader-Willi-Syndrom lautet, kann ein Fokus auf dem Teilhabeaspekt Selbstversorgung, im Speziellen „Essen“, und auf dem „Lernen“ liegen, da bei Kindern mit Prader-Willi-Syndrom beides potenzielle Gesundheitssorgen darstellen, die aus der Diagnose resultieren. Diese logischen Zusammenhänge verweisen darauf, dass bei der Erstellung von Teilhabezielen zwar die hochindividuelle Situation eines Kindes oder eines Jugendlichen mit Entwicklungsschwierigkeiten sprachlich zu berücksichtigen ist, dass aber die Gesundheitssorge oder Diagnose genauso in logischem Einklang mit erwarteten Teilhabebeeinträchtigungen stehen sollten. Denn Diagnosen oder Gesundheitssorgen der Eltern geben in der Regel auch eine (evidenzbasierte) Richtung der Intervention vor.
!
Das Berücksichtigen von Gesundheitssorgen bei der Formulierung von Teilhabezielen hebt die Wahrscheinlichkeit, evidenzorientierte Strategien zu finden und den Behandlungserfolg zu heben.