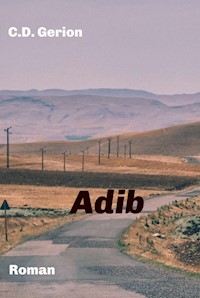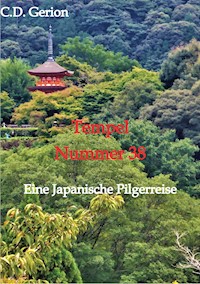
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Reiseabenteuer vor dem Hintergrund einer tragischen Familiengeschichte. Thomas, durch eine Tropenkrankheit aus seiner beruflichen Routine als Diplomat im Auslandseinsatz gerissen, wagt sich mit seinem Sohn Daniel auf eine nostalgische Pilgerreise auf der Route der 88 Tempel von Shikoku (Japan). Er hofft, so die über die Jahre gewachsene Entfremdung zwischen ihnen zu überwinden. Auf dieser Reise finden Vater und Sohn Schritt für Schritt wieder zueinander, so dass Thomas schließlich auch den Mut findet, seinem Sohn die wahren Hintergründe ihrer tragischen Familiengeschichte zu enthüllen. Eine Geschichte, die die Leser alle Höhen und Tiefen einer abenteuerlichen Reise durch ein faszinierendes Land durchleben und sie tief in die geheimnisvolle Welt des japanischen Buddhismus eintauchen lässt. Eine Geschichte um Liebe und Lebenslügen, um Schicksal und Schuld, in deren Verlauf sich alle Gewissheiten auflösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
C.D. Gerion
Tempel Nummer 38
Eine japanische Pilgerreise
© 2022 C.D. Gerion
Umschlagfoto: C.D. Gerion
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-51168-2
Hardcover
978-3-347-51169-9
e-Book
978-3-347-51170-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
‚Dogyo ninin‘ – Auf dem Weg ist man immer zu zweit.
(Leitspruch der Shikoku-Pilger)
14. Mai, Kap Ashizuri
Beinahe wäre ich in diesen viel zu großen Latschen gestolpert. Daniels verzweifeltes „Dad!“ hallt noch in meinem Kopf nach. Krampfhaft versuche ich mit beiden Händen, den Hotel-Yukata1) unten zusammenzuhalten, damit man mir nicht in den Schritt sehen kann. Drunter habe ich ja nichts an. Den schmalen Gürtel habe ich in der Eile völlig unjapanisch hoch vor dem Bauch verknotet. Wenn ich mir vorstelle, die hätten mir auch noch Handschellen angelegt …
Alle, die uns auf dem Gang entgegenkommen, starren mich an wie ein Gespenst. Hinter uns wird getuschelt. Ich verstehe immer nur „Gaijin…“ Die beiden Gören, die uns vom Fahrstuhl her entgegenkommen und sich nun an uns vorbeidrücken, kichern sogar hemmungslos, wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Aber wer könnte ihnen das auch verdenken. Es muss ja wirklich grotesk aussehen, wie ich hier in meinem lächerlichen Aufzug zwischen den zwei stramm Uniformierten voranstolpere.
Die beiden Polizisten sind sich meiner so sicher, die fassen mich nicht einmal an. Es reicht ihnen offenbar, mich zwischen sich zu wissen, während sie schweigend den unendlich langen Korridor hinuntermarschieren. Wie sollte ich ihnen hier auch entkommen können. Möglicherweise hat man vor den Notausgängen auf diesem Stock und unten in der Lobby auch noch weitere Polizeibeamte postiert. Immerhin hat es, wie mir der ältere und kräftigere meiner beiden Begleiter – der mit der Haltung und den markanten Gesichtszügen eines kampferprobten Samurai – mit unbewegter Miene verkündet hat, einen Toten gegeben. Nur habe ich selber nicht die geringste Ahnung, was das mit mir zu tun haben soll …
Vor dem Fahrstuhl warten zwei nicht mehr ganz junge japanische Damen – Damen, so sichtlich teuer und unfehlbar stilsicher gekleidet, wie man sie in Tokio bei klassischen Konzerten in der Suntory Hall oder auf Botschaftsempfängen trifft. Sie scheinen mich nicht einmal wahrzunehmen, treten nur dezent zur Seite, bis ich mit meinen Begleitern im Fahrstuhl verschwunden bin.
Angekommen im obersten Stock bittet mich der Samurai schon einmal in den großen Lesesaal mit den Panoramafenstern vorauszugehen. Ganz nach hinten durch, bis zu der offenbar extra für die bevorstehende ‚Befragung‘ hergerichteten Sitzecke mit den zwei Sesseln und dem niedrigen Tischchen dazwischen. Ich bekomme gerade noch mit, wie ihm sein Kollege einen Umschlag überreicht und ihm dazu irgendetwas erklärt.
Zwei ältere Herren in korrekt sitzenden Yukata haben es sich hier in den vor der Fensterfront stehenden Sesseln bequem gemacht, mit dem Rücken zur Aussicht auf den Ort und das in der Morgensonne glitzernde Meer. Sie sind vollkommen in ihre Zeitungslektüre vertieft und schenken mir keine Beachtung.
Ich setzte mich ebenfalls mit dem Rücken zum Fenster. Taktisch ist es sicher geschickter, wenn ich bei dem kommenden 'Verhör' – oder was immer das hier werden soll – mein Gegenüber gut ausgeleuchtet im Blick habe.
„We need to know the truth“, hat der Samurai gesagt, bevor sie mich mitgenommen haben. Oder hat er „facts“ gesagt? Wahrheit oder Fakten, macht das überhaupt einen Unterschied? Wie hat Daniel doch vorgestern Abend so treffend gesagt, nachdem ich ihm alles gebeichtet hatte: Man kann ja meist nicht einmal sagen, wo so eine Kausalkette letztendlich ihren Anfang genommen hat …
Aber um was für eine Wahrheit geht es hier überhaupt? Erst jetzt fällt mir auf, dass die beiden Polizeibeamten mich gar nicht belehrt haben, wie es sicher auch hier bei der Verhaftung eines Verdächtigen Vorschrift ist. Auch wenn ich in der ersten Minute, nachdem sie zu uns ins Zimmer gestürmt waren, noch nicht so ganz wach war – dass alles, was ich von jetzt an sage, gegen mich verwandt werden kann, hat mit Sicherheit keiner von beiden gesagt. Vielleicht ist die Lage ja doch nicht so ernst, wie es schien. So oder so wird es sicher das Klügste sein, wenn ich gleich von Anfang an in die Offensive gehe.
Sobald der Chefinspektor mir gegenüber Platz genommen hat – in dem hellen Licht, das durch die schrägen Panoramafenster hereinströmt, wirkt sein Gesicht noch maskenhafter als vorher – lege ich los, ihm meine Sicht der Dinge vorzutragen. Er aber unterbricht mich schon nach dem ersten Satz. Immerhin beginnt er mit einer japanisch-höflichen Entschuldigung dafür, dass man sich gezwungen gesehen habe, uns so früh am Morgen in unserem Hotelzimmer zu überfallen. Sein unergründliches Samurai-Lächeln lässt aber keinen Schluss darauf zu, wie aufrichtig diese Worte gemeint sind.
Dass die Lage wohl doch ernst ist, sehe ich, als er mir nach einigen weiteren kurzen Erklärungen einen weißen Briefumschlag über den Tisch schiebt, ganz offensichtlich der Umschlag, den ihm sein jüngerer Kollege draußen vor dem Lesesaal überreicht hat. Mir wird ganz heiß, als ich lese, was in großen Druckbuchstaben darauf geschrieben steht:
Mr. Gerion, Pilgrim from Germany – darunter noch eine kurze Botschaft auf Deutsch.
Ja, dieser Brief ist tatsächlich an mich gerichtet!
In was bin ich da, um Himmels Willen, hineingeraten?
1) Erklärung japanischer Wörter und buddhistischer Fachbegriffe im Anhang
20. April, Düsseldorf
„Finde ich toll, dass ihr auf diese Weise versuchen wollt, euch auszusöhnen.“ Ich stehe etwas abseits, aber das habe ich trotzdem gehört.
„Wir müssen“, sagt Daniel. Er befreit sich aus der Umarmung seiner Freundin, dann spurten wir los. Erst als wir uns in die Schlange vor der Sicherheitskontrolle eingereiht haben, kommen wir wieder zu Atem. Wenigstens sind hier in Düsseldorf die Wege und die Warteschlangen nicht ganz so lang wie in Frankfurt.
„Hilf mir mal mit dem Rucksack.“ Ich bin froh, das schwere Ding erst mal vom Rücken herunterzubekommen. Ich schwitze. „Ich hasse diese ewige Fliegerei“, sage ich.
„Wenn ich mich recht erinnere, war das hier deine Idee“, sagt Daniel. Immerhin grinst er.
„Wie hat sie das eigentlich gemeint?“
„Wer?“
„Deine Freundin. Das mit dem Aussöhnen. Gut, wir haben vielleicht kein besonders enges Verhältnis, aber ich wüsste nicht, dass wir Streit miteinander hätten.“
„Na, wie auch – wenn man sich höchstens einmal im Jahr sieht.“
Die Schlange hat sich ein ganzes Stück vorwärtsbewegt. Ich kicke den Rucksack mit dem Fuß weiter. „In meinem Job kann man nun mal nicht einfach so auf die Schnelle für ein paar Tage nach Deutschland fliegen, weil der Herr Sohn zufällig gerade mal Zeit hat. Als ich das letzte Mal für volle zehn Tage hier war, musstest du ja gerade zum Surfen nach Portugal.“
„Schon gut. Vor drei Jahren, als ich fast eine Woche lang bei dir in Kanton war, haben wir auch nicht gerade ein engeres Verhältnis entwickelt. Aber okay. Vielleicht wird ja ab jetzt alles anders.“
„Werde mir Mühe geben. Ich wusste ja nicht mal, dass du inzwischen eine feste Beziehung hast. War mir ein bisschen peinlich, dass ich nicht mal ihren Namen kannte.“
„Muss dir nicht peinlich sein. Wusste selber nicht, dass sie extra zum Flughafen rauskommen wollte, um mich zu verabschieden. Ehrlich gesagt habe ich auch deshalb ja zu diesem Trip gesagt, um da etwas Abstand zu gewinnen.“
„Anscheinend ist diese Reise für uns beide eine Gelegenheit, das ein oder andere abzuklären.“ Schon wieder hat sich die Schlange weiterbewegt. Hätte den Rucksack vielleicht doch aufbehalten sollen. „So oder so finde ich es toll, dass du dich doch noch entschieden hast, mitzukommen.“
*
Damit hatte ich eigentlich schon gar nicht mehr gerechnet. Daniels erste Reaktion, als ich ihn vor zehn Tagen angerufen habe: „Achtundachtzig Tempel? Siebenhundert Kilometer pilgern? Wie abgefahren ist das denn? Willst du jetzt etwa den Hape spielen?“
„Den was?“
„Sag bloß, du kennst Hape Kerkeling nicht? Der hat doch dieses Buch über seine Pilgerreise geschrieben.“
„Der war auch in Japan?“
„Quatsch. Der ist den Jakobsweg in Spanien abgelaufen. Du kennst also tatsächlich einen der beliebtesten deutschen Fernsehkomiker nicht?“
„Vergiss nicht, ich habe die letzten acht Jahre im Ausland verbracht. Und in den Jahren davor ist mir auch nicht gerade nach deutschen Fernsehkomikern zumute gewesen …“
Daraufhin hat mein Sohn nur noch irgendetwas Unverständliches gegrummelt. Ich glaube, was ihn am Ende dazu gebracht hat, sich tatsächlich auf das Abenteuer einer dreiwöchigen gemeinsamen Wanderung mit seinem Vater einzulassen, war die Aussicht auf eine Japanreise, die er sich zurzeit finanziell gar nicht leisten könnte. Das hat er in diesem Telefongespräch ja auch selber durchblicken lassen.
„Warum plötzlich so ein großzügiges Angebot?“, hat er gefragt.
„Na, immerhin bist du mein Sohn.“
„Das zumindest kann ich nicht leugnen. Nehme an, du hast sogar irgendwo noch eine beglaubigte Kopie meiner Geburtsurkunde.“ Mit einem knappen „Na ja, kannst mir ja mal eine Mail mit den Details schicken“, hat er unser Gespräch beendet. Nach sechs Tagen Funkstille dann seine knappe WhatsApp-Nachricht: „Okay, bin dabei. Könnte dir übrigens vorab auch SIM-Karte für Japan besorgen – es sei denn, du hast ein SIM-Lock-Handy.“
*
Inzwischen sind wir am Gate angelangt. Boarding um neunzehn Uhr zwanzig – also frühestens in einer Dreiviertelstunde. Es sind gerade noch zwei Plätze nebeneinander frei. Ich setze mich, und Daniel lässt sich in den Sitz neben mir fallen. Die junge Frau gegenüber sieht von ihrem Handy auf. Sie mustert uns auffällig. Daniel vor allem. Der Junge ist größer und kräftiger ist als ich. Das volle, dunkelblonde Haar hat er von seiner Mutter. Dazu die auffallend blauen Augen, die sensiblen Lippen und das kleine Grübchen am Kinn. Frauen finden ihn sicher gutaussehend. Jetzt, wo wir nebeneinandersitzen, sieht man ihm wohl trotz meiner Glatze auch an, dass er mein Sohn ist. In meine Rolle als stolzer Vater werde ich mich aber wohl erst wieder hineinfinden müssen. Bis zu vier Wochen werden wir jetzt ständig eng beieinander sein. Auf einmal kommen mir Zweifel, ob das hier nicht doch allzu ehrgeizig ist …
*
Ich habe meinem Sohn die Bordkarte für den Fensterplatz überlassen, aber als wir unsere Sitzreihe erreichen, lässt er mich großzügig vor. Als uns die junge Japanerin bemerkt, springt sie sofort von ihrem Gangplatz auf, um uns durchzulassen. Sieht echt nett aus, die Kleine. Daniel hat seinen Sitzgurt noch nicht geschlossen, da fängt er schon eine Konversation mit ihr an. So erfahre auch ich, dass sie Violine an der Musikhochschule in Köln studiert hat, dass sie gerade ihre Abschlussprüfung bestanden hat und dass sie jetzt erst mal nach Tokio zurückkehrt, wo man ihr eine Stelle in einem Orchester angeboten hat. Außerdem liebt sie Deutschland und hofft, bald wieder zurückzukommen, denn sie träumt davon, eines Tages in einem unserer berühmten Orchester zu spielen … Mein Sohn ist ein hartnäckiger Frager. Das scheint seine Sitznachbarin aber überhaupt nicht zu stören. Ihr Deutsch ist erstaunlich gut.
Zwanzig Uhr dreißig. Mit einer halben Stunde Verspätung setzt sich der Flieger in Bewegung.
21. April, Tokio
Der Flughafenbus nach Shinagawa steht schon da, als wir aus der Ankunftshalle ins Freie kommen. Ich sprinte zum Ticket-Automaten hinüber. „Beeil dich“, rufe ich Daniel zu. Mein Sohn und die kleine Japanerin müssen ja unbedingt noch ihre E-Mail-Adressen austauschen … Zum Glück bemerkt der Busfahrer mein Winken und wartet noch, wobei er uns schon seine Hände in den blütenweißen Handschuhen entgegenstreckt, um uns unsere Rucksäcke abzunehmen. Kaum hat er die im Gepäckfach unter dem Bus verstaut, wirft er mit der einen Hand die Klappe zu und winkt mit der anderen, dass wir einsteigen sollen. Zwei Minuten später sind wir schon auf dem Expressway.
Zuerst geht es noch durch ländliche Gegenden – beiderseits Kiefernhaine, Reisfelder, einzelne oder zu kleinen Siedlungen zusammengedrängte Häuser, mit blauen, in der Mittagssonne glänzenden Ziegeldächern.
„Ist es nicht schön, dieses ländliche Japan?“, sage ich. Der Junge reagiert überhaupt nicht. Er scheint mit seinen Gedanken ganz woanders zu sein. Und hin und wieder so ein seltsam versonnenes Lächeln. Das kenne ich gar nicht an ihm – aber wir haben uns in den letzten Jahren auch selten gesehen. Vielleicht ist er ja auch einfach nur müde …
Erst auf dem letzten Teil der Strecke die Tokio Bay entlang beginnt auch Daniel mit sichtbarem Interesse aus dem Fenster zu blicken, hinunter auf das chaotische Durcheinander, über das sich die Wangan Route hier hinwegschwingt: Eine Aneinanderreihung künstlich aufgeschütteter Inseln, auf denen sich in bunter Mischung und dicht gedrängt Fabriken, Lagerhallen, von riesigen Auffangnetzen überwölbte Golfabschlagplätze, ein Park mit einem Riesenrad mittendrin, ein Museum, ein Stahlwerk, Kaianlagen, fußballfeldgroße Lager mit importierten Baumstämmen, Ausstellungshallen und riesige Containerlager ausbreiten – und jetzt auch noch das futuristische Gebäude eines bekannten TV-Senders.
Wir haben gerade die Auffahrt zur Rainbow Bridge erreicht. Plötzlich zeigt Daniel nach unten. „Da ist ja ein richtiger Sandstrand!“, ruft er. Ich beuge mich über ihn, um hinuntersehen zu können. Tatsächlich, ein langgezogener heller Sandstrand, zur Landseite hin begleitet von einem grünen Band aus dicht belaubten Büschen und Bäumen. Dieser schmale Streifen künstlich geschaffener Natur bildet den abschließenden Saum des streng geordneten Chaos auf der unter uns liegenden aufgeschütteten Insel. Aber ein Strand direkt an einer vielbefahrenden Durchfahrt in einen weiteren Teil des riesigen Tokioter Hafens?
„Aber baden würde ich da nicht wollen“, sage ich.
„Hast du inzwischen überhaupt mal wieder einen richtigen Strandurlaub gemacht?“ Natürlich denkt der Junge dabei an Sri Lanka.
„Nein“, sage ich – „kannst dir ja denken, warum. Übrigens, erinnerst du dich noch an unsere Überfahrt mit der Fähre nach Nachi-Katsuura, wo wir in diesen Sturm geraten sind? Da ganz hinten, auf der Rückseite dieser Insel, liegt das Ferry Terminal, von dem aus wir damals losgefahren sind.“
„Als ob ich das jemals vergessen könnte. Vor allem den Abend nach unserer Ankunft, als der Taifun so stark wurde, dass plötzlich die Wellen in die Höhle hineinschlugen, in der wir uns gerade in dem großen Thermalbecken niedergelassen hatten …“
Wir blicken beide aus dem Fenster. Von hier aus, kurz vor dem höchsten Punkt der Rainbow Bridge, hat man einen besonders weiten Blick über diese sich ins Unendliche dehnende Stadt, diesen einzigartigen, sinnenverwirrenden Mischmasch aus Kaiserresidenz, Megacity und Dorf. Uns ist aber beiden erst mal nicht mehr nach reden zumute.
*
Der Busfahrer greift mit seiner weißbehandschuhten Hand unter den vielen Dutzend Gepäckstücken im Laderaum zielsicher all diejenigen heraus, deren Besitzer ihr Ticket bis hierher gelöst haben. In dem Moment, als er meinen Rucksack ans Tageslicht zieht, sehe ich, dass vor dem Hoteleingang gerade ein Taxi frei wird. Schnell strecke ich dem Fahrer meinen Kontrollschein hin und schnappe mir das gute Stück.
„Komm, beeil΄ dich“, rufe ich Daniel zu.
„Ich dachte, wir übernachten in diesem Hotel?“, ruft er hinter mir her.
„Nur noch ein kurzes Stück mit dem Taxi“, sage ich zu ihm, als er neben mir steht, und „mō ii des'“ – schon gut – zu dem Taxifahrer, der mir den Rucksack abnehmen will, um ihn im Kofferraum zu verstauen.
„Ich hoffe, du hast nicht auch hier in Tokio schon irgend so eine rustikale Tempelherberge gebucht“, sagt Daniel, als wir uns beide zusammen mit unseren Rucksäcken auf den Rücksitz quetschen.
„Du hast mir doch ausdrücklich freie Hand gelassen, was unsere Reiseplanung betrifft“, sage ich und grinse ihn an. „Lass dich überraschen.“ Dem Fahrer rufe ich zu, „Meguro, Yūtenji.“
„Nihongo jōzu des' nee“, sagt der und legt den Gang ein.
„Iie, iie“, bestreite ich seine Behauptung, mein Japanisch wäre hervorragend.
*
Das kleine familiäre Hotel liegt unweit der belebten Komazawa-Dōri in einem ruhigen Wohnviertel mit überwiegend niedrigen Häusern und beinahe dörflicher Atmosphäre, wie sie für das Tokio abseits der Hochhausviertel und der großen Durchgangsstraßen typisch sind. Unsere Zimmer liegen nebeneinander, ganz oben im dritten Stock.
„Schlage vor, wir legen uns erst mal ein bisschen aufs Ohr“, sage ich. Daniel nickt. „Wir sollten allerdings gegen Abend noch mal rausgehen und irgendwo was essen. Sonst wachen wir mitten in der Nacht auf und können nicht mehr schlafen – wegen Jetlag.“
„Okay“, sagt er und verschwindet in seinem Zimmer. Ihm scheint jetzt erst einmal alles recht zu sein.
*
Das leise Pochen verwandelt sich in ein lautes, beharrliches Klopfen. Wo bin ich hier überhaupt? Draußen vor dem Fenster nur ein schwacher gelblicher Widerschein, der im diesigen Dunkel eines tiefhängenden Himmels zu versickern scheint … Tokio! Am liebsten würde ich mich einfach umdrehen und weiterschlafen. Aber ich habe diesen abendlichen Bummel ja selbst vorgeschlagen. „Komme“, rufe ich, und endlich hört das Geklopfe auf.
Gemächlich laufen wir die abendlich ruhige Straße entlang. Jetzt, gegen Ende April, ist es hier schon angenehm warm, aber die Luftfeuchtigkeit noch nicht so hoch – bis zur Regenzeit ist es ja noch ein paar Wochen hin.
Die Häuser hier sind meistens zweistöckig, dazwischen nur vereinzelt etwas größere Appartementgebäude, deren vorgeklebte Fassaden roten Klinker oder senfgelbe Ziegel vortäuschen. Die ganze Straße entlang Betonmasten, die das Gewirr der Stromkabel über uns hochhalten. Zwischen den Wohnhäusern immer wieder auch kleine Läden – hier schon ein zweiter Kombini, einer dieser allgegenwärtigen ‚Convenience Stores‘. Hin und wieder öffnet sich der Blick in eine Seitengasse, in deren dunklen Tiefen leuchtende Schriftzüge oder bunte Papierlaternen kleine Restaurants oder Kneipen verheißen.
Die milde Abendluft schmeckt nach Staub und Abgasen, jetzt gerade gewürzt mit einer Prise von Seetang und Meer. Die muss von dem Fischladen dort an der Ecke herüberwehen. Aber jetzt wird dieser Duft auch schon abgelöst von einer feinen Kiefernholznote.
Vor dem kleinen, hellblau gestrichenen Holzhaus schräg gegenüber drängt sich ein Dutzend Topfpflanzen zu sowas wie einem Blumengärtchen zusammen.
Ein junger Mann in einem grauen Overall öffnet die Schiebetür zu dem kleinen Yakitori-Restaurant, an dem wir nun vorbeikommen. Für einen kurzen Moment sind wir in den Duft von frisch gegrillten Hühnerspießchen mit einem leichten Hauch von Sake gehüllt.
Vor uns läuft schon die ganze Zeit ein Mädchen in Schuluniform, einer Art Matrosenbluse über einem Faltenrock in gleichem Dunkelblau, weiße Socken darunter, und auf dem schwarzen Schulranzen klebt ein Hello Kitty-Aufkleber. Die kommt wohl so spät noch von der Juku, der Paukschule.
Die schmale Straße macht einen Bogen, und nach wenigen Metern kommen wir
auf die Komazawa-Dōri hinaus.
„Lass uns nach rechts runterlaufen“, sage ich.
An der Ampel müssen wir eine Weile warten.
„Hey, da gegenüber, das ist doch …“
„Na, weißt du jetzt, wo wir sind?“, frage ich.
„Das ist doch unser Shinto-Schrein!“
Daniel macht große Augen – als wäre er wieder der Elfjährige, der stolz eine Plastiktüte mit drei munteren kleinen Schildkröten nach Hause trägt.
„Erinnerst du dich noch an das Schreinfest, auf dem du die Schildkröten bekommen hast?“
„Ich erinnere mich vor allem daran, dass ich da erst mal voll frustriert war, weil ich es nicht geschafft hatte, mit dem kleinen Papierkescher einen der Goldfische aus der Schüssel zu holen.“
„Genau deshalb hat Mom dir dann ja diese Schildkröten gekauft.“
„Das muss ziemlich am Anfang unserer Zeit hier gewesen sein. Am Ende waren die ja schon richtig groß und ich musste sie irgendwo freilassen.“
„Stimmt. In dem kleinen Teich in dem Park hier ganz in der Nähe.“
„Vielleicht leben die da immer noch …“
“Du, es ist grün!“
Als wir die Komazawa-Dōri überqueren, lächelt mich mein Sohn zum ersten Mal an. „Wollen wir mal sehen, ob unser Haus noch steht?“
„Warum nicht? Liegt ja gleich in der Seitenstraße hinter dem Schrein.“
Wir laufen den aus kantig zugehauenem Naturstein zusammengefügten Zaun entlang, der das Schreingelände umschließt. Alles unverändert: Das zugegebenermaßen etwas hässliche, weil aus Beton bestehende große Tōri am Eingang, der Brunnen mit dem kupfergedeckten Dach darüber, der Hauptschrein mit den Nebengebäuden, alle aus dunkelgebeiztem Holz und ebenfalls mit kupfergrünen, geschwungenen Dächern – alles jetzt nur schemenhaft erkennbar, da die mächtigen Kronen der uralten Bäume auf dem Gelände das von außen hereinfallende Licht der Straßenlaternen und den Wiederschein des fahlgelb leuchtenden Nachthimmels größtenteils schlucken.
Angelika und ich hatten diesen altehrwürdigen Schrein zum ersten Mal im goldenen Licht einer tiefstehenden Abendsonne gesehen. Eine Ansicht wie aus einem Bildband über das traditionelle Japan. Allein deshalb hatten wir uns für das gleich dahinter liegende Haus praktisch schon entschieden, bevor der Makler es uns überhaupt richtig gezeigt hatte. Schon stehen Daniel und ich auf dem kleinen Parkplatz davor, auf dem wir immer unseren alten Honda Accord geparkt hatten.
„Nicht gerade schick“, sagt er. „Und irgendwie hatte ich das Haus größer in Erinnerung.“
„Aber die Lage war super“, sage ich, „so dicht an der Haltestelle für deinen Schulbus nach Yokohama. Und der rote Ahorn da an der Seite, den hat deine Mutter persönlich gepflanzt. Irre, wie groß der inzwischen geworden ist.“
„Irre“, sagt er und wirft mir einen etwas seltsamen Blick zu.
„Komm“, sage ich, „oder hast du etwa keinen Hunger?“
„Wo wollen wir überhaupt hin?“
„Wo wir damals auch so oft hin sind. In das Izakaya in der Einkaufsstraße vor dem Gakugei-Daigaku-Bahnhof. Nicht mal eine Viertelstunde von hier.“
„Izakaya?“
„Ach ja, dein bisschen Japanisch von damals hast du wahrscheinlich so ziemlich vergessen.“
„Ist ja wohl kein Wunder. Ist schließlich schon zehn Jahre her, dass wir hier weg sind.“
„Klar – jedenfalls wirst du unser Lieblingsrestaurant von damals bestimmt gleich wiedererkennen. Ich hoffe jedenfalls, dass es den Laden noch gibt. Die hatten so viele kleine Köstlichkeiten auf der Speisekarte, dass wir meistens viel zu viel bestellt haben. Du wolltest immer die Gyōza und auf einer Eisenplatte gebratene Fleischwürfel.“
„Ja, jetzt habe ich Hunger!“
Erst als wir die Außentreppe zum ersten Stock hinaufsteigen, erinnert sich Daniel. „Ah ja, den erkenne ich wieder“, sagt er, und zeigt auf die große Keramik-Figur neben dem Eingang. „Wie heißen die Viecher noch?“
„Tanuki“, helfe ich ihm auf die Sprünge.
„Genau. Auch den habe ich allerdings deutlich größer in Erinnerung.“
„Du warst ja auch erst elf als wir 2002 nach Tokio gekommen sind – und nicht viel größer, als dieser Tanuki.“
„Jetzt übertreib' mal nicht“, protestiert er.
„Jetzt komm rein“, sage ich und halte die Tür auf.
Auch drinnen sieht alles noch genauso aus wie damals. Einer der Zweiertische an der Längswand ist noch frei. Kaum sitzen wir, bringt uns die Bedienung die buntbebilderte Speisekarte. „Etwas altmodisch, findest du nicht?“, meint der Junge nach einem kurzen Blick in die Runde. Dann aber muss er zugeben, dass auch er das hier durchaus gemütlich findet – „ein bisschen wie ein bayrisches Brauhaus.“
*
Natürlich haben wir wieder viel zu viel bestellt – genauso wie damals. Von den Gyōza gleich zwei Portionen, und die Fleischwürfel, die hier immer noch ‚cycle steak‘ heißen, weil sie auf der Platte in einem Kreis arrangiert sind, durften auch nicht fehlen. Dazu noch gebratenes Schweinfleisch mit Kimchi, Sashimi (gleich zwei Platten), Hühnerfleischspießchen mit Erdnusssoße, in mundgerechten Stücken servierten gebratenen Aal, Garnelen in süßsaurer Soße, ein Schälchen Wakame-Seetangsalat, zwei Schüsselchen Suppe mit dicken weißen Udon-Nudeln.
Daniel strahlt. Zur Eröffnung stoßen wir an, mit einem eisgekühlten Asahi Bier.
„Auf eine erfolgreiche Pilgerfahrt.“
„Hals- und Beinbruch.“
So ganz scheint er sich mit dem Charakter unserer Reise noch nicht angefreundet zu haben.
„Where are you from?“, ruft ein junger Mann vom Nebentisch herüber. Er will mit seinem Englisch offenbar die junge Dame beeindrucken, die bei ihm am Tisch sitzt.
„Doitsu“, rufe ich zurück.
„Ah, sō des' ka“, sagt er. Er zeigt auf sein Glas. „German Beer best.“ Dabei hebt er anerkennend den Daumen. Dann kommt noch das unvermeidliche „Nihongo jōzu des΄, nee“, das ich natürlich mit dem obligatorischen „Iie, iie“ zurückweise.
Ansonsten nimmt niemand in dem fast vollbesetzten Lokal von Daniel und mir Notiz. An den Tischen um uns herum fast nur lässige junge Leute in entspannter Feierlaune. Zumeist wohl Studenten der nahegelegenen Uni. Die Angestellten in ihren korrekten schwarzen Anzügen sitzen um diese Zeit sicher noch in ihren Großraumbüros. Sie werden kaum vor 22:00 Uhr zum obligatorischen Umtrunk mit den Kollegen hier einfallen.
„Itadakimas'!“, sage ich.
„Itadakimas', dōzo“, kommt es prompt zurück. Das hat er also von damals noch drauf. Mit den Stäbchen schnappt er sich ein großes Stück Maguro Sashimi, tunkt es in das Schälchen dick mit Wasabi angerührter Sojasoße und eröffnet damit genießerisch unser Gelage.
„Wollen wir nicht einfach in Tokio bleiben?“, fragt er nach dem dritten oder vierten Scheibchen Sashimi. „Vier Wochen schlemmen statt durch die Gegend zu laufen wäre vielleicht auch besser für dich, Dad – so geschafft wie du aussiehst.“
„Danke für das Kompliment“, sage ich.
„Ich meine ja nur. Im Vergleich zum letzten Mal, als wir uns gesehen haben, hast du jedenfalls ganz schön abgenommen. Also, um ehrlich zu sein: Ich hätte einen Strandurlaub in Thailand sowieso besser gefunden als jetzt drei Wochen lang einen Tempel nach dem anderen abzuklappern. So ganz verstehe ich ehrlich gesagt immer noch nicht, warum du unbedingt zum Pilgern nach Shikoku willst.“
„Du, das ist so eine Art Nostalgietrip für mich. Mit Mom bin ich von Kobe aus ein paarmal auf Shikoku gewesen.“
Uns jetzt allerdings schon an unserem ersten gemeinsamen Abend in eine weitere Diskussion über Sinn und Zweck unserer 'Pilgerreise' zu verwickeln, erscheint mir eher kontraproduktiv zu sein. Ob er nicht Lust hätte, vor unserem Aufbruch nach Shikoku seiner alten Schule noch einen Besuch abzustatten, wechsle ich das Thema. Vielleicht kann ich den Jungen ja so auch noch etwas für unsere gemeinsame Unternehmung erwärmen. „Schließlich soll hier jeder auf seine Nostalgiekosten kommen. Liegt ja praktisch auch auf dem Weg. Wir würden dann anschließend einfach vom Bahnhof Shin-Yokohama aus den Shinkansen nach Kobe nehmen.“
„Ach lass mal. Inzwischen kennt mich da ja sowieso kaum noch einer“, sagt Daniel. „Und allen, denen wir dort über den Weg laufen, auch noch erklären, dass ich ein Ehemaliger auf Nostalgietrip bin – nein, so alt bin ich noch nicht.“
„Okay, wie du willst“, sage ich. „Aber wenn ich das richtig sehe, war das doch eine gute Zeit für dich dort.“
„Stimmt, war tatsächlich nicht schlecht. Auf jeden Fall besser als in Bonn am Aloysius-Kolleg, wohin du mich danach wieder abgeschoben hast.“
Ich greife spontan nach meinem Bierglas. Mein Sohn sieht mich angespannt an. Soweit kenne ich ihn immerhin noch, dass ich seinen Gesichtsausdruck deuten kann. Er fragt sich wohl gerade, ob das so gut war, dass ihm das eben so rausgerutscht ist. Ich nehme erst einmal einen tiefen Schluck.
„Das hast du wohl nicht ganz so gemeint, wie das rüberkam“, sage ich, hoffend, dass das jetzt meinerseits souverän und völlig entspannt rübergekommen ist.
„Schon gut, Dad“, kommt es in versöhnlichem Ton zurück.
„Also, ich finde, wir sollten jetzt erst mal unser Essen genießen. Wäre doch schade, wenn deine cycle steaks kalt werden würden.“ Ich lange mit meinen Essstäbchen über den Tisch und picke mir einen der Fleischwürfel von der Platte.
„Hast recht“, sagt Daniel und langt ebenfalls zu.
Eine Zeit lang arbeiten wir uns mit den Stäbchen durch die Platten, Schüsseln und Schälchen zwischen uns auf dem Tisch. Statt weitere Diskussionen vom Zaun zu brechen fordere ich meinen Sohn nur zwei oder drei Mal zwischendurch auf, mit den schweren Halbliter-Biergläsern anzustoßen: „Auf Shikoku!“ „Auf eine gute Zeit!“ „Auf uns!“
Erst als nur noch etwas von den ohnehin kalten Speisen übrig ist – eine halbe Platte Sashimi, der Wakame-Salat, ein paar von den Garnelen – wage ich es, noch mal eine Frage zu stellen.
„Übrigens, wie war eigentlich die erste Station deines Referendariats? Wo hast du die überhaupt abgeleistet? Zivilrecht, oder?“
„Mit sowas Trockenem wollen wir uns doch jetzt nicht die Stimmung verderben.“ Diesmal hebt Daniel als Erster das Glas.“
„Haste auch wieder recht“, sage ich, „Prost!“
Eine weitere Frage kann ich mir dann aber doch nicht verkneifen. „Habe ich dir eigentlich mal gesagt, wie sehr ich mich seinerzeit über deine Entscheidung gefreut habe, Jura zu studieren, wie ich?“
„Oh Gott, nein, hast du nicht. Du hast nur immer gesagt, mit diesem Studium stünden einem beruflich besonders viele Möglichkeiten offen. Komischerweise hat mich das damals überzeugt.“
„Wahrscheinlich gut, dass ich nicht mehr gesagt habe. So, wie du damals auf Opposition gebürstet warst, hättest du dich sonst wahrscheinlich für die Schauspielerei oder eine ähnlich brotlose Kunst entschieden …“
„Mann, ich platze gleich“, stöhnt er.
„Wolltest du nicht eigentlich die ganzen vier Wochen nur schlemmen?“, frage ich.
„Immer noch besser als drei Wochen nur magere Tempelkost – Reisgrütze, Tofu und zu Buddhas Geburtstag eine trockene Mohrrübe extra.“
„Unterschätz' die Buddhisten nicht“, sage ich.
„Bestellen wir noch eins?“, fragt er. Als ich zögere stößt er nach: „Jetlag – durchschlafen – das war doch dein Plan.“
Ich gebe mich geschlagen.
Als wir das Izakaya eine Stunde später verlassen – wir haben zu guter Letzt sogar beide noch ein drittes Halbes geleert – sitzt schon eine erste Gruppe von Angestellten im obligatorischen schwarzen Anzug um einen der größeren Tische. Von der nahen Toyoko-Bahnlinie her hört man das vertraute ‚ping – ping – ping‘, weil gerade die Schranke an einem der Übergänge hoch- oder runtergeht.
„Eigentlich ein geiles Gefühl, wieder hier in Japan zu sein“, höre ich meinen Sohn sagen.
„Na, dann haben wir vielleicht doch alles richtig gemacht“, sage ich vorsichtig.
„So weit, so gut“, gibt er zurück.
*
Es ist erst zwei Uhr! Statt mich durchschlafen zu lassen, haben mich die anderthalb Liter Bier vorzeitig aus dem Bett getrieben. Von der Toilette zurück ziehe ich den Fenstervorhang an den Rändern noch ganz zu, um auch den letzten Streifen Licht der nächtlichen Stadt auszusperren.
Aber das, was einem im Kopf herumgeht, lässt sich nicht einfach so zuhängen. Dabei ist unser erster gemeinsamer Tag doch gar nicht so schlecht gelaufen. Nur einmal, beim Essen vorhin, ist der Korken kurz aus der Flasche gepoppt, die mein Sohn und ich so lange nicht anzurühren gewagt haben. Aber selbst das haben wir doch schnell wieder eingefangen. Ja, Daniel und ich haben doch, trotz allem, hier einen weitgehend entspannten ersten Abend miteinander verbracht.
Okay, da wird noch so Einiges hochkommen in den nächsten drei Wochen. Aber ein Anfang ist gemacht, der durchaus hoffen lässt. Zumal auch Daniel das anscheinend so sieht. Wie hat er es doch am Ende so schön formuliert? „So weit, so gut …“
„Aber dass er tatsächlich von ‚abschieben‘ gesprochen hat … Kann doch nicht sein, dass er sich gar nicht mehr daran erinnert, dass er selber es war, der damals wieder nach Bonn ins Aloysius zurückwollte.
Eine dröhnende Männerstimme, draußen auf dem Gang. Um diese Zeit noch? Wahrscheinlich betrunken. Eine Frau lacht laut auf. Offenbar sind die direkt vor meiner Tür stehengeblieben. Die werden doch nicht die Zimmernummer verwechselt haben und versuchen, hier einzubrechen … Nein, jetzt sind sie offenbar eine Tür weiter. Laut fällt die ins Schloss. Jetzt bin ich endgültig glockenwach.
Dass ich Daniel letztlich wohl nicht ganz der Vater gewesen bin, den er gebraucht hätte, lässt sich wohl nicht abstreiten …
Ich wälze mich auf die andere Seite. Manchmal hilft das ja, das Gegrübel zu unterbrechen. Aber jetzt, allein in der Finsternis, kommen mir auf einmal ernsthafte Zweifel an dem, was ich mir vorgenommen habe. Ja, auf was habe ich mich hier überhaupt eingelassen? Wie weit muss ich nun gehen, damit der Junge versteht und verzeiht? Wie weit will ich überhaupt gehen?
Warum bloß habe ich das alles nicht schon gründlich bedacht, bevor ich Daniel vorgeschlagen habe, sich mit mir auf diese Pilgerreise zu machen?
Nebenan knarrt das Bett. Der Lärm auf dem Gang hat wohl auch Daniel aufgeweckt. Ein Stöhnen dringt durch die Wand. Mein erster Gedanke: Jetzt ist ihm schlecht geworden nach der Völlerei von vorhin. Ich setze mich ruckartig auf. Nein, jetzt knarrt es, als ob er auf seinem Bett auf und ab wippen würde. ‚Hospitalismus‘, schießt es mir durch den Sinn. Vernachlässigte Kinder schaukeln doch manchmal so zwanghaft hin und her …
Ein Jubelruf zerreißt die Watte in meinem Kopf. Das Wippen und Knarren hat in einen festen, stetigen Rhythmus gefunden. Jetzt wird es auch noch von seltsamen Lauten interpunktiert. Irgendwas zwischen unterdrückten Hilferufen und genussvollem Aufstöhnen. Jetzt entfaltet sich das Ganze zu einem unzweideutigen Wechselgesang zwischen tiefem Bass und jubilierendem Koloratursopran: Ja, da ist eindeutig dieses Pärchen zugange – in dem Zimmer auf der anderen Seite!
Ich sitze wie festgefroren und lausche mit klopfendem Herzen, als könne jede falsche Bewegung oder ein einziger Laut auf dieser Seite der Wand die artistische Choreografie des Stücks nebenan einstürzen lassen.
Jetzt ruckt auch noch etwas in stetem Rhythmus dumpf gegen die Wand, von einem aufmunternden Klatschen getrieben – als säße da drüben ein Zuschauer, der sich von dem, was er da sieht, zu voreiligem Beifallklatschen hat hinreißen lassen.
‚Wie klingt das Klatschen einer einzelnen Hand?‘ Dass mir ausgerechnet jetzt und bei solchem Treiben das berühmte Zen-Rätsel einfällt …
Das Hörspiel im Nebenzimmer scheint inzwischen seinem Höhepunkt zuzutreiben. Tiefe Grunzer wechseln sich in immer dichter werdender Folge mit immer hektischeren, in immer luftigere Höhen getriebenen Keuch- und Stöhnlauten ab. Nun auch noch Text, kurze erregende Sätze, antreibende, fordernde Wörter, bejahende, verneinende, staunende Silben – und alles so laut hervorgestoßen, dass es durch die dünne Wand klar zu verstehen ist.
So nachdrücklich liegt mir das Paar nebenan in den Ohren, als wäre es beauftragt, mir Schwung um Schwung einzuhämmern, wie ungezwungen das Leben sein kann. Und das auch noch heute und hier, wo mich alles an die letzten drei Jahre mit Angelika erinnert – ja, auch an vergleichbare Momente mit ihr!
Über die aber war ja in diesen Jahren nach wie vor wie eine alle Empfindungen dämpfende Decke der Trauerflor unseres Unglücks gebreitet. Nur eine einzige einsame Insel hebt sich in meiner Erinnerung aus der stillen See unserer sorgsam im Gleichgewicht gehaltenen Liebe dieser Endzeit empor: Jener eine Moment in unserem letzten Tokioter Herbst – dieser Moment plötzlich auflodernden Glücks während der Überfahrt auf der schwankenden Fähre nach Katsuura. Und so hoch uns da die von den ersten Ausläufern des Taifuns erregten Wogen des Pazifik getragen haben, so jäh ließen uns später die vom Sturm in die Badehöhle gepeitschten Brecher wieder hinunterstürzen …
Ernüchtert falle ich ins Kissen zurück und ziehe mir die Decke über den Kopf.
22. April, Yokohama – Naruto
Daniel sitzt auf dem Fensterplatz und starrt hinaus. Da draußen gleitet schneller und schneller das chaotische Häusermeer von Yokohama vorbei. Der Shinkansen hat eben erst den Bahnhof Shin-Yokohama verlassen und gerade hat der Junge tatsächlich gesagt, die drei Jahre an der Deutschen Schule Tokio-Yokohama seien die schönsten Jahre seiner gesamten Schulzeit gewesen.
Ich muss an die ewig langen Schulvorstandssitzungen an der DSTY denken. „Nirgendwo sonst habe ich so viel Zeit in deiner Schule verbracht, wie hier“, sage ich.
„Ja, wenn es um die Schule ging. Wenn es um mich ging, warst du nie da. Beim großen Tischtennistournier gegen unsere japanische Partnerschule zum Beispiel. Da warst nicht mal bei der Siegerehrung dabei. Selbst als ich schon auf dem Treppchen gestanden habe, habe ich noch nach dir Ausschau gehalten.“
„Da war garantiert mal wieder was Dienstliches dazwischengekommen. Aber ich gehe davon aus, dass deine Mom bei diesem Ereignis dabei war.“
„Darum geht es nicht, Dad.“
„Irgendwo dahinten hinter dem Wolkenvorhang müsste jetzt der Fuji liegen“, sage ich.
„Vielleicht sehen wir den ja in drei Wochen, wenn wir zurückkommen“, sagt Daniel. „Ach übrigens, du wolltest mir doch noch erklären, wie das jetzt weitergeht. Also, von Kobe aus nehmen wir heute Nachmittag den Bus über Awaji nach Shikoku. Und dann?“
„Übernachten wir in Naruto. Das ist der erste kleine Ort auf Shikoku – gleich nach der Brücke über die Naruto-Meerenge. Ich habe uns da ein Zimmer in einem kleinen Guesthouse reserviert. Ein Tatami-Zimmer. Da können wir uns schon mal wieder daran gewöhnen, auf dem Fußboden zu schlafen. Du erinnerst dich doch sicher, wie wir früher, wenn wir hier unterwegs waren, gelegentlich in traditionellen Gasthäusern auf Tatami-Matten geschlafen haben.“
„Ich erinnere mich eher an Schulausflüge, an wilde Kissenschlachten oder Ringkämpfe in den großen Tatami-Schlafräumen …“
„Wie auch immer. Jedenfalls ist es von diesem Gasthaus nicht weit bis zum Bahnhof. Dort nehmen wir morgen früh den ersten Zug der Lokalbahn bis Bando. Schräg gegenüber der Bahnstation liegt dann schon Tempel Nummer 1. Ab da heißt es laufen. Erst mal bis Tempel Nummer 6. Dort habe ich zur Einstimmung eine Übernachtung in der Tempelherberge reserviert. Da gibt es als besonderen Luxus sogar ein Onsen, eine heiße Quelle für die Pilger zum Baden.“
„Klingt gut, soweit“, wirft Daniel ein – sein erster positiver Kommentar zu dem, was wir vorhaben. „Aber dann willst du tatsächlich in drei Wochen gut siebenhundert Kilometer zu Fuß machen?“ Prompt ist sie wieder da, seine grundsätzliche Skepsis.
„Das ist der Witz bei der Sache.“
„Ich meine ja nur. Bist du wirklich schon wieder so fit? War doch anscheinend ein ziemlich übler Virus, den du dir eingefangen hattest.“
„Kein Virus. Ein Darmparasit. Aber der Arzt meint, das Monster wäre besiegt und, wie gesagt, er hat mir Wandern sogar empfohlen.“
„Nun ja, wandern ist ja okay. Aber warum es unbedingt eine Pilgerwanderung sein muss, habe ich immer noch nicht so ganz durchschaut“, sagt Daniel und blickt mir dabei direkt ins Gesicht. „Vor allem, weil wir damit ja offenbar nicht mal an der vorgeschriebenen Stelle anfangen. Ich habe mich nämlich inzwischen auch selber ein bisschen schlau gemacht – Lonely Planet und so. Normalerweise muss man diese Pilgertour mit einem Besuch auf dem Kōya-san beginnen, weil dort der Haupttempel der Shingon-Sekte liegt, deren Tempel auf Shikoku du ablaufen willst. Wenn du also nicht mal an der richtigen Stelle anfangen willst, warum das Ganze dann überhaupt? Warum wandern wir nicht einfach so, ganz entspannt und ohne festen Plan? Die Gegend ist doch sicher auch so urig genug.“
Natürlich habe ich diese Frage erwartet, wenn auch vielleicht nicht so schnell. „Das ist einfach erklärt“, sage ich. „Wir fangen nicht auf dem Kōya-san an, weil wir da schon mal gewesen sind.“
„Wie jetzt? Ich auch?“
„Ja, in unserem ersten Jahr in Tokio. Über Ostern. Da waren wir in Kyoto und haben von dort aus einen Tagesausflug gemacht. Auf diesen Berg mit den vielen Tempeln und dem großen Friedhof.“
„Ach, diese Steingräber im Wald?“
„Genau. In diesem uralten Zedernwald“
„Dann weiß ich wieder. Wir sind da stundenlang rumgelaufen. Mom und du, ihr habt geschwärmt, von der Atmosphäre und so, und ich fand es stinklangweilig. Ansonsten erinnere ich mich nur noch, dass es arschkalt war da oben.“
„Na ja, da warst du erst dreizehn – vielleicht ein bisschen zu jung, um einen mehr als tausend Jahre alten heiligen Ort so richtig zu würdigen.“
„Wenn du meinst …“
Die Japaner um uns herum starren auf ihre Handy-Displays, sind in Zeitungen oder Manga-Hefte vertieft oder – wie der junge Mann auf der anderen Seite des Ganges – in irgendwelche Tabellen. In der Reihe hinter uns schnarcht jemand leise. Ansonsten hört man nur das gedämpfte Rauschen des Shinkansen und hin und wieder den leichten Schlag, wenn der Zug in einen der vielen Tunnel eintaucht. Die Anzeige vorne im Wagen zeigt, wir sind gerade mit rund dreihundert Stundenkilometern unterwegs.
„Ganz schön sportlich“, stellt Daniel fest.
„In der Tat. So schnell sind die Bahnen in Deutschland ja bis heute noch nicht.“
Daniel grinst mich an. „Wieso Bahnen? Ich musste gerade daran denken, was da abgegangen ist, letzte Nacht.“
Oh Gott, der Junge hat es also auch gehört – obwohl mein Zimmer dazwischenlag.
„Muss dir nicht peinlich sein, Dad. War nicht das erste Mal, dass ich sowas mitbekommen habe.“
„Quatsch, warum sollte mir das peinlich sein“, sage ich und schüttele – vielleicht ein klein wenig übertrieben – den Kopf. Offenbar hat er meinen Gesichtsausdruck missdeutet. Wenn, dann hat es mich überrascht, dass er sowas vor mir, seinem Vater, so unverblümt angesprochen hat. Irgendwie habe ich ihn wohl bis jetzt immer noch als meinen kleinen Jungen gesehen …
„Übrigens“, sage ich, „wir könnten in Naruto auch erst noch die Sixtinische Kapelle besuchen.“
„Willst du mich verkackeiern?“
„Ganz und gar nicht. Es gibt in Naruto ein Museum mit weltberühmten Gemälden, von Leonardo da Vincis Abendmahl bis zu den Sonnenblumen von Van Gogh – alles Reproduktionen, die mit einer extra dafür entwickelten Technik auf Keramikkacheln aufgebracht worden sind. Wirkt absolut originalgetreu. Und das Prunkstück dieses Museums ist ein Nachbau des Innenraums der Sixtinischen Kapelle im Vatikan, in Originalgröße, einschließlich all dieser großen Decken- und Wandgemälde Michelangelos.“
„Ist ja irre.“
„Mit Mom bin ich da mal gewesen. Sie wollte da unbedingt hin. Vielleicht so eine Art Kompensation für die vielen buddhistischen Tempel, die wir seinerzeit hier in Japan besucht haben.“
„Ihre katholischen Erziehung?“
„Kann sein. In ihrer Studienzeit in Münster ist sie ja sogar eine Zeitlang mit einem Theologiestudenten liiert gewesen. Der war allerdings evangelisch.
„Aber du willst da jetzt nicht wirklich hin, oder?“
„In diese Keramik-Kapelle? Nein, wir wollen΄s ja nicht übertreiben – es sei denn, du bestehst darauf…“
Wir werden in wenigen Minuten den Bahnhof Shin-Kobe erreichen, tönt es aus dem Bordlautsprecher. Ein Schlag, kurz wird es dunkel, bevor das Licht im Waggon aufflammt. Der einzige Tunnel auf der kurzen Strecke zwischen Osaka und unserem Ziel Kobe.
Ob ich nicht, wenn wir schon hier vorbeikämen, unserem Generalkonsulat einen Besuch abstatten wolle, fragt Daniel. „Hier soll schließlich jeder auf seine Nostalgiekosten kommen“, zitiert er mich.
„Unser GK ist gar nicht mehr hier in Kobe. Das ist nach dem großen Erdbeben von 1995 nach Osaka verlegt worden. Selbst das Haus, in dem Mom und ich vor dreißig Jahren gewohnt haben, ist, wie wir gehört haben, nach dem Beben so stark beschädigt gewesen, dass es abgerissen werden musste.“
„Muss ein Horror sein, so ein starkes Beben.“
„Freunde, die das miterlebt haben, haben uns erzählt, das Schlimmste wären die Nachbeben gewesen. Da hätte man jedes Mal Angst, dass es gleich wieder so richtig losgeht. Jedenfalls behalte ich lieber alles so in Erinnerung, wie es damals gewesen ist.“
Daniel lässt ein verständnisvolles Knurren hören. Im gleichen Moment gleiten wir aus dem Tunnel heraus und der Zug kommt im Bahnhof Shin-Kobe zum Stehen.
*
Nach dem langen Sitzen im Zug und im Bus tut es ganz gut, die nicht allzu lange Strecke von der Bushaltestelle in Naruto bis zu unserem ‚Guesthouse‘ zu Fuß zu laufen. Die erste etwas längere Strecke mit Rucksack. Verdammt ungewohnt. Wenn ich daran denke, dass ich mit dieser Last auf dem Rücken morgen kilometerweit werde laufen müssen …
Auf halber Stecke kommen wir an einem Kombini vorbei. Wir beschließen spontan, uns noch schnell mit ein paar Sandwiches und zwei Dosen Bier für unser Abendessen einzudecken. Wir sind beide zu müde, um nachher noch mal extra auszugehen. Als ich schon an der Kasse stehe, entdeckt Daniel noch irgendwas in dem Regal mit den Manga-Heften. Er kommt mit einem Notizheft zurück, so einem dicken mit Pappeinband, wie es die Schüler in Japan benutzen. Ich frage ihn, ob ihm sein Rucksack immer noch nicht schwer genug ist. Er grinst nur.
*
Unser Tatami-Zimmer ist klein, Bad und Gemeinschaftstoilette am anderen Ende des Flurs. Alles wirkt ein wenig wie in einer Jugendherberge. Eigentlich hatte ich mir das etwas netter vorgestellt. Daniel aber findet es ‚japanisch gemütlich‘, mit den shōji-Schiebetüren – und dann auch noch die Tatami im großen Gemeinschaftsraum.
Das Wichtigste ist, dass es hier WLAN gibt. So kann ich mir auf Google Maps noch mal unsere morgige Strecke ansehen. Daniel notiert derweil schon irgendwas in sein Notizheft.
„Hey“, sage ich, „der Tempel, in dem wir morgen Abend übernachten, hat sogar eine Webseite auf Englisch.“
„Kann man heutzutage doch auch erwarten“, stellt Daniel nüchtern fest. Als er aufsieht, fällt ihm auf, dass ich mit überkreuzten Beinen im Lotossitz dasitze. Wo ich das denn gelernt hätte, fragt er. Offenbar erinnert er sich gar nicht daran, dass ich schon seit unserer gemeinsamen Zeit in Kathmandu mehr oder weniger regelmäßig Zen-Meditation geübt habe. War allerdings auch morgens ganz früh, wenn er noch geschlafen hat. Und in Tokio, wenn ich es sonntags mal geschafft habe, an den Laien-Zen-Übungen zweimal im Monat in dem kleinen Zendō in der Nachbarschaft teilzunehmen, war ich meist so früh zurück, dass ich für ihn und seine Mutter noch den Frühstückstisch decken konnte.
„Hast du etwa gehofft, so vor Mom's depressiven Stimmungen ins Nirvana flüchten zu können?“ Daniel hat inzwischen sein Notizheft zur Seite gelegt, ist unter die Decke geschlüpft und hat diese Frage jetzt in einem so heiter-unbefangenen Ton gestellt, dass ich sie ihm nicht einmal übelnehmen kann.
Mir sei es nur um die entspannungsfördernden und die Konzentrationsfähigkeit steigernden Wirkungen der Meditation gegangen, erkläre ich. Anfangs habe mich durchaus auch die Vorstellung gereizt, durch intensive Meditation vielleicht sowas wie 'höhere Bewusstseinszustände΄ zu erreichen. Je mehr ich mich aber mit der Sache befasst habe, desto klarer sei mir geworden, dass es sich beim Zustand des Samadhi, also der tiefen Versenkung – und erst recht dem der Erleuchtung – wohl eher um einen Zustand totaler Regression handeln müsse. Also eine gezielt herbeigeführte Rückkehr in den Zustand des neugeborenen Menschen, bevor sich dessen Ich und das differenzierende Denken ausgebildet haben. Dafür spreche ja schon, dass dieser zweifellos selige Zustand selbst bei denen, die ihn mehrfach erlebt haben wollen, immer nur für kurze … Ein vernehmliches Schnarchen lässt mich innehalten. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass mein Sohn inzwischen fest schläft.
*
„Hey, Dad!“
„Was΄n los?“ Wo bin ich überhaupt? Es ist stockfinster. Das Bett unter mir ist hart wie ein Brett. Ich taste herum. Kühl und glatt … Tatami … Naruto!
„Hast du das nicht gemerkt, eben? Ein Erdbeben. Hat ganz schön gerappelt …“
„Echt? Habe ich nicht mitbekommen …“
„Bekommst du überhaupt irgendwas mit?“
„Hm …“
Jetzt bin ich wach und Daniel schnarcht schon wieder.
Auf dem Weg
T a g E i n s
Die beiden überlebensgroßen Wächterfiguren im mächtigen Holztor vor dem Gelände von Tempel Nummer 1 blicken grimmig auf uns herunter. Der auf der linken Seite streckt mir abwehrend seine geöffnete Rechte entgegen. Der rechts droht mir mit seiner hoch erhobenen linken Faust. Das beeindruckt mich allerdings weniger als Daniels völlig verblüffter Gesichtsausdruck.
Er kann es offenbar gar nicht fassen, wie ich mich inzwischen ausstaffiert habe. Fast genauso nämlich wie die lebensgroße Schaufensterpuppe, die linkerhand vor dem Tempeltor steht, und an der der Neuling studieren kann, was alles zur Ausstattung des klassischem Shikoku-Pilgers gehört: Ein runder, nach oben spitz zulaufender Strohhut, ein weißes Gewand aus dünnem Baumwollstoff, bestehend aus langer Hose mit einem losen Hemdchen darüber, ein um den Nacken gehängter schmaler Schal – eigentlich eher ein Band – aus besticktem Stoff, weiße Socken mit einem Extraabteil für den großen Zeh, Strohsandalen, ein langer, vierkantiger Pilgerstab sowie eine Gebetskette, die einem katholischen Rosenkranz zum Verwechseln ähnlich sieht.
In der Gasse, die auf das Tempeltor zuführt, gab es einen kleinen Laden für Pilgerbedarf, dessen Schiebetür einladend offenstand, und aus dem mir ein altes Mütterchen zuwinkte, als hätte sie schon auf mich gewartet. Daniel ist achtlos daran vorbeigelaufen und hat womöglich erst gemerkt, dass ich verschwunden war, als er schon hier vor dem Tempeltor stand.
„Oh Gott, auf was habe ich mich da bloß eingelassen“, stöhnt er jetzt. „Du nimmst das Ganze hier anscheinend doch ernster, als du bisher zugegeben hast.“