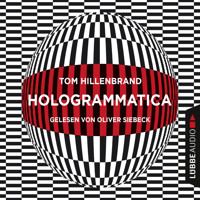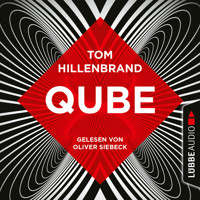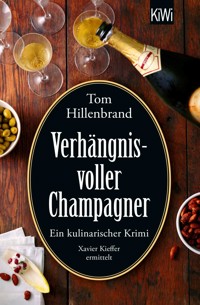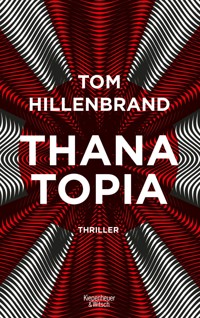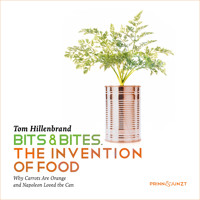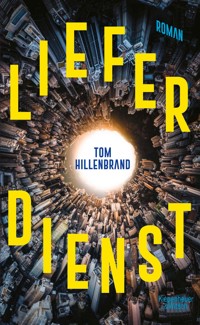9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Xavier-Kieffer-Krimis
- Sprache: Deutsch
Ein Krimi zum Genießen! Der erste Fall für den kulinarischen Ermittler Xavier Kieffer. Der ehemalige Sternekoch Xavier Kieffer hat der Haute Cuisine abgeschworen und betreibt in der Luxemburger Unterstadt ein kleines Restaurant, wo er seinen Gästen Huesenziwwi, Bouneschlupp und Rieslingpaschtéit serviert. Doch dann bricht eines Tages ein renommierter Pariser Gastro-Kritiker tot in seinem Restaurant zusammen – und plötzlich steht Kieffer unter Mordverdacht. Als dann noch sein alter Lehrmeister spurlos verschwindet, beschließt der Luxemburger, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen; sie führen ihn bis nach Paris und Genf. Dabei stößt er auf eine mysteriöse, außergewöhnlich schmackhafte Frucht, auf gewissenlose Lebensmittelkonzerne und egomanische Fernsehköche. Immer tiefer taucht Kieffer in die von Konkurrenzkampf und Qualitätsdruck beherrschte Gourmetszene ein – und erkennt, was auf dem Spiel steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Tom Hillenbrand
Teufelsfrucht
Ein kulinarischer Krimi Xavier Kieffer ermittelt
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tom Hillenbrand
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tom Hillenbrand
Tom Hillenbrand, geb. 1972, studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Ressortleiter bei SPIEGEL ONLINE.
Seine Bücher wurden mehrfach ausgezeichnet, sind in viele Sprachen übersetzt und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
www.tomhillenbrand.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der ehemalige Sternekoch Xavier Kieffer hat der Haute Cuisine abgeschworen und betreibt in der Luxemburger Unterstadt ein kleines Restaurant, wo er seinen Gästen Huesenziwwi, Bouneschlupp und Rieslingpaschtéit serviert. Doch dann bricht eines Tages ein renommierter Pariser Gastro-Kritiker tot in seinem Restaurant zusammen – und plötzlich steht Kieffer unter Mordverdacht. Als dann noch sein alter Lehrmeister spurlos verschwindet, beschließt der Luxemburger, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Dabei stößt er auf eine mysteriöse, außergewöhnlich schmackhafte Frucht, auf gewissenlose Lebensmittelkonzerne und egomanische Fernsehköche. Immer tiefer taucht Kieffer in die von Konkurrenzkampf und Qualitätsdruck be-herrschte Gourmetszene ein – und erkennt, was auf dem Spiel steht.
»Gleichermaßen amüsant wie interessant.« Süddeutsche Zeitung
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/ RelaxImages
ISBN978-3-462-30332-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Epilog
Glossar: Küchenlatein
Leseprobe »Verhängnisvoller Champagner«
Für Cornelia
Prolog
Aaron Keitel beobachtete, wie seine linke Hand den Schlitten der Halbautomatik zurückzog und nach vorn schnappen ließ. Er hob die Waffe über den Kopf und zielte vage auf das Blattwerk des Dschungelbaums, in dem er einen der verdammten Vögel vermutete. Die Vögel schrien, seit Stunden schrien sie, ununterbrochen brüllten sie wütend gegen die kleine Truppe von Fremden an, die sich erdreistete, in ihr abgelegenes Revier einzudringen.
Der Amerikaner legte den Finger an den Abzug und stellte sich vor, wie er das Magazin der Walther P99 in einen der Bäume feuerte, sämtliche 15 Schuss. Er sah vor seinem geistigen Auge, wie Äste, Blätter und blutige Federn in alle Richtungen stoben. Warum eigentlich nicht? Es gäbe einen ohrenbetäubenden Lärm, sicherlich, aber danach hörten die Vögel vielleicht auf zu schreien.
Keitel senkte seine Waffe. Er musste sich zusammenreißen. Ihm war bewusst gewesen, dass die Expedition in die Aramia-Ebene, einen besonders entlegenen Teil Papua-Neuguineas, seinen Körper auslaugen und seine Nerven zerrütten würde. Aber sie stapften erst seit zwei Tagen durch den feuchtheißen Dschungel, und es war noch ein bisschen zu früh, um den Verstand zu verlieren. Später vielleicht.
Er sicherte die Walther und steckte sie wieder in das Gürtelholster. Jetzt erst fiel ihm das faustgroße Insekt auf, das bereits sein Schienbein hinaufgeklettert war und sich nach einer kurzen Positionsbestimmung nun anschickte, in Richtung seines Schritts weiterzukrabbeln. Keitel schüttelte sein Bein. Es gab ein knirschendes Geräusch, als er den Blutsauger unter seinem Springerstiefel zerquetschte.
Er blieb stehen und schaute sich um. So weit das Auge reichte, erblickte man nichts als von dichten Schlingpflanzen überzogene Bäume und undurchdringliches, mannshohes Gebüsch. Straßen und Siedlungen gab es in der Südprovinz fast keine. Stattdessen war das Land reich an giftigen Insekten und tückischen Sümpfen. Das Gebiet um den Aramia-Fluss galt nicht umsonst als die unerfreulichste Ecke Papua-Neuguineas.
Während Aaron Keitel weiterstapfte, wischte er die schweißnassen Hände an seiner kakifarbenen Survivalweste ab und musste dabei unwillkürlich grinsen. Es gab vermutlich überhaupt keine Ecke Papua-Neuguineas, die nicht unerfreulich war, vielleicht mit Ausnahme des Crowne Plaza in der Hauptstadt Port Moresby. Die ganze verdammte Insel war ein feuchtwarmes Höllenloch.
Nach einer Weile hielt Keitel an und bedeutete seinem einheimischen Führer zu warten. Er schraubte eine Wasserflasche auf, nahm einen tiefen Schluck und goss den Rest über seine von Schweiß und Dreck verklebten blonden Haare. Dann zertrat er einen besonders bizarr aussehenden Käfer von der Größe eines Meerschweinchens. Das Ungeziefer war ihm für gewöhnlich gleichgültig. Seine Expeditionen hatten ihn unter anderem nach Indochina, Java und in den brasilianischen Regenwald geführt. Über die Jahre hatte er sich an Insekten jeder Art und Größe gewöhnt. Papua-Neuguinea stellte jedoch selbst erfahrene Globetrotter vor eine Herausforderung. Tagsüber war es heiß und feucht, nachts eisig kalt. An Schlaf war in der Wildnis kaum zu denken – zum einen wegen des Klimas, zum anderen wegen des Ungeziefers, das unentwegt versuchte, in sämtliche Körperöffnungen einzudringen.
Er winkte seinen Guide zu sich. »Sekou, wie weit ist es noch?« Anders als der mit modernster Hiking-Kleidung ausgestattete Keitel trug der schmächtige Guineer lediglich Shorts und ein arg verblichenes Trikot des Fußballvereins Manchester United. Weder schwitzte er, noch sah er erschöpft aus. »Nicht weit jetzt, Sir. Tulai haben Lager dort drüben«, sagte Sekou und machte eine unbestimmte Handbewegung in Richtung der vor ihnen aufragenden Wand aus Blättern, Ästen und Lianen. Keitel nickte, warf die Plastikflasche ins Gebüsch und lief weiter.
Die Tulai waren ein Stamm, der auf dem entlegenen Oriomo-Plateau im Südwesten der Pazifikinsel lebte. Fast zwei Monate hatte Keitel in der Hauptstadt und in einem Provinznest namens Daru verbracht, um einen Kontakt zu Ratu Koca, dem obersten Tulai-Häuptling, herzustellen.
Der Stamm bekam normalerweise keinen Besuch von amerikanischen Geschäftsleuten – oder von irgendwem sonst. Nur alle paar Jahre verirrte sich ein Ethnologe oder ein Sprachwissenschaftler in die Gegend, um das Leben der scheuen Jäger und Sammler oder ihren seltsamen Stammesdialekt zu studieren. Kaum jemand interessierte sich für die Eingeborenen mit der martialischen Gesichtsbemalung und den wunderlichen Kopfputzen.
Hinzu kam die Tatsache, dass die Tulai noch im Jahr 1952 vier auf Missionsreise befindliche Methodistenpriester verspeist hatten – also zu einem Zeitpunkt, als die meisten anderen Stämme Papua-Neuguineas den Kannibalismus schon lange ablehnten. Ob die Tulai dieser kulinarischen Tradition noch anhingen, wusste man nicht so genau. Auch dieser Umstand hielt selbst hartgesottene Dschungeltouristen davon ab, Tulai-Stammesgebiet ungefragt zu betreten.
Auch Keitel waren die Tulai bis zum April dieses Jahres gleichgültig gewesen. Genauer gesagt hatte er noch nie von ihnen gehört, bis er in einem Buch des britischen Ethnologen Leicester Morris etwas über den Stamm gelesen hatte. Der Wissenschaftler hatte in den Siebzigerjahren mehrere Wochen bei den Tulai verbracht und ihre Lebensweise studiert.
Keitel las regelmäßig Erfahrungs- und Reiseberichte, in denen er etwas über die wenig bekannte Flora und Fauna entlegener Gegenden erfahren konnte – das gehörte zu seinem Job. Morris’ Tulai-Monografie war zunächst quälend langweilige Lektüre gewesen, und er hatte sich zwingen müssen, sie nicht bereits nach dem ersten Kapitel beiseitezulegen; für Jagdmethoden und Familienstruktur der hiesigen Ureinwohner brachte Keitel ungefähr so viel Interesse auf wie für papuanische Cricketergebnisse. Doch dann war er in Morris’ Bericht auf eine Passage gestoßen, die ihn elektrisiert hatte: »Die Tulai ernähren sich vor allem von Fladen, die sie aus dem Mark der Sagopalme herstellen. Auch Schlangen und Exemplare des Grauen Kuskus (Phalanger orientalis) stehen auf ihrem Speiseplan. Zu festlichen Anlässen servieren sie ferner eine auberginenartige Frucht, welche Chatwa genannt wird. Sie wurde mir anlässlich der Hochzeit eines Häuptlingssohns serviert und gehört zweifelsohne zum Schmackhaftesten, was ich auf meinen bisherigen Reisen gekostet habe. Ich wage sogar zu sagen, dass die Chatwa das Köstlichste ist, was ich in meinem ganzen erfüllten Leben überhaupt je genießen durfte.«
Keitel war ausgebildeter Karpologe – ein auf Früchte und Pflanzensamen spezialisierter Botaniker. Eine Frucht namens Chatwa war ihm jedoch gänzlich unbekannt. Umgehend hatte er den Autor des Buches kontaktiert. Professor Morris war bereits emeritiert, erinnerte sich aber noch lebhaft an Geschmack und Aussehen der mysteriösen Frucht, die er Keitel am Telefon als »ungeheuer würzig und unbeschreiblich köstlich« beschrieb.
Der Karpologe hatte daraufhin alle ihm zugänglichen Datenbanken durchsucht – ohne Ergebnis. Die Frucht, von der Morris schwärmte, war der Fachwelt völlig unbekannt. Die Entdeckung hatte jene fiebrige Euphorie bei Keitel ausgelöst, die sich immer dann einstellte, wenn er eine neue Frucht, Knolle oder Wurzel aufspürte. Diesmal war seine Aufregung allerdings ungleich stärker als sonst. Früchte oder Beeren, die kein Botaniker je zu Gesicht bekommen hatte, waren kaum noch zu finden. Essbare Novitäten waren noch viel seltener und galten in seinem Job bereits als Hauptgewinn. Wenn sie aber in die Kategorie »ungewöhnlich wohlschmeckend« fielen, dann war das der Jackpot.
Keitel fischte eine Marlboro aus seiner Hosentasche. Einen Jackpot könnte er in der Tat gut gebrauchen. Seit er vor drei Jahren in den Anden eine nussartige Frucht namens Paro entdeckt hatte, die inzwischen in den USA und Europa als Vitaminbombe und Anti-Aging-Wunder galt, hatte er nur noch Kleinkram aufgetrieben – eine Wasserkresse aus Kambodscha, die sich als Salatgarnitur verwenden ließ; eine bläuliche Kastanie aus China, die ungewöhnlich viel Calcium enthielt. Das waren willkommene Neuerungen für die ewig nach originellen Zutaten gierenden Restaurantchefs in Tokio, Paris oder Los Angeles. Aber nichts, was das ganz große Geld verhieß.
Vor ihm rief Sekou etwas in einer Sprache, die Keitel noch nie zuvor vernommen hatte. Er blickte auf und sah drei Männer, die ihnen aus dem Busch entgegenkamen. Das mussten Tulai-Krieger sein. Sie hatten ihre nackten Körper mit schwarzem Schlamm eingerieben und darüber mit weißer Farbe eine aus V-Linien bestehende Verzierung aufgetragen, die Keitel an das Hahnentritt-Muster englischer Tweed-Jacketts erinnerte. Alle drei waren nackt, abgesehen von Holzröhren, die über ihre Penisse gestülpt waren. Jeder der Wilden trug mehrere kurze Wurfspeere in der Hand.
Nach einem kurzen Gespräch mit Keitels Guide machten die drei Tulai kehrt und bedeuteten den Fremden, ihnen zu folgen.
»Was haben sie gesagt, Sekou?«, rief Keitel.
»Sie uns bringen zu Häuptling. Sie sagen, Ratu Koca erfreut von Besuch.«
»Klar ist er erfreut«, knurrte Keitel. »Bei all dem, was wir mitschleppen, macht er das Geschäft seines Lebens.« Das Tulai-Stammesgebiet lag derart abgeschieden, dass es nicht einmal mit den auf Papua-Neuguinea allgegenwärtigen Flugzeugtaxis zu erreichen war. Teil des Deals, den er im Vorfeld über Mittelsmänner mit dem Häuptling ausgehandelt hatte, war eine umfangreiche Warenlieferung, für deren Transport er insgesamt acht Träger hatte anheuern müssen. Auf ihren Rücken schleppten die Männer Kostbarkeiten aus der fernen Zivilisation durch den Dschungel: Kochtöpfe, Messer, Angelhaken – aber auch mehrere aufziehbare Radiogeräte, die ohne Batterien funktionierten, sowie eine Palette Cherry-Cola. Auf Letztere hatte Ratu Koca ganz ausdrücklich bestanden.
»Hast du sie nach der Chatwa-Frucht gefragt? Haben sie ausreichend Exemplare gesammelt? Und auch eine Pflanze ausgegraben, wie abgemacht?« Sekou antwortete nicht, sondern nickte nur. Keitel begann, trotz der Hitze zu frösteln. Er hatte alles in allem wohl fünfzig- oder sechzigtausend Dollar in diese Expedition investiert, der Löwenanteil entstammte seiner Privatschatulle. Wenn die Sache schiefging, war seine bisher recht vielversprechende Karriere als Foodscout vermutlich zu Ende.
Nach einem Fußmarsch von einer weiteren halben Stunde erreichte die Gruppe eine kleine Lichtung. Zur Linken ragten drei hölzerne Hütten empor, die auf Pfählen errichtet worden waren. Zur Rechten befand sich auf dem fest gestampften Boden ein Lager, das mit Bastmatten ausgekleidet war. Dort saßen rund fünfzehn Tulai und musterten die Besucher mit einer Mischung aus Neugier und Ehrfurcht.
»Ist das der Häuptling?«, fragte Keitel und richtete seinen Blick auf einen älteren, weißbärtigen Mann, der in der Mitte des Lagers saß. Auf seinem Kopf saß ein hoch aufragender Strohhut voller bunter Federn, seine muskulösen Arme und sein Oberkörper waren mit gelber Farbe bemalt. »Ja, das ist Chef«, erwiderte Sekou.
Keitel lächelte, ging einige Schritte auf Ratu Koca zu und verneigte sich dann. »Ich grüße den ehrenwerten Häuptling und freue mich, mit ihm Geschäfte machen zu dürfen.« Während Sekou die Höflichkeitsfloskeln übersetzte, sah Keitel sich verstohlen um. Halb im Gebüsch versteckt, entdeckte er, was er erhofft hatte: In einer Art Holztrog lagen Dutzende Früchte, die bläulich schimmerten. Sie hatten die Form von Auberginen, waren jedoch deutlich größer, so lang wie ein Unterarm. Die Chatwa-Frucht. Exakt so, wie Professor Morris sie beschrieben hatte.
Sekous Stimme riss Keitel aus seinen Gedanken. »Häuptling bittet euch, sich zu ihm zu setzen.« Der Amerikaner nahm neben dem lächelnden Häuptling Platz und forderte die Träger mittels Gesten auf, ihre Rucksäcke zu öffnen. Dann zeigte er Ratu Koca die Tauschgüter. Der Häuptling begutachtete die Waren und wies einen seiner Untertanen an, ihm eine Cherry-Cola zu reichen. Ratu Koca öffnete die Dose und nahm einen Schluck. Bevor er die warme Limonade hinunterschluckte, presste er die Cola mehrfach von der einen in die andere Backe. Dabei schaute er wie ein kritischer Sommelier, der sich der Qualität eines besonders teuren Bordeaux versichert. Ratu Koca lächelte – das künstliche Kirscharoma schien seinen Gaumen zu überzeugen. Nachdem der Häuptling seine Degustation beendet hatte, brach Keitel das Schweigen. »Sekou, sag ihm, dass ich von der langen Reise etwas hungrig bin und gerne eine Chatwa probieren würde.«
Als der Häuptling das Wort Chatwa hörte, gab er einer hinter ihm sitzenden Frau einen Befehl. Kurz darauf legte diese ein großes Blatt vor Keitel auf den Boden. Auf dem provisorischen Tablett lagen vier Chatwas, die der Länge nach halbiert worden waren. Offenbar hatte man die Früchte über einem offenen Feuer geröstet. Keitel griff eine und biss hinein.
Er musste sich beherrschen, um den Bissen nicht sofort wieder auszuspucken. Das weiche Fruchtfleisch hatte die Konsistenz einer überreifen Avocado und einen bitteren, öligen Geschmack. Keitel verzog das Gesicht, woraufhin Ratu Koca und seine Untertanen wissende Blicke austauschten und zu kichern begannen.
Der Häuptling unterhielt sich kurz mit Sekou. Der übersetzte für Keitel: »Mister USA zu ungeduldig, meinen Ratu Koca. Er sagt, Chatwa man isst nicht so.« In diesem Moment brachte eine weitere Frau eine Schale mit einer dampfenden, gelblichen Paste. Der Häuptling gestikulierte und griff nach einer der Fruchthälften. Er nahm ein kleines Stück Baumrinde, das neben der Schale lag, und strich damit etwas von der gelblichen Substanz auf die Chatwa. Dann bot er Keitel die präparierte Frucht an. Der griff danach und biss hinein.
Erst als Sekou an seiner Schulter rüttelte, bemerkte Keitel, dass ihm Tränen die Wangen hinunterströmten. Die Frucht in seiner Hand war zur Hälfte verschwunden. »Alles okay, Sir?«
»Ja, alles okay, Sekou.« Keitel biss ein weiteres Stück Chatwa ab. »Es geht mir sehr gut.« Der letzte Satz ging in seinem Schluchzen unter.
1
Von der kleinen Terrasse des »Deux Eglises« hatte Xavier Kieffer einen hervorragenden Blick auf die Straße, die sich vom Europaviertel auf dem Plateau de Kirchberg hinab in Richtung Clausener Unterstadt schlängelte. Es war bereits später Nachmittag, doch kaum ein Auto war zu sehen. Kieffer seufzte und wandte sich, mit einem feuchten Tuch bewaffnet, den Holztischen zu, die im Außenbereich der Gaststätte aufgestellt waren.
Das »Deux Eglises«, dessen Koch und Besitzer er war, galt vielen EU-Beamten als beliebter Treffpunkt. Auf der mit Verwaltungsgebäuden gespickten Anhöhe im Osten der Stadt gab es lediglich einige überteuerte Spesenritterlokale zweifelhaften Rufs sowie eine Cafeteria, die bereits um halb sechs schloss. Kieffers Lokal am Hang des Kirchbergs lockte deshalb viele fonctionnaires an, die auf dem Heimweg noch eine Kleinigkeit essen oder ein Glas Rivaner trinken wollten.
Das war insofern erstaunlich, als Kieffer sich standhaft weigerte, all den zugezogenen Deutschen, Briten oder Spaniern kulinarisch auch nur einen Zentimeter weit entgegenzukommen. Tapas oder Schnitzel suchte man auf der Karte seines »Zwou Kierchen« vergebens. Der in seinen feinschmeckerischen Überzeugungen etwas starrsinnige Kieffer servierte seinen Gästen stattdessen unverdrossen moselfränkische Klassiker wie Judd mat Gaardebounen, Friture de la Moselle und sein persönliches Leibgericht: vor Fett triefende Gromperekichelcher, Luxemburger Kartoffelpuffer.
Kieffer säuberte alle Tische auf der Terrasse – machte sich allerdings wenig Hoffnung, dass an diesem Abend viele Gäste kämen. Vielleicht würden später ein paar Einheimische auftauchen und exotische Spezialitäten wie Kuddelfleck oder Träipen bestellen, die er nicht auf der Karte hatte, auf Nachfrage aber gerne zubereitete. Ansonsten aber würde Kundschaft heute Abend Mangelware sein. Nicht einmal sein Freund und Stammgast Pekka Vatanen würde sich blicken lassen. Auch der war, wie alle wichtigen Luxemburger EU-Beamten, in Brüssel, wo diese Woche das Europäische Parlament zusammentrat.
Auf dem Kirchberg herrschte wegen der Sitzungswoche Grabesstille. Dort war unter anderem der EU-Parlamentsdienst ansässig, der dafür zuständig war, die Abgeordneten mit Zahlen und Fakten zu munitionieren. Die meisten Mitarbeiter waren den Deputierten nach Brüssel gefolgt, wo die Ausschüsse des Parlaments tagten. Die wenigen Zurückgebliebenen nutzten die Abwesenheit ihrer Vorgesetzten, um bereits nach dem Mittagessen still und heimlich die verwaisten Büros zu verlassen.
Erst in der nächsten Woche kam der EU-Wanderzirkus wieder nach Luxemburg. Dann würde sich auch das »Deux Eglises« wieder mit zahlungskräftigen Deutschen, Litauern und Italienern füllen. Bis dahin blieb Kieffer nichts anderes übrig, als ein bisschen aufzuräumen, die Buchhaltung zu erledigen und seine Bestände an Nahrungsmitteln, Gewürzen und Wein zu überprüfen. Vor allem Letzteres war an einem sonnigen Septembertag wie diesem eine durchaus erfreuliche Perspektive für den weiteren Abend.
Er wischte gerade den letzten Tisch ab, als Claudine die Terrassentür öffnete. Die junge Frau schaute nervös. Claudine arbeitete seit vier Jahren als gardemanger in seiner Küche. De facto konnte sie jedoch alles zubereiten, was auf der Speisekarte stand. Kieffer hatte geplant, ihr an diesem Abend die Küche zu überlassen und sich mit den Bestelllisten sowie einer Flasche fruchtigen Auxerrois’ auf die sonnenbeschienene Terrasse zu setzen. Als Claudines Blick den seinen traf, ahnte er, dass daraus nichts werden würde.
»Wir haben einen Gast, den du dir besser mal anschaust, Xavier.«
»Warum? Ist etwas Besonderes an ihm? Gehört er zur großherzoglichen Familie? Oder, noch schlimmer, zur EU-Kommission?«
Claudine rollte mit den Augen. »Ich glaube, es ist ein Kritiker. Er sieht so aus. Franzose, übellaunig, mustert die Karte wie ein Buchprüfer.«
Kieffer setzte die Stühle ab und sah sie überrascht an. »Ist er mit dem Auto gekommen? Hast du seinen Wagen überprüft?«
»Ja, natürlich. Ein großer Peugeot, französisches Nummernschild.«
»Département?«
»38. Isère.«
Kieffer nickte bedächtig und zündete sich eine Ducal an. Viele Franzosen rümpften die Nase über die Luxemburger Küche, da sie ihnen als zu vulgär, zu derb oder anders gesagt: als zu deutsch erschien. Dennoch waren französische Gäste im »Deux Eglises« keine Seltenheit. Meistens wiesen die Nummernschilder ihrer Autos jedoch den Pariser Départementcode auf, die 75. Oder die 67 für Straßburg.
Aus dem Verwaltungsbezirk Isère und seiner Hauptstadt Grenoble verirrte sich hingegen kaum jemand in das abgelegene Restaurant. Touristen oder durchreisende Geschäftsleute kamen selten hierher. Das Gros der Ausflügler blieb in den Touristenfallen am Place d’Armes kleben; und selbst die abenteuerlustigen unter ihnen, die von der ville haute in die ville basse hinunterfuhren, landeten in jenen kleinen hippen Brasserien, die sich um die restaurierte Brauerei in der Mitte des Unterstadtviertels Clausen angesiedelt hatten.
Kieffers Restaurant zu finden war ohne fundierte Ortskenntnisse nahezu unmöglich. Laufkundschaft hatte er deshalb keine, und selbst mit dem Auto war sein Spezialitätenlokal schwer zu erreichen. Es lag zwar nur ein paar Hundert Meter von der Innenstadt entfernt. Doch aufgrund der steil abfallenden Felswände, die Luxemburgs Ober- und Unterstadt voneinander trennten, musste man zunächst das Stadtzentrum verlassen und auf den östlich des Zentrums gelegenen Kirchberg fahren, um dann durch eine unscheinbare Durchfahrt neben der Philharmonie auf ein abschüssiges Sträßchen namens Milliounewee zu gelangen, das sich den steilen, zugewucherten Hang hinunter ins Alzettetal wand.
Diese Serpentinenstraße endete nach einigen Hundert Metern vor einem kleinen mittelalterlichen Stadttor, das für größere Autos kaum passierbar war. Hatte sich der Fahrer durch das Nadelöhr gezwängt, ging es nur noch im Schritttempo weiter; der Weg am Hang wurde nun noch schmaler und war zudem unbeleuchtet, sodass man vor allem abends leicht die zwei kleinen blauen Laternen verfehlen konnte, welche die Einfahrt zum Parkplatz markierten.
Kieffer zündete sich noch eine Zigarette an. Niemand schneite zufällig hier herein, und das Nummernschild des Peugeot war höchst verdächtig. Jedermann wusste, dass das Gros französischer Leasingfahrzeuge und Mietwagen eine 38 auf dem Nummernschild hatte, weil der größte Autoverleiher Frankreichs dort seine Pkws zuließ. Jeder Gastronom wusste zudem, dass die Tester der beiden großen Gourmetführer, Guide Gabin und Levoir-Brillet, Firmenwagen mit einer 38 fuhren, meistens solche von Peugeot.
»Na denn, Claudine«, sagte Kieffer und trat seine halb gerauchte Ducal aus. »Op an d’Schluecht!«
2
Kieffers Restaurant befand sich in einem dreistöckigen Steinhäuschen, das mit seinem Holzschindeldach, den Schießscharten und der eisenbeschlagenen Eichenpforte wie ein kleines Kastell aussah. Während der napoleonischen Besatzung im 19. Jahrhundert hatten die Franzosen das Gebäude am Hang errichtet, um ihren Wachsoldaten Unterschlupf zu gewähren und nach feindlichen Truppen Ausschau zu halten.
Das eigentliche Restaurant war im Erdgeschoss untergebracht, die Küche befand sich im ersten Stock. Dort stand Xavier Kieffer nun an seinem Platz neben dem Speiseaufzug und wartete auf das Klingeln, das die Ankunft der kleinen Kabine ankündigte. Als es schellte, öffnete er die Klappe und nahm eine kleine Klemmtafel heraus, auf der ein handgeschriebener Bestellzettel befestigt war.
»Was will er?«, rief Claudine aus dem hinteren Teil der Küche, ohne von der Arbeitsplatte aufzusehen, auf der sie mit einem großen Messer in atemberaubender Geschwindigkeit Karotten in hauchdünne Juliennestreifen verwandelte.
»Einen Salat.«
»Nur einen Salat?«
Kieffer sah auf den Zettel, auf dem Jacques die Bestellung des mysteriösen Franzosen vermerkt hatte. Mit einem Kugelschreiber hatte der Kellner eine Reihe von Abkürzungen darauf gekrakelt: »2 Sal, 3 Bou, C4 Pat, 17 Civ m. Grom, 26 Que«. Kieffer kannte seine Speisekarte auswendig. Aus der Bestellung ergab sich folgendes Menü:
Grüner Salat
Bouneschlupp
Rieslingpaschtéit
Civet de lièvre, façon luxembourgeoise
Quetscheflued mat Vanilleglace
»Er möchte eine Bohnensuppe, dann die Pastete, danach Hasenpfeffer und zum Dessert Zwetschgenkuchen.«
»Er ist ein Tester, ich sag’s dir.«
»Oder er hat einfach Hunger und kennt unsere Portionen nicht.«
Kieffer ließ Claudine mit ihren Juliennes alleine und stieg die steile Steintreppe in den Schankraum hinunter. Inzwischen waren noch drei weitere Gäste eingetroffen, ansonsten war das Lokal leer. Er griff nach einer Weinkarte und hielt sie seinem Kellner Jacques fragend hin. Der schüttelte den Kopf.
Kieffer klemmte sich die Karte unter den Arm und ging auf den Tisch des mutmaßlichen Gastrokritikers zu. Der Mann, der an einem Ecktisch auf einer Holzbank saß, hatte zurückgegeltes schwarzes Haar und blickte Kieffer durch eine etwas altmodische braune Hornbrille an. Er mochte um die 40 sein und trug ein blaues Button-Down-Hemd, ein schokoladenfarbenes Cord-Jackett sowie eine englische Regimentskrawatte. Ein Franzose, dachte Kieffer, der den englischen Landadeligen mimt? Das kann ja heiter werden.
Weil er sich angesichts dieser Erscheinung ein Grinsen ohnehin nicht verkneifen konnte, setzte Kieffer lieber gleich sein breitestes Chefkoch-Lächeln auf. »Bonsoir, Monsieur. Möchten Sie einen Blick in unsere Weinkarte werfen?«
»Ja, gerne«, sagte der Franzose – in einem Tonfall, der das Gegenteil von Interesse verriet. Er nahm die geöffnete Karte entgegen, schaute gelangweilt auf die aufgeschlagene Seite, um sie dann umgehend zuzuklappen. Er musterte Kieffer. »Was würden Sie denn empfehlen?«
»Zu Ihrer Haupt- und Vorspeise würde ein Mosel-Riesling passen, sagen wir, ein Wormeldanger Stiercherg. Zu dem Hasenpfeffer vielleicht ein roter …«
»Was für Spätburgunder haben Sie denn?«, unterbrach ihn der Franzose, der nun, ohne Kieffer eines weiteren Blickes zu würdigen, wieder in der Weinkarte zu blättern begonnen hatte.
»Ich hätte einen Schengener Markusberg.«
»Akzeptabel.«
»Und zum Dessert dann vielleicht eine Mirabelle, Monsieur?«
»Aus welcher Brennerei?«
»Tasselbach, bei Septfontaines, 5000 Flaschen im Jahr, schwer zu bekommen. Meiner Ansicht nach der Beste.«
»Hmmm. Na gut, bringen Sie ihn mal.«
Na gut. Kieffer merkte, wie es in ihm zu brodeln begann. Er besaß ein dickes Fell, und es war nicht einfach, ihn zu beleidigen – außer bei zwei Punkten. Das Erste, was er nicht ausstehen konnte, war ein rüder, herablassender Tonfall. Das Zweite, was ihn auf die Palme brachte, waren Zweifel an der Qualität der von ihm verwendeten Produkte. Er mochte vielleicht nur ein kleines Restaurant betreiben, und seine Speisekarte bestand aus relativ schlichten Klassikern. Aber wenn es etwas gab, worauf er stolz war, dann war es die Auswahl seiner Zutaten.
Kieffer investierte viel Zeit und Energie in entsprechende Recherchen. Dazu gehörten ausgedehnte Streifzüge durch Feinschmeckerregionen wie das Lyonnais oder das Luxemburger Moseltal. Er hatte in seinem Leben sicherlich an die 80 verschiedene Mirabellenschnäpse probiert, und Tasselbacher war der beste. Der Mann vor ihm hatte schlichtweg keine Ahnung. Kieffer atmete tief durch und sagte: »Mit Vergnügen, Monsieur, vielen Dank.«
Verärgert ging er zurück in seine Küche, um nach dem Hasenpfeffer zu schauen. Falls der Franzose tatsächlich ein Restauranttester sein sollte, dann galt es, ihm ein ordentliches Menü vorzusetzen, auch wenn er ein Gimpel war und ein Unsympath obendrein. Vermutlich traf das ohnehin auf die meisten Tester zu. Kieffer öffnete den Ofen und warf einen Blick auf die casserole, in der die marinierten Hasenstücke zusammen mit Räucherspeck, Perlzwiebeln und Rotwein vor sich hin köchelten. Eigentlich musste er sich wegen des Gastrokritikers keine Sorgen machen. Seine Stammkunden kamen schließlich nicht wegen eines Eintrags im Guide Gabin, und sie würden auch in Zukunft kommen. Aber verärgern wollte er den Kritiker, wenn er schon einmal hier war, deshalb natürlich auch nicht. Da ging es ihm einfach um seine Ehre als Koch.
Selbst wenn der Tester von seinem Huesenziwwi angetan sein sollte, würde das kaum Folgen für das »Eglises« haben. Kieffer war sich völlig im Klaren darüber, dass sein kleines Restaurant es niemals in den Gabin oder den Levoir-Brillet schaffen würde. Er hatte seine Lehre im »Renard Noir« in der Champagne absolviert, einem Ein-Sterne-Restaurant, dessen Chef später sogar einen zweiten Stern ergattert hatte. Deshalb kannte er die Kriterien, die französische Gastroführer anlegten, gut genug, um zu wissen, dass sein Restaurant eigentlich nicht in deren Raster fiel.
Die Befähigung, etwas Köstliches zu kochen, war eine Sache. Aber Sternekoch zu werden war nicht nur eine Frage des Talents. Es setzte vor allem die Fähigkeit voraus, allabendlich ein außergewöhnliches Brimborium zu veranstalten. Edle Einrichtung, teures Geschirr und ein Weinkeller von der Größe der Luxemburger Kasematten waren unumgänglich. Vor dem Essen galt es ausgefallene amuse-gueules zu servieren, zum Kaffee filigrane petits fours. All das war unabdingbar, wenn man einen Gabin-Stern begehrte. Für die notwendigerweise komplexen, vielgängigen Menüs brauchte ein Sterneaspirant zudem eine Armada von sous-chefs, sauciers, pâtissiers und weiteren Postenköchen. Ferner eiserne Disziplin, Organisationstalent und eine autokratische Persönlichkeitsstruktur. Kieffer musste an seinen Lehrmeister denken, den Renard-Chef Paul Boudier. Der Alte war ein fürchterlicher Tyrann. Seinen Mitarbeitern hatte der Franzose immer wieder eingebläut, was er von ihnen erwartete: »Bedingungslos gehorchen sollt ihr, präzise meine Rezepturen befolgen und euch eure eigenen kulinarischen Ideen in den Arsch stecken.«
Das war nichts für Kieffer. Sterneköche konnten sich nicht den halben Abend mit einer Flasche Riesling zu ihren Gästen setzen. Bodenständiges wie Bouneschlupp oder Gromperekichelcher war auch nicht drin. Da kochte Kieffer lieber so, wie er eben kochte, in seinem kleinen Lokal mit einem Dutzend Gerichte auf der Karte, einer Handvoll Mitarbeitern, ganz ohne Sterne oder Häubchen. Aber warum war dieser Gastrokritiker dann hier? Was hatte der Mann bloß in seinem Restaurant verloren?
»Paschtéit fir Dësch véier«, rief Claudine und riss Kieffer aus seinen Gedanken. Er nahm den Hasen aus dem Ofen und musterte den Teller, den Claudine an den Pass, den Abnahmeplatz, gestellt hatte. Zwei dünne Scheiben Rieslingspastete in Teigkruste lagen darauf, nebst einer Salatgarnitur und einem ordentlichen Klecks Soße aus pürierten Maronen und Honig. Die Pastete war eine specialité de la maison. Kieffer war ziemlich stolz auf das Rezept, das er selbst immer wieder verfeinert hatte. Er ging zu Claudines Posten, tauchte einen kleinen Löffel in die Maronensoße und probierte noch einmal. Dann nickte er zufrieden und stellte den Teller in den Aufzug.
Gut zehn Minuten später klingelte das Küchentelefon.
»Xavier, er sagt, er möchte ein Päuschen machen, kannst du den Hauptgang schieben?«
»Geht. Mochte er die Pastete?«
»Er hat beide Scheiben aufgegessen und die ganze Soße aufgetunkt.«
Das musste nichts heißen. Soweit Kieffer wusste, waren Gabin-Tester gehalten, die Gänge nicht nur zu probieren, sondern alles komplett aufzuessen. »Was macht er jetzt?«
»Er steht vor dem Lokal, neben seinem Auto, und telefoniert.«
Kieffer stellte den Hasen warm. Er verschob das Andicken der Soße und begann stattdessen automatisch, seinen Posten zu kontrollieren. Zwar erwartete er an diesem Abend kaum Kundschaft, doch das war kein Grund, bei der Organisation seines Arbeitsplatzes nachlässig zu werden.
Wie jeder Profikoch war Kieffer äußerst eigen, was seine mise en place anging. »Es ist dein Werkzeugkasten, es ist das A und O«, hatte ihn Boudier einmal vor versammelter Mannschaft heruntergeputzt, als Kieffers Posten nicht in Ordnung gewesen war. »Wenn er durcheinander ist, kochst du durcheinander.« Boudier hatte natürlich recht gehabt; die mise en place war die Voraussetzung für fast alles andere. Ein hervorragendes médaillon de veau et foie gras au raisin – eines von Kieffers Lieblingsgerichten – zuzubereiten, verlangte neben guten Zutaten nur ein wenig Geduld und eine Prise Talent. 60 Portionen davon binnen einer Stunde zu servieren, war ohne perfekte Vorbereitung hingegen unmöglich. Wenn man nicht genau wusste, wo sich welche der benötigten Zutaten befanden, war man in einer Restaurantküche verloren. Spätestens nach der dritten oder vierten Sechsertisch-Bestellung ging dann alles den Bach runter, völlig egal, wie begnadet ein Koch sein mochte.
Das Gleiche galt für Köche, die in der Vorbereitung schluderten und gängige Zutaten nicht in ausreichender Menge vorhielten. Wenn die Bestellungen auf ein Team einprasselten wie Granaten, dann blieb keine Zeit, Gemüse für einen mirepoix zu würfeln oder auf die Schnelle das Rosinensößchen für die Kalbsmedaillons herzustellen. Alles musste schon griffbereit dastehen, portioniert, abgemessen, vorgewürzt, mise en place.
Kieffer überprüfte zunächst seine Schüsseln. Rechts neben seinem Herd standen zwölf quadratische Edelstahlbehälter, parallel in zwei Reihen angeordnet. Sie enthielten grobes und feines Meersalz; schwarzen und weißen Pfeffer; Zucker; tomates concassées; Petersilienchiffonade, süßes Paprikapulver; kleine getrocknete Chilis; karamellisierten Knoblauch; ferner Zitronenschnitze und -zesten. Nachdem er die Metallbehälter kontrolliert hatte, öffnete er sechs Tupperdosen, die neben den Schüsselchen standen. Darin waren frische Kräuterzweige: Lorbeer, Thymian, Rosmarin und Minze, außerdem chapelure und Mehl. Er nickte zufrieden und ließ den Blick über seine Arbeitsfläche streifen. Sie bestand aus zwei Plastik-Schneidebrettern, die auf feuchten Küchentüchern ruhten, damit sie nicht verrutschten. Daneben lagen drei japanische Edelstahlmesser, ein kleines Schälmesser, ein großes Allzweck-Küchenmesser sowie ein breitklingiges Santoku. Alle drei hatte Kieffer am Morgen mit einem feuchten Wetzstein geschärft. In der Schublade unter der Arbeitsfläche warteten diverse Fonds, die er gestern in vierstündiger Arbeit hergestellt hatte: heller und dunkler Hühnerfond; zwei Fischfonds, die wie heller und dunkler Wackelpudding aussahen; Kalbs- und Rindsfonds sowie gewürfelte Butter und beurre marnie, eine Art halb gefrorene Mehlschwitze, mit der man Soßen andicken konnte. Alles wartete in acht säuberlich mit Deckeln verschlossenen Plastikbehältern auf seinen Einsatz. Nachdem Kieffer zum Schluss noch seine Vorräte an Öl, Essig, Wein und Noilly Prat überprüft und für ausreichend befunden hatte, wandte er sich wieder dem Hauptgang zu. Der französische Engländer hatte nun lange genug pausiert.
Zunächst briet er für die Garnitur einige Pilze in Speck an. Dann holte er die casserole aus dem Ofen. Timing war jetzt wichtig. Sobald er den Bratensaft passiert hatte, würde er Johannisbeergelee, kalte Butter und zerstoßene Lebkuchen hinzufügen. Binnen weniger Sekunden würde die Soße dadurch eine sämige Konsistenz bekommen. Dann musste der Hasenpfeffer schnell auf den Tisch. Just als Kieffer zum Spitzsieb griff, klingelte das Küchentelefon. »Sag mir jetzt nicht, dass die Vier noch länger mit dem Huesenziwwi warten will. Ich bin schon bei der Soße.«
»Vergiss den Hasen. Ich … er …«
»Was ist los, Jacques? Ist er abgehauen?«
»Nein, er ist tot, Xavier.«
3
Von seinem Platz hinter der Theke konnte Kieffer beobachten, wie zwei in weiße Overalls gekleidete Forensiker der Police Judiciaire den Riesling, die Kräuterbutter und das Besteck von Tisch Nummer vier in kleine Plastiktütchen verpackten. Sein Kellner wurde derweil von einem der Beamten befragt. Der Franzose hatte sich laut Jacques nach dem Verlassen des Lokals neben seinen vor dem Haus geparkten Wagen gestellt und dort ein etwa fünfminütiges Telefonat geführt. Danach war er wieder ins Restaurant zurückgekehrt.
Kaum hatte der Franzose die Türschwelle überschritten, war er tot zusammengebrochen. Jacques stand unter Schock. Er war gerade dabei gewesen, dem Mann aus dem Mantel zu helfen, als dieser der Länge nach vornüberkippte. Die Leiche lag noch immer im Eingangsbereich des Restaurants. In kurzen Abständen zuckten Lichtblitze durch den lang gezogenen Speiseraum – ein Polizeifotograf war gerade dabei, sämtliche Details des Tatorts zu fotografieren.
Das »Zwou Kierchen«, ein Tatort. Kieffer hätte jetzt gerne einen Obstbrand von Tasselbach getrunken oder besser gleich zwei. Aber er hielt sich zurück. Zuerst wollte er mit dem Kommissar sprechen. Der Polizist saß seit etwa 20 Minuten mit dem aschfahlen Jacques an einem Tisch am anderen Ende des Restaurants, stellte eine Frage nach der anderen und machte sich Notizen.
Nach weiteren fünf Minuten erhob sich der Kommissar und kam auf Kieffer zu. »Didier Manderscheid, gudden Owend.« Der etwas zu kurz geratene, junge Beamte trug einen modisch schmal geschnittenen Anzug ohne Krawatte sowie ein keckes Menjou-Bärtchen und hatte seit seiner Ankunft noch nicht ein einziges Mal gelächelt. »Was können Sie mir über den Toten sagen, Monsieur Kieffer?«
»Nicht viel, Monsieur le Commissaire. Kein Stammkunde. War zum ersten Mal hier.«
Manderscheid entnahm seiner Jackentasche eine bereits gestopfte Pfeife und hielt ein Streichholz an den Kopf. Er setzte sich auf einen der Barhocker und schmauchte bedächtig. Nach einigen Zügen legte Manderscheid die Pfeife weg, faltete betont langsam seine Hände und sah den Koch prüfend an. »Sie wissen also nicht, wer der Mann ist und für wen er arbeitet? Gearbeitet hat?«
Kieffer beschloss, lieber gleich mit seinem Verdacht herauszurücken – es hatte wenig Sinn, den Ahnungslosen zu spielen. »Nein. Aber eine Vermutung habe ich.«
»Alors?«
»Wir vermuteten, dass er ein Restauranttester ist. War.«
»Warum?«
Kieffer erzählte Manderscheid von dem Nummernschild.
»Sie haben ein gutes Näschen, Haer Kieffer. Nach Angaben unserer Kollegen in Paris heißt der Tote Agathon Ricard, ist 42 Jahre alt und arbeitet für den Guide Gabin, der Ihnen sicherlich ein Begriff ist.«
»Natürlich.«
Der Gabin war nicht irgendein Restaurantführer. Das blaue Buch galt unter Gourmets als Bibel der guten Küche. Die Zentrale des Gabin befand sich in Paris, selbstverständlich, und von dort aus schickte der Guide seine Tester in alle Welt, um die besten Restaurants, die raffiniertesten Zubereitungen und die brillantesten Köche ausfindig zu machen. Für gewöhnliche Restaurants war im Gabin kein Platz, auch für gute nicht – die Tester des Gourmet-Imperiums, allesamt Besseresser mit geschulten Gaumen, interessierten sich nur für Top-Küche. Einmal im Jahr veröffentlichte der Gabin eine aktualisierte Ausgabe, und die gesamte Branche fieberte dem Erscheinungstermin entgegen. Wer einen, zwei oder gar drei Sterne verliehen bekam, musste sich um Reservierungen fortan keine Sorgen mehr machen. Wer von den Gourmetpriestern des Gabin hingegen exkommuniziert wurde, verlor nicht nur sein Gesicht, sondern auch den Großteil seines Umsatzes.
»Ein Gabin-Tester ist hoher Besuch für ein …«, Manderscheid deutete mit der Hand auf den leeren Schankraum und machte eine Kunstpause, »… kleines Restaurant wie dieses, nicht wahr?«
Kieffer zuckte mit den Achseln und deutete auf ein Foto an der Wand, das ihn zusammen mit zwei Mitgliedern der Luxemburger Herrscherfamilie zeigte. »Vergangenes Jahr waren Erbgroßherzog Guillaume und sein Bruder hier. Das würde ich als hohen Besuch bezeichnen.«
Manderscheid schien die flapsige Antwort nicht zu gefallen. »Herr Kieffer, in Ihrem Restaurant ist ein Mensch gestorben. Und der Polizeiarzt bezweifelt, prima facie, dass ihn aus heiterem Himmel der Schlag getroffen hat.«
»Sie meinen, er wurde ermordet?«
Manderscheid senkte seine Stimme wieder etwas. »Ich meine gar nichts. Die Obduktion steht noch aus. Aber wohlgenährte Männer um die vierzig wie Ricard fallen relativ selten mausetot um, wenn man nicht ein wenig nachhilft. Dass ein Gastrokritiker des berühmtesten Gourmetführers der Welt nach einem Dinner in Ihrem Restaurant zusammenbricht, sieht nicht gut für Sie aus.«
»Soll das etwa heißen, Sie verdächtigen mich?«
Manderscheid zuckte mit den Achseln. »Mir mussen Iech verdächtegen. C’est la routine.«
Kieffer schnaubte. »Das ist doch lächerlich. Warum sollte ich einen Tester vergiften?«
»Weil er eine vernichtende Kritik über Ihr Restaurant zu verfassen gedachte?«, schlug Manderscheid vor.
»Deshalb soll ich ihn ermordet haben? Der Gedanke ist absurd – außerdem hat er seinen Vorspeisenteller leer gegessen und die ganze Soße aufgetunkt. Es scheint ihm also geschmeckt zu haben, prima facie, wie Sie wohl sagen würden. Also sah es nicht so übel für uns aus, oder? Als Nächstes hätte ich ihm den Hauptgang serviert, Huesenziwwi, eine unserer Spezialitäten. Der beste Hasenpfeffer, den Sie in der ganzen Stadt bekommen können. Warum sollte ich den Mann vergiften, bevor er den probiert hat? Außerdem ist ein Laden wie unserer gar nicht auf dem Radar von … wie war sein Name?«
»Agathon Ricard.«
»Genau. Wir passen gar nicht in Ricards Beuteschema.«
»Wie meinen Sie das?«
Kieffer griff unter den Tresen und holte die in kobaltblaues Leder gebundene Benelux-Ausgabe des Guide Gabin hervor. Er schlug den Luxemburg-Teil auf und schob das Buch zu Manderscheid hinüber. »Schauen Sie. Der Gabin testet weltweit Tausende Restaurants pro Jahr. Es gibt etwa 1500, die mit Sternen ausgezeichnet werden, davon derzeit 13 in Luxemburg, hier: Das ›Corioli‹ hat zwei Sterne, ›L’Université‹ drei.«
»Was hat das mit dem toten Tester zu tun?«
»Verstehen Sie nicht? ›Deux Eglises‹ ist im Sterneverzeichnis des Guide überhaupt nicht aufgeführt. Das war es noch nie und wird es auch nie sein, egal wie gut unser Hasenpfeffer schmeckt. Diese Tester haben einen sehr vollen Terminkalender. Sie müssen täglich Gaststätten besuchen. Die schon mit Sternen ausgezeichneten Betriebe werden sogar mehrmals im Jahr kontrolliert. Diese Leute haben keine Zeit, einfach mal so in einem gutbürgerlichen Restaurant essen zu gehen.«
Manderscheid legte einen Finger über seine Oberlippe. »Sie wollen mir also sagen, so jemand kommt nicht zufällig in Ihrem abseitig gelegenen Gasthof vorbei, sondern nur auf Weisung oder Empfehlung?«
Kieffer fühlte, wie ihm mulmig wurde. Manderscheid traf den Nagel auf den Kopf. Auswärts zu speisen war für Gastrokritiker stets eine Pflichtveranstaltung; sie gingen nur selten zum Spaß in Restaurants. Ebenso wie Profiköche waren sie froh, an ihren freien Tagen in ihrer eigenen Küche ein schnödes Käsebrot essen zu können. Jemand musste Ricard zum Besuch des »Eglises« geraten haben. Aber wer?
»Das … liegt nahe«, antwortete er zögernd, »aber ich wüsste nicht, wer mich empfohlen haben sollte.«
In diesem Moment trat einer der Forensiker an Manderscheid heran und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Dann drückte er dem Kommissar eine kleine Tüte in die Hand, die dieser unter der Theke verschwinden ließ.
»Monsieur Kieffer, ich hoffe, Sie verstehen, dass ich Sie bitten muss, Luxemburg nicht zu verlassen.«
»Ich muss aber regelmäßig nach Frankreich und Belgien, wegen der Einkäufe.«
»Ich befürchte, wir werden Ihre Küche auseinandernehmen und alle Ihre Lagerbestände überprüfen müssen. Solange die Spurensicherung damit beschäftigt ist, müssen Sie ohnehin schließen.«
»Wie lange wird das dauern?«
»Mindestens drei Tage, vielleicht auch länger. Und bitte kommen Sie morgen Nachmittag aufs Präsidium.« Manderscheid strich seinen Notizblock glatt und erhob sich.
»Eine Sache noch, Monsieur Kieffer. Hätten Sie freundlicherweise eine Karte des ›Zwou Kierchen‹ für mich?«
»Sicher«, sagte der Koch und griff in eine Schublade, um dem Kommissar eine seiner auf marmoriertem braunen Büttenpapier gedruckten Visitenkarten auszuhändigen.
»Haben Sie Ricard auch so eine gegeben?«
»Nein, die gibt es standardmäßig erst mit der Rechnung.«
»Interessant«, sagte Manderscheid und hielt Kieffer den kleinen Plastikbeutel unter die Nase, den ihm der Forensiker gegeben hatte. Er enthielt eine etwas verbogene Visitenkarte des »Deux Eglises«. »Somit stellt sich allerdings die Frage, wieso die hier in seinem Auto lag.« Dann steckte der Kommissar seine Pfeife in den Mund, drehte sich um und ging auf die Tür zu. »Äddi, Haer Kieffer.«
4
Kieffer griff nach Pekka Vatanens gläsernem Schwenker und schenkte ihm Eau de Vie nach. Dann goss er sich selbst zwei Fingerbreit des Birnenbrands ein. »Ich weiß nicht recht, was ich jetzt tun soll, Pekka.«
»Du kannst erst mal gar nichts machen. Die Polizei ist am Zug.« Der Finne blinzelte in die Abendsonne. »Ein feiner Tropfen. Trink aus, das beruhigt.«
Kieffer musterte seinen Freund. Vatanen war Mitte vierzig und hatte semmelblondes, schütteres Haar. Obwohl das Wetter seit mehreren Wochen wunderbar spätsommerlich war und die Sonne fast den ganzen Tag schien, hatte der Finne sich eine beinahe leichenartige Büroblässe bewahrt. Nur Wangen und Nase waren etwas gerötet. Kein Sonnenbrand, sondern die geplatzten Äderchen eines Kampftrinkers, dachte Kieffer. Das Obstlerglas des Finnen war schon wieder fast leer.
Kieffer selbst schwirrte nach dem dritten Schnaps bereits ein wenig der Kopf, und er war dankbar für die kühle Brise, die vom Fluss herüberzog. Kieffers Haus in der Tilleschgass war wunderbar gelegen – oder, wie Vatanen es auszudrücken pflegte, eine »bodenlose Frechheit«.
Das gedrungene Steinhäuschen mit der Nummer 27a war über 300 Jahre alt und lag eingeklemmt zwischen der kleinen, mit Kopfsteinpflaster ausgelegten Gasse im Herzen des Unterstadtviertels Grund und dem Fluss Alzette, der hinter dem Gebäude entlangfloss.
Von der Tilleschgass aus konnte man zwischen den dicht aneinandergedrängten Gebäuden nicht hindurchgucken, und auf der anderen Seite des Flusses gab es keine ans Ufer angrenzende Straße. Die Hinterseite des Gebäudes war deshalb vor den neugierigen Blicken der zahllosen Touristen geschützt, die täglich mit Kameras bewaffnet durch den mittelalterlichen Stadtteil stapften.
Der Garten hinter Kieffers Häuschen war eine stille Oase, in der er und Vatanen gerne stundenlang saßen, vesperten, zechten und dem Rauschen der Alzette lauschten. Das Haus hatte Kieffer von seinem Vater geerbt, er selbst hätte sich eine Immobilie in Flusslage niemals leisten können. Es befand sich schon seit Generationen im Besitz der Familie.
Kieffer stellte sein Schnapsglas kopfüber auf den Tisch, zum Zeichen, dass er erst einmal genug hatte. Vatanens Blick hingegen war noch glasklar, wie üblich. Kieffer war immer wieder erstaunt, welch unfassbare Mengen an Alkohol der hagere Mann in sich hineinschütten konnte. Der Obstler des Finnen war inzwischen verschwunden. »Schenk uns nach, mein Freund.«
»Erst, wenn ich etwas zu beißen habe«, erwiderte Kieffer. »Sonst haut es mich um.« Er erhob sich von der Gartenbank, die zwischen zwei struppigen Büschen an der von der Abendsonne warmen Wand seines kleinen Häuschens stand und ging durch die Gartentür in die Küche.
Rasch stellte er dort einige Happen zusammen – französische Oliven, einige saucisses, ein Baguette und ein Glas confit de moulard. Kieffer packte alles mit einem Stück Räucheraal und einigen frisch gepflückten Tomaten aus dem Garten auf ein Tablett und ging zurück zu Vatanen.
»Kippis!«, rief der Finne, was so viel wie prost bedeutete. Dann stürzte er einen weiteren Obstler hinunter. »Ahh, sehr gut. Diese Leckereien verschaffen uns eine gute Basis für den Rest der Flasche.« Vatanen ließ ein Stück Fisch in seinem Mund verschwinden, während er sich und Kieffer mit der anderen Hand nachgoss. »Und nun erzähl.«
»Das meiste weißt du schon. Hast du den Artikel im ›Wort‹ gesehen?«
»Gesehen ja, aber nicht gelesen, er ist auf Deutsch. Sag mir, was drinsteht.«
Kieffer griff nach der aktuellen Ausgabe des »Luxemburger Worts«, die unter der Bank lag. Ausländer waren über die führende Zeitung des kleinen Landes mitunter verwundert, weil sie Artikel in unterschiedlichen Sprachen enthielt. Einige waren auf Französisch verfasst, andere auf Hochdeutsch und im Lokalteil verwendete das »Wort« mitunter Lëtzebuergesch, den moselfränkischen Dialekt der Einheimischen. Dieses bunte Sprachgewirr wirkte auf Auswärtige verwirrend, weil man beim Lesen ständig zwischen drei verschiedenen Sprachen hin und her wechseln musste; für Luxemburger war das ganz normal.
»Wieso lernst du nicht langsam mal Deutsch, Pekka? Du bist jetzt seit acht Jahren hier. Die Sprache könnte vielleicht ganz nützlich sein. Wenn du Deutsch sprächest, müsste ich außerdem deinen entsetzlichen französischen Akzent nicht mehr ertragen.«
»Keine Lust«, sagte Vatanen, während er mit konzentrierter Miene Confitbrocken auf ein Stück Baguette transferierte. »Ihr Luxemburger sprecht doch alle Französisch, das reicht mir. Ich habe bereits dieses Genäsel gelernt und außerdem Schwedisch, Russisch und Englisch. Ich finde, das reicht fürs Leben.«
»Als Beamter der Europäischen Union könntest du etwas mehr Interesse für die Sprache eures größten Mitgliedstaats aufbringen.«
»Als EU