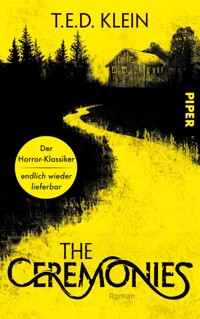
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein wiederentdeckter Klassiker in neuer, hochwertiger Ausstattung: »The Ceremonies« ist ein Meilenstein des Horror-Genres, der den Vergleich zu den Werken Stephen Kings nicht scheuen muss. Eigentlich wollte Jeremy Freirs sich für den Sommer aufs Land zurückziehen, um an seiner Doktorarbeit zu schreiben. Doch er merkt schnell, dass die Bewohner des verschlafenen Dorfes Gilead einer religiösen Sekte angehören und seltsame Rituale befolgen. Jeremy wird immer tiefer in die Ereignisse verstrickt, bis in der Sommerhitze ein uraltes Grauen erwacht, das nicht aus dieser Welt stammt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »The Ceremonies« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Die Zitate auf den Teile-Titeln »Fünftes Buch«, »Sechstes Buch«, »Achtes Buch«, »Neuntes Buch« und »Zehntes Buch«stammen aus: Arthur Machen, Die weißen Gestalten. Erzählungen, übersetzt von Joachim Kalka, Piper 1993.
Das Zitat auf dem Teile-Titel »Zweites Buch« stammt aus: Arthur Machen, Botschafter des Bösen, übersetzt von Joachim Kalka, Piper 1993.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Dagmar Hartmann
© T. E. D. Klein 1984
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»The Ceremonies« bei Viking Press, New York 1984
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Erstmals erschienen im Goldmann Verlag, München, unter dem Titel »Morgengrauen«
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Guter Punkt, München, Markus Weber und Mi Ha unter Verwendung von Motiven von iStock / Getty Images Plus
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorbemerkung des Autors
Prolog
Weihnachten
Erstes Buch
Vorzeichen
Erster Mai
Vierundzwanzigster Juni
Fünfundzwanzigster Juni
Zweites Buch
Poroth-Farm
Sechsundzwanzigster Juni
Neunundzwanzigster Juni
Dreißigster Juni
Erster Juli
Drittes Buch
Der Ruf
Zweiter Juli
Viertes Buch
Der Traum
Dritter Juli
Vierter Juli
Sechster Juli
Fünftes Buch
Die Weiße Zeremonie
Siebter Juli
Achter Juli
Neunter Juli
Zehnter Juli
Sechstes Buch
Die Grüne Zeremonie
Elfter Juli
Zwölfter Juli
Dreizehnter Juli
Vierzehnter Juli
Fünfzehnter Juli
Sechzehnter Juli
Siebtes Buch
Der Altar
Siebzehnter Juli
Achtzehnter Juli
Neunzehnter Juli
Zwanzigster Juli
Achtes Buch
Die Prüfung
Einundzwanzigster Juli
Zweiundzwanzigster Juli
Dreiundzwanzigster Juli
Neuntes Buch
McKinney’s Neck
Vierundzwanzigster Juli
Fünfundzwanzigster Juli
Sechsundzwanzigster Juli
Siebenundzwanzigster Juli
Zehntes Buch
Die Scharlachrote Zeremonie
Achtundzwanzigster Juli
Neunundzwanzigster Juli
Dreißigster Juli
Einunddreißigster Juli
Epilog
Weihnachten
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorbemerkung des Autors
OFTWIRDGESAGT …
Doch warum flüchte ich mich gleich mit der allerersten Zeile in eine derart vage und passive Formulierung? Weil die Feststellung, die darauf folgt – so denn das Netz eine verlässliche Quelle darstellt –, annähernd einem Dutzend bedeutender Namen zugeschrieben wird, von Leonardo da Vinci bis W. H. Auden.
Also dann, wiederholen wir’s: Oft wird gesagt, dass ein Kunstwerk nie fertig ist, nur verlassen. Und wenngleich ich dieses Buch keinesfalls aus fester Überzeugung als Kunstwerk bezeichnen würde, wurde es definitiv verlassen – tatsächlich ein bisschen früher, als mir lieb gewesen wäre. Ich war spät dran – typisch spät dran, wie manche sagen mögen – mit der Abgabe des Manuskripts; und einige Wochen oder auch Monate danach verpasste ich den Termin des Verlags fürs Einreichen der Druckfahnen. Ich weiß noch, dass ich während der Fahrstuhlfahrt hinauf zu den Büros von Viking in der buchstäblich allerletzten Minute Korrekturen auf die letzten Seiten kritzelte. (Immerhin bin ich einigermaßen erstaunt darüber, den Roman überhaupt abgeschlossen zu haben, wenn ich daran denke, seinerzeit außerdem das Twilight Zone-Magazin herausgegeben zu haben.)
Über diverse andere Probleme hinaus wurde die gebundene Erstausgabe nie ordentlich lektoriert oder Korrektur gelesen, was höchstwahrscheinlich den von mir verursachten Verspätungen geschuldet war. Bevor ich das Buch nun also, nach fast 40 Jahren, ein zweites Mal in die Welt hinausschicke, habe ich versucht, sowohl hier und da auftauchende Stellen, die mir inzwischen unbeholfen geschrieben vorkommen, als auch ein paar Fehler und Unstimmigkeiten zu verbessern. Obwohl ich bezweifle, dass diese Veränderungen irgendjemandem außer mir selbst auffallen würden, bin ich mit der aktuellen Version weitaus glücklicher.
Eine Sache, die ich nicht in Angriff genommen habe, war allerdings das Bemühen, den Roman zu modernisieren. The Ceremonies wurde erstmals 1984 veröffentlicht, doch die Erzählung, aus der das Buch erwuchs, wurde Anfang der 1970er-Jahre geschrieben. Dementsprechend spielt das Buch in einer Welt vor dem Handy und dem Internet, und die Orte, die darin beschrieben werden, haben sich bis heute stark verändert, wenn auch keinesfalls zum Besseren. Die Einstellungen das betreffend, was als gefährlich gilt (Zigaretten, Sonnenbräune), haben sich ebenfalls gewandelt; wie auch Gehälter, Lebensmittelpreise und Mietkosten. Man könnte sogar behaupten, die Vergangenheit sei ein fremdes Land … wenngleich ich glaube, dass auch das schon oft zuvor gesagt wurde.
Stellen Sie sich mal vor, keine Laptops! Keine Tablets! Ich lade Sie hiermit ein, in jene fremde, entschwundene Welt zurückzukehren.
Prolog
Weihnachten
Der Wald stand in Flammen.
Eine Wand aus Rauch und Feuer erstreckte sich von einem Ende des Horizonts bis zum anderen, färbte den Nachthimmel rot und löschte die Sterne aus. Jegliche Vegetation verdorrte, wurde augenblicklich verzehrt; krachend stürzten riesige Bäume zur Erde, sterbende Götter angesichts eines wütenden Sturmes, und das Getöse ihrer Zerstörung glich dem Brüllen von tausend Winden.
Sieben Tag lang wütete das Feuer ungehindert. Niemand war da, der ihm hätte Einhalt gebieten können; niemand hatte es ausbrechen sehen, abgesehen von den verschreckten Stämmen der Mengo und Unami, die entsetzt aus ihren Hütten geflohen waren. Einige von ihnen behaupteten, gesehen zu haben, wie am Abend des Ausbruchs ein Stern vom Himmel gefallen und mitten im Wald niedergegangen sei. Andere erklärten, ein Blitz sei die Ursache gewesen, wieder andere, eine sonderbare rote Flüssigkeit sei brodelnd aus der Erde hervorgequollen.
Vielleicht hatte keiner von ihnen recht.
Sei es deshalb, wie es ist: Die hier aufgezeichneten Ereignisse nahmen ihren Anfang, wie sie eines Tages auch enden werden …
Als Geheimnis.
Endlich wurden die Flammen durch eine Nacht beständig niedergehenden Regens erstickt. Die Morgensonne erhob sich über einem Königreich aus Asche, einem verwüsteten grauen Land, in dem kein einziger Baum mehr stand, keine Spur von Leben auszumachen war – mit Ausnahme einer verkohlten uralten Pappel genau im Zentrum. Sie war der höchste Gegenstand meilenweit.
Der Baum war tot. Aber zwischen seinen Zweigen, verborgen hinter Schwaden von Rauch, der noch immer aus der Erde aufstieg, lebte etwas: etwas, das weitaus älter war als die menschliche Rasse und dunkler als eine riesige, sonnenlose Höhle in einer Welt jenseits der tiefsten Tiefen des Alls. Etwas, das atmete, Pläne schmiedete, spürte, wie es starb, und sterbend dennoch weiterlebte.
Es befand sich außerhalb der Natur, und es war allein und namenlos. Hoch über dem rauchenden Grund wartete es, schwarz vor der Schwärze des Baumes. Das Feuer hatte seinen Leib verwüstet; ein Glied war von den Flammen verschlungen worden. Wo einst der Kopf gewesen war und etwas anderes, einem Gesicht Ähnliches, befand sich jetzt eine zerfallende Masse von der Form und Farbe eines Stückchens Holzkohle. Doch noch immer klammerte es sich ans Leben wie an den Zweig, um den sich seine Klauen krallten. Überleben war eine Sache der Berechnung; es gab noch etwas, das es erledigen musste, bevor es starb. Die Zeit war noch nicht gekommen, aber es hatte Geduld. Es schloss sein eines noch existierendes Auge und schickte sich an zu warten. Seine Zeit würde kommen.
Der Planet drehte sich; der Mond nahm zu und wieder ab; die Vegetation kehrte zurück, bahnte sich hungrig ihren Weg durch die Asche. Der vernarbte Ort auf dem Angesicht des Planeten verlor sich unter einem Baldachin aus Grün, und erneut ragten die Bäume aufrecht und hoch empor, um das Sonnenlicht einzufangen.
Nur in einem kleinen Hain in der Nähe des Zentrums konnte man etwas Sonderbares ausmachen. Das Laub war hier weniger dicht, und die Bäume selbst waren kürzer, rauer, merkwürdig verstümmelt wie die Artverwandten am Gipfel des Berges. Einige hatten sonderbare Formen angenommen, ihre Stämme waren in unzählige verzweigte Arme zersplittert, sie waren gekrümmt oder unnatürlich angeschwollen wie die Körper ertrunkener Tiere. Und blies ein Westwind vom Meer herüber, der das Dach des Waldes in einen Ozean aus rauschenden Blättern verwandelte, dann machte diese Bewegung vor dem Hain halt.
Die Erde selbst hatte sich hier verändert. Des Nachts schien sie zu glühen, als würde das Feuer noch immer in ihr wüten. Hin und wieder stiegen dünne Rauchfähnchen aus der Erde auf, an den Wurzeln und blattlosen Stämmen entlang bis hinauf zu den Baumwipfeln, verdunkelten diese ebenso wie den Himmel.
Die Indianer wagten sich nur selten in diesen Teil des Waldes, ja, sie vermieden es sogar, davon zu sprechen, nachdem eine Frau, die dort Feuerholz gesammelt hatte, beschrieb, was sie gesehen hatte, jenes Ding, das in dem toten Baum mitten im Hain kauerte.
Für dieses Etwas gab es kein Wort in ihrer Sprache. Aber sie fanden eines für den Hain, in dem es sich zu warten entschlossen hatte. Maquineanok nannten sie ihn. Den Ort des Brandes.
Ein Jahr verging. Und ein weiteres. Und dann noch einmal fünftausend Jahre. Die Sterne waren stetig auf ihrer Bahn weitergezogen. Aber der Himmel sah jetzt verändert aus.
Ebenso die Oberfläche des Planeten. Die Indianer waren tot, und das Waldgebiet war auf ein Drittel seiner ursprünglichen Größe geschrumpft. Siedler hatten es mit ihren Heimen in Besitz genommen; Ingenieure hatten Straßen gebaut; Bauern hatten den Wald gerodet und Weiden und Felder angelegt. Dörfer waren entstanden; Millionen von Bäumen mussten riesigen Städten weichen.
Hier und dort hatten Relikte des früheren Zeitalters überlebt: verborgene Areale der Wildnis, Gebiete, die noch keines Menschen Fuß je betreten hatte, wo die gewaltigen Bäume noch immer ungestört den Überlebenskampf unter ihresgleichen ausfochten. Doch von diesen unberührten Stellen gab es nur wenige, und auch sie verschwanden schnell; schon bald, im Laufe eines Jahrhunderts, würden der Wald und seine Geheimnisse den Menschen allein gehören.
Dort, wo der alte Wald am undurchdringlichsten war, in dem Gebiet, das die Indianer Maquineanok genannt hatten, waren fünftausend Jahre der Stille vergangen. Doch dann war die erste Bresche in diese Ruhe geschlagen worden, hatte der Hain unter dem fernen Echo der Äxte gebebt; jeden Augenblick nun konnten menschliche Schritte die Stille und Dunkelheit durchdringen.
Und Es wartete noch immer.
Der Knabe hatte sich noch nicht verlaufen, aber er war verwirrt. Er hatte einen Fehler gemacht, als er sich in diesen Teil des Waldes gewagt hatte, um die neuen Schneeschuhe auszuprobieren, die er am Morgen bekommen hatte. Und plötzlich konnte er nicht mehr weiter. Sein linker Schuh saß in dickem Schlamm fest. Überall sonst war die Erde von einer weißen Decke eingehüllt, aber hier wies sie große schneefreie Stellen auf, und der graue Dezemberhimmel spiegelte sich in Pfützen aus geschmolzenem Schnee.
Festen Boden suchend, trat er einen Schritt zurück, strich sich dabei eine helle Haarsträhne aus dem Gesicht und schob sie unter die handgestrickte Wollmütze. Den ganzen Nachmittag über hatte er einen stetigen Wind im Rücken gehabt, aber jetzt hatte er nachgelassen. Bis zu diesem Augenblick hatte er das kaum bemerkt. Er fuhr sich mit der Zunge über die aufgeplatzten Lippen und sah sich um, spitzte die Ohren. Kein Laut war zu hören, außer seinem eigenen Atmen, das in der winterlichen Stille unnatürlich laut schien.
Dieser Wald war – anders. Das sah er jetzt. Nicht nur wegen der schneefreien Stellen. Die Bäume waren hier kleiner und merkwürdig geformt; ein Kreis aus blattlosen Zweigen, so scharf wie Krallen, streckte sich sehnsüchtig nach seinem Gesicht, und viele der Stämme waren zu grotesken Gestalten, Gesichtern aus halb vergessenen Träumen verzerrt.
Mit den Zähnen zog er einen Fellhandschuh aus und bückte sich, um die Bindung der Schneeschuhe zu lösen. Es war schon spät, und er wurde hungrig. Daheim wartete heißer Eierpunsch auf ihn, dazu Kuchen und auf dem bullernden schmiedeeisernen Ofen eine Schüssel mit Weihnachtspudding. Die älteren Mädchen halfen seiner Mutter in der Küche, die anderen sangen Hymnen und Lieder. Seine beiden kleinen Schwestern würden auf dem Teppich neben dem Kamin spielen …
Der dunkle Wald schien sich enger um ihn zu schließen, als wolle er ihm jeglichen Fluchtweg abschneiden.
Er wischte sich den Schmutz von den Beinen und band die Schuhe fester zu. Dann schlüpfte er aus den verschmutzten Schneeschuhen, tat einen Schritt nach hinten und wäre dabei beinahe über die herausragenden Wurzeln einer alten Pappel gestolpert. Blindlings stützte er sich ab …
Mit einem Schrei zog er die Hand zurück. Der Baum hatte sich warm angefühlt wie ein Lebewesen. Doch ein Blick beruhigte ihn, dass es sich bloß um totes Holz handelte: vom Blitz versengt, wie es aussah, oder durch ein Feuer vor Kurzem verkohlt.
Hastig nahm er seine Schneeschuhe und warf sie über die Schulter. Die Pappel hinter sich lassend, trat er den Heimweg in östlicher Richtung an, in die Richtung also, die ihm von den länger werdenden Schatten gewiesen wurde. Er wollte den Hain gerade verlassen, noch unsicher, welchen Weg er einschlagen musste, als ihn ein plötzlicher Impuls veranlasste, sich umzudrehen, und da sah er Es – das monströse, schwarze Etwas, das ihn vom Baum her anstarrte.
Er warf die Schneeschuhe von sich und rannte los.
Er rannte den ganzen Weg heim – fast.
Kurz bevor er das Haus erreichte, fiel der Knabe ins Schritttempo, blieb dann stehen. Er wandte sich um und ging langsam zurück.
Er glaubte, dass er umkehrte, um seine Schneeschuhe zu holen. Er glaubte, er würde sich nicht lange aufhalten, nur um sie dort aufzuheben, wo er sie hingeworfen hatte, ehe er in die Sicherheit seiner Familie zurückhasten würde.
Er irrte sich.
Über Meilen von Schnee und Eis hinweg, durch den düsteren Dezemberwald, war ein Ruf erklungen.
Man hatte ihn herbeigerufen.
Der Knabe erzählte niemandem, was er gesehen hatte. Am nächsten Tag kehrte er noch einmal zurück, magisch angezogen von dem geheimen Ort, um voller Erstaunen und Entsetzen anzustarren, was dort lebte. Wieder rollte das Etwas sein kaltes Auge hoch, starrte ihn an, ohne mit der Wimper zu zucken. Und nichts rührte sich, nicht ein einziges Wort fiel, nichts durchbrach die Stille dieses Waldes.
Am nächsten Tag war es dasselbe.
Und auch am nächsten. Und am übernächsten. Und auch an dem Tag, der diesem folgte.
Am siebten Tag tötete Es ihn.
Anschließend schenkte Es ihm sein Leben zurück – aber entstellt, verdorben. Unwiderruflich verändert. Der Knabe warf sich bäuchlings in den Schlamm und betete Es an.
Das Frühjahr und den Sommer hindurch suchte er Es jede Nacht auf, schaute Es an, sang und brachte ihm Opfer.
Als er das letzte Mal zu ihm kam, sprach Es zu ihm.
Es öffnete seine fleischlosen, schwarzen Kiefer und trug ihm, kurz bevor Es starb, in allen Einzelheiten auf, was er für Es tun sollte.
Erstes Buch
Vorzeichen
Es ist schon lange meine Überzeugung, daß sich das Böse,sollte es menschliche Gestalt annehmen,nicht als schrecklicher Menschenfresser oder in Schwarz gehüllte Erscheinung mit glühenden Augen manifestieren würde, sondern daß esdie Gestalt eines harmlosen, ja selbst freundlichenSterblichen annehmen würde – einer Matronemittleren Alters, eines Schuljungen vielleicht …oder eines kleinen alten Mannes.
Nicholas Keize, Beneath the Moss (Boston: East Side Tract Society, 1892)
Erster Mai
Träge liegt die Stadt in der Sonne. Aus ihrem Herzen ringelt sich ein dünner schwarzer Rauchfaden in den Himmel. Seit fast dreizehn Stunden ist der April vorüber; schon hat sich die Welt verändert.
In einem Park oberhalb des Hudson wartet der Alte, blinzelt mit milde blickenden Augen in die Sonne. Insekten umschwirren den Abfall am Wasserrand, summen in dem Gras neben der Bank. Abgesehen von ihrem Summen, dem Plätschern des öligen Wassers und dem Rauschen vorbeifahrender Wagen ist es im Park still, die Luft von Erwartung erfüllt.
Ein Schrei in der Höhe durchbricht die Stille: drei lange, zitternde Töne …
Dann ist der Vogel fort. Blätter rascheln leise. Der Alte beugt sich vor, hält den Atem an. Bald wird es geschehen.
Eine plötzliche Brise weht vom Fluss herauf; blutrote Blüten liegen zu seinen Füßen. Die Seiten einer alten Zeitung wirbeln auf, enthüllen verwischte Stiefelabdrücke, ein nacktes Bein, einen Schnitt.
Über ihm rauschen die Bäume im Wind. Grünes Aufblitzen: Die Blätter stellen sich auf und weisen alle auf die Stadt. Das Gras neigt sich in eine Richtung.
In der Ferne peitscht die Rauchfahne hin und her, fällt dann in sich zusammen. Die schwarze Spitze schwingt sich zum Himmel auf, teilt sich wie eine Schlangenzunge.
Der Alte leckt sich die Lippen. Es nimmt seinen Anfang.
–
Den ganzen Weg von New York bis hierher hatte Jeremy Freirs über die Farm nachgedacht, während der Bus durch den Abgasdunst des vom Sonntagsverkehr brummenden Lincoln-Tunnel und schließlich, vorbei an Häuserblöcken, Restaurants und Parkplätzen, den Highway entlangbrauste.
Die Annonce hatte verführerisch geklungen. Die Handschrift war sauber und hatte irgendwie mädchenhaft ausgesehen:
SOMMERWOHNUNG
Privatunterkunft auf einer Farm
Ruhige Umgebung. Strom vorhanden
$ 90/Woche einschl. Verpflegung
R. F. D. 1, Box 63, Gilead, N. J.
Bei diesem Preis könnte er sogar noch einen Gewinn erzielen, wenn es ihm gelänge, sein Apartment in der Bank Street den Sommer über unterzuvermieten. Außerdem war eine »ruhige Umgebung« genau das, was er im Augenblick brauchte. Es würde wahrscheinlich ein paar Monate der Trennung bedeuten, aber es wäre dann nicht nötig, die unerlässliche Geburtstagsfeier über sich ergehen zu lassen, auf die seine Freunde so scharf waren. Er würde einfach da draußen auf der Farm feiern, fernab von aller Zivilisation, ganz so wie Thoreau. Es wäre ohne Zweifel gut für ihn, sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren, etwa seine Dissertation, über die er dringend nachdenken musste. Zum Wasauchimmer-Wasauchimmer-Wasauchimmer der Schauerfantasie; sicher würde ihm ein knackiges Thema einfallen, vielleicht was zum Unzuverlässigen Erzähler oder dem Zusammenspiel von Schauplatz und Handlungsträgern. Oder, noch reizvoller, Schauplatz als Handlungstragender … Bis dahin würde er sich gründlich einlesen – die Primärquellen, Sheridan Le Fanu, Matthew Gregory Lewis und der ganze Rest – und sich Notizen für ein Seminar machen, das er nächsten Herbst und, wer weiß, vielleicht auf Jahre hinaus zu veranstalten plante. Jedenfalls war es eine reizvolle Aussicht, den Sommer dort draußen allein mit seinen Büchern zu verbringen.
Er vermisste eine gewisse Laura Rubinstein, die den letzten Sommer über sein Schlafzimmer in der Stadt geteilt hatte, immer noch. Eine Weile hatte er tatsächlich geglaubt, sie könnte seine zweite Frau werden. In seinem Leben hatte es noch ein paar andere Frauen gegeben, aber keine hatte ihm wirklich etwas bedeutet. Vor drei Wochen, an dem Tag, an dem Laura einen alten Freund heiratete, hatte er auf die Annonce hin geschrieben und den heutigen Tag, den ersten Mai, vorgeschlagen, um sich kennenzulernen.
Nach weniger als einer Woche hatte er schon die Antwort erhalten. Drei Fotos waren dem Brief beigelegt, der in derselben mädchenhaften Handschrift geschrieben war.
Lieber Mr Freirs,
mein Mann und ich haben uns sehr über Ihren Brief gefreut. Es wäre schön, wenn Sie am 1. Mai zu uns kommen könnten. Der Sonntagsbus trifft kurz nach zwei in Gilead ein. Man wird Sie gegenüber dem Selbstbedienungsladen absetzen. Das Geschäft ist zwar geschlossen, wenn Sie ankommen, aber davor steht eine Bank, auf der Sie warten können. Mein Mann wird Sie abholen, sobald der Gottesdienst beendet ist. Lange werden Sie bestimmt nicht warten müssen, und wir werden auch dafür sorgen, dass Sie rechtzeitig zur Rückfahrt wieder in der Stadt sind.
Das Gästehaus ist renoviert und ans Stromnetz angeschlossen, und wir werden in alle Fenster neue Scheiben einsetzen. Ein Teil des Gebäudes dient als Lagerraum, aber Sie werden gewiss feststellen, dass die andere Hälfte Ihren Ansprüchen mehr als genügt. Es ist mit allem Notwendigen eingerichtet; etwa ein zusätzlicher Tisch, den Sie als Schreibtisch benutzen können. (Ihre Arbeit hört sich sehr interessant an! Es gab eine Zeit, in der mein Mann und ich ebenfalls Lehrer werden wollten.)
Wir sind keine vornehmen Leute, aber ich kann Ihnen drei nahrhafte Mahlzeiten am Tag versprechen. Unsere Farm ist noch nicht voll in Betrieb (wir haben sie erst im November gekauft), aber bis zum Sommer, denken wir, können wir unsere eigenen Erzeugnisse essen. Wir gehören zeitlebens der religiösen Gemeinschaft der Brethren-Bruderschaft des Erlösersan. Die Gemeinschaft hat Anhänger in der ganzen Welt, aber die meisten Mitglieder konzentrieren sich hier in Gilead und in einigen Siedlungen in Pennsylvania und New York. Sowohl mein Mann als auch ich haben das College außerhalb der Gemeinde besucht. Unseren Glauben wollen wir niemandem aufzwingen.
Wir haben kein Telefon. Wenn Sie also am 1. Mai nicht kommen können, teilen Sie uns das bitte so bald wie möglich schriftlich mit. Sollten wir nichts mehr von Ihnen hören, nehmen wir an, dass Sie kommen, und Sarr wird da sein, um Sie abzuholen. Ich sehe schon, ich wiederhole mich! Also schließe ich hiermit. Ich freue mich schon darauf, Sie kennenzulernen und vom Leben in New York zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
(Mrs) Deborah Poroth
PS: Jeremia ist unser Prophet. Ihr Name erscheint mir daher als ein sehr gutes Omen!
Freirs hatte den Brief während der Fahrt in der U-Bahn gelesen. Er fand den Ton der Frau irgendwie charmant, doch als er die Fotos genauer betrachtete, wurde ihm ganz seltsam zumute.
Es waren Farbfotos, und wäre das nicht der Fall gewesen, hätten sie ebenso gut einem längst vergessenen Album aus ferner Vergangenheit entstammen können. Das erste zeigte eine Sandstraße, von Bäumen gesäumt. Auf einer Lichtung zur Linken lag ein kleines, weißes Haus mit einer offenen Veranda, auf der nichts weiter als zwei grobe Holzstühle standen. Auf einem der Stühle saß eine Frau in einem langen, schwarzen Kleid, das dunkle Haar zu einem Knoten geschlungen, das Gesicht von Schatten verdeckt. Auf ihrem Schoß ruhte ein kleines Kätzchen, und ein zweites lag zu ihren Füßen. Die Frau saß aufrecht auf dem Stuhl und starrte direkt geradeaus. Die Szene strahlte Ruhe und Stille aus wie ein Gemälde von Hopper. Hinter dem Haus befand sich ein winziger eingezäunter Garten. Jenseits der Bäume konnte er ein offenes Feld ausmachen, und an seinem Rand erhob sich dicht und dunkel der Wald.
Das zweite Foto zeigte einen anderen Teil des Feldes, einen Flecken aus rötlicher Erde. Ein schmaler Bach glitzerte am anderen Ende. In der Mitte des Bildes war ein schlanker, bärtiger Mann zu sehen, der steif dastand, einen Rechen in der Hand. Zu seinen Füßen kauerte eine dicke, graue Katze. Er mochte etwa um die vierzig sein. Sein Gesicht war blass und ernst, aber Freirs meinte, den Anflug eines Lächelns in seinen Mundwinkeln zu erkennen, und musste irgendwie an Abraham Lincoln denken.
Das dritte Foto war ein wenig dunkler als die anderen, als sei es kurz vor Einbruch der Dämmerung aufgenommen worden. Am Rand des Bildes konnte man die Rückwand des Farmhauses ausmachen, in der Mitte ein niedriges, graues Gebäude. Es schien zwei Eingänge zu haben.
Über das Dach ragte eine finstere Reihe von Baumwipfeln auf. Die Vorderseite des Gebäudes ging auf den Rasen hinaus; das Gras wuchs bis direkt vor die Tür. Das Mauerwerk auf der Vorderseite war größtenteils von dichtem Efeu verdeckt, der sich bereits über die Fenstersimse ausgebreitet hatte. Die Fenster waren sehr groß und ermöglichten den Blick durch das ganze Gebäude bis zu den Stämmen der massigen Bäume auf der anderen Seite.
Während der Fahrt in der überfüllten U-Bahn hatten ihn die Fotos beunruhigt, ohne dass er hätte sagen können, woran genau es lag.
Die Bilder schienen aus einer anderen Welt zu stammen, von frühen Siedlern oder aus dem rückständigen Maine. Es war kaum zu glauben, dass sie offensichtlich erst kürzlich aufgenommen worden waren, noch dazu an einem Ort, der kaum fünfzig Meilen von New York entfernt war.
Aber Isolation, so erkannte er allmählich, war auch ein Geisteszustand, und ein unbedeutendes kleines Dorf konnte leicht übersehen werden. Freirs hatte gelesen, dass im Mai 1962 ein Reporter der Times eine solche religiöse Gemeinde in der Nähe von New Providence »entdeckt« hatte. Man hatte nie ein Geheimnis um sie gemacht; man hatte sie einfach ignoriert, bis plötzlich eines schönen Morgens die New Yorker ihre Zeitungen aufschlugen, und da war sie: eine Stadt, die noch genauso aussah wie Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als sich die ersten Siedler dort niederließen. Die Religion, die alten Bräuche, besondere Schulen für die Kinder, all das hatte unverändert überlebt. Die Arbeit auf der Farm wurde ausschließlich von Hand getan, jeden Abend versammelte sich der Rat der Stadt, die Frauen trugen noch immer lange Kleider mit hohen Kragen – und all das geschah weniger als dreißig Meilen vom Times Square entfernt.
Und doch waren diese Orte Wirklichkeit. Einige seien einst sogar von hohen Steinmauern umgeben gewesen, hieß es – Orte wie Harmony und Mt. Jordan, Zion und Zarephath, mit Bibellesungen im Radio rund um die Uhr. Orte wie Gilead, sein Ziel.
Kenilworth, Mountainside, Scotch Plains, Dunellen … selbst die Namen schienen aus Romanen zu stammen, verhießen Wasserfälle und Wiesen, auf denen Schafe grasten. Aber die Wegweiser logen, die Bücher hatten gelogen, die Times hatte gelogen; das Land hier war nichts anderes als ein hässlicher Vorort, und vom Bus aus sah Freirs nichts weiter als die graue Monotonie des Highways, die von Zeit zu Zeit von einer Tankstelle, Rasthäusern oder Einkaufszentren durchbrochen wurde.
Im Bus war es heiß, und die Fahrt verursachte ihm langsam Kopfschmerzen. Er schob die Brille hoch und rieb sich die Augen. Die Landschaft langweilte ihn, aber wenigstens konnte er jetzt in der Ferne Hügel und Grünflächen ausmachen. Außerdem war er hungrig, obwohl er erst vor zwei Stunden in seinem Apartment ein riesiges Omelett verschlungen hatte.
Seufzend wandte er sich wieder seiner Lektüre zu. Er hatte sich genügend Lesestoff – fotokopierte Artikel aus Sight and Sound und Cahiers du Cinéma – mitgebracht, um sich vorzubereiten und durch eine weitere Vorlesung an der New School zu mogeln, wo er einen Filmkursus abhielt. Zum Glück war es nicht schwierig, seinen Schülern immer ein wenig voraus zu sein und ihnen ein gutes Dutzend alter Schinken aufs Auge zu drücken.
Der Bus war nahezu leer, und er hatte eine ganze Sitzreihe für sich. Die anderen Fahrgäste erweckten den Eindruck, als stammten sie aus Jersey: Männer mit ausdruckslosen Gesichtern, Frauen in schäbigen Kleidern. Er fragte sich, was sie wohl alle zu erledigen hatten. Aus dem Kofferradio eines rothaarigen jungen Mannes mit einer Tasche der US-Army klang knisternd eine Zeitansage: zwölf Uhr siebenundfünfzig. Der Himmel im Westen war nahezu wolkenlos und tauchte den Bus in hellen Sonnenschein. Es war heiß für Mai; vielleicht eine Vorahnung auf das, was ihn noch erwartete? Die Poroths hatten erwähnt, dass es Strom geben würde. Aber schloss das auch eine Klimaanlage mit ein? Wahrscheinlich nicht.
Allmählich veränderte sich jetzt der Charakter der Landschaft. Es tauchten hier und da gepflegt wirkende Farmhäuser auf, das Land wurde grüner, Asphalt und rostrote Erde blieben im Osten zurück. Aus dem Radio drang, nachdem das elektrisierte Pastorale von Jethro Tull unter einem schrillen, insektenhaften Summen abgestorben war, erneut eine Stimme: »Und Jeremia verließ Jerusalem, um sich ins Land Benjamins zu begeben.«
Sie fuhren tiefer in das Land hinein.
Nie zuvor war er auf dem Land gewesen. Dort, wo er aufgewachsen war, in Astoria im nördlichen Queens, hatte es Spielplätze gegeben, winzig kleine grüne Grasflecken, aber nichts wirklich Natürliches, nichts, was ein Junge hätte erforschen können.
Das einzig offene Gebiet, abgesehen vom La-Guardia-Flughafen, waren der Flushing-Meadows-Park und ein Friedhof ohne Bäume gewesen, auf dem unzählige Leute mit Namen wie Freirs, Freireicher oder Bodenheim begraben lagen.
Wie so viele andere Kinder in New York war er paradoxerweise mit der Vorstellung aufgewachsen, dass er nichts so sehr liebe wie das Land. Phrasen wie »die dunklen Wälder«, »der Urwald«, »die weiten, offenen Flächen« hatten ihn vor Sehnsucht schaudern lassen. Bilder von Farmhäusern und Bergen, sogar ein Poster von Smokey, dem Bären, hatten ihn gerührt. Mit sechs Jahren war er über den Parkplatz hinter dem Haus gelaufen und hatte sämtliche Zigarettenstummel ausgetreten, überzeugt, Waldbrände zu verhindern.
Und jetzt näherte er sich ebendieser Welt, und langsam war er sich nicht mehr ganz so sicher, dass es sich lohnen würde.
Er versuchte sich einen Ort wie Gilead vorzustellen, verborgen im dünner besiedelten Teil des Landes, in einem Gebiet, das aus Wald und Sumpf bestand. Gewiss waren die Bewohner misstrauisch Fremden gegenüber und interessierten sich kaum für ihre Nachbarn. Zum ersten Mal begriff er, wie ein solcher Ort überleben konnte, selbst in einem Land, das so schnell wuchs. Gilead hatte nichts von der Welt draußen zu erwarten und war dieser seinerseits nichts schuldig. Außenstehende hatten keinen Grund, den Ort aufzusuchen, außer sie kamen so wie er – mit einer bestimmten Absicht. Diejenigen, die in die Gemeinschaft hineingeboren wurden, würden sie niemals verlassen; all ihre Freunde und Verwandten hausten direkt neben ihnen. Und so schien das Land dicht verschlossen, Neuankömmlingen unzugänglich – und neuen Ideen wohl auch, wenn man die Religion in Betracht zog, nach der hier gelebt wurde. Das Fernsehen galt womöglich als ein Werkzeug des Teufels. Und nach allem, was er wusste, waren vielleicht sogar Telefone verboten. Die Poroths jedenfalls hatten gewiss keines. Aber selbst wenn sie über einen Anschluss verfügt hätten, was hätte er ihnen genützt, wenn es außerhalb der Gemeinde niemanden gab, mit dem sie hätten telefonieren können? So lebte Gilead wahrscheinlich in seiner selbst gewählten Isolation, folgte seinen eigenen sonderbaren Regeln, bis es im Laufe der Zeit einfach vergessen werden würde – wenn das nicht schon jetzt der Fall war.
Aus dem Radio drang noch immer die Stimme des Predigers, aber obwohl sie Jeremy auf die Nerven ging, wagte er es nicht, den jungen Mann zu bitten, das Radio leiser zu stellen. »Ich habe dich in ein reiches Land geführt, wo du dich an dessen Früchten laben solltest; doch als du es betreten hast, da hast du mein Land entweiht und mein Vermächtnis in eine Abscheulichkeit verwandelt.« Zum mindestens zehnten Mal überlegte er, den Sitzplatz zu wechseln. Der am obersten Stimmpegelrand plärrende Singsang entstammte einem Bibelsender des einige Meilen östlich gelegenen Zarephath, und diese Radiostation schien es ganz besonders mit Jeremia zu haben. Doch irgendwie hatte der schiere Rhythmus der Worte auch etwas Faszinierendes, wenngleich ihre Bedeutung letztlich im Dunkel blieb; es war, als hörte man die Aufnahme einer Hitler-Rede. Außerdem gefiel es ihm, dass in diesem Landstrich Jeremia so beliebt war. Ihm hatte sein Name noch nie sonderlich gefallen – bislang.
Die Poroth-Frau hatte auch eine Bemerkung darüber gemacht. Er fragte sich, was für Leute sie und ihr Mann wohl sein und was sie von ihm halten mochten. Ihr Brief klang jedenfalls so, als sehnte sie sich nach Gesellschaft.
Er langte in die Jackentasche auf dem Sitz neben sich, zog die Fotos hervor und betrachtete sie erneut. Die Frau war eigentlich recht hübsch, und sie schien jünger zu sein, als er zuerst gedacht hatte. Ihr Mann dagegen – ziemlich düster. Aber man musste abwarten. Wieder betrachtete er das dritte Foto. Das Haus sah eigentlich ganz brauchbar aus, und doch rief es abermals eine gewisse Unruhe in ihm wach.
Vielleicht war es der Efeu, der das Haus umrankte, oder das flache Dach oder … ja, das war es – die Fenster. Die Fenster auf der Rückseite. Sie waren zu groß, zu nah an den Bäumen und schienen sich zu einer anderen Welt zu öffnen, einem Zwielicht aus verknoteten Ästen und schemenhaften schwarzen Schatten. Ein Gedanke stieg in ihm auf. Sie bieten keinen Schutz.
Später sollte er sich fragen, was diesen Gedanken in ihm hervorgerufen hatte und wovor er geschützt werden wollte. Aber in diesem Augenblick vergaß er alle Fragen vor der einzigen, alles überwältigenden Überzeugung: Es ist nicht recht, ein Haus so nah am Wald zu bauen.
Sie hatten nun auch Flemington hinter sich gelassen, und der Bus folgte der Hauptstraße in westlicher Richtung. Geschäfte und Verwaltungsgebäude wichen hübschen kleinen Vororthäuschen und gepflegten Vorgärten, die von frisch gepflügten Feldern, Weiden, auf denen Vieh graste, und gelegentlich einem Waldflecken abgelöst wurden. Der Bus bog abrupt nach Norden ab, verließ die Hauptstraße und folgte jetzt einer schmalen Straße, die sich zwischen hohen Hecken hindurchwand, vorüber an halb versteckt liegenden, einfachen Häuschen. Pappelzweige kratzten über die Fahrzeugflanken, Erdefeu und Dornengestrüpp wurden dichter, und als der Bus sich inmitten der Bäume zu verlieren schien, durchfuhr er etwas, das wie die Ruinen einer antiken Steinmauer aussah, und Freirs verspürte das Gefühl, unbefugt in fremdes Privatterritorium einzudringen. Dann wurde die Straße plötzlich breiter und endete an einer anderen, die quer zur ersten verlief. Auf der anderen Seite der Kreuzung stand ein halb verfallenes, weißes Gebäude mit einer breiten Veranda und einem »Post«-Schild neben der Eingangstür. Hinter dem Gebäude und anscheinend damit verbunden, ragte ein hoher, rostroter Silo auf.
Der Bus fuhr langsamer, als er sich der Kreuzung näherte, und hielt schließlich vor dem Gebäude. Freirs konnte drei Benzinzapfsäulen ausmachen und auf einer Seite eine breite Verladerampe. Neben einer der Türen standen ein staubiger kleiner Traktor und ein Anhänger, auf dem sich volle Kornsäcke häuften. Ein leerer Lieferwagen parkte weiter vorn, bei den Tanksäulen, ein anderer im Schatten der Scheune. Beide sahen aus, als wären sie schon Jahrzehnte alt.
Niemand war zu sehen. Die Veranda war leer, abgesehen von einer Holzbank; die Tür war geschlossen, die Schlagläden vor den Fenstern waren verriegelt, der ganze Ort war so ruhig und verlassen wie eine leere Filmstadt. Es gab weder Straßenschilder noch ein Ortsschild, und doch wusste Freirs – noch ehe sich der Fahrer umdrehte und den Namen ausrief –, dass er Gilead endlich erreicht hatte.
Er blieb allein vor dem Laden zurück, in einer Hand sein Jackett und den Umschlag mit den Zeitungsausschnitten. Wie Deborah Poroth bereits gewarnt hatte, war niemand da, der ihn erwartete. Der Bus verschwand hinter der Kurve, und die Stille wurde nur noch vom Summen der Insekten und dem gelegentlichen Schrei eines Vogels unterbrochen.
Freirs hatte nicht erwartet, dass die Stadt so klein sein würde. Was ihn jedoch am meisten überraschte, war, dass es keine Kirche gab. Von dem Punkt aus, wo er stand, konnte er nichts anderes sehen als saubere kleine Häuser, welche die Straße zu beiden Seiten säumten, und Eichen und Ahornbäume. Kein schlanker, weißer Turm, kein goldenes Kreuz unterbrach das Blau des Himmels. Vielleicht wurden die Gottesdienste in einem einfachen Gebäude abgehalten, das irgendwo hinter einer Kurve lag.
Aufseufzend wandte er sich dem Lebensmittelladen zu und stieg die Stufen zur Veranda hinauf. Er setzte sich auf die – wie angekündigt – dort stehende Bank und genoss die Ruhe. Es würde ihm hier gefallen, wenn es auf der Farm ebenso ruhig war wie in der Stadt. Schon bald wurde er schläfrig. Die stundenlange Fahrt im Bus und jetzt hier die Hitze und Einsamkeit, all das verlangte seinen Tribut.
Nach einer Weile stand er auf, schlenderte die Verandastufen hinab und die Straße entlang in Richtung Friedhof. Vielleicht entdeckte er ein paar interessante Grabinschriften. Und wenn die Bewohner es nun nicht mochten, wenn Fremde die Ruhestätte ihrer Ahnen aufsuchten? Aber wahrscheinlich waren die Leute hier in der Gegend stolz darauf, wie weit ihre Familien in die Vergangenheit zurückreichten.
Nachdem er den Friedhof betreten hatte, wanderte er langsam zwischen den Gräbern hindurch und las hier und da die Inschriften auf den älteren Steinen. Die Stille und die Sonne, die auf ihn herabbrannte, machten ihn von Neuem schläfrig. Er schaute zu dem Laden auf der anderen Straßenseite hinüber. Die Tür war noch immer geschlossen; niemand war bisher dort aufgetaucht.
Am Ende der Reihe bückte er sich, um eine Inschrift zu entziffern; der Stein war aus Schiefer und die Schrift fast unleserlich. Es kostete ihn zu viel Anstrengung, sich wieder aufzurichten, er ließ sein Jackett und den Umschlag fallen und streckte sich im Gras im Schatten eines Grabmals aus. Es war der größte Stein in dieser Reihe, eine Säule, deren Spitze unregelmäßig, wie abgebrochen wirkte, und doch schien sie mit Absicht so behauen worden zu sein. Sie schien die Erinnerung an eine ganze Familie wachhalten zu sollen. Er versuchte, die Namen und Lebensdaten zu entziffern.
ISAIAH TROETHANNA TROET
1839–18771845–1877
Sie waren im selben Jahr gestorben. Nun, der Schmerz über den Tod des engsten Angehörigen führte manchmal dazu.
Seine Augen wurden schwer. Er legte sich im Sonnenlicht zurück und blinzelte zu den anderen Namen hinauf, die in den Stein gemeißelt waren.
IHRE KINDER
Ruth1863–1877
Tabitha1865–1877
Amos1866–1877
Absolom1868–
Tamar1871–1877
Leah1873–1877
Tobias1876–1877
Sonderbar. Sie waren alle in demselben Jahr gestorben. Vielleicht ein Unglück. Krankheit, Hochwasser, Hungersnot.
Die Augen fielen ihm zu. Einen Augenblick lang hatte er eine Vision längst Verstorbener mit merkwürdig geschriebenen Namen.
Als der Schlaf ihn übermannen wollte, schoss ihm noch etwas durch den Kopf, das sonderbar war: Sie hatten das Todesjahr für denjenigen ausgelassen, der Absolom hieß. Was mochte das wohl bedeuten? Vielleicht war Absolom in demselben Jahr gestorben, in dem er auch geboren war.
Armes Kind, dachte er noch, dann fiel er in Schlaf.
Wind bläst in Böen über den Hudson, bringt den Geruch von Öl mit sich, von Öl und Feuer, und den süßen Duft ferner Rosen.
Niemand hat es bemerkt – niemand außer der plumpen kleinen Gestalt, die unauffällig am Ende der Bank hockt, einen alten Schirm neben sich. Niemand sonst schaut zu; niemand würde verstehen. Niemand sieht die Muster im Wasser, riecht den Verfall hinter dem Blumenduft oder hört das leise Geräusch, das das Gras macht, als der Wind erstirbt.
Wieder wird die Luft ganz still. Kleine grüne Falter flattern zwischen den Halmen umher; Hornissen umschwirren einen Abfallkorb. Niemand kann ahnen, was geschieht. Der Fluss rauscht am Park vorüber, unbeobachtet; der Planet zieht seine Bahn durch den Weltraum; der kurze, schwarze Schatten des Alten auf der Bank wird länger.
Im Schatten, geschützt vor der Nachmittagssonne, schläft friedlich ein Baby, eingehüllt in eine Decke. In sich zusammengesunken sitzt seine Mutter daneben. Neben ihr am Boden liegt eine Papiertüte, aus der der Hals einer Flasche herausragt. Der Verschluss ist schon vor geraumer Zeit ins Gras gerollt.
Abgesehen von den drei Gestalten auf der Bank ist dieser Teil des Parks fast verlassen. Mit gleichgültigem Gesicht beobachtet der Alte, wie die Insekten nach Nahrung suchen. Eines der Tiere stürzt sich gierig auf etwas im Korb, während ein anderes immer weitere Kreise zieht, bis es schließlich bei der Bank angelangt ist. Über der Flasche verharrt es in der Luft, lässt sich schließlich darauf nieder und verschwindet dann in ihrem Inneren.
Plötzlich verändert sich die Luft; er kann es fühlen. Der Alte flüstert den Zweiten der Sieben Namen und wendet seinen Blick dem Fluss zu, den schattigen Hügeln auf der gegenüberliegenden Seite. Merkwürdige Wolken sind am Horizont aufgetaucht; Teil zwei der Sequenz ist fast vollständig. Aufrecht, bereit, starr vor Erwartung sitzt er auf der Bank. Im nächsten Augenblick … im nächsten Augenblick …
Ein kleiner grüner Falter flattert an seinem Gesicht vorbei und lässt sich auf seinem Handrücken nieder. Die Flügel öffnen und schließen sich, öffnen … schließen … bis sie sich schließlich öffnen und still liegen. Jegliche Bewegung erstirbt.
Am anderen Ende der Bank sinkt der Kopf der Frau nach hinten, als wollte sie im Traum ihre Kehle dem Messer darbieten. Ihr Mund öffnet sich wie eine Rose.
Hoch über ihren Köpfen kreist ein weißer Vogel am Himmel, stürzt plötzlich schreiend zum Hudson hinab.
Die Zeichen sind allgegenwärtig. Es ist Zeit. Der Alte singt sich selbst das Todeslied, die Neun Noten, und bebt vor Erregung. Sein Leben lang hat er darauf gewartet – gewartet, geplant, sich auf das vorbereitet, was er zu tun hat. Jetzt ist der Augenblick gekommen, und er weiß, dass die Jahre der Vorbereitung nicht vergebens gewesen sind.
Der Himmel über dem Park bleibt strahlend blau; gnadenlos brennt die Sonne herab. Aus der leeren Flasche kriecht das Insekt hervor und steigt summend zum Gesicht des Babys hinauf. Mutter und Kind schlafen weiter.
Der Alte betrachtet sie stumm, beobachtet, wie sich die Brust der Frau hebt und senkt, betrachtet das schlafende Kind. Da liegt sie vor ihm in all ihrer Pracht: die Menschheit.
Er hat Pläne für sie.
Und jetzt, nach einem Jahrhundert des Planens und der Einkehr, ist er frei zu handeln; endlich ist die Zukunft klar. Er hat die durchdringenden Schreie der weißen Vögel am Himmel gehört. Er hat die alten Worte gelesen, die in die Steine der Stadt gehauen sind. Er hat die Fäulnis am Rand eines neuen Blattes gesehen und die dunklen Schatten, die wartend hinter den Wolken lauern. Gestern Abend, als er die Geburt des Monats Mai gefeiert hat, als er ernst auf dem Dach seines Hauses stand, hat er den gehörnten Mond gesehen, mit einem Stern zwischen den Spitzen. Es gibt nichts mehr zu lernen.
Er schnippt den Falter von der Hand, langt nach seinem Schirm, steht auf und zertritt den winzigen Körper am Boden.
Das Baby regt sich und öffnet die Augen. Eine Hornisse lässt sich sanft auf einer Wange nieder; die andere summt interessiert um das verschreckt zuckende Augenlid.
Hilflos in der Decke gefangen, versucht das Kind, seine Ärmchen zu befreien. Der kleine Mund öffnet sich im Schrei. Die Frau schläft weiter ihren nichts ahnenden Schlaf.
Der Alte beobachtet sie noch eine Zeit lang. Dann lenkt er seine Schritte lächelnd auf die Stadt zu.
Die Welt hat sich verdunkelt. Eine tiefe Stimme nannte seinen Namen. Freirs schreckte auf, missmutig und ängstlich, und stellte fest, dass sein Kopf im Schatten lag. Einen Moment lang wusste er nicht, wo er war. Eine Gestalt ragte vor ihm auf und versperrte die Sonne.
»Jeremy Freirs?«
Er grunzte zustimmend.
»Ich bin Sarr Poroth. Mein Wagen steht unten auf der Straße.«
Noch ganz benommen kam Freirs auf die Füße und bürstete sich ab. Dann nahm er sein Jackett und die Papiere. Gähnend rieb er sich die Augen hinter der Brille.
»Ich glaube, die Busfahrt hat mich geschafft.«
Er wünschte, er könnte noch schlafen, als er Poroth durch die Reihen der Grabsteine folgte, den Hügel hinab zu einem alten, dunkelgrünen Lieferwagen, der am Straßenrand stand. Der Laden war jetzt geöffnet, und er sah noch mehr Autos und Lieferwagen auf dem angrenzenden Parkplatz. Sie alle glichen den Autos auf alten Fotos. Die Fenster des Ladens und die Veranda quollen jetzt über von Waren, und man konnte in der Ferne das Rattern eines Traktors hören. Der Lärm der Zivilisation. Freirs blinzelte in die Sonne, als er Poroth zum Lieferwagen folgte. Seine Beine waren noch steif vom Schlaf.
Poroth tätschelte die Metallflanke seines alten grünen Wagens, als sei das Fahrzeug ein Tier. »Wohl kaum das, woran Sie gewöhnt sind«, meinte er bedauernd. Freirs erwartete, dass er noch mehr sagen, Erklärungen abgeben, die Eigenschaften des Wagens loben würde. Aber der andere schwang sich einfach auf den Fahrersitz und wartete darauf, dass Freirs neben ihm einstieg.
Poroth fuhr schnell, entweder, weil er Eindruck schinden oder schlicht, weil er schnell heimkommen wollte. Dank der Höhe des Gefährts konnte Freirs die Straße gut überblicken. Bei jeder Unebenheit hüpften die beiden Männer auf den schwarzen Sitzen empor wie Cowboys im Sattel. Mehrfach ertappte sich Freirs dabei, dass er sich am Armaturenbrett abstützte. Aus den Augenwinkeln musterte er Poroth, dessen Haut zwar derb, aber überraschend blass war für einen Mann, der den größten Teil des Tages im Freien in der Sonne arbeitete. Neben dem dunklen Bart wirkte die Haut noch blasser. Der Bart und die Größe des Mannes machten es schwierig, sein Alter zu schätzen. Auf dem Foto hatte er wie vierzig ausgesehen, aber jetzt glaubte Freirs, dass er kaum älter war als er selbst. Was für ein Mensch wäre Poroth wohl, wenn er in der Stadt leben würde? Er versuchte es sich vorzustellen … nein, er passte einfach nicht dorthin; er war zu groß, zu breitschultrig, eindeutig für die Arbeit im Freien bestimmt.
Poroth hatte ihn überhaupt noch nicht nach seinen Interessen, seinen Eindrücken, seinem Leben befragt. Hatte er etwas falsch gemacht? Nahm der andere es ihm übel, dass er auf dem Friedhof geschlafen hatte?
»Als Sie mich dort drüben gefunden haben«, fing er an und musste laut sprechen, um das Motorengeräusch zu übertönen, » …ich hoffe, da ruhen nicht auch Verwandte von Ihnen.«
Zu seiner Überraschung antwortete Poroth nicht sofort, sondern warf Freirs nur einen kurzen Blick zu. »Nun ja, Tatsache ist, dass wir hier irgendwie alle miteinander verwandt sind. Sie wissen schon, ein begrenztes Gebiet mit einer bestimmten Anzahl von Familien. Ein Soziologe würde seine helle Freude haben.«
»Klingt nach Inzest.«
Poroth zuckte mit den Schultern. »Nicht mehr als bei anderen Stämmen. Wir sind ziemlich streng hier. Aber es gibt auch Brethren-Gemeindemitglieder, die außerhalb von Gilead leben. Meine Frau stammt aus Sidon in Pennsylvania.«
»Haben Sie sich am College kennengelernt?«
»Nein, schon Jahre vorher bei einem Fest der Pflanzer. Aber dann haben wir uns erst im College wiedergesehen. Wir sind erst seit sechs oder sieben Monaten hier. Deborah hat sich noch immer nicht ganz angepasst.«
»Ist das so wichtig?«
»Ja, sehr.«
Freirs Interesse nahm zu. »Dann haben sie und ich wohl einiges gemeinsam.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, wir sind beide neu hier.«
Mit gerunzelter Stirn schien der andere darüber nachzudenken. »Da haben Sie wohl recht. Es leben hier ein paar starke Persönlichkeiten in Gilead, und ein paar Leute haben sie noch immer nicht akzeptiert. Es ist alles ein bisschen schwierig für Deborah. Sie versucht im Augenblick immer noch, sich die Familienverhältnisse einzuprägen. Es gibt Gesichter, an die man sich erinnern muss, Namen und Verwandtschaften …«
»Ja, ich habe eine ganze Reihe Namen dort auf dem Friedhof gesehen. Sturtevant, van Meer …«
»Richtig. Und Reid, Troet, Buckhalter …«
»Das war der Stein, bei dem ich eingeschlafen bin«, unterbrach Freirs ihn. »Troet.«
»Ah ja, entfernte Verwandte meiner Mutter. Sie ist auch eine Troet. Aber dieser Zweig der Familie ist inzwischen ausgestorben.«
»Sie scheinen alle zur selben Zeit gestorben zu sein.«
Poroth nickte. »Ein Feuer, glaube ich. Der Herr geht seltsame Wege.« Er verstummte, fügte dann aber noch hinzu: »Ein Feuer war immer eine Gefahr auf dem Land. Heutzutage allerdings leben die Leute hier genauso wie anderswo, sterben auch an denselben Krankheiten – Krebs, Herzschlag, gelegentlich ein Unfall … das Übliche eben. Natürlich leben sie ein paar Jahre länger, bei all der harten Arbeit an der frischen Luft und der gesunden Ernährung mit eigenen Erzeugnissen.«
»Nun, ich habe auch vor, in diesem Sommer hart zu arbeiten, aber mehr auf geistiger Ebene.« Freirs lehnte sich zurück und schlug sich auf den Bauch. »Vielleicht kann ich sogar ein bisschen Gewicht verlieren.«
Poroth lächelte. »Ich sollte Sie warnen. Deborah ist eine gute Köchin. Ich hoffe, Sie können den Versuchungen des Fleisches widerstehen.«
Freirs lachte. »Nicht besser als jeder andere!« Er lachte wieder und blickte zu Poroth hinüber, aber der lächelte nicht mehr.
Sie waren bereits an einer Reihe Ziegelhäuser vorbeigefahren, die dadurch auffielen, dass kein Kinderspielzeug herumlag, keine alten Autowracks herumstanden, keine Blumen die Rasenflächen zierten, wie Freirs es in anderen ländlichen Gegenden gesehen hätte, an denen sie heute vorübergekommen waren. Kinder arbeiteten neben ihren Eltern im Garten, und alle winkten Poroth zu und beäugten Freirs misstrauisch.
»Wie ich sehe, ist die Arbeit am Sonntag nicht verboten«, bemerkte Freirs.
»Im Gegenteil. Wir halten die Arbeit für heilig.«
Sie waren der Straße über eine kleine Anhöhe gefolgt. Auf der anderen Seite kamen sie an einem ausgedehnten roten Farmhaus und einer Scheune vorbei. Vieh graste überall.
»Sieht wohlhabend aus.«
»Verdocks Molkerei. Weitere Verwandte. Lise Verdock ist die Schwester meines Vaters.«
Mit dem Kopf wies er auf ein noch eindrucksvolleres Haus jenseits der Molkerei, am Ende einer langen, baumgesäumten Auffahrt. »Sturtevant«, sagte er. »Bruder Joram hat hier in der Gegend großen Einfluss.«
»Hat Ihr Vater auch eine Farm hier?«
»Nein, er ist vor zehn Jahren gestorben. Und er war nie ein Farmer; er hat das Lebensmittelgeschäft geleitet. Genau wie sein Vater und dessen Vater vor ihm. Jetzt führen die Steeglers den Laden – Bruder Bert und Schwester Amelia. Berts Mutter war eine Stoudemire, was ihn zu … warten Sie, einem Cousin dritten Grades oder so macht.« Er grinste. »Sie sehen, es ist kompliziert.«
»Vielleicht sollte ich einfach alle als eine große, glückliche Familie betrachten.«
Poroth schien das einen Moment lang zu überdenken. Dann nickte er. »Ja, glücklich«, sagte er, ebenso zu sich selbst wie zu Freirs.
So kehrte Poroth also nach Generationen wieder zum Land zurück. Irgendwie war er also genauso neu als Farmer wie Freirs selbst. Es tat gut, das zu hören.
Die Straße verlief jetzt etwas steiler abwärts. Unten angelangt, bog Poroth scharf nach links ab und folgte dann einem kleinen Flusslauf. Durch das offene Fenster konnte Freirs das Rauschen des Wassers hören. »Junge, Junge, ich habe das Gefühl, New York ist tausend Meilen weit entfernt.«
Poroth blickte ihn fragend an. »Und – ist das ein gutes Gefühl oder ein schlechtes?«
»Ein gutes … glaube ich.« Freirs lächelte. »Ich lasse es Sie am Ende des Tages wissen.«
»Was mich angeht – tausend Meilen weit fort, genau da möchte ich es haben. Sogar zweitausend wären mir noch sehr recht.«
»Oh? Wäre es nicht ein wenig unbequem, um hin- und herzufahren?«
»Ich denke schon. Aber, sehen Sie, ich fahre ja nicht hin und her. Ich habe die Stadt vor ungefähr zehn Jahren zum ersten Mal gesehen und bin seither nie mehr dort gewesen.«
»Klingt, als hätten Sie eine schlechte Erfahrung gemacht.«
»Unvergesslich jedenfalls. Ich werde Ihnen mal davon erzählen.«
»Und wie alt waren Sie damals?«
»Warten Sie … gerade siebzehn.«
Dann musste Poroth tatsächlich jünger als er sein. Kaum zu glauben – und kaum zu glauben, dass ein normaler, neugieriger junger Mann so nah bei New York aufwachsen konnte, ohne je in einen Bus zu springen und sich die Stadt anzusehen.
»Die Welt da draußen ist groß und reich, Sarr. Meinen Sie nicht, Sie sollten ihr eine zweite Chance geben?«
Poroth schüttelte den Kopf. »Ich habe schon alles von der Welt gesehen, was ich sehen wollte. Ich bin sieben Jahre lang dort draußen gewesen. Wie viele Jahre haben Sie hier verbracht?«
»Nun, keines natürlich. Aber das ist wohl kaum dasselbe.«
»Da bin ich anderer Ansicht. Sie haben nur eine Seite der Welt gesehen. Ich kenne beide. Aber jetzt bin ich daheim, und es ist ein gutes Gefühl.«
»Und Deborah? Empfindet sie genauso?« Er vermutete bereits, dass das nicht der Fall war.
»Nein, Deborah ist ein wenig … abenteuerlustiger als ich. Und nicht so schnell mit ihrem Urteil, das muss ich ihr zugestehen. Sie war ein paarmal in der Stadt, und ich kann mir nicht vormachen, sie würde meine Gefühle teilen.«
»Dann war es wohl Deborah, die die Anzeige in der Bücherei angebracht hat.«
»In welcher Bücherei?«
»Lindauer, wo ich meine Studien und Literaturrecherchen betreibe. Dort habe ich Ihre Anzeige entdeckt. Am Schwarzen Brett.«
Poroth sah Freirs misstrauisch an. »Das ist unmöglich. Ich habe den Zettel selbst angebracht – an der Bushaltestelle in Flemington. Ich wollte eigentlich niemanden haben, der von so weit her kommt. Sehen Sie, wir haben dergleichen noch nie getan, und da schien es sicherer, mit jemandem anzufangen, der die Gegend bereits kennt. Ich dachte, Sie hätten die Anzeige entdeckt, als Sie einmal durch Flemington gekommen sind.«
»Nein, ich war noch nie hier. Wahrscheinlich hat sie einfach irgendjemand umgehängt.« Er tappte genauso im Dunkeln wie Poroth. »Schicksal.«
Poroth sagte nichts mehr.
Er schwieg immer noch, als ein paar Minuten später der Baumbestand spärlicher wurde und sie an eine Kreuzung kamen. Auf halber Höhe auf einem Hügel am anderen Ufer sah Freirs ein kleines Steinhaus, das von wildem Wein umrankt war. Bunte Blumen trennten das Haus von dem angrenzenden Garten, und terrassenförmige Stufen führten zum Fluss hinab. Eine alte Steinbrücke überspannte dort den Wasserlauf. Freirs hielt automatisch den Atem an, so unsicher wirkte sie, als sie die Brücke passierten.
Auf der anderen Seite verlangsamte Poroth unerwartet das Tempo und umfuhr den Hügel. Das Häuschen oben sah aus wie ein Wachtposten, umgeben von schlafenden Wachen in Form von Blumen.
»Ein hübsches Plätzchen«, lobte Freirs, als sie vorbeifuhren.
Poroth nickte. »Gehört meiner Mutter. Ich hatte erwartet, sie im Garten zu sehen. Für gewöhnlich hält sie sich um diese Zeit dort auf.« Er schaute zum Hof hinüber, suchte nach Anzeichen dafür, dass sie daheim war, und schien leicht beunruhigt, als nichts darauf hindeutete. Aber vielleicht spukte ihm auch noch die Sache mit der Anzeige im Kopf herum.
»Was sind das für Dinger?«, erkundigte sich Freirs und deutete auf ein paar aufrechte Kästen auf Beinen, die im Hof standen, so weit wie möglich vom Fluss entfernt.
»Bienenstöcke. Die hatte sie schon, als wir noch in der Stadt gewohnt haben. Mein Vater und ich sind pausenlos gestochen worden.« In der Erinnerung daran schüttelte er den Kopf.
Die Straße wand sich jetzt landeinwärts. Freirs blickte sich um. Kurz bevor das Haus seinen Blicken entschwand, entdeckte er etwas an einem der Fenster auf der Vorderseite – etwas, das aus der Ferne wie ein Gesicht aussah, das ihnen stirnrunzelnd aus der Dunkelheit nachstarrte.
Mrs Poroth, seit mehr als neun Jahren Witwe, stand oben auf der Treppe und beobachtete, wie der Wagen verschwand. Das Sonnenlicht, das durch die Fenster einfiel, enthüllte harte Züge, eine kräftige Adlernase und ein energisches Kinn, scharfe Falten kerbten sich in die Mundwinkel ein, als habe sie Kummer. Und sie hatte allen Grund dazu. Die Vision war bestätigt worden; ihre Prophezeiung hatte sich als richtig erwiesen. So manche Frau würde geweint haben.
An einem normalen Sonntagnachmittag im Frühling wäre sie draußen im Garten mit ihren Rosen beschäftigt gewesen, aber heute war sie nach dem Gottesdienst in ihr Haus zurückgekehrt und hatte sich ans Fenster gestellt, entschlossen und besorgt, den Besucher zu sehen, den ihr Sohn bringen würde.
Und sie hatte ihn gesehen.
Wie im Traum stieg sie langsam die Stufen hinab, trat aus dem Haus und starrte mit versteinertem Gesicht in den Garten. Es gab zu vieles, über das sie jetzt nachdenken musste, Ereignisse, die zu bedrohlich waren, als dass ihr Geist sie hätte bewältigen können, und so wandte sie sich aus Gewohnheit der Erde, den Pflanzen und dem Wetter zu. Das Leben der Pflanzen war für sie immer interessanter gewesen als das der Menschen. Die Krokusse und Schneeglöckchen waren längst verblüht, aber andere Arten hatten den Höhepunkt ihrer Blüte erreicht: Akelei, deren Blätter den Ängstlichen Mut machten; die zarten Levkojen, mit deren Blütenblättern man weissagen konnte; die Maiglöckchen, die – richtig zubereitet – halfen, ein besseres Gedächtnis zu bewahren.
Nicht, dass sie selbst solcherlei Stützen nötig gehabt hätte. Sie vergaß nichts, fürchtete wenig und sah mehr voraus, als ihr lieb war. In Seiner Weisheit hatte es der HERR für richtig gefunden, sie über alle anderen zu stellen. Er hatte ihr die Schatten der Zukunft gezeigt, hatte sie mit Visionen der Welt gequält, die sie erwartete. Er hatte dafür gesorgt, dass sie niemals lange glücklich sein konnte, ganz gleich, was ihr Gutes widerfuhr.
Es war nicht immer so gewesen. Sie war mit gewissen Gaben geboren worden, wie die Brethren sie nannten, mit einem Talent, den Menschen geheime Gedanken vom Gesicht abzulesen; aber diese Gaben waren bei den Frauen ihrer Familie üblich. Anderen vor ihr war es ebenso ergangen.
Die Troets waren immer mehr Gelehrte als Farmer gewesen, was sie von der Gemeinschaft der anderen trennte; und doch lag ihre Kraft in gewisser Weise tiefer als die der Farmer. Es war merkwürdigerweise immer eine weibliche Stärke gewesen, eine Art Allianz mit den Gesetzen der Natur. Und in jeder Generation hatte es bei den Troets ein oder zwei Frauen gegeben, die mit großer Intuition ausgestattet waren. Mrs Poroth erinnerte sich noch an ihre Großmutter mütterlicherseits, eine verheiratete Buckhalter, aber geborene Troet, die das Wetter mithilfe eines Krähenschreies vorhersagen konnte und von »kleinen Zeichen« sprach, die andere ignorierten. Sie hatte diese Gabe nie erklären können und immer nur achselzuckend gemeint: »Es gibt noch andere Wege, etwas zu erfahren«, wenn ihre Enkelin sie danach gefragt hatte.
Mrs Poroth selbst, so glaubte man, hatte einige dieser Kräfte geerbt; schon als kleines Mädchen hatte sie angefangen zu verstehen. Die Welt konnte durch die Gerüche und Farben der Blumen zu ihr sprechen, durch die Formen von Blättern und Wolken. Aber es war nichts Außergewöhnliches an ihren Talenten gewesen – bis zu dem Sommermorgen, als sie dreizehn Jahre alt war. Am Tag nach der Beerdigung ihrer Großmutter hatte sie ein unwiderstehlicher Impuls gedrängt, die Treppe zum Speicher der alten Frau hinaufzusteigen, wo sie die BILDER gefunden hatte.
Sie waren mit einem Band zusammengehalten worden und lagen unter einem Stapel staubiger Bücher in der dunkelsten Ecke des Raumes. Die Zeichnungen waren schlicht, als hätte ein begabter neunjähriger Junge sie angefertigt. Sie sahen aus, als wären sie mindestens ein halbes Jahrhundert alt, das vergilbte Papier war brüchig und an den Rändern ausgefranst, dabei steif vor Alter.
Ihre Augen hatten sich geweitet, als sie die BILDER betrachtet hatte, und ihr Herz klopfte plötzlich wie rasend. Alles in allem waren es einundzwanzig Zeichnungen, jede auf einem eigenen Blatt, und jede einzelne erfüllte sie auf ihre eigene Art mit unaussprechlichem Entsetzen. Da war ein weißes vogelähnliches Gebilde mit Blut auf der Brust, sterbend; ein Tümpel dunklen Wassers, mit der Andeutung eines Wesens darunter; ein blassgelbes Buch, dick und irgendwie abstoßend; ein niedriger Erdhügel mit merkwürdigen Proportionen, eine rote, teuflisch aussehende Sonne, ein kalter, bedrückender Mond und eine runde, weiße Gestalt vor einem schwarzen Hintergrund, den sie zuerst auch für einen Himmelskörper hielt, einen Planeten oder Mond, bis sie plötzlich schaudernd erkannte, was es wirklich war: ein großes, rundes, lidloses Auge.
Ein paar der BILDER waren so sonderbar, dass sie nicht sagen konnte, was sie darstellen sollten. Wie zum Beispiel das schlanke, schwarze, stockähnliche Ding; und die anderen, die aussahen wie Hunde, aber so seltsam gezeichnet waren, dass sie sich nicht sicher sein konnte; und ein Etwas, das ein zusammengerollter Wurm sein konnte oder aber auch lächelnde Lippen; und eine weitere Gestalt, klein, dunkel, ohne festen Umriss, wie der Versuch eines Kindes, etwas zu zeichnen, von dem es gehört, das es aber niemals gesehen hatte.
Und bei jedem neuen BILD regten sich Erinnerungen; selbst das merkwürdigste der BILDER, die drei konzentrischen Kreise mit dem roten Spalt in der Mitte, schien irgendwie vertraut, und es schmerzte fast, darüber nachzudenken. Und andere waren noch schlimmer: eine entsetzliche, ganz in Weiß gezeichnete Szene, die andere ganz in Schwarz; und ein abscheuliches Ding, das eine Rose sein konnte, aber etwas wie Zähne besaß; und ein Baum mit etwas darin, einem Ding, das böse dreinschaute und winkte.
Sie wusste, dass es ihr winkte. Das Zimmer begann sich zu neigen; sie glitt aus, stürzte, die Welt um sie her drehte sich, zog sie auf das schreckliche Gesicht im Baum zu …
So benommen sie auch gewesen war, besaß sie doch genügend Geistesgegenwart, um die bösen Dinger wieder zu verstecken, sie unter die alten Bücher zu schieben, ehe sie die Treppe hinuntertaumelte.
Als man sie Minuten später bewusstlos auf dem Treppenabsatz fand, wurde vermutet, dass sie gestürzt sei. Man brachte sie ins Schlafzimmer ihrer Großmutter und legte sie auf das Bett der toten Frau. Den ganzen Tag hatte sie wie betäubt dort gelegen, kaum geatmet. Ihr Gesicht war starr geworden wie eine Maske, und wenn sie ihr das Augenlid hochschoben, war nur das Weiße sichtbar, als wolle sie ins Innere ihres Schädels schauen. Ihre Familie bangte um ihr Leben und verbrachte Stunden im Gebet.
Der Dämmerzustand hatte die ganze Nacht und auch noch den folgenden Morgen über angedauert. Es war ein heißer, windstiller Tag gewesen, der das alte Haus in einen Brutofen verwandelt hatte. Die Brethren versammelten sich im Erdgeschoss, wischten sich den Schweiß von der Stirn und beteten für die Seele des Mädchens, und viele von ihnen bereiteten sich innerlich schon auf das nächste Begräbnis vor. Ein paar fragten sich sogar, ob das nicht vielleicht eine Strafe für den ganzen Clan der Troets war, für ihre sonderbare Art.
Und so hatte es bis zum Abend des zweiten Tages angedauert, als das Mädchen plötzlich die Augen aufschlug und sich aufsetzte. Mit einem Schrei, der sich anhörte wie »Das Feuer!« erschreckte es alle, die an seinem Bett versammelt waren. Schnell wurde erklärt, dass sie außer Gefahr war, dass ihr dramatisches Erwachen nur der Höhepunkt eines Albtraums gewesen zu sein schien, und ihre Familie stellte erleichtert fest, dass sie kein Fieber hatte.
Aber der Albtraum war wahr gewesen, davon war sie überzeugt. Während sie dort gelegen hatte, waren Visionen auf sie eingestürzt, Bilder von Mord. Irgendwo, nicht weit von Gilead, würde ein Mädchen sterben, das ihr sehr ähnlich war. Da war Licht und ein Baum und ein merkwürdiges Zeichen, drei konzentrische Kreise …
Ihr wirres Gestammel wurde nicht vollkommen verworfen – die Brethren nahmen derlei Warnungen ernst, denn sie wussten, dass der HERR den Menschen gelegentlich einen Blick auf künftige Ereignisse erlaubt –, aber es war schwer, Sinn in dem zu erkennen, was sie stammelte. Ein Baum? Es gab Tausende von Bäumen, keine halbe Meile vom Haus entfernt. Ein Mädchen? Das konnte jedermanns Tochter oder Schwester sein. Und was die Zeichnung anging, von der sie plapperte, was sollten sie darunter verstehen? Man konnte kaum erwarten, dass sie einer solch vagen Prophezeiung nachgingen.
Am Ende hatte sie nachgegeben. Vielleicht hatten sie recht; vielleicht war es doch nur ein Albtraum gewesen, hervorgerufen durch die Entdeckung der BILDER – deren Existenz sie verzweifelt geheim hielt.





























