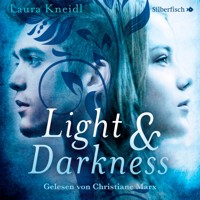14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Darlington
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung der New-Adult-Reihe um das Luxushotel THE DARLINGTON
Nach einem schweren Schicksalsschlag ist Grace am Boden zerstört. Das Einzige, was sie noch aufrecht hält, ist der Wunsch nach Gerechtigkeit. Sie hegt den Verdacht, dass die Familie Darlington mehr über den Vorfall weiß, der ihr Leben für immer verändert hat, und ist wild entschlossen, der Sache nachzugehen. Doch ausgerechnet Ethan Darlington wird für Grace zur Ablenkung. Schon immer haben sich das Zimmermädchen und der arrogante Hotelerbe hitzige Wortgefechte geliefert, aber plötzlich ist da mehr zwischen ihnen: eine körperliche Anziehung, der Grace nicht widerstehen kann - und will. Aber so ganz kann sich Grace nicht auf Ethan einlassen, weil sie das Gefühl hat, dass er ihr etwas verschweigt.
Band 2 der THE DARLINGTON-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
The Blackroom
001
002
003
004
005
The Blackroom
006
007
008
009
010
011
012
The Blackroom
013
014
015
016
017
The Blackroom
018
019
020
021
022
023
024
The Blackroom
025
026
027
028
The Blackroom
029
030
031
032
033
034
The Blackroom
035
036
037
038
039
040
041
042
The Blackroom
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
The Blackroom
Die Autorin
Die Bücher von Laura Kneidl bei LYX
Impressum
LAURA KNEIDL
The Darlington
EHTAN & GRACE
Roman
ZU DIESEM BUCH
Das Leben der 22-jährigen Grace Claymore wird nach einem schweren Schicksalsschlag völlig auf den Kopf gestellt. Das Einzige, was sie noch antreibt, ist die Suche nach der Person, die für den Vorfall verantwortlich ist, der alles verändert hat. Und dafür muss sie zurück an den Ort des Geschehens: das Londoner Luxushotel The Darlington. Um Hinweise auf den Täter zu finden, nimmt Grace ihren Job als Zimmermädchen wieder auf, bricht in das Büro des Hotelmanagers ein – und wird dabei prompt von Ethan Darlington erwischt! Ausgerechnet Ethan, der jüngste der Darlington-Brüder, der Partyboy und Player, den Grace absolut nicht ausstehen kann und mit dem sie beim Putzen seines Penthouses ständig aneinandergerät. Leider bleibt ihr nun keine andere Wahl, als sich Ethan anzuvertrauen, damit er sie nicht auffliegen lässt. Doch dieser überrascht sie: Er bietet Grace unerwartet seine Hilfe an. Während sie gemeinsam den Hinweisen nachgehen, merkt Grace, dass Ethan längst nicht mehr der arrogante Hotelerbe ist, den sie verabscheute. Er hat sich verändert, und mit ihm auch die Anziehung zwischen den beiden, der sie schon bald nicht mehr widerstehen können – und wollen.
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Laura und euer LYX-Verlag
Für Eivor
THE BLACKROOM
Am Abend der Pearl Gala ereignete sich ein tragischer Unfall in unmittelbarer Nähe zum The Darlington. Eine 22-jährige Frau wurde in einer Seitenstraße des Hotels von einem Auto erfasst und verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer beging Fahrerflucht und ließ die Frau ohne Hilfe zurück.
Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit unklar. Die Polizei beteuert, dass es keinerlei Hinweise auf den flüchtigen Täter gibt, obwohl die Überwachungskameras des skandalträchtigen Hotels den Vorfall eigentlich hätten aufzeichnen müssen. Doch seltsamerweise konnte kein Beweismaterial sichergestellt werden. Kommt euch das bekannt vor?
Da stellt sich uns die Frage, ob das The Darlington womöglich mal wieder etwas zu vertuschen hat …
Wir hoffen auf Gerechtigkeit und dass der flüchtige Fahrer seine gerechte Strafe bekommt. Unsere Gedanken sind bei der Familie des Opfers.
Ruhe in Frieden.
001
Hey, vermutlich geht es mich nichts an, aber ist bei Ethan alles in Ordnung? James macht sich Sorgen um ihn. Er übertreibt es wohl etwas mit den Partys.
Nachricht von Olivia an Henry
Ethan
Eine Woche nach dem Unfall
Ich kotz gleich.
Der Gedanke wurde von einem sauren Gefühl in meiner Kehle begleitet, allerdings war ich mir nicht sicher, was den Brechreiz heraufbeschworen hatte. Der Alkohol von gestern Abend oder der Proteinshake von eben. Oder es war eine Kombination aus beidem: der Shake, der in meinem Magen auf eine Mischung aus Tequila, Bier, Gin Tonic und Whisky traf. Es war eine wilde Nacht gewesen.
Ich verzog die Lippen und stellte den Shaker, in dem sich noch ein Rest des Proteingesöffs befand, in die Spüle. Ich hasste das Zeug wie die Pest. Obwohl ich schon viele unterschiedliche Marken ausprobiert hatte, schmeckten für mich alle gleich. Als hätte man einen alten Schuh, Dreck und etwas Schimmliges in einen Mixer gegeben. Aber es ließ sich nicht abstreiten, dass diese Shakes Wunder an meinem Körper wirkten, also zwang ich mich, den Ekel zu überwinden.
Ich füllte ein Glas mit Wasser und trank es aus, um den Geschmack nach altem Schuh loszuwerden und in der Hoffnung, die Übelkeit runterzuspülen. Ich verabscheute es, mich zu übergeben. In den letzten Monaten hatte ich glücklicherweise Methoden gefunden, das größtenteils zu vermeiden, aber ich befürchtete, dass mich dieses Schicksal früher oder später erneut ereilen würde, wenn ich nicht bald einen Gang runterschaltete. Seit Weihnachten war ich praktisch nicht mehr nüchtern gewesen, dafür waren die Partys zu dieser Zeit des Jahres einfach zu geil. Erst die Pearl Gala, dann Nates Geburtstag zwei Tage später, gefolgt von Silvester und schließlich Olivia Asterdams legendäre Neujahrsfete gestern Abend.
Mein Magen hasste mich für diesen Partymarathon, doch ich brauchte das Vergessen. Die Leere. Die Gleichgültigkeit, wenn nur der Moment existierte und alles andere egal war. Wenn ich einen Shot nach dem anderen kippte, spielte es keine Rolle, dass mein Dad ein beschissener Vergewaltiger war, der unser aller Leben ruinierte. Wenn ich einen Joint rauchte, ließ mich das verdrängen, wie verloren ich mich fühlte. Und wenn ich mich auf der Tanzfläche oder im Bett mit einer schönen Frau verausgabte, ließ es sich leichter ignorieren, wie einsam ich in Wirklichkeit war. Den meisten Leuten war ich scheißegal, aber diese Partys erschufen zumindest die Illusion von Gemeinschaft.
Ich lachte über mich selbst. Was war ich nur für ein erbärmlicher Wichser. Und obwohl ich mir dessen bewusst war, bestand kein Zweifel daran, dass mich meine Füße heute Abend zur nächsten Party tragen würden. Zum nächsten Vergessen. Zum nächsten Ignorieren aller Probleme. Und für ein paar Stunden würde ich mich besser fühlen – bis ich ausnüchterte. Es war ein Teufelskreis, aus dem es kein Entkommen gab, wenn ich nicht den Verstand verlieren wollte.
Wirklich nicht?, fragte eine kritische Stimme in meinem Kopf.
Meine Stimme.
Eine Stimme, die ich schon vor langer Zeit hatte verstummen lassen, weil sie mir in der Vergangenheit nichts als Schmerz, Leid und Kummer beschert hatte.
Glücklicherweise rettete mich das Vibrieren meines Handys vor meinem eigenen Ich. Es war eine Nachricht von James, dem wahrscheinlich einzigen Menschen, dem ich tatsächlich nicht egal war.
JAMES:
Hey, alles gut bei dir? Du warst gestern ziemlich schräg drauf.
Schräg? Was sollte das bedeuten? Ich hatte nur meinen Spaß gehabt.
ICH:
Ja, alles gut. Nur leicht verkatert.
Leicht. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Der Liter Wasser, den ich vor dem Schlafengehen getrunken hatte, und die Tabletten, die das Pochen in meinem Schädel linderten, waren der einzige Grund, aus dem ich nicht total hinüber war.
JAMES:
Stimmt es, dass du gestern Britney abgeschleppt hast?
ICH:
Ja.
JAMES:
War sie nicht Charles’ Begleitung?
ICH:
Ja. Das macht es nur noch besser.
JAMES:
Warum musst du ihn immer provozieren?
ICH:
Provozieren? Was kann ich dafür, wenn Britney nicht auf ihn steht?
JAMES:
Nichts, doch du hättest dir auch eine andere aussuchen können.
ICH:
Wollte ich aber nicht.
JAMES:
Vergiss es. Du bist unverbesserlich. Lust auf Brunch, bevor ich zurück nach Cambridge fahre?
ICH:
Ich wollte gerade zum Sport.
JAMES:
Alter. Warum hasst du dich selbst?
Das war eine ausgezeichnete Frage, die ich lieber nicht beantworten wollte.
ICH:
No pain, no gain.
JAMES:
Viel Spaß bei der Folter. Ich geh brunchen. Wir hören uns!
Ich wünschte ihm eine gute und sichere Fahrt nach Cambridge, ehe ich meinen inneren Schweinehund, der zurück ins Bett wollte, fesselte und knebelte und mich auf den Weg in das hoteleigene Gym machte. Zwar hatte ich auch einen Fitnessraum in meinem Penthouse, allerdings wäre es in meiner derzeitigen Verfassung unvernünftig gewesen, allein zu trainieren. Ich war vielleicht masochistisch, aber nicht lebensmüde.
Mit einer Flasche Wasser in der Hand und einem Handtuch über den Schultern folgte ich dem Flur bis zu den Aufzügen. In der obersten Etage des The Darlington war es vollkommen still. Das Stockwerk war privat, und anders als im Rest des Hotels gab es hier glücklicherweise keine Gästezimmer, sondern nur vier Penthouse-Wohnungen. In einer davon lebten meine Eltern, in einer mein ältester Bruder Henry, in einer ich, die vierte war unbewohnt. Zudem gab es noch ein paar Zimmer für Besucherinnen und Besucher. Da jedoch sowohl meine Mum als auch mein Dad Einzelkinder und meine Großeltern bereits verstorben waren, wurden sie nur selten genutzt.
Mit einem melodischen Klang verkündete der Aufzug seine Ankunft. Die Türen schoben sich auf, und für den Bruchteil einer Sekunde war mein vernebeltes Gehirn davon überzeugt, in einen Spiegel zu gucken. Bis ich begriff, dass ich nicht mich selbst anschaute, sondern Henry, der in der Fahrstuhlkabine stand. Wir sahen einander zum Verwechseln ähnlich mit unseren schwarzen Haaren, den eisblauen Augen und den markanten Gesichtszügen, die wir von unserem Dad geerbt hatten.
»Hey«, grüßte er mich.
»Hey«, grüßte ich zurück.
Obwohl Henry und mich nur sechs Jahre Altersunterschied trennten, fehlte jedes Gefühl von Brüderlichkeit zwischen uns, da wir nie die Chance gehabt hatten, einander richtig kennenzulernen. Und mit den Jahren war die Kluft immer größer geworden. Ein Teil von mir wünschte sich, wir wären einander näher, aber das hätte ein Maß an Ehrlichkeit und Offenheit verlangt, das ich aktuell nicht zu geben bereit war.
Henry trat in den Eingang des Aufzugs und versperrte mir den Weg. Er musterte mich eingehend, was mir nicht gefiel, doch ich hielt seinem Blick stand und betrachtete ihn meinerseits. Obwohl es körperlich nur wenige Unterschiede zwischen uns gab – er war etwas größer, ich dafür ein wenig breiter –, sahen wir in diesem Moment doch völlig verschieden aus. Er wirkte adrett und ordentlich in seinem maßgeschneiderten Anzug. Ich hingegen fühlte mich nicht nur wie ein Stück Scheiße, sondern sah mit meiner blassen Haut und den tiefen Augenringen vermutlich auch wie eines aus.
»Hättest du einen Moment Zeit?«, fragte Henry.
Ich verschränkte die Arme. »Kommt drauf an, wofür.«
»Ich muss mit dir reden.«
»Steck ich in Schwierigkeiten?« Falls ja, wollte ich es nicht wissen.
»Nein.«
Ich zögerte trotzdem. Die Unterhaltungen, die Henry und ich im letzten Jahr miteinander geführt hatten, ließen sich an einer Hand abzählen. Dass er mich nun um ein Gespräch bat, weckte in mir sowohl Neugierde als auch Nervosität. Doch die Neugierde überwog. Ich nickte, und Henry bedeutete mir, ihm zu folgen.
Obwohl ich seit eineinhalb Jahren zurück in London war, hatte ich Henrys Apartment, zu dem er mir nun einladend die Tür aufhielt, noch nie betreten. Sein Penthouse war eine gespiegelte Version von meinem, dennoch sah es völlig anders aus. Seine Wohnung war ein Zuhause, meine nur eine Bleibe. Bei ihm gab es gerahmte Fotos von Freunden, Freundinnen und Familie zu entdecken, während meine Wände kahl waren. Pflanzen und Dekoelemente verpassten seinem Wohnzimmer eine Persönlichkeit, und in einem Regal neben dem Fernseher stellte er seine beeindruckende London-Has-Fallen-DVD-Sammlung zur Schau, von der ich bisher nur gehört hatte. Es handelte sich dabei wohl um einen Insider zwischen ihm und unserem Bruder Logan, den ich noch weniger kannte als Henry. Mein Penthouse wirkte im Vergleich leblos, zumindest wenn ich nicht gerade fünf Dutzend Leute einlud, um es gemeinsam mit mir zu verwüsten.
»Willst du etwas trinken?«, erkundigte sich Henry.
»Nein danke.«
Er bedeutete mir, mich auf die Couch zu setzen, und nahm mit etwas Abstand neben mir Platz. Ich wartete darauf, dass er etwas sagte, aber einige Sekunden blieb es still, während er mich erneut von Kopf bis Fuß musterte.
»Ist bei dir alles in Ordnung?«, fragte er schließlich.
»Klar, alles bestens«, log ich.
»Wirklich?«
»Ja.«
»Bist du dir auch ganz sicher?«
Ich runzelte die Stirn. »Was soll das Verhör?«
Henry seufzte schwer, und erst jetzt fiel mir auf, dass auch er erschöpft wirkte. »Ich hab vorhin eine Nachricht von Olivia bekommen. Anscheinend macht sich James Sorgen um dich. Er meint, du trinkst zurzeit ziemlich viel. Mehr als sonst. Stimmt das?«
»Nein«, widersprach ich instinktiv, vielleicht eine Spur zu schnell. Ich ruderte zurück. »Okay, vielleicht stimmt es, aber das hat nichts zu bedeuten. Es waren die Feiertage – Weihnachten, Silvester –, und dazwischen hat die Pearl Gala stattgefunden, dazu kam Nates Geburtstag. Das wird auch wieder weniger. Und überhaupt, was interessiert es dich? Das hat nichts mit dir zu tun.«
»Nein, aber mit dir. Und du bist mein Bruder.«
Ich schnaubte, denn Blutsverwandtschaft hin oder her, wir waren dennoch Fremde füreinander. »Ich wiederhole: Was interessiert es dich?«
»Ethan …«
»Henry«, äffte ich ihn nach, doch er ließ sich davon nicht provozieren.
»Ich weiß, dass wir uns nicht besonders nahestehen, aber das bedeutet nicht, dass ich mir keine Sorgen um dich mache, wenn ich so etwas höre«, erklärte Henry und rieb dabei die Hände aneinander. Eine nervöse Geste, die in meinen Augen nicht zu ihm passte. Bisher war er mir immer unerschütterlich erschienen. Ausgeglichen wie jemand, der keine Probleme hatte, nur Lösungen. Worauf ich stets ein bisschen neidisch war, denn wäre ich nur halb so geordnet wie Henry gewesen, wäre mein Leben um einiges leichter. »Ich bin nicht hier, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen oder dich zu verurteilen. Im Gegenteil. Ich verstehe besser als jeder andere, wie schwierig die aktuelle Situation ist. Wir suchen alle nach einem Weg, damit umzugehen, aber nicht jeder Weg ist der richtige.«
»Klingt schon ziemlich verurteilend. Anscheinend hältst du deinen Weg für den richtigen und meinen für den falschen.«
Henry lachte laut auf. Es war ein kühles, freudloses Lachen. »Glaub mir, kein Weg ist so falsch wie meiner. Ich …« Er unterbrach sich, und ein verhaltener Ausdruck trat in seine Augen. Abermals betrachtete er mich, bevor er fortfuhr: »Wenn ich dir etwas anvertraue, versprichst du mir, es für dich zu behalten?«
Überrascht runzelte ich die Stirn. Ich hatte keine Ahnung, was für ein Geheimnis jemand wie Henry haben sollte, aber ich trug bereits so viele davon mit mir herum, dass ein weiteres keinen Unterschied machte. »Wenn es sein muss.«
Er holte tief Luft, wappnete sich für die nächsten Worte. »Ich habe ein Suchtproblem.«
Das waren die letzten Worte, die ich jemals erwartet hätte, aus seinem Mund zu hören. Ich blinzelte. Einmal. Zweimal. Dreimal. Versuchte, die Information zu verarbeiten. »Ist das ein Scherz?«
»Leider nicht.«
»Fuck«, murmelte ich. »Alkohol oder Drogen?«
»Drogen«, antwortete Henry. Ihm war anzusehen, dass es ihm nicht leichtfiel, das auszusprechen. »Vitalyn, um genau zu sein. Das ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, das ich in den letzten Monaten ohne Anordnung eines Arztes eingenommen habe.«
Fassungslos starrte ich meinen Bruder an. Was er gerade gesagt hatte, widersprach allem, was ich bis eben geglaubt hatte, über ihn zu wissen. Er wirkte stets so gefasst. Kontrolliert. Und Sucht bedeutete das Gegenteil von Kontrolle: den absoluten Kontrollverlust.
»Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, was du zu tun hast. Dazu habe ich kein Recht, vor allem nicht, wenn man bedenkt, wie es zwischen uns steht«, fuhr Henry fort, wobei es schwer war, die Sorge in seiner Stimme nicht an mich heranzulassen. »Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie verlockend es ist, falsche Entscheidungen zu treffen, wenn man sich eine schnelle Lösung erhofft.«
Ich nickte bedächtig, während ich noch immer versuchte, auf das Gesagte klarzukommen, doch es gelang mir nicht. Henry war … Henry. Er war organisiert, gewissenhaft und diszipliniert. Der perfekte Vorzeigesohn, der alles auf die Reihe bekam und stets wusste, was zu tun war. Der nie über die Strenge schlug. Sein bis dato größer Skandal war seine Beziehung zu Kate gewesen, eine ehemalige Obdachlose, die vor ein paar Monaten in sein Leben getreten war.
»Wer weiß alles davon?«, fragte ich.
»Bisher nur Logan, Olivia, Kate und eine ihrer Freundinnen. Weshalb es wichtig ist, dass du mit niemandem darüber redest. Wenn die Öffentlichkeit Wind davon bekommt …« Er beendete den Satz nicht, aber das musste er auch nicht. Sollte die Presse davon erfahren, wären wir geliefert. Sie würden Henry in der Luft zerreißen und damit jede Chance auf Rehabilitierung für das Darlington vernichten. Die Reservierungen würden weiter in den Keller gehen. Und wahrscheinlich würde es eine erneute Flutwelle an Kündigungen geben. Ich war zwar nicht ins Hotel-Business involviert, aber einiges bekam ich trotzdem mit.
»Was ist mit Mum und Dad?«
»Denen werde ich es auch noch sagen. Vielleicht.«
Bei diesem Gespräch wollte ich auf keinen Fall dabei sein. Dad würde vollkommen ausrasten und Mum aus Sorge um Henrys Ruf einen Nervenzusammenbruch erleiden. »Wie kam es dazu?«
Er zuckte mit den Schultern. »Wie es bei dieser Art von Drogen wohl häufig anfängt. Ich war erschöpft. Überfordert. Vitalyn steigert die Leistungsfähigkeit und vertreibt Müdigkeit. Mir sind der Stress und die Verantwortung für das Hotel über den Kopf gewachsen. Es war alles zu viel.«
Davon hörte ich gerade zum ersten Mal. Was mich nicht weiter überraschen sollte, Henry und ich hatten nicht die Art Beziehung, in der wir uns gegenseitig unsere Gedanken und Sorgen anvertrauten. »Wirst du einen Entzug machen?«
»Ich bin bereits seit etwa drei Wochen clean. Aber ich fang bald eine Therapie an, um einen gesünderen Umgang mit dem Stress zu finden.«
»Klingt vernünftig«, erwiderte ich tonlos, weil ich das alles nicht begriff. Ich hatte immer geglaubt, er wäre immun gegen das Chaos, das unser Dad in unser Leben gebracht hatte. Und bis eben war ich davon überzeugt gewesen, wenn jemand diese Familie und das The Darlington retten konnte, dann Henry. Aber da hatte ich mich wohl geirrt. Fatal geirrt.
Er konnte das Hotel und unsere Familie nicht retten, denn zuerst musste er sich selbst retten. Es war wie bei einem Flugzeugabsturz, bei dem man dazu angehalten wurde, sich selbst als Erstes die Sauerstoffmaske aufzusetzen, bevor man anderen half. Und vermutlich war es nicht nur unfair, sondern auch naiv von mir gewesen zu glauben, Henry könnte diese Rettungsmission im Alleingang bewältigen. Er war kein Ritter in glänzender Rüstung. Er war ein Junkie. Was für ein absoluter Mindfuck.
»Darf ich gehen?« Meine Stimme klang hohl. Leblos. Ich brauchte Zeit für mich, um das zu verarbeiten.
Henry wirkte enttäuscht, als hätte er eine andere Reaktion von mir erwartet. »Natürlich. Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Und dir vielleicht einen Denkanstoß geben.«
Ich stand von der Couch auf und verließ das Penthouse ohne ein weiteres Wort. Gedankenverloren machte ich mich wie geplant auf den Weg zum Fitnessraum. Erst während des Aufwärmens fiel mir ein, dass ich Henry vielleicht meine Unterstützung hätte anbieten sollen. Aber wie sollte ich ihm zur Seite stehen, wenn ich nicht einmal für mich selbst einstehen konnte, sondern Tag für Tag, Nacht für Nacht, Party für Party vor der Realität flüchtete wie ein Feigling? Ein Feigling, der sich darauf verlassen hatte, von jemand anderem gerettet zu werden. Was mich wieder zu der Erkenntnis brachte, dass ich ein erbärmlicher Wichser war. Vielleicht der erbärmlichste von allen. Denn ich war nicht nur ein Feigling, sondern auch ein Heuchler und Schwächling.
Mein Work-out nach dieser Erkenntnis war unerbittlich – trotz des Hangovers, der mich noch immer plagte. Ich verausgabte mich auf dem Laufband, bis es sich anfühlte, als würde meine Lunge platzen, und stemmte Gewichte bis zum kompletten Muskelversagen. Es war die reinste Qual. Dabei hörte ich keine Musik. Keinen Podcast. Und ich redete auch mit niemandem.
Da waren nur ich und meine Gedanken.
Meine Ängste.
Meine Sorgen.
Als ich eine Stunde später das Gym verließ, hatte ich eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die meinem Leben eine Hundertachtziggradwende geben würde, wenn ich nur mutig genug war, die Veränderung zu ertragen.
Keuchend schleppte ich mich zurück in meine Wohnung, als mein Handy vibrierte.
NATE:
Hey, hast du den Snap von Michelle schon gesehen? Party in der Stadtvilla ihrer Eltern heute Abend. Bist du dabei?
Ich starrte die Nachricht an. Vor meinem Gespräch mit Henry wäre die Antwort ein klares Ja gewesen – ohne Bedenken, ohne Zögern. Denn es wäre genau das gewesen, was ich gewollt hätte. Nun jedoch fühlte sich die Frage wie eine Bewährungsprobe für meine soeben getroffene Entscheidung an.
Mit rasendem Puls tippte ich eine Antwort, die mir mehr abverlangte als das Work-out, mit dem ich meinen Körper an sein absolutes Limit getrieben hatte.
ICH:
Nein, ich brauch etwas Zeit für mich.
002
22-jährige Frau stirbt bei Unfall mit Fahrerflucht
zwei Monate alte Headline
Grace
Sieben Wochen später
In meinem Leben gab es bisher drei entscheidende Wendepunkte. Der erste war die Geburt meines jüngeren Bruders Jason. Der zweite war die Entscheidung, mein Jurastudium abzubrechen und einen Job als Zimmermädchen im The Darlington anzunehmen. Der dritte und mit Abstand schrecklichste Wendepunkt war der Tod meiner Zwillingsschwester Amy.
Er hatte mein Leben nicht nur verändert, sondern vollkommen aus der Bahn geworfen. Wie ein Auto, das zu schnell eine Kurve genommen hatte, war es von der Straße abgekommen und von einer Klippe gestürzt. Es hatte sich mehrfach überschlagen und war nach einem endlos langen Fall kopfüber aufgekommen. Jeder Knochen in meinem Körper fühlte sich gebrochen an, und die Splitter bohrten sich seitdem mit jedem Atemzug tiefer in mein Herz.
»Grace, kommst du? Wir müssen los!«, brüllte mein Dad durch die Wohnung.
Ich blinzelte benommen. Es dauerte einen Moment, bis mein Verstand sich daran erinnerte, dass ich nicht blutend am Fuß einer Klippe lag, sondern unversehrt in meinem Zimmer stand und dabei war, mich für meinen ersten Tag zurück im The Darlington fertig zu machen. Nach Amys Unfall hatte ich mir eine Auszeit genommen, aber tatenlos zu Hause rumzusitzen, würde mir meine Schwester auch nicht zurückbringen.
»Ich bin gleich so weit!«, rief ich meinem Dad zu.
Entschlossen, ihn nicht länger warten zu lassen, warf ich einen prüfenden Blick in den Spiegel. Dank der Magie von Concealer und der Kraft von Koffein sah ich aus wie ein halbwegs funktionierender Mensch. Probeweise hob ich die Mundwinkel zu einem Lächeln. Es wirkte hohl und freudlos. Die Muskeln in meinem Gesicht führten die Bewegung zwar aus, aber mein Herz fühlte die damit verknüpften Emotionen nicht. Es war vor Trauer und Schmerz nach wie vor gelähmt, was sich in den nächsten Minuten allerdings auch nicht ändern würde, von daher war ich fertig.
Ich schnappte mir meine Handtasche und ließ den Blick ein letztes Mal über mein Zimmer gleiten, über die hellen Möbel mit den abgestoßenen Ecken, über das ungemachte Bett, in das nur mit viel gutem Willen zwei Personen passten, und die beigefarbenen Vorhänge, die noch zugezogen waren, weil ich mir nicht die Mühe gemacht hatte, sie zu öffnen. Es war Ende Februar in London und die Stadt vom Regen trist und grau.
Ich lief den Flur entlang in die Küche, wo mein Dad auf mich wartete. Gemeinsam mit meiner Mum und Jason saß er am Tisch. Sie alle schauten in meine Richtung, aber sahen nicht mich an. Ihre Blicke trafen den Riemen meiner Tasche, den Anhänger meiner Kette oder den Halsausschnitt meines Pullovers. So ging das seit zwei Monaten. Sie vermieden es um jeden Preis, mir ins Gesicht zu sehen. Weil ich Amys Ebenbild war. Die fleischgewordene Erinnerung ihres Verlustes. Meine Haare waren blond wie ihre. Meine Augen braun wie ihre. Meine Lippen geschwungen wie ihre. Und meine Nase spitz wie ihre.
Ich war sie.
Sie war ich.
Nur war sie tot, während ich lebte und meine Familie tagein, tagaus an die Tochter und Schwester erinnerte, die sie verloren hatten. Wäre es mir möglich gewesen, hätte ich mein eigenes Spiegelbild gemieden. Unmittelbar nach Amys Tod hatte ich das tatsächlich einige Tage lang getan. Ich war vollkommen verwahrlost gewesen, ehe meine Freundinnen Rose und Kate mich gezwungen hatten, eine Dusche zu nehmen und für einen Spaziergang rauszugehen.
»Wir können los«, sagte ich. Meine Stimme klang kratzig, obwohl ich heute noch gar nicht geweint hatte. Es war, als hätten die Tränen der letzten Wochen meine Stimmbänder nachhaltig geschädigt. An manchen Tagen hatte ich gar nicht damit aufhören können. Meine Wangen waren von morgens bis abends feucht gewesen, und ich hatte das Gefühl gehabt, an meiner Trauer zu ersticken.
Mein Dad schob seinen Stuhl zurück, hob die Aktentasche auf, die zu seinen Füßen stand, gab meiner Mum einen Kuss auf die Stirn und strubbelte Jason zum Abschied durch das hellbraune Haar. In typischer Teenagermanier stieß dieser ein genervtes Ächzen aus und zückte sein Handy, um seine Frisur mithilfe der Frontkamera zu richten. Vor Amys Tod hatte er versucht, Tamil, ein Mädchen aus seiner Klasse, zu beeindrucken, aber ich wusste nicht, was inzwischen aus seinen Bemühungen geworden war.
Ich wünschte Jason und meiner Mum, die an derselben Schule unterrichtete, die er besuchte, viel Spaß, bevor ich gemeinsam mit meinem Dad die Wohnung verließ.
Sein Toyota parkte auf der Straße vor dem Haus. Wir stiegen ein, und er startete den Motor. Normalerweise nahm ich die Tube zur Arbeit, was weitaus praktischer war als das Auto, da das Darlington im Stadtzentrum lag, in der Nähe des Big Ben und des London Eye, direkt an der Themse. Aber mein Dad hatte darauf bestanden, mich heute hinzubringen, auch wenn das für ihn einen Umweg bedeutete.
»Bereit für deinen ersten Tag zurück auf der Arbeit?«, fragte er, als wir an einer Ampel mit langem Rückstau zum Stehen kamen. Der Berufsverkehr in London war die Hölle, und ich bereute es bereits, das Angebot meines Dads angenommen zu haben. Nicht nur wegen des Staus, sondern auch wegen des Small Talks. Seit Amys Tod fühlte sich jedes Gespräch zwischen meinen Eltern und mir verkrampft an, als wären wir keine Familie, sondern Fremde, die man gezwungen hatte zusammenzuleben.
Ich zuckte mit den Schultern und spielte nervös an meinen Ringen herum. Ich hatte eine große Sammlung, denn ich hatte es mir bereits als Teenager zur Angewohnheit gemacht, an jedem Ort, den ich zum ersten Mal besuchte, einen zu kaufen. Und irgendwann fingen auch meine Freundinnen und meine Verwandtschaft damit an, mir Ringe aus aller Welt mitzubringen. »Denke schon.«
»Du weißt, dass es für deine Mum und mich okay wäre, wenn du dir Zeit lässt. Amy ist erst seit zwei Monaten … fort.« Mein Dad stolperte über den letzten Teil des Satzes. Er sagte immer, dass Amy fort, weg oder nicht mehr bei uns war, aber nie, dass sie tot war. Als würde er es nicht über sich bringen, das Wort mit all seiner Endgültigkeit auszusprechen. »Du musst dich nicht dazu zwingen, arbeiten zu gehen, wenn du noch nicht bereit bist.«
»Du arbeitest seit Wochen wieder im Krankenhaus.«
Falten erschienen auf der Stirn meines Dads. Die letzten Wochen hatten sie tiefer werden lassen. »Das ist etwas anderes.«
Ich musste nicht fragen, was er damit meinte. Ich wusste es. Amy war in einer Seitenstraße neben dem Darlington gestorben, man konnte den Unfallort von einigen Zimmern aus sogar sehen. Es war am Abend der Pearl Gala geschehen, einem Charity Event, das jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester im Hotel stattfand. Amy hatte mich von der Gala abholen wollen, um mit mir gemeinsam in den Pub zu gehen, als sie von einem Auto erfasst worden war. Ihren Verletzungen nach zu urteilen war der Fahrer etliche Meilen pro Stunde schneller gefahren, als in der verkehrsberuhigten Zone erlaubt war. Er hatte Amy frontal erwischt und nicht einmal den Anstand besessen anzuhalten, geschweige denn Hilfe zu rufen. Irgendein Fremder hatte den Notruf alarmiert – zu spät. Die Rettungskräfte hatten Amy nicht mehr helfen können.
»Vielleicht solltest du dir einen neuen Job suchen«, sagte mein Dad in mein Schweigen hinein. Er hatte diesen Vorschlag schon des Öfteren angedeutet, aber heute war das erste Mal, dass er ihn direkt aussprach.
»Kein Interesse.«
»Es ist nicht gesund für dich, jeden Tag mit dem Ort konfrontiert zu werden, an dem deine Schwester von uns gegangen ist«, bemerkte er in seinem sanften, jedoch sachlichen Arzt-Tonfall, als wäre ich die Hinterbliebene irgendeines Patienten, der auf seinem OP-Tisch verstorben war. »Die Leute im Hotel würden das verstehen, da bin ich mir sicher.«
»Ich will keinen neuen Job«, erwiderte ich, während ich aus dem Fenster starrte.
Mein Dad seufzte, als wäre ich der Ursprung all seines Kummers. »Bitte denk zumindest darüber nach. Du musst auch nicht studieren. Arbeite in einem anderen Hotel. Die gibt es in dieser Stadt wie Sand am Meer. Du findest sicherlich schnell was Neues, und falls es finanziell eng wird, können deine Mum und ich dir aushelfen.«
Ich schüttelte den Kopf. Meine Entscheidung, nicht zu kündigen, stand fest, und sie hatte nichts mit Geld oder der Angst, arbeitslos zu sein, zu tun. Es ging mir einzig und allein um Gerechtigkeit. Und das Darlington war meine einzige Verbindung zum Tod meiner Schwester. Es mochte ein Unfall gewesen sein, der Amy das Leben gekostet hatte. Aber es war ganz gewiss kein Zufall, dass der verantwortliche Täter noch immer nicht gefasst worden war. Die Polizei zeigte sich erschreckend desinteressiert an der Aufklärung des Falls, es wirkte beinahe so, als hätte ihnen jemand Geld dafür bezahlt, die Füße hochzulegen. Und dass die Aufnahmen der hoteleigenen Überwachungskameras, die den Unfall hätten aufzeichnen müssen, auf mysteriöse Weise verschwunden waren, wurde von der Polizei auch nicht hinterfragt. Doch ich würde Fragen stellen – bis zum bitteren Ende.
Bis der Mörder meiner Schwester gefasst war.
Vierzig Minuten später parkte mein Dad in zweiter Reihe vor dem Hotel, was ihm ein Hupkonzert einbrachte. Ich griff nach meiner Tasche und öffnete die Tür. »Danke fürs Bringen. Ich nehme später die Tube nach Hause.«
»Okay«, sagte er mit besorgtem Blick und angestrengtem Lächeln, bevor ich ausstieg.
Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke hoch, um mich gegen den kalten Wind zu wappnen, und lief schnurstracks die letzten Schritte in Richtung des Darlington, das jedes Mal aufs Neue einen beeindruckenden Anblick bot. London war eine Mischung aus Alt und Neu, Modern und Historisch. Gläserne Wolkenkratzer gehörten zur Skyline genauso wie massive Steinmauern und altehrwürdige Bauwerke. Das Darlington lag mit seiner Fassade aus cremefarbenem Kalkstein, den majestätisch geschwungenen Pfeilerarkaden und den kleinen Balkonen mit den gusseisernen Brüstungen irgendwo dazwischen.
Ich benutzte nicht den Haupteingang des Hotels, sondern die Hintertür, die fürs Personal bestimmt war, und für Promis, die unbemerkt eingeschleust werden wollten. Den Blick starr geradeaus gerichtet, versuchte ich, die Straße, in der Amy gestorben war, zu ignorieren. Trotzdem stellten sich die Härchen in meinem Nacken auf.
Noch im Gehen fischte ich die Zugangskarte aus meiner Tasche, um sie am Eingang schnellstmöglich zu scannen. Mit meinen zitternden Händen brauchte ich dennoch drei Anläufe, bis der Scanner meine Karte erkannte und das Schloss sich entriegelte. Eilig flüchtete ich mich ins Innere und zog die Tür hinter mir zu, wie um eine Barriere zwischen mir und dem Unfallort zu errichten. Ich hatte geahnt, dass es nicht leicht werden würde zurückzukommen, trotzdem war ich erstaunt, wie unglaublich eng sich meine Brust plötzlich anfühlte. Erinnerungen an jene Nacht stürzten auf mich ein, wie ich im Foyer des Hotels ungeduldig auf Amy wartete, nachdem ich Kate und Henry für ihr Happy End allein gelassen hatte. Aus dem Ballsaal waren Stimmen, Gelächter und Musik zu hören gewesen, so laut, dass ich das kurze Aufheulen der Sirenen kaum wahrgenommen hatte.
Ich hatte mit Rose geschrieben, als um mich herum Unruhe ausbrach. Die Band hatte weitergespielt, aber die Stimmung hatte sich verändert. Nervöse Blicke. Aufgebrachtes Getuschel. Rakesh war in seinem Anzug mit einem panischen Gesichtsausdruck an mir vorbeigestürzt, Henry auf den Fersen. Ich hatte mich ihm in den Weg gestellt und gefragt, was los sei. Doch er hatte mir nicht viel sagen können, nur dass es ganz in der Nähe des Hotels einen Unfall gegeben hatte. Sofort war da dieses ungute Gefühl gewesen. Ich hatte Amy geschrieben, ohne eine Antwort zu erhalten. Ich hatte versucht, sie anzurufen. Sie war nicht rangegangen. Ich hatte weiter auf sie gewartet. Aber sie war nicht gekommen. Und als Henry kurze Zeit später mit traurigen Augen und schmerzverzerrtem Gesicht auf mich zugekommen war, hatte ich es gewusst: Amy war tot.
Damals hatte ich nicht geweint. Ich war nur wie erstarrt dagestanden, mit jeder Menge Fragen im Kopf, als hätte mein Verstand auf Hochtouren gearbeitet, um keinen Platz für all die überwältigenden Gefühle zu lassen. War Amy sofort tot gewesen? Falls nicht, wie hatten sich diese letzten Minuten für sie angefühlt? Hatte sie Schmerzen gehabt? Hatte sie gewusst, dass sie sterben würde? Hatte sie Angst gehabt? Oder hatte ihr Bewusstsein sie verlassen, bevor ihr Körper aufgegeben hatte?
Ich kniff die Augen zusammen. Verdrängte diese Fragen, die mich auch heute noch plagten und auf die ich keine Antworten mehr bekommen würde. Aber eine Frage, auf die sich eine Antwort finden ließ, war: Wer hatte Amy umgebracht? Deswegen war ich hier. Ich wollte herausfinden, wer sie überfahren und zum Sterben zurückgelassen hatte. Darauf musste ich mich konzentrieren.
Ich straffte die Schultern, holte tief Luft und inhalierte den für das Darlington typischen Geruch nach Kaminfeuer, antikem Holz und den Blumenarrangements, die in jeder Ecke des Hotels standen und ihren süßlichen Duft verströmten. Dann folgte ich entschlossen den vertrauten Fluren zu Giulias Büro. Sie war die Hauswirtschaftsleiterin und hatte mich gebeten, bei ihr vorbeizuschauen.
Selbst hinter den Kulissen war das Darlington makellos. Weder Fussel noch Krümel waren auf dem Parkett zu erkennen, und kein Staubkorn trübte das Licht der Wandstrahler. Alte Fotos des Hotels in wuchtigen Goldrahmen schmückten die Gänge, die zu beiden Seiten von massiven Holztüren gesäumt waren.
Mein Handy vibrierte mit einer neuen Nachricht.
KATE:
Viel Erfolg heute. Du schaffst das!
ICH:
Danke! Bist du im Hotel?
Kate und ich hatten uns vor gut einem halben Jahr im Darlington kennengelernt. Zeitweise hatte sie ebenfalls als Zimmermädchen hier gearbeitet, aber seit Anfang des Jahres war sie für Hope Harbour tätig, eine Organisation, die sich für Obdachlose in Großbritannien einsetzte. Sie war dennoch ständig im Hotel, da ihr Freund Henry der CEO des The Darlington war. Neben meinen Eltern und Jason waren Rose und sie die Einzigen, mit denen ich in den letzten Monaten Kontakt gehalten hatte. Die beiden waren nach Amys Tod für mich da gewesen. Und ohne sie würde es mir heute noch um einiges schlechter gehen.
KATE:
Nein, ich hab heute bei mir gepennt. Aber ich kann vor der Arbeit vorbeikommen, wenn du willst?
ICH:
Unsinn. Das wäre voll der Umweg für dich. Ich komm zurecht. Außerdem ist Rose ja da.
KATE:
Okay, aber ruf an, wenn du mich brauchst!
ICH:
Mach ich. Versprochen.
Ich steckte mein Handy weg, als ich Giulias Büro erreichte. Die Tür stand einen Spaltbreit offen, eine unausgesprochene Einladung. Dennoch klopfte ich gegen den Rahmen, um mich anzukündigen, bevor ich sie aufdrückte. Giulia, die über ihrem Laptop kauerte, blickte auf.
Ich schloss die Tür hinter mir. »Hallo, Giulia.«
»Grace, wie schön, dich zu sehen!« Sie schob die Brille, die an einer Kette um ihren Hals hing, in ihr wallendes schwarzes Haar und stand von ihrem Platz auf, um mich zu umarmen. Ich war nicht groß, aber Giulia war im Vergleich zu mir winzig. Und trotzdem besaß sie die Kraft eines Bauarbeiters. Ihre Umarmung drückte mir förmlich die Luft aus der Lunge. »Wie geht es dir?«
»Gut«, log ich, weil es nichts brachte, ihr die Wahrheit zu sagen, nämlich dass es mir scheiße ging. Nicht nur ein bisschen scheiße, sondern so richtig scheiße, sodass ich die meiste Zeit abwechselnd weinen und schreien wollte und dazwischen immer wieder den Drang verspürte, auf jemanden einzuprügeln. Niemand Bestimmten, aber irgendjemanden, weil Trauer, Schmerz und Wut mir allmählich den Verstand raubten. Ich war es leid, mich so schrecklich zu fühlen, und sehnte mich danach, etwas anderes zu empfinden – oder gar nichts. Aber das konnte ich Giulia unmöglich sagen, denn ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machte oder, schlimmer noch, mich wieder nach Hause schickte.
Sie entließ mich aus ihrer klammergriffartigen Umarmung. »Setz dich.«
Ich folgte der Aufforderung und nahm auf dem Stuhl vor ihrem Schreibtisch Platz. In der Ecke ihres Büros stand auch eine kleine Couch, doch ich hatte nicht vor, länger zu bleiben. Ich wollte nur in Erfahrung bringen, ob sich irgendetwas in meiner Abwesenheit verändert hatte. Als mein Blick auf den von Giulia traf, ahnte ich allerdings, dass ich nicht so leicht davonkommen würde. In ihren Augen lag ein einfühlsames Schimmern, und ihre Lippen waren zu einem Lächeln verzogen. Die Art Lächeln, die man aufsetzte, um andere, unangenehmere, Gefühle dahinter zu verbergen – wie Mitleid.
»Wie geht es deinen Eltern? Und deinem Bruder? Ist er schon wieder in der Schule?«
»Gut und gut und ja«, antwortete ich mechanisch und knapp.
Giulia seufzte auf die gleiche enttäuschte Art, wie mein Dad es im Auto getan hatte, nur weil ich ihr nicht mein Herz ausschüttete, aber ich konnte nicht über Amy reden. Es ging nicht. Nicht, wenn ich funktionieren wollte.
Zu meiner Erleichterung gab Giulia ihre Bemühungen, mich zum Reden bringen zu wollen, auf. »Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass du wieder da bist. Die vierte Etage ist aktuell geschlossen, um Kosten zu sparen, dennoch gibt es jede Menge zu tun. In den letzten Wochen hat weiteres Personal gekündigt, und die Reservierungen ziehen wieder an, was schön ist, aber auch hektisch ohne ein entsprechend großes Team. Sag trotzdem Bescheid, wenn es dir zu viel wird. Du kannst jederzeit deine Stunden reduzieren oder dir noch mal eine Auszeit gönnen.«
Ich ignorierte Giulias Angebot. Es war zwar lieb gemeint, aber ich brauchte weder Mitgefühl noch eine Sonderbehandlung. Ich brauchte bloß eins: Antworten zum Tod meiner Schwester. Und die konnte ich nur im The Darlington finden.
003
Richard Darlington: Wie gefährlich ist der Triebtäter wirklich?
Headline des INsider
Grace
Die nächsten Stunden waren die Hölle. Die kummervollen Mienen und traurigen Blicke meiner Kolleginnen und Kollegen begleiteten mich, wohin ich auch ging, und mehrfach wurde ich von quasi Fremden ungefragt in den Arm genommen, als wäre ich auf ihren Trost angewiesen. Mit der Zeit entwickelte sich meine Arbeit zu einem Slalomlauf, in dem ich nur noch versuchte, den Leuten aus dem Weg zu gehen, weil ich es nicht länger aushielt, ihre von Mitleid verzerrten Gesichter zu sehen. Ich wusste, dass sie es gut meinten, aber ihr Mitgefühl lockte all jene Emotionen an die Oberfläche, die ich eigentlich verdrängen wollte. Und ich wusste nicht, wie lange ich das noch aushalten würde. Seit Stunden war da dieses heimtückische Kratzen in meiner Kehle, das ich zu ignorieren versuchte, doch mit jedem weiteren Gespräch über Amy wurde es schwerer.
Was die ganze Angelegenheit noch schlimmer machte, war das Wissen, dass einer der anderen Hotelangestellten sein Mitleid nur heuchelte. Denn irgendjemand hatte das Material der Überwachungskameras, welche die Straße vor der Tiefgarage überwachten, gelöscht, noch bevor die Spurensicherung eine Chance gehabt hatte, es zu beschlagnahmen. Ich hatte die Polizisten am Unfallort darüber reden hören, wie merkwürdig es war, dass die Aufnahmen nicht da waren. Dennoch war ihr Fehlen nicht weiter untersucht worden. Der Täter wurde also nicht nur von den Ermittlern geschützt, sondern zusätzlich von jemandem im Hotel gedeckt.
»Es tut mir unendlich leid, was mit deiner Schwester passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer das für dich sein muss«, sagte Rakesh, der Hotelmanager, der mich eben im Gang vor der Wäscherei abgefangen hatte. Er roch nach Parfüm und Zigarettenrauch. Es war allseits bekannt, dass er in seinem Büro qualmte, obwohl das eigentlich im gesamten Hotel verboten war, mit Ausnahme des Zigarrenraums. Aber bei allem, was das Darlington in den letzten Monaten hatte durchstehen müssen, wurde sein Stressrauchen stillschweigend akzeptiert. Wäre ich Raucherin gewesen, hätte ich mir jetzt auch gerne eine angesteckt.
»Du sollst wissen, dass dir meine Tür immer offen steht. Du musst das nicht allein durchstehen. Wir – Mr Darlington junior, ich und das Hotel – unterstützen dich, wo immer wir nur können, um dir durch diese schwere Zeit zu helfen«, fuhr Rakesh fort. Erst jetzt bemerkte ich den schwarzen Umschlag mit dem goldenen Siegel in seiner Hand. Er sah aus wie einer jener Briefe von Henry, die ich im Dezember Kate überbracht hatte, nachdem sich die beiden kurzzeitig getrennt hatten. Doch mein Gefühl sagte mir, dass dieser Brief nicht für Kate, sondern für mich bestimmt war. »Die Belegschaft hat ein bisschen was für dich gesammelt, um dich zu unterstützen.«
Er hielt mir das Kuvert hin, und am liebsten hätte ich es abgelehnt, aber Rakeshs eindringlicher Blick brachte mich dazu, danach zu greifen. »Danke«, sagte ich mit Zurückhaltung in der Stimme, die man leicht als Ergriffenheit hätte deuten können.
Er lächelte ermutigend. Abwartend. Offenbar wollte er, dass ich den Umschlag sofort öffnete. Um ihn nicht vor den Kopf zu stoßen, brach ich das Siegel. In dem Kuvert steckten eine Beileidskarte, die alle unterschrieben hatten, sowie ein Stapel Geldscheine. Ich war mir nicht sicher, was ich davon halten sollte. Einerseits konnte ich das Geld nach fast zwei Monaten unbezahltem Urlaub gut gebrauchen, andererseits fühlte es sich merkwürdig an, als würde ich mich an Amys Tod bereichern.
»Danke, das ist sehr … aufmerksam.«
Rakesh nickte. »Gerne, und wenn es noch irgendetwas gibt …«
»… melde ich mich«, unterbrach ich ihn, bevor er erneut betonen konnte, dass mir seine Tür offen stand. Kurz war der Gedanke da, ihn auf den Unfall und die verschwundenen Aufnahmen anzusprechen. Ich entschied mich jedoch dagegen, denn ich war mir nicht sicher, ob ich ihm vertrauen konnte. Er arbeitete seit über zwanzig Jahren für das Darlington und war dem Hotel treu ergeben. Und das Letzte, was ich wollte, war, die falsche Person darauf aufmerksam zu machen, dass ich meine eigenen Nachforschungen anstellte.
Ich verabschiedete mich von Rakesh und schlug den Weg in Richtung Pausenraum ein, um den Umschlag mit dem Geld sicher in meinem Spind zu verstauen.
In der Kaffeeküche hatten sich ein paar Leute zur gemeinsamen Pause um den großen Tisch versammelt. Ihre ausgelassenen Stimmen erfüllten den Raum, jedoch verstummten sämtliche Gespräche schlagartig, als sie meine Anwesenheit bemerkten. Plötzlich wurde es totenstill, und ihre Gesichter nahmen alle denselben gequälten Ausdruck an, der mich bereits den ganzen Tag verfolgte. Sanfte Blicke gepaart mit verkniffenen Mündern.
Ich schloss die Tür hinter mir. »Hey.«
»Hey«, echote ein Chor aus monotonen Stimmen, ehe es wieder still wurde.
Alle starrten mich an. Niemand sagte etwas, aber auch ohne Worte war mir klar, was sich in ihren Köpfen abspielte: Sie bemitleideten mich. Sie wussten, was ich verloren hatte, und vermutlich hatten sie auch die Geschichte gehört, wie ich auf Amys Beerdigung zusammengebrochen war, und nun warteten sie darauf, dass es wieder passierte. Und wenn ich ehrlich war, fehlte nicht mehr viel. Die Schutzmauer, die ich um mein Herz errichtet hatte, um meine Trauer darin einzusperren und den Tag zu überstehen, bröckelte nach den zahlreichen Gesprächen über Amy gefährlich. Insgeheim wünschte ich mir, Rakesh und die anderen wären weniger verständnisvoll, damit ich wütend sein konnte. Denn wenn ich in den letzten Wochen eine Sache gelernt hatte, dann, dass es deutlich leichter war, mit Wut umzugehen als mit Trauer. Wut verlieh einem Antrieb, Trauer hingegen lähmte. Letztlich war es meine Wut gewesen, die mir die Kraft gegeben hatte, hierher zurückzukehren, um nach der Person zu suchen, die für den Unfall verantwortlich war.
Wortlos durchquerte ich den Raum, wobei die anderen jeden meiner Schritte verfolgten. In der Umkleide entriegelte ich meinen Spind und stopfte den Umschlag mit dem Geld in meine Tasche. Aus dem Pausenraum erklangen nun wieder leise Stimmen. Ich konnte nicht verstehen, was gesagt wurde, aber immer wieder hörte ich meinen Namen. Meine Nackenhaare stellten sich auf, und ich spürte einen Widerstand in den Beinen, der mich davon abhalten wollte, wieder in die Kaffeeküche zu gehen, doch mir blieb keine andere Wahl.
Ich verließ die Umkleide, und sofort verstummte das Gespräch wieder. Die Stille war erdrückend. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie George aus der Küche Philippa von der Rezeption unter dem Tisch einen Tritt verpasste.
Sie räusperte sich. »Grace?«
Ich blieb stehen und schaute zu ihr. Während ich meine dunkle Zimmermädchenuniform anhatte, die mit dem goldenen Logo des Darlington bestickt war, trug sie einen eleganten Hosenanzug und eine weiße Bluse. An Letzterer war ihr Namensschild befestigt, was mich daran erinnerte, dass ich meines vergessen hatte. Ein eindeutiges Indiz für meine Zerstreutheit. »Ja?«
»Willst du dich zu uns setzen?«
Mein erster Impuls war es, das Angebot abzulehnen. Ich wollte den anderen die Pause nicht mit meiner Anwesenheit verderben. Außerdem konnte ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mit all diesen Leuten in zähflüssiger Stille dazusitzen, während sie mich mit ihren traurigen Blicken durchbohrten. Trotzdem nickte ich, denn ich wollte die Chance, mit den anderen zu reden und sie zu observieren, nicht ungenutzt verstreichen lassen. Schließlich konnte es sein, dass einer oder eine von ihnen mit dem Täter zusammenarbeitete.
»Gern«, sagte ich mit dünner Stimme und steuerte den Tisch an.
Lucy sprang wie eine aufgescheuchte Gans auf, um mir ihren Platz zu überlassen. Sie murmelte etwas davon, dass ihre Pause vorbei war, und huschte aus dem Raum. Ich schaute ihr nach, unsicher, ob ich ihr Verhalten als verdächtig einstufen sollte oder ob sie nur einem unangenehmen Gespräch entkommen wollte. Nachdem die Tür hinter ihr zugefallen war, schnellten sämtliche Blicke wie ein gespanntes Gummi zu mir zurück.
»Wie geht es dir?«, fragte Melissa, eines der anderen Zimmermädchen, und legte ungefragt ihre Hand auf meine.
Ich hatte kein Problem mit Berührungen. Im Gegenteil, ich liebte es, von meinen Freunden umarmt und gekuschelt zu werden und Trost in ihrer Nähe zu finden, aber heute entwickelte ich eine regelrechte Aversion dagegen, angefasst zu werden.
Hastig entzog ich Melissa meine Hand. »Ich komme zurecht.«
»Ich bewundere dich echt«, sagte George mit Hundeblick. »An deiner Stelle könnte ich nicht mehr hier arbeiten. Ich hab selbst eine Schwester, und wäre sie bei diesem Unfall ums Leben gekommen …«
»Geht mir genauso«, stimmte Philippa mit einem Nicken zu, wobei mir ihre goldenen Ohrringe ins Auge fielen, die alles andere als billig aussahen. Waren die Creolen neu? Oder waren sie mir bisher nur nicht aufgefallen? Falls sie neu waren und so teuer, wie ich vermutete, könnten sie ein Hinweis darauf sein, dass Philippa einen plötzlichen Geldsegen erhalten hatte, vielleicht in Form von Bestechungsgeld? »Du bist echt tapfer.«
Meine Antwort bestand aus einem verkniffenen Lächeln. Was sollte ich darauf schon erwidern? Ich war nicht tapfer. Ich hatte nur keine andere Wahl. Amy war fort und würde nicht zurückkommen. Sie hatte ein Loch aus Schmerz und Sehnsucht zurückgelassen, und mir blieb nichts anderes übrig, als damit zu leben – oder daran zugrunde zu gehen.
Die von mir prophezeite Stille kehrte wieder ein. George schien plötzlich ziemlich interessiert an den Krümeln auf seinem Teller, während Melissa gebannt auf ihr Handy starrte und Philippa nervös an ihren Ohrringen herumspielte, die Lippen fest versiegelt, obwohl sie sonst immer etwas zu erzählen hatte. Die Luft im Raum fühlte sich dick und aufgeladen an, zu schwer, um meine Lunge richtig zu füllen.
Ich seufzte. »Wie ist es euch in den letzten Wochen so ergangen?«
Unsichere Blicke.
Lautes Schweigen.
Niemand antwortete mir. Mein Herz verkrampfte sich, und ich fragte mich, ob es jemals wieder so werden würde wie früher oder ob das mein neues Leben war. Nicht nur ein Leben ohne Amy, sondern ein Leben, in dem alle um mich herumschlichen, weil sie sich mit meinem Schmerz und meiner Trauer unbehaglich fühlten.
Zögerlich rückte George mit der Sprache raus, und auch Melissa und Philippa murmelten halbherzige Antworten, um mir nicht auf die Füße zu treten. Ich zwang mich zu lächeln, obwohl ich weinen wollte, und den bedauernden Blicken der anderen nach zu urteilen, war mir das anzusehen. Was den Knoten in meiner Kehle nur noch enger zog.
Ich schob meinen Stuhl zurück. Meine Kollegen und Kolleginnen wegen der gelöschten Videos zu observieren, war grundsätzlich sicherlich keine schlechte Idee, aber ich hatte es überstürzt. Sie brauchten noch Zeit. Ich brauchte noch Zeit, um mich in diesem alten, neuen Leben zurechtzufinden. »Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen.«
Das Aufatmen der anderen war förmlich zu hören. Ich wünschte ihnen noch eine schöne Pause, und kaum war die Tür hinter mir ins Schloss gefallen, erklangen wieder Stimmen – keine mitleidigen, sondern erleichterte.
Bedrückt machte ich mich auf den Weg zum Aufzug und versuchte, den Schmerz und die Enttäuschung von mir wegzuschieben. Ich fühlte mich wie eine Fremde in dem Hotel, das sich in den vergangenen zwei Jahren zu meinem zweiten Zuhause entwickelt hatte, und bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die zu einer Art Familie geworden waren. Hier hatte ich Rose und später Kate kennengelernt, meine zwei besten Freundinnen. Im The Darlington zu arbeiten, schweißte zusammen, denn im Hotel herrschte ein ständiges wir – die Arbeiterklasse – gegen sie – die Superreichen. Aber heute fühlte es sich nicht wie ein Wir gegen sie an, sondern wie ein Ich gegen den Rest der Welt.
Im Gehen holte ich die goldene Schlüsselkarte aus meiner Tasche, die mir Zutritt zu der privaten Etage der Familie Darlington gewährte. Die Familienmitglieder lebten in separaten Penthouses im obersten Stockwerk, das nur für wenige Angestellte zugänglich war. Es wurde sorgfältig ausgewählt, wer Zutritt bekam und wer nicht. Ich betrat den Aufzug, scannte die Karte und betätigte den Knopf für die Penthouse-Etage. Binnen Sekunden rauschte der Fahrstuhl nach oben. Derselbe Luxus wie im gesamten Hotel war auch auf diesem Stockwerk zu finden. Der Boden war mit einem makellosen tiefroten Teppich ausgelegt. Goldene Kronleuchter baumelten von der Decke, und die Wände wurden von Ölgemälden in massiven Rahmen geschmückt; alles Originale, die ein Vermögen wert waren, dabei waren die Motive noch nicht einmal sonderlich schön.
Ich holte den Wagen mit den Putzutensilien und den Staubsauger aus dem Hauswirtschaftsraum und beschloss, ausnahmsweise mit der hoteleigenen Müllhalde aka der Heimat von Beelzebub aka der Wohnung von Ethan Darlington, dem jüngsten Darlington-Bruder, anzufangen. Normalerweise hob ich mir seine Wohnung immer bis zum Schluss auf, denn sein Apartment zu putzen, war der meistgehasste Teil meiner Arbeit, doch wenn mich jemand von meinem Schmerz ablenken konnte, dann war es Ethan.
Er war vielleicht Erbe eines versnobten Luxushotels, aber er führte das Leben eines Rockstars. Seine Partys waren wild, laut und exzessiv, und nachdem sie vorbei waren, sah es aus, als wäre ein Tornado durch sein Penthouse gefegt. Doch das war noch nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste war Ethan selbst. Der Kerl war genauso respektlos und arrogant wie attraktiv – und leider war er verdammt attraktiv. Nicht Meine-Knie-werden-weich-attraktiv, sondern Mein-Höschen-wird-feucht-attraktiv. Was ziemlich unfair war, denn niemand mit einer derart ätzenden Persönlichkeit sollte dermaßen gut aussehen. Außerdem war es geradezu unmöglich, dem Kerl die Pest an den Hals zu wünschen, während mein Körper von der Idee, Sex mit ihm zu haben, hellauf begeistert war. Ich hätte es niemals zugegeben – nicht einmal unter Folter –, aber Ethan war nicht selten der Hauptdarsteller in meinen Fantasien, während ich Quality Time mit meinem Vibrator verbrachte. Wenn er es nicht schaffte, mich auf andere Gedanken zu bringen, dann niemand.
Ich betätigte wie immer die Klingel, um mich anzukündigen, bevor ich die Schlüsselkarte scannte, um die Tür zu öffnen. Innerlich bereitete ich mich auf das totale Chaos vor. Schließlich war Montag, was bedeutete, dass ein langes Wochenende hinter Ethan und seinen Freunden lag. Ein letztes Mal atmete ich tief ein und wappnete mich für den Gestank nach Alkohol und Gras, aber als ich die Tür aufdrückte, lag zu meinem Erstaunen der frische Duft von Zitronengras in der Luft. Und es sah auch nicht so aus, als wäre eine Bombe aus leeren Flaschen, Bechern und Pizzakartons mitten im Wohnzimmer detoniert. Es war ordentlich. Blitzblank, um genau zu sein. War ich versehentlich in Henrys Apartment gestolpert?
Nein, das war eindeutig Ethans Wohnung. In der Ecke stand sein schwarz glänzendes Klavier, und in dem Lowboard unter dem gigantischen Fernseher befanden sich mehrere Gamingkonsolen und eine Spielesammlung, die Jason in Schnappatmung versetzt hätte. Was war hier los? Hatte Giulia bereits ein anderes Zimmermädchen geschickt, weil sie mir nicht zutraute, mit dem Chaos zurechtzukommen? Ausgeschlossen. Es gab nur eine goldene Schlüsselkarte, und die war seit heute Morgen in meinem Besitz.
»Hey.«
Beim Klang der tiefen Stimme, die mich schon in zu vielen meiner Träume heimgesucht hatte, zuckte ich zusammen. Ich wirbelte herum und entdeckte Ethan. Er saß mit seinem Laptop an der Kücheninsel, neben sich ein Buch, das mit zahlreichen Post-its versehen war. Lernte er etwa? Die Brille mit dem schwarzen Rahmen, die er normalerweise durch Kontaktlinsen ersetzte, bestärkte mich in dieser Vermutung. Was für ein seltsamer Anblick. War ich in einem Paralleluniversum gelandet? Ich hatte Ethan schon in einigen kompromittierenden Situationen erwischt, aber noch nie hatte ich ihn beim Lernen erlebt. Das war befremdlich. Zumindest eine Sache war jedoch unverändert: Mein Körper reagierte mit Verlangen auf ihn. Ich konnte mich nicht dagegen wehren.
»Hey Beelzebub«, begrüßte ich ihn, um einen neutralen Tonfall bemüht.
Er sah genauso fantastisch aus wie auf der Pearl Gala, auf der ich ihn zuletzt gesehen hatte. An jenem Abend hatte er einen schicken schwarzen Dreiteiler getragen, nun hatte er eine dunkle Jogginghose und einen grauen Hoodie an. Trotz der weiten Kleidung war ihm sein sportlicher Körperbau anzusehen. Es lag an der Art, wie er sich bewegte. Seinen breiten Schultern und seiner aufrechten Haltung. Ich hätte wie eine schrumpelige Kartoffel auf diesem Hocker ohne Lehne gesessen, er wirkte dagegen regelrecht anmutig.
Ethan scannte mich von oben bis unten. »Du bist zurück.«
Ich setzte ein Lächeln auf, und erstaunlicherweise war es heute das erste, das sich nicht gequält oder verkniffen anfühlte. »Ja, hast du mich vermisst? Ach, was frage ich überhaupt. Natürlich hast du mich vermisst. Ich weiß doch, dass ich dein absolutes Tageshighlight bin.«
Ethan nahm seine Brille ab, und irgendwie schaffte er es, selbst diese alltägliche Geste verführerisch aussehen zu lassen. Dann stand er auf und ging auf mich zu. Je näher er kam, desto klarer wurde das Blau seiner Augen. Sie waren so schön wie das Meer – und mindestens genauso gefährlich. Auf den ersten Blick erschienen sie trügerisch ruhig, aber bei genauerem Hinsehen erkannte man die spitzen Felsen, die unter der Oberfläche lauerten. Doch sosehr ich mich auch anstrengte, heute konnte ich keine spitzen Felsen erkennen, dafür lag ein anderer Ausdruck in seinen Augen. Ein Ausdruck, der mich verwirrte, denn ich hatte ihn noch nie zuvor an Ethan wahrgenommen.
In der nächsten Sekunde erkannte ich allerdings, was es war: Mitleid.
Fuck.
My.
Life.
Ethan Darlington, König der Arschlöcher, selbst ernannter Frauenheld und Vollzeit-Egozentriker, bemitleidete mich. Verdammt, wie armselig musste ich aussehen, wenn jemand wie er Mitgefühl für mich zeigte?
Ein paar Schritte von mir entfernt blieb er stehen. Bis auf seine Hände, die er locker in die Taschen seiner Hose geschoben hatte, wirkte er steif und seltsam unbeholfen. »Ich habe gehört, was mit deiner Schwester passiert ist, und –«
»Wag es ja nicht!«, zischte ich mit erhobenem Zeigefinger.
»Was?«
Mein Magen zog sich zusammen. »Wehe, du bist nett zu mir.«
Ethan stutzte. »Ich wollte doch nur –«
»Vergiss es!«, unterbrach ich ihn erneut, weil ich es nicht ertragen würde, auch nur ein Wort des Trostes aus seinem Mund zu hören – aber da war es bereits zu spät. Meine Unterlippe begann zu beben. Vielleicht waren die rührseligen Blicke meiner Kolleginnen und Kollegen schuld, die mich schon den ganzen Tag begleiteten. Vielleicht lag es an der Nähe zum Unfallort. Oder vielleicht einfach daran, dass Amy tot war, doch ich konnte nicht mehr. Die Mauer, die ich um mein Herz errichtet hatte, brach in sich zusammen, und plötzlich war mein Schmerz frei.
Die Tränen, die ich den ganzen Tag zurückgehalten hatte, schossen mir in die Augen. Ich blinzelte ein paarmal schnell hintereinander in der Hoffnung, sie zurückzudrängen, aber es gelang mir nicht. Ich war zu schwach. Und der Schmerz zu groß. Ein erbärmliches Japsen entwand sich meiner Kehle, und ich heulte ausgerechnet vor dem Mann los, von dem ich geglaubt hatte, er könnte mich ablenken.
Ich schlug die Hände vor das Gesicht, weil ich nicht wollte, dass Ethan mich so sah, aber dafür war es längst zu spät. Dieser Tag konnte nicht mehr schlimmer werden! Oder doch? Ich hörte, wie er näher kam, bis er unmittelbar neben mir stand. Selbst in meinem derzeitigen Zustand war seine Präsenz zu einnehmend, um nicht von mir bemerkt zu werden.
Er berührte mich sachte an der Schulter, und ich bereitete mich darauf vor, hochkant von ihm aus dem Apartment geschmissen zu werden, denn das Letzte, was ein Typ wie er wollte, war, eine weinende Frau an der Backe zu haben. Doch zu meinem Erstaunen zerrte Ethan mich nicht aus seiner Wohnung, sondern an sich. Ein Ruck fuhr durch meinen Körper, und plötzlich fand ich mich in seinen Armen wieder.
Unter anderen Umständen hätte ich mich gegen die Umarmung gewehrt, denn so groß die körperliche Anziehung zu Ethan auch war, ebenso groß war meine persönliche Abneigung gegen arrogante Arschlöcher. Aber ich besaß nicht die Kraft, mich gegen seine tröstende Geste zu sträuben. Wie von selbst krallten sich meine Finger in den Stoff seines Hoodies, worauf er mich noch fester an sich zog, was wiederum dazu führte, dass ich noch heftiger weinte.
Ich war mir nicht einmal sicher, warum ich weinte. Weinte ich um Amy? Weinte ich, weil nicht nur sie ihr Leben verloren hatte, sondern auch ich meines, so wie ich es kannte? Weinte ich, weil Amys Verlust mich zu einer Aussätzigen machte und meine Kolleginnen und Kollegen nicht mit meiner Trauer umzugehen wussten? Oder weinte ich, weil meine Eltern und mein kleiner Bruder meinen Anblick nicht ertrugen?
Ethan sagte nichts. Er hatte keine beschwichtigenden Floskeln oder Worte des Trostes für mich übrig. Er säuselte mir auch nicht beruhigend ins Ohr. Oder versicherte mir, dass alles wieder gut werden würde. Er umarmte mich einfach nur fest, bis ich das Gefühl hatte, dass alles, was mich noch aufrecht hielt, seine starken Arme waren. Und so ungern ich es mir eingestehen wollte, es fühlte sich gut an, von Ethan gehalten zu werden. Ich mochte ihn genauso wenig wie er mich, aber er umarmte mich auf eine Weise, die mich etwas anderes glauben ließ. Sein Duft hüllte mich ein, und mit der Zeit ebbte der Strom an Tränen, die gegen meine Kehle drückten, ab. Was gut und schrecklich zugleich war, denn umso klarer mein Blick wurde, desto klarer wurde auch mein Verstand und das Bewusstsein, dass ich mich gerade von Ethan trösten ließ. Damit würde er mich für den Rest meines Lebens aufziehen, oder zumindest, solange ich für das Hotel arbeitete.
Ich löste mich von ihm, wischte mir das Gesicht trocken und starrte auf den nassen Fleck, den meine Tränen auf seinem Hoodie hinterlassen hatten, denn ich brachte es nicht über mich, ihm ins Gesicht zu sehen. Vermutlich würde ich dort ohnehin nur ein selbstgefälliges Grinsen vorfinden. Ich schämte mich, ausgerechnet vor ihm derart die Fassung verloren zu haben. Am liebsten wäre ich schnurstracks aus der Wohnung marschiert und nie wieder zurückgekehrt, aber ich wollte nicht noch mehr Schwäche zeigen. Ich war stark. Ich konnte zu meinen Gefühlen stehen.
»Geht es wieder?«, fragte Ethan erstaunlich sanft.
Ich würgte die letzten verbliebenen Tränen herunter, um meine Stimme unter Kontrolle zu bringen. »Ich … Ich denke schon.«
»Gut.« Als hätte er nur darauf gewartet, dass ich das sagte, wich er zurück und nahm all die Wärme und den Trost mit sich. »Denn wenn du damit fertig bist, hier rumzuflennen, kannst du dich an die Arbeit machen.«
Das war Ethan, wie ich ihn kannte und verfluchte. Jeder Hauch von Nettigkeit war verflogen. Jedoch gaben mir seine gehässigen Worte die Kraft, mich aufrecht hinzustellen und ihm ins Gesicht zu sehen. Sein Blick wirkte verschlossen, doch in der Tiefe erkannte ich ein Aufglimmen, und da verstand ich: Er war nicht gemein zu mir, weil er ein Arschloch war, sondern weil ich ihn zuvor darum gebeten hatte, nicht nett zu mir zu sein. Was auf verquere Art und Weise irgendwie ziemlich süß von ihm war.
»Was ist, Gracie?«, fragte er. Ich hasste es, wenn er diese Verniedlichung meines Namens benutzte, aber ich wollte ihn auch nicht darauf hinweisen, denn dann würde er erst recht nicht damit aufhören. »Hörst du schlecht, oder warum stehst du hier so nutzlos rum? Du sollst dich an die Arbeit machen. Der Müll bringt sich nicht von selbst raus.«
Ich griff nach Ethans Hand, die kurz zuvor so beschwichtigend auf meinem Rücken gelegen hatte, und zog ihn in Richtung Wohnungstür, wobei ich nur zwei Schritte weit kam, bevor er sich dagegenstemmte und stehen blieb.
Irritiert starrte er mich an, als wäre ich dabei, den Verstand zu verlieren. »Was soll das werden?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich dachte, ich soll den Müll rausbringen.«
Er entriss mir seine Hand. »Sehr witzig.«
»Was? Ich kann dich nicht tragen.«
Ethans Mundwinkel zuckten kaum merklich. Ich wartete auf eine Retourkutsche, doch die kam nicht. Stattdessen schob er sich an mir vorbei und rempelte mich dabei mit der Schulter an, als wäre ich ein leidiges Hindernis, das ihm im Weg stand. Wortlos setzte er sich wieder vor seinen Laptop und ignorierte mich, als hätte er beschlossen, dass ich seiner Aufmerksamkeit nicht länger würdig war.