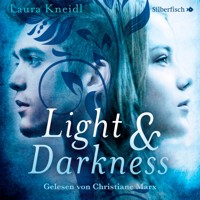6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich mache mir ständig Gedanken darum, was andere Menschen von mir denken. Wen sie in mir sehen. Aber nicht bei dir. Bei dir kann ich ganz ich selbst sein.
Als Micah auf ihren neuen Nachbarn trifft, kann sie es nicht glauben: Es ist ausgerechnet Julian, der wenige Wochen zuvor ihretwegen seinen Job verloren hat. Micah fühlt sich schrecklich, vor allem, weil Julian kühl und abweisend zu ihr ist und ihr nicht mal die Gelegenheit gibt, sich zu entschuldigen. Doch gleichzeitig fasziniert Micah seine undurchdringliche Art, und sie will ihn unbedingt näher kennenlernen. Dabei findet sie heraus, dass Julian nicht nur sie, sondern alle Menschen auf Abstand hält. Denn er hat ein Geheimnis, das die Art, wie sie ihn sieht, für immer verändern könnte ...
"Ein absolutes Must-Read, das ich am liebsten in jedes Regal der Welt stellen möchte. Someone New ist romantisch, ehrlich, authentisch - und so wichtig!" Leselurch
Nach "Berühre mich. Nicht" und "Verliere mich. Nicht." - der neue Roman von Platz-1-Spiegel-Bestseller-Autorin Laura Kneidl
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungMottoPlaylist1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. Kapitel32. Kapitel33. Kapitel34. Kapitel35. KapitelEpilogNachwortDanksagungLeseprobeDie AutorinDie Romane von Laura Kneidl bei LYXImpressumLAURA KNEIDL
Someone New
Roman
Zu diesem Buch
Die achtzehnjährige Micah hat nur einen Wunsch: ihren Zwillingsbruder zu finden. Adrian ist spurlos verschwunden, seit ihre Mutter ihn mit einem anderen Jungen im Bett erwischt und anschließend aus dem Haus geworfen hat. Während ihre Eltern mit aller Macht das Ansehen der Familie wahren wollen, verzichtet Micah auf ihren Studienplatz in Yale und schreibt sich stattdessen an der örtlichen Uni ein, um in ihrer Heimatstadt weiter nach Adrian suchen zu können. Das Letzte, was sie dabei gebrauchen kann, ist Ablenkung. Doch als sie ihre neue Wohnung bezieht, stellt sie fest, dass ihr Nachbar ausgerechnet der attraktive Kellner ist, mit dem sie wenige Wochen zuvor auf einer Dinnerparty ihrer Eltern heftig geflirtet hat – und der daraufhin seinen Job verloren hat. Micah fühlt sich noch immer schrecklich deswegen, zumal Julian ihr nicht einmal die Chance gibt, sich zu entschuldigen. Schnell findet Micah allerdings heraus, dass er nicht nur sie, sondern alle Menschen in seinem Leben auf Abstand hält. Je näher sie ihn kennenlernt, desto mehr fasziniert sie seine undurchdringliche Art und umso stärker wird das Prickeln, das sie in seiner Gegenwart spürt. Doch Micah ahnt nicht, dass Julian ein Geheimnis hat. Und dass dieses Geheimnis die Art, wie sie ihn sieht, für immer verändern könnte …
Für alle, die sich zwischen den Seiten dieses Buches wiederfinden.
»Habe den Mut, du selbst zu sein. Es ist ein Prozess,mit dem du jederzeit anfangen kannst.«
Anabelle Stehl
Playlist
Hozier – Someone New
Selena Gomez feat. Marshmello – Wolves
Taylor Swift – Dress
Raleigh Ritchie – Stronger Than Ever
Demi Lovato – Sorry Not Sorry
Beyoncé – Hold Up
MIKA – Grace Kelly
Selena Gomez – Bad Liar
Linkin Park – Waiting for the End
The Darkness – I Believe in a Thing Called Love
Five Hundredth Year – I Did Something Bad
Shinedown – DEVIL
Harry Styles – Sign of the Times
Jennifer Rostock – Kaleidoskop
Nightwish – Ever Dream
A Great Big World feat. Christina Aguilera – Say Something
Keiynan Lonsdale – Preach
Selena Gomez feat. Gucci Mane – Fetish
Hozier – Take Me to Church
Casper – Flackern, Flimmern
Snow Patrol – What If This Is All the Love You Ever Get?
1. Kapitel
Wie lange muss ich das wohl noch ertragen?
Die Frage stellte ich mir zum wiederholten Mal an diesem Abend, während mich Gwendoline Finn, die beste Freundin meiner Mom, von Kopf bis Fuß musterte. Abschätzend ließ sie den Blick von meinen schwarzen Haaren mit dem kurzen Pony über mein Louis-Vuitton-Kleid hinab bis zu meinen Schuhen gleiten – ein altes Paar Jimmy Choos aus der vorletzten Frühjahrskollektion. Sie rümpfte die Nase, was in ihrem vom Botox versteinerten Gesicht allerdings nur als ein leichtes Zucken zu erkennen war.
Doch ich lebte schon von klein auf in dieser Welt, und mit der Zeit hatte ich gelernt, in den regungslosen Mienen der High Society zu lesen.
»Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie nicht nach Yale gehen werden«, sagte Mrs Finn. Ihr Tonfall war übertrieben freundlich und gleichzeitig distanziert, als würde sie mich nicht bereits seit meiner Geburt kennen. Dabei hatte sie miterlebt, wie ich mir als Baby in die Hose gemacht und als Kleinkind den Mund mit Sandkuchen vollgestopft hatte.
»Da haben Sie richtig gehört«, antwortete ich. Ich fühlte mich wie Sam Winchester in der Serie Supernatural, als er dazu verdammt worden war, seinen Bruder immer wieder auf unterschiedliche Arten sterben zu sehen. Ich wiederum war verflucht, an diesem Abend immer und immer wieder das gleiche Gespräch zu führen. Die Unterhaltungen variierten zwar in der Wortwahl, aber sie endeten alle auf dieselbe Weise: mit Unverständnis und Verachtung.
»Und Sie werden tatsächlich das örtliche College besuchen?«
Ich sah sehnsüchtig zu einem der Ausgänge, ehe ich nickte.
Mrs Finn starrte mich fassungslos und mit einem Hauch von Ekel an, als befürchtete sie, ich könnte mir am MFC – dem Mayfield College – eine ansteckende Krankheit einfangen.
Mir lag auf der Zunge, sie darüber aufzuklären, was für einen guten Ruf das MFC genoss, aber sie hätte es ohnehin nicht verstanden. Alles, was nicht Yale, Brown, Dartmouth, Harvard oder Princeton war, lag vermeintlich unter der Würde dieser Menschen; nur ein Auslandssemester in Europa war darüber hinaus noch akzeptabel.
»Aber Sie planen weiterhin, Jura zu studieren, nicht wahr?«
»Selbstverständlich«, erwiderte ich mit einem falschen Lächeln und versuchte, nicht daran zu denken, wie sehr ich die nächsten Jahre hassen würde. Tatsache war, dass ich mich weder für Politik oder Gesetze noch unseren Rechtsstaat interessierte. Während der Anwaltsberuf in der Theorie für mehr Gerechtigkeit auf der Welt sorgte (was eine schöne Vorstellung war), bedeutete er in der Praxis vor allem, reiche Menschen noch reicher und arme Menschen noch ärmer zu machen, zumindest entsprach das meinen Beobachtungen der letzten Jahre.
»Das freut Ihre Eltern mit Sicherheit«, sagte Mrs Finn, aber was sie wirklich meinte, war: Zumindest ziehst du den Namen eurer Familie nicht noch weiter in den Dreck, indem du Kunst studierst. »Und Ihr Bruder? Er reist gerade durch Europa, nicht wahr?«
»Ja«, antwortete ich gelangweilt. Wieso nervte mich diese Frau mit Fragen, auf welche sie die Antworten bereits kannte? Na ja, zumindest kannte sie die Lügen, die meine Eltern verbreitet hatten. Die Wahrheit war in ihren Augen zu beschämend, um mit der Allgemeinheit geteilt zu werden. Dabei waren sie diejenigen, die sich schämen sollten.
»Mein Ältester, Carter, hat einige Monate in Italien verbracht. Eine wunderbare Erfahrung.« Mrs Finn hob die Hand und winkte eine Kellnerin heran.
Sofort kam die junge Frau in schwarzer Stoffhose, weißem Hemd und dunklen Hosenträgern durch den Raum geeilt. Die Haare hatte sie straff nach hinten gebunden, und obwohl sie lächelte, war ihr Blick leer. Sie wollte genauso wenig hier sein wie ich. Dennoch hielt sie Mrs Finn, ohne mit der Wimper zu zucken, ihr Tablett hin, damit diese ihre leere Champagnerflöte darauf abstellen und sich eine volle nehmen konnte. »Gibt es noch Hummerhäppchen?«
»Ich werde in der Küche nachsehen.« Die Kellnerin hielt mir ebenfalls das Tablett entgegen.
Kopfschüttelnd lehnte ich ab, auch wenn ein wenig Alkohol den Abend sicherlich erträglicher gemacht hätte. Nur war es als Tochter zweier Anwälte nicht wirklich ratsam, gegen das Alkoholgesetz zu verstoßen, vor allem nicht in der Anwesenheit von Klienten, die ihnen Millionenbeträge anvertrauten.
»Michaella, da bist du ja!«
Die Stimme meiner Mom, die geradewegs auf uns zugelaufen kam, ließ mich und Mrs Finn aufblicken. Sie trug ein dunkles Kostüm mit plissiertem Rock, und ihre Stöckelschuhe klackerten auf dem polierten Marmorboden. Anders als viele ihrer Freundinnen hatte meine Mom ihr Gesicht noch nicht mit Botox unterspritzen lassen, aber etliche Schichten Make-up kaschierten ihre Falten und verdeckten die Sommersprossen, die auch ich auf der Nase trug.
»Ich suche schon die ganze Zeit nach dir, um dir jemanden vorzustellen. Kennst du Marshall Millington bereits?« Sie deutete vielsagend auf den jungen Mann, den sie im Schlepptau hatte. Er war vermutlich in meinem Alter, achtzehn oder neunzehn, aber sein grauer Anzug war identisch mit dem, den mein Dad heute trug.
»Es freut mich, dich endlich kennenzulernen«, sagte Marshall und streckte mir die Hand entgegen. Er hatte ein niedliches Lächeln.
Ich ergriff seine Hand. »Marshall Millington. Schöne Alliteration. Bist du ein Superheld?«
»Wie bitte?«
»Na ja, wie Peter Parker oder Wade Wilson«, erläuterte ich.
»Wer sind diese Leute?«, fragte er verständnislos und sah Hilfe suchend zu meiner Mom, die mir einen mahnenden Blick zuwarf und kaum merklich den Kopf schüttelte. Es gehörte sich nicht für eine junge Frau, über Superhelden und Comics zu reden. Das war allein Kindern vorbehalten, und auch da nur den Jungs, zumindest in der mittelalterlichen Welt, in der meine Eltern lebten.
»Spider-Man? Deadpool? Oder der Hulk? Bruce Banner.«
Die Verwirrung in Marshalls Augen wurde nur noch größer. Wie konnten diese Leute angeblich so weltgewandt sein und gleichzeitig hinterm Mond leben? Hätte ich Anstoß für ein Gespräch über die Wall Street gegeben, hätte Marshall vermutlich einen stundenlangen Monolog über Aktien, Geldkurse und den Weltmarkt halten können.
»Mach dir nichts draus«, kam ihm meine Mom zu Hilfe. »Mir sagen diese Namen auch nichts. Michaella hatte schon immer einen sehr speziellen Geschmack. Wahnsinnig charmant.« Sie tätschelte Marshall die Schulter, wobei die goldenen Armbänder an ihrem Handgelenk klimpernd gegeneinanderschlugen.
»Mrs Finn?« Die Kellnerin war zurück. Das Tablett mit den Champagnerflöten hatte sie gegen eines mit Häppchen ausgetauscht.
Mrs Finn, meine Mom und Marshall nahmen sich jeweils einen der kleinen Porzellanteller und bedienten sich an den Horsd’œuvres.
»Willst du nichts essen?« Mom sah mich fragend an.
»Nein danke, ich habe keinen Hunger«, log ich. In Wahrheit war ich kurz davor zu verhungern, aber ich wollte nicht schon wieder erklären müssen, wieso Hummer und Kaviar nicht in meine vegetarische Ernährung passten, also sparte ich mir den Atem.
Mit gespieltem Interesse hörte ich Marshall zu, wie er von seinem Praktikum bei einer Zeitung erzählte und davon, wie er Donald Trump Jr. hatte interviewen dürfen. Natürlich war er Republikaner, was sonst? Ich blieb, bis sich die Unterhaltung unserem Präsidenten zuwandte und ich es keine Sekunde länger aushielt. Mit der Ausrede, mich frisch machen zu wollen, eilte ich davon, bevor mich weitere Klienten und Geschäftspartner meiner Eltern ansprechen konnten.
Ich durchquerte den Salon mit den hohen Decken, der dunklen Polstergarnitur und dem gigantischen Erkerfenster, das sich zum Garten hin öffnete. Doch statt ins Badezimmer flüchtete ich in die Küche. Die lauten Stimmen und grellen Lacher hinter mir wurden leiser, und ich atmete das erste Mal seit zwei Stunden erleichtert auf.
Obwohl sich meine Eltern nie in der Küche aufhielten, war sie so groß wie ein Ein-Zimmer-Apartment und verfügte über einen professionellen Herd, wie ihn sich jeder Fünf-Sterne-Koch in seinem Restaurant wünschen würde. Gekocht wurde hier allerdings nur von ihrer Haushälterin, Rita. Nicht mal die Häppchen, die das Cateringpersonal verteilte, waren hier zubereitet worden. Überall standen mit Folie abgedeckte Tabletts und Aufbewahrungsbehälter herum.
Ich öffnete den Kühlschrank, ein monströses Teil aus Edelstahl mit zwei Türen und genug Platz, um Lebensmittel für eine zehnköpfige Familie zu horten. Trotzdem herrschte darin gähnende Leere, mit Ausnahme irgendwelcher Smoothies und weiterer Horsd’œuvres. Nachdem ich den Kühlschrank wieder geschlossen hatte, zog ich mir meine Jimmy Choos aus und kletterte auf die Anrichte, was sich in dem schmal geschnittenen Kleid als ziemliche Herausforderung erwies. Da meine Eltern keinen Industriezucker im Haus duldeten, versteckte Rita im hintersten Eck in einem der Schränke immer ein paar Schokoriegel für mich. Aber mein Lager war leer.
»Fantastisch«, murmelte ich genervt und war gerade dabei, von der Anrichte zu klettern, als die Tür hinter mir aufgestoßen wurde. Ich zuckte zusammen und musste mich an einem der Küchenschränke festklammern, um nicht abzurutschen. Shit. Langsam drehte ich mich um in der Erwartung, Mom wäre mir gefolgt. Seit einem Vorfall von vor zwei Jahren ließ sie mich bei dieser Art Veranstaltungen nur noch selten aus den Augen. Doch es war nicht meine Mutter, die in die Küche gekommen war, sondern ein Kellner.
Er war wie vom Donner gerührt stehen geblieben und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an. Bei dem Versuch, von der Anrichte zu steigen, war mein Kleid hochgerutscht, sodass der Kerl jetzt einen ungehinderten Blick auf meine rote Spitzenunterwäsche hatte. Völlig ungeniert gaffte er mich an.
Herausfordernd hob ich eine Augenbraue. »Gefällt dir die Aussicht?«
Er ließ den Blick von meinem Hintern zu meinem Gesicht wandern. Gleichgültig zuckte er mit den Schultern. »Schwarze Wäsche hätte mir besser gefallen, wenn ich ehrlich sein soll, aber rot ist auch in Ordnung.«
Seine plumpe Antwort warf mich vollkommen aus der Bahn. Die meisten Leute, die für meine Eltern arbeiteten, behandelten mich wie ein rohes Ei. Entweder weil sie mich für ein naives Dummchen hielten, oder weil sie fürchteten, das verzogene Gör könnte sie feuern lassen. Aus diesem Grund sagten sie in meiner Gegenwart meist nur Dinge, von denen sie glaubten, dass ich sie hören wollte.
Ich sprang von der Anrichte, zog das Kleid über die Oberschenkel und betrachtete den Kerl eingehend. Ich war mir sicher, dass er mir heute noch keinen Champagner hatte aufdrängen wollen. Seine kantigen Gesichtszüge und die vollen Lippen, die er jetzt zu einem schiefen Lächeln verzog, wären mir aufgefallen. Und obwohl seine spitze Nase ein wenig zu groß für sein Gesicht war, änderte das nichts an der Tatsache, dass er mit Abstand der attraktivste Mann des Abends war. Seine braunen Haare, die an dunkles Karamell erinnerten, waren etwas zu lang, so als hätte er seinen letzten Friseurtermin verpasst, und auf eine unordentliche Weise nach hinten gekämmt, wie es meiner Mom nicht gefallen hätte.
»Schwarz ist langweilig«, erwiderte ich schließlich.
»Schwarz ist elegant.«
»Ist deine Unterwäsche schwarz?« Ich neigte den Kopf und versuchte, aus der Entfernung seine Augenfarbe auszumachen, was unter dem künstlichen Licht der Deckenstrahler praktisch unmöglich war. Doch ich war mir sicher, dass sie blau oder grün und nicht braun wie meine eigenen waren.
Ein amüsierter Ausdruck trat auf das Gesicht des Kellners, und Grübchen drückten sich in seine glatt rasierten Wangen. Er stellte in aller Ruhe sein leeres Tablett ab, als würde er täglich miterleben, wie sich Frauen beim Herumklettern in der Küche entblößten. »Wer sagt, dass ich überhaupt welche trage?«
»Dir ist klar, dass du hier Essen servierst, oder?«
»Aber das tue ich mit meinen Händen und nicht mit meinem …« Er hielt inne und presste die Lippen aufeinander, um das Wort zurückzuhalten, das ihm eindeutig auf der Zunge lag, dann räusperte er sich. »Was machst du überhaupt hier? Suchst du etwas?« Er deutete auf den offen stehenden Schrank.
»Essen.«
»Davon haben wir jede Menge.«
Ich schnaubte. »Das sehe ich, aber habt ihr auch etwas ohne Kaviar, Hummer oder andere tote Tiere?«
»Ich fürchte nicht.«
»Verdammt.« Mit einem Stöhnen lehnte ich mich gegen die Anrichte und schlang die Arme um meine Mitte, als könnte ich meinen Magen so davon abhalten, ungeduldig zu knurren. Wieso hatte ich auf dem Weg hierher nicht bei Whole Foods haltgemacht?
»Vielleicht kann ich dir helfen.« Der Kellner kam näher, bis ich erkannte, dass seine Augen grün waren. Nicht hell wie Knospen im Frühjahr, sondern dunkel wie Blätter, kurz bevor sie braun wurden und von den Bäumen fielen. Statt vor mir stehen zu bleiben, lief er an mir vorbei zum Vorratsraum, in dem für gewöhnlich nur Konserven und trockene Lebensmittel gelagert wurden. Doch heute stapelten sich darin mehrere Taschen und Jacken. Er ging in die Knie und durchwühlte den Berg aus Stoff. Ich konnte nicht sehen, was er suchte, bis er sich aufrichtete und mit einem Sandwich auf mich zukam. Wortlos hielt er es mir entgegen.
Ich zögerte nicht. »Danke, du hast was gut bei mir.«
»Ich nehme gern Trinkgeld.«
»Sollst du bekommen.« Ich wickelte die Folie vom Sandwich, und nachdem ich mich vergewissert hatte, dass wirklich kein Fleisch darauf war, nahm ich einen gierigen Bissen – und stöhnte auf. Es schmeckte fantastisch, und das nicht nur, weil ich total ausgehungert war. Das Brot war fluffig, wie frisch gebacken, und statt einfach nur mit einer Scheibe Käse und Mayo zusätzlich mit Salat, Gurken und Tomaten belegt, verfeinert mit einem Hauch Senf und etwas Süßem, das ich nicht zuordnen konnte.
Der Kellner beobachtete mich. Langsam und eindringlich zugleich ließ er den Blick an meinem Körper entlangwandern, so als würde er nicht nur mein zurechtgemachtes Äußeres sehen, sondern auch die Persönlichkeit, die darunter verborgen lag. Mich hatten an diesem Abend schon viele Männer gemustert, aber ihre Neugierde hatte mich kaltgelassen. Nun jedoch beschleunigte sich mein Herzschlag.
»Wie heißt du?«, fragte ich mit vollem Mund. »In meinem Kopf nenne ich dich die ganze Zeit ›der Kellner‹.«
»Leute haben mich schon Schlimmeres genannt.« Die Bemerkung kam ihm locker über die Lippen, aber dabei flackerte etwas Dunkles in seinen Augen auf, das nicht zu seinem Tonfall passte.
Irritiert wartete ich darauf, dass er sich vorstellte, aber er sprach nicht weiter.
»Jetzt sag schon«, drängte ich.
Ich wusste nicht, wieso es mir so wichtig war, seinen Namen zu erfahren, vermutlich würden wir uns nie wiedersehen. Bei diesen Cateringfirmen herrschte ein ständiger Personalwechsel. Studenten kamen und gingen, wie es ihnen ins Semester passte. Allerdings war ich mir nicht sicher, ob er einer von ihnen war. Er war etwas älter, Mitte zwanzig, aber womöglich studierte er auch etwas besonders Anspruchsvolles wie Medizin oder machte seinen Doktor in einem anderen Fachgebiet.
»Julian«, antwortete er schließlich, und das war alles: Julian. Kein Titel, kein Zweitname, kein Nachname, um sich zu profilieren und um mich wissen zu lassen, wie viel Geld seine Familie besaß.
Ich lächelte und schwang mich auf die Anrichte. Meine Füße baumelten in der Luft. »Ich bin Micah.«
»Ich weiß, wer du bist. Michaella Rosalie Owens.«
»Klingt irgendwie gruselig, wenn du das so sagst. Wie ein Stalker.«
»Kein Stalker. Nur ein Kellner mit gutem Gehör. Die Leute reden über dich.«
»Und was sagen sie?«
»Dies und das. Vor allem spekulieren sie darüber, wieso du nicht nach Yale gehst. Sie vermuten, dass du schwanger bist, wie damals die kleine Lilly Sullivan. Und vermutlich ist der Sohn eurer Haushälterin der Vater, mit dem du bereits vor einer Weile eine Affäre hattest.« Julian schüttelte den Kopf, als hätte ich ihn enttäuscht.
Ich verdrehte die Augen und biss in das Sandwich, als könnte ich meine Gefühle mitsamt dem Brot runterschlucken. Die Leute taten, als würde die Welt untergehen, nur weil ich mich gegen ein Ivy-League-College entschieden hatte. Aber wie hätte ich ruhigen Gewissens nach Yale gehen können, ohne zu wissen, was mit Adrian war? Denn genauso wenig wie ich schwanger war, war er in Europa – meine Eltern hatten ihn rausgeschmissen, nachdem sie ihn vor einem Monat mit einem anderen Jungen im Bett erwischt hatten. Homosexualität passte nicht in die konventionelle Weltanschauung unserer Eltern und ihrer Geschäftspartner. Zwar hätte es keiner ihrer Klienten je gewagt, sich offen gegen Adrians sexuelle Orientierung auszusprechen. Niemand wollte als ignorant gelten. Aber mit der Zeit hätten wohl die meisten von ihnen Ausreden gefunden, um sich von der Kanzlei meiner Eltern zu distanzieren. Aus Angst, ihre Familiennamen mit irgendwelchen Gerüchten zu beschmutzen.
Seitdem hatte ich Adrian nicht mehr gesehen. Er hatte sich nur noch ein einziges Mal nachts heimlich ins Haus geschlichen, um ein paar Sachen zu packen und seinen Hausschlüssel zurückzulassen. In der ersten Woche nach dem »Vorfall« hatte ich kein Wort mit meinen Eltern gesprochen und all meine Kraft darauf verwendet, meinen Zwillingsbruder zu suchen. Erfolglos. Er war nirgendwo. Nicht bei seinen Freunden. Nicht in seinem Lieblingscafé. Und auch nicht im Museum für moderne Architektur, das er als seine persönliche Oase betrachtete. Wo immer er war, er wollte nicht gefunden werden. Nicht einmal von mir. Weit konnte er allerdings nicht gekommen sein, denn unsere Eltern hatten all seine Konten gesperrt. Er musste nach wie vor in der Nähe sein, und das war der Grund, weshalb ich Mayfield nicht für Yale verlassen würde. Adrian hatte seine Immatrikulation zurückgezogen, obwohl er immer davon geträumt hatte, auf eine Elite-Uni zu gehen, mehr als ich. Niemals hätte ich seinen Traum ohne ihn verfolgen und ihn dabei auch noch im Stich lassen können. Ich wollte für ihn da sein, wenn er sich entschied zurückzukommen, und keine dreitausend Meilen entfernt. Er brauchte wenigstens meine Unterstützung, wenn er sie schon von unseren Eltern nicht bekam.
Ich würde nie verstehen, was sie dazu getrieben hatte, Adrian wegzuschicken, und ein Teil von mir würde ihnen dies wohl nie verzeihen, aber alles in allem waren sie keine schlechten Menschen. Sie hatten uns immer alles gegeben, was wir gebraucht hatten – Kleidung, Essen, ein Dach über dem Kopf und Liebe. Obwohl sie viel arbeiteten, hatten sie sich mindestens einmal in der Woche Zeit für einen gemeinsamen Abend genommen. Bis vor einem Monat. Ich hoffte inständig, dass es wieder so werden konnte wie früher und unsere Eltern eines Tages lernen würden, Adrian so zu akzeptieren, wie er war. Denn sie hatten mich, und ich würde alles sein, was sie immer gewollt hatten – Jurastudentin, Anwältin, Geschäftspartnerin und Erbin.
»Schmeckt dir das Sandwich nicht?«
Julians Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Ich blinzelte. »Doch. Es ist gut. Wieso?«
»Weil du gerade das Gesicht verzogen hast, als würde man dich zwingen, Dreck zu essen.«
»Oh, sorry, das war nicht wegen des Sandwiches.« Ich lächelte, spürte aber, dass es verkrampfter wirkte als noch vor ein paar Minuten. Wenn ich an Adrian und meine Zukunft dachte, hatte das diese Wirkung auf mich. Ich musste mich ablenken. In diesem Zustand konnte ich unmöglich wieder zurück in den Salon. »Wo habt ihr den Champagner versteckt?«
Julian hob den Deckel einer Styroporkiste an. Nebelschwaden stiegen aus dem Behälter von den Kühlaggregaten auf, die den Alkohol kalt hielten. Er nahm eine Flasche heraus und öffnete sie gekonnt mit einem lauten Knall.
Wie von selbst wanderte mein Blick zu seinen Armen und dem Muskelspiel unter dem weißen Hemd. Julian war kein Fitness-Junkie, aber es war nicht zu übersehen, dass er auf sich achtete. Sein Körper war drahtig und schlank.
Er bemerkte meinen forschen Blick, doch anstatt ihn zu erwidern oder mit einem süffisanten Grinsen zur Kenntnis zu nehmen, wandte er sich von mir ab und holte ein Glas. Er füllte es bis zum Rand mit Champagner und reichte es mir.
»Danke.«
»Ich mache nur meinen Job.«
Allerdings war es nicht sein Job, mir das Sandwich zu geben, das er sich selbst mitgebracht hatte, oder mir Gesellschaft zu leisten, während ich mich vor den anderen Gästen versteckte. Und das wusste ich sehr zu schätzen.
»Nimm dir auch ein Glas. Lass uns anstoßen.«
»Das darf ich nicht.«
Ich runzelte die Stirn. Hatte ich mich doch in seinem Alter getäuscht? »Komm schon. Nur ein Glas.« Ich streckte meinen Fuß aus und stupste ihn mit der Spitze meiner rot lackierten Zehe auffordernd an. »Ich dürfte eigentlich auch noch nichts trinken.«
»Ich rede nicht von meinem Alter, sondern davon, dass ich gerade arbeite.«
»Für meine Eltern.«
»Das ändert nichts.«
»Bitte.« Ich schob meine Unterlippe vor. »Alleine trinken macht keinen Spaß.«
Julian zögerte und sah mich nachdenklich an, als würde er abwägen, ob meine Bitte einen Verstoß gegen die Regeln wert war.
Und genau in diesem Moment begann ich, meine Worte zu bereuen. Er sollte seinen Job nicht meinetwegen riskieren. Das zu verlangen war überheblich und unverschämt und etwas, was meine Mom tun würde, nicht ich. Ich wollte Julian gerade sagen, er solle die Sache wieder vergessen, als er ein Seufzen ausstieß, sich eine Champagnerflöte nahm und sie bis zur Hälfte füllte.
»Ein halbes Glas muss reichen«, sagte er. »Worauf wollen wir anstoßen?«
»Dass dieser Abend schnell vorbeigeht«, erklärte ich und hoffte inständig, dass sich meine Mom nicht ausgerechnet diesen Moment aussuchte, um in die Küche zu kommen. »Cheers.«
»Cheers«, echote Julian und kam mir mit seinem Glas entgegen, wobei sein Ärmel leicht hochrutschte.
Ich glaubte, eine Narbe unter seinem Hemd hervorblitzen zu sehen, aber der Stoff glitt so schnell zurück, dass ich mir nicht sicher war, ob ich es mir nur eingebildet hatte. Um nicht noch unsensibler zu wirken, hielt ich meine Klappe und nippte an meinem Glas. Der Champagner prickelte wie eine Wunderkerze in meinem Hals, als auf einmal ein lautes Surren losging. Instinktiv versteifte ich mich, aber es war nur Julians Handy.
Er stellte sein Glas ab, zog das Smartphone aus seiner Hosentasche und starrte mit zusammengezogenen Augenbrauen auf das Display, bevor er den Anruf entgegennahm.
»Hey, was gibt’s?« Er wandte mir den Rücken zu und entfernte sich ein paar Schritte von mir, während der Anrufer ihm antwortete.
Geschäftig biss ich in mein Sandwich, als wäre mein Kauen laut genug, um Julian nicht zu belauschen.
»Dann nimm ihn und setz ihn aufs Klo.«
Ich runzelte die Stirn. Mit wem zum Teufel telefonierte er da?
»Daran kann ich jetzt auch nichts mehr ändern.«
»…«
Julian stieß ein Seufzen aus. »Cassie soll es wegputzen.«
»…«
»Dann lass es liegen, bis ich wieder zurück bin.« Er begann, schmutzige Gläser in eine der Styroporkisten zu schichten, die einer der anderen Kellner achtlos auf dem Tresen hatten stehen lassen. »Zwei oder drei Stunden.«
»…«
Julian stieß ein frustriertes Knurren aus und rieb seine Nasenwurzel zwischen Daumen und Zeigefinger, während die Person am anderen Ende der Leitung offensichtlich weiter auf ihn einredete. Schließlich ließ er die Hand sinken. »Danke, bis dann.« Er legte auf und schob das Handy zurück in seine Hosentasche, wo es den schwarzen Stoff ausbeulte. Langsam drehte er sich zu mir um und fing meinen fragenden Blick auf, sagte jedoch nichts.
Als mir klar wurde, dass er das Telefonat nicht von sich aus erklären würde, hakte ich nach. »Wer war das?«
»Mein Mitbewohner.«
»Musst du gehen?«, fragte ich, überrascht, wie sehr ich wollte, dass die Antwort »Nein« lautete.
Julian schüttelte den Kopf, und eine Strähne seines braunen Haares fiel ihm ins Gesicht. »Mein Kater hat unter die Couch gekackt. Mein Mitbewohner will es nicht wegputzen, aber auch nicht liegen lassen. Ich habe ihn erst seit einer Woche.«
»Den Kater oder den Mitbewohner?«
Julian grinste. »Den Kater.«
»Wie heißt er?«
»Laurence.«
Ich biss ein letztes Mal in das Sandwich und hielt Julian die übrige Hälfte hin. Er sollte meinetwegen nicht den restlichen Abend hungrig arbeiten. »Ich wollte immer eine Katze haben, aber meine Eltern haben es mir nie erlaubt.«
»Wieso nicht?«
»Sie haben Angst vor Haaren auf ihren teuren Anzügen.«
»Wofür gibt es Fusselrollen?«
Ich zuckte mit den Schultern, und während Julian die Reste seines Sandwiches aß, erzählte ich ihm von dem Aquarium, das mir meine Eltern geschenkt hatten, als ich sieben war. Doch viel zu schnell hatte Julian das Brot verputzt, und unsere Champagnergläser waren leer. Nun gab es keinen Grund mehr für mich, länger in der Küche zu bleiben, außer dass ich es wollte. Aber meiner Mom würde mein Verschwinden sicherlich bald auffallen.
Ich sprang von der Anrichte und schlüpfte wieder in meine Schuhe. »Ich glaube, es wird Zeit, wieder da rauszugehen«, sagte ich, bewegte mich aber nicht vom Fleck.
»Wieso gehst du auf eine Party, auf die du keine Lust hast?«, fragte Julian und räumte unsere Gläser mit einer Selbstverständlichkeit auf, die erahnen ließ, dass er diesen Job schon eine ganze Weile machte.
»Weil ich keine andere Wahl habe.«
Fragend zog Julian eine Braue hoch.
»Ich will ausziehen und bin gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Allerdings kann ich sie mir allein nicht leisten, deswegen habe ich eine Abmachung mit meinen Eltern getroffen. Sie bezahlen mir ein Apartment und das Studium, und ich muss dafür einmal die Woche bei ihnen zum Abendessen erscheinen und mich für eine angemessene Zeitspanne auf allen wichtigen sozialen Events blicken lassen.«
»Klingt nach einem fairen Handel.«
»Ich weiß.« Es war mehr als fair. Ein paar Stunden meiner Zeit im Austausch gegen Tausende von Dollar. Trotzdem hasste ich jede Sekunde. »Und warum bist du hier?«, fragte ich. Julian wirkte genauso lustlos wie ich und hatte sich dem Salon noch kein Stück genähert.
»Ist das nicht offensichtlich? Geld verdienen. Laurence ist vielleicht klein, aber er kostet ein Vermögen.«
»Wie viel bekommst du bezahlt?«
»Fünfundsiebzig Dollar.«
»Pro Stunde?«
Er lachte. »Für den ganzen Abend.«
»Das ist aber nicht viel.«
»Es ist mehr, als man anderswo verdient.«
»Das wusste ich nicht.« Woher auch? Ich hatte in meinem ganzen Leben noch keine Sekunde arbeiten müssen. Trotzdem wusste ich, dass fünfundsiebzig Dollar zu wenig dafür waren, den ganzen Abend Menschen wie Gwendoline Finn bedienen zu müssen. Ich gab Julian ein Zeichen, mir zu folgen. »Komm mit.«
»Wohin?«
»Das wirst du schon sehen.«
Er zögerte, aber besonders lange hielt sein Widerstand nicht an. Einen Moment später folgte er mir aus der Küche, den Flur entlang, am Salon vorbei bis zur begehbaren Garderobe.
In dem kleinen Raum roch es nach dem teuren Leder neuer Handtaschen und den parfümierten Mänteln der Gäste. Ich suchte meinen purpurnen Parka, den mir meine Mom vor drei Monaten zum Geburtstag geschenkt hatte. Am Kleiderhaken daneben hing meine Clutch, die von dem Notizbuch, das ich hineingestopft hatte, zum Bersten gespannt war.
»Halt mal.« Ich reichte Julian das Buch.
Er nahm es entgegen, und die Garderobentür fiel hinter ihm ins Schloss.
Das Licht war dämmrig, und im Vergleich zur Küche war der Raum eher klein. Zwischen all den Mänteln und Jacketts mussten Julian und ich dicht beisammenstehen. Mir entging nicht, wie gut er nach Tannennadeln und Erde roch, obwohl er schon den ganzen Abend Tabletts durch die Gegend schleppte.
»Was ist das?«, fragte Julian.
Ich hob den Kopf und stellte überrascht fest, dass ich mit ihm auf Augenhöhe war. Mit gerade mal eins sechzig war ich es gewohnt, zu anderen aufzublicken, selbst in hochhackigen Pumps, aber nicht bei Julian.
Er blätterte mein Notizbuch durch und betrachtete meine Skizzen.
»Nur etwas, an dem ich arbeite.«
»Das sieht gut aus.« Er hatte die Seite aufgeschlagen, auf welcher der erste Entwurf der Albtraumlady zu sehen war. »Ist das ein Comic?«
»Vielleicht«, erwiderte ich und zog geschäftig den Geldbeutel aus meiner Clutch, um ihm nicht weiter antworten zu müssen. Ich liebte Comics, Graphic Novels und Mangas. Ich fühlte mich in dieser Kunst zu Hause, aber sie anderen Menschen zu erklären und begreiflich zu machen war eine Herausforderung. Vor allem in den Kreisen, in denen sich meine Familie bewegte, entlockte meine Leidenschaft den meisten Leuten nur ein müdes Lächeln.
Ich öffnete mein Portemonnaie, nahm mehrere Geldscheine heraus und hielt sie Julian entgegen. »Hier.«
Er blickte von dem Notizbuch auf und sah auf das Geld. Seine Augen wurden groß. »Das ist zu viel.«
»Ist es nicht.« Es waren zweihundertdreißig Dollar. Meine Clutch hatte mehr gekostet. »Nimm es.«
Er schüttelte den Kopf. »Das geht nicht.«
»Wieso nicht?« Er öffnete den Mund, um mir zu antworten, aber ich kam ihm zuvor. »Und sag nicht, dass es zu viel ist.«
»Ich –« Julian kam nicht weiter, denn in diesem Moment wurde die Tür zur Garderobe geöffnet. Er erstarrte, und ich stopfte instinktiv das Geld zurück in meine Clutch.
»Michaella!« Es gab keine andere Person, die so viel Empörung, Enttäuschung und Wut in ein einziges Wort legen konnte, wie meine Mom. »Ist das dein Ernst? Schon wieder?« Sie sah von mir zu Julian, und die Verachtung in ihrem Blick wurde noch größer, als sie erkannte, wie dicht wir beisammenstanden. Ich musste keine Hellseherin sein, um zu ahnen, was sich meine Mom gerade in ihrem Kopf zusammenreimte; dafür war das Bild, das Julian und ich abgaben, zu eindeutig. Gemeinsam in einer geschlossenen Garderobe, im schummrigen Licht mit schuldbewussten Gesichtern.
»Ich wollte ihm Trinkgeld geben«, erklärte ich.
»Trinkgeld.« Meine Mom spuckte das Wort förmlich aus. »Diese Art von ›Trinkgeld‹ kannst du dir sparen, Michaella. Wir hatten dieses Thema schon mal, oder hast du das etwa vergessen?«
»Nein, aber ich wollte wirklich nur …« Ich hob meine Clutch an, um erneut das Geld herauszufischen.
Aber meine Mom hatte sich bereits Julian zugewandt. Die rot geschminkten Lippen zu dem grimmigen Lächeln verzogen, mit dem sie sonst nur gegnerische Anwälte bedachte.
Julian verspannte sich spürbar neben mir, aber sein Gesichtsausdruck blieb unverändert. Geradezu gleichgültig sah er meine Mom an. Ein Ausdruck, der ihr sichtbar missfiel.
»Und Sie … Sie sind gefeuert. Verschwinden Sie.«
Ich schnappte nach Luft. »Mom! Du kannst ihn doch nicht einfach feuern.«
»Ich kann. Und ich werde«, antwortete sie knapp. »Was immer ihr gemacht habt, wir bezahlen diese Leute nicht, um sich mit dir im Kleiderschrank zu verstecken. Er sollte dort draußen sein und uns bedienen.«
»Es war nicht seine Idee. Ich –«
»Lass es gut sein, Micah«, unterbrach mich Julian. Mit leerer Miene reichte er mir mein Notizbuch und trat einen Schritt zurück.
Mein Herz zog sich zusammen. Ich musste an Laurence denken. Konnte Julian ihn sich jetzt noch leisten?
Er schob sich an meiner Mom vorbei, als diese plötzlich die Hand nach vorn schießen ließ. Sie packte seinen Arm und beugte sich vor, die Nase gerümpft. »Haben Sie getrunken?«
»Ich … Ja«, gestand Julian mit gesenkter Stimme. »Ein halbes Glas.«
Angewidert schüttelte meine Mom den Kopf, obwohl sie selbst schon mindestens vier Gläser Champagner gehabt hatte. »Ich werde das Ihrem Chef melden. Wenn ich mit Ihnen fertig bin, werden Sie nie wieder einen Cateringjob in dieser Stadt bekommen.«
Julian spannte den Kiefer an und ballte die Hände zu Fäusten.
Ich hätte ihm gern geholfen, aber ich kannte meine Mom zu gut. Sie war dickköpfig, hatte einen eisernen Willen, und ihre Entscheidungen waren in Stein gemeißelt, was sie zu der brillanten Anwältin machte, die sie war. Alles, was ich zu Julians Verteidigung zu sagen hatte, würde die Situation noch verschlimmern. Ich konnte nur schweigen und darauf hoffen, dass meiner Mom die Arbeit in die Quere kam und sie vergaß, Julian anzuschwärzen.
Julian wandte sich ab und verließ, ohne mich noch eines Blickes zu würdigen, die Garderobe. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Immerhin hatte ich ihn in diese Lage gebracht, und er hatte nicht einmal das Geld eingesteckt, das ich ihm angeboten hatte. Vermutlich bereute er seine falsche Bescheidenheit schon jetzt.
Schweigend und mit einem flauen Gefühl im Magen sah ich ihm hinterher, wie er in die Küche ging, um seine Sachen zu holen. Anschließend würde er vermutlich durch den Dienstboteneingang verschwinden, und ich würde ihn nie wiedersehen.
»Kommst du!«, sagte meine Mom mit spitzer Stimme. Keine Frage, sondern ein Befehl. Auffordernd hielt sie die Tür zur Garderobe auf. Und wie so oft in den vergangenen Wochen biss ich mir auf die Zunge und gehorchte – für Adrian.
Ich hing meine Clutch zurück an ihren Platz und lief an meiner Mom vorbei in Richtung Salon. Sie folgte mir auf dem Fuß, als wollte sie sicherstellen, dass ich Julian nicht nachlief, und die ganze Zeit über konnte ich ihre vorwurfsvollen Blicke im Rücken spüren.
2. Kapitel
Zwei Monate später
Ich trat einen Schritt zurück und betrachtete mein Kunstwerk: eine aus Umzugskartons erbaute Festung. Sie reichte bis unter die Decke meiner neuen Wohnung, und durch eine Öffnung an der rechten Seite konnte man ins Innere krabbeln. Es hatte mich drei Stunden meines Lebens gekostet, diese Festung zu bauen, und ich war durchgeschwitzt vom Stapeln der Kartons, aber das war es wert.
Ich wischte mir mit dem Unterarm über die Stirn, ehe ich mein Handy hervorholte und ein paar Fotos meines Bauwerks knipste, um sie an Adrian zu schicken. Meine Nachrichten kamen anscheinend zu ihm durch, aber ich wusste nicht, ob er sie sich ansah, denn eine Antwort bekam ich nie. Trotzdem hielt ich unseren einseitigen Nachrichtenverlauf aufrecht. Ihm weiterhin zu schreiben gab mir das Gefühl, noch ein Teil seines Lebens zu sein, auch wenn wir uns inzwischen seit drei Monaten nicht mehr gesehen hatten. Ich vermisste ihn und machte mir zunehmend Sorgen, auch wenn ich damit offenbar allein war. Unsere Eltern bestritten ihren Alltag, als hätte es Adrian nie gegeben. Und auch sonst schien sich niemand wirklich für ihn zu interessieren. Mein Versuch vor einigen Wochen, eine Vermisstenanzeige aufzugeben, war gescheitert. Die Polizei hatte sich geweigert, etwas zu unternehmen. Adrian war ein geistig gesunder, erwachsener Mann. Er hatte seine Sachen gepackt und war – mehr oder weniger – freiwillig gegangen. In ihren Augen war nichts Bedenkliches oder Gesetzwidriges passiert.
Ich schüttelte den Kopf und verdrängte die Erinnerung, die sonst nur erneut die Wut in mir hätte hochkochen lassen; ein Gefühl, das ich in letzter Zeit oft im Zusammenhang mit meinen Eltern verspürte, weshalb ich umso glücklicher war, endlich bei ihnen ausgezogen zu sein. Es hatte länger gedauert als erwartet, ein geeignetes Apartment zu finden, aber seit heute war ich offiziell Eigentümerin einer Wohnung in der Copper Avenue – finanziert von meinen Eltern. Denn ich hatte nie etwas angespart. Es war nicht nötig gewesen. Vor der Sache mit Adrian hätte ich niemals gedacht, dass es mir eines Tages unangenehm sein könnte, vom Geld meiner Familie zu leben.
Eine positive Seite hatte meine finanzielle Abhängigkeit allerdings: Meine Eltern und ich mussten miteinander reden. Obwohl ich gerade nicht gut auf sie zu sprechen war, liebte ich sie und hoffte, unsere Familie eines Tages wieder zusammenzuführen. Keine Ahnung, ob das möglich war oder nur naives Wunschdenken, aber ich musste es mindestens versuchen. Und das ging nur, wenn wir miteinander im Kontakt blieben. Ich war das Bindeglied zwischen unseren Eltern und Adrian – sobald ich ihn fand.
Ich warf einen letzten Blick auf die Bilder, die ich Adrian geschickt hatte, und wollte gerade das Handy zurück in meine Hosentasche schieben, als es zu klingeln begann. Schlagartig breitete sich eine Mischung aus Angst und Hoffnung in mir aus. Das konnte kein Zufall sein, oder? Mit zitternden Händen hob ich das Handy und starrte auf das Display. Nur um im selben Moment enttäuscht festzustellen, dass es nicht Adrian war, der mich anrief. Allerdings war es auch nicht nicht Adrian.
Rufnummer unbekannt.
Hastig wischte ich mit dem Daumen über den Bildschirm, bevor die Person am anderen Ende auflegen konnte. »Hallo?«
»Guten Tag, spreche ich mit Micah Owens?«, fragte eine fremde, tiefe Stimme.
Enttäuscht ließ ich die Schultern sinken. »Ja, das tun Sie.«
»Hier ist Patrick Walsh, der Leiter vom Rainpride Center. Wir haben vor drei Wochen miteinander gesprochen, als du in meiner Einrichtung nach deinem Bruder gesucht hast.«
»Ja. Ich erinnere mich.« Wie hätte ich es auch vergessen können?
Nachdem die Polizei meine Vermisstenanzeige abgelehnt hatte, hatte ich meine eigene Suche ausgeweitet. Ich hatte sämtliche mir bekannten LGBTQ-Treffpunkte der Stadt abgeklappert, von Beratungsstellen bis hin zu Nachtclubs, für die ich mir extra einen gefälschten Ausweis hatte anfertigen lassen, für dessen Besitz meine Eltern mich umbringen würden, sollten sie jemals davon erfahren. Aber das Risiko war es mir wert.
»Gibt es etwas Neues?«, erkundigte ich mich ohne allzu viel Hoffnung. Mr Walshs nüchterner Tonfall deutete nicht darauf hin, dass er mir gute Neuigkeiten zu überbringen hatte.
Er seufzte. »Bedauerlicherweise nicht. Ich habe mich umgehört und meine Mitarbeiter über deinen Bruder informiert, aber er ist nicht zu Rainpride gekommen.« Mr Walsh legte eine kurze Sprechpause ein. »Bist du dir sicher, dass er noch in der Stadt ist?«
Nein. »Ja«, antwortete ich beharrlich. An die Möglichkeit, dass er inzwischen an Geld gekommen sein und Mayfield verlassen haben könnte, wollte ich überhaupt nicht denken. In diesem Fall hatte ich kaum eine Chance, ihn überhaupt noch zu finden. Denn was, wenn er nicht nur die Stadt, sondern auch Washington verlassen hatte? Oder gleich Amerika? Womöglich war er nach Kanada ausgewandert. Bei dem Gedanken wurden meine Knie weich. Ich stützte mich mit der freien Hand an meiner Festung ab.
»Und du warst schon bei der Polizei?«, fragte Mr Walsh nachdenklich.
Ich nickte, bis mir einfiel, dass er mich nicht sehen konnte. »Ja, war ich. Sie können mir nicht helfen.«
»Das tut mir leid.« In seinen Worten schwang ehrliches Bedauern mit. »Ich hoffe, du findest deinen Bruder. Er kann sich glücklich schätzen, dich zu haben.«
Konnte er das wirklich? An manchen Tagen war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich immer die Schwester für ihn gewesen war, die ich hatte sein wollen. Irgendetwas hatte ich ganz offensichtlich falsch gemacht. Warum glaubte Adrian sonst, vor mir ebenso wegrennen zu müssen wie vor unseren Eltern? Die Vorstellung versetzte mir jedes Mal einen Stich.
»Danke für Ihre Hilfe, Mr Walsh.«
»Selbstverständlich. Wenn mir noch etwas zu Ohren kommt, melde ich mich.«
»Danke«, sagte ich noch einmal und beendete das Telefonat.
Langsam ließ ich das Handy sinken, die Finger vor Anspannung verkrampft, und starrte auf das Wallpaper, das ich als Hintergrund eingestellt hatte. Es zeigte ein Foto von Adrian, unseren Eltern und mir, wie wir eingemummelt in dicke Jacken auf dem Deck des Bootes standen, das uns vor vier Jahren durch die eisige Landschaft Grönlands gesegelt hatte. Ich hatte das Bild wegen der beeindruckenden Gletscher im Hintergrund gewählt, aber heute erinnerte es mich an etwas Verlorenes, das ich wiederhaben wollte.
Ich steckte das Handy zurück in die Hosentasche und holte den Laptop aus dem Koffer, in den ich die wichtigsten Sachen gepackt hatte, um sie trotz des Umzugs sofort zur Hand zu haben. Neben meinem MacBook befanden sich darin ein paar Anziehsachen und ein Kulturbeutel sowie mein Zeichentablet, fünf Comics und zwei Notizbücher meiner Lieblingsmarke. In dem einen waren nur noch vier Seiten frei, das andere war noch vollkommen leer. Ich konnte es kaum erwarten, es mit Gedanken und Ideen zur Albtraumlady zu füllen.
Mit dem Laptop in der Hand lief ich um meine Festung herum und setzte mich auf einen der beiden Kartons, die den Eingang ins Innere flankierten. Ich rief die Webseite des Rainpride Centers auf und wurde von einem Foto des lächelnden Mr Walsh begrüßt, das vermutlich schon einige Jahre alt war. Daneben befand sich ein kurzer Text, in dem er von seinen persönlichen Erfahrungen und seinem Entschluss, Rainpride zu gründen, erzählte. Ich hatte die Zeilen bereits gelesen und klickte direkt auf den Menüpunkt »Spenden«. Ich überflog das Kleingedruckte, in dem stand, wofür das Geld genutzt wurde, und widmete mich dann dem Wesentlichen: »Bitte wählen Sie einen Betrag aus«. Ich tippte eine vierstellige Summe ein, klickte auf »Weiter« und hinterlegte anschließend Nummer und Prüfziffer meiner Kreditkarte, die ich bereits seit meinem zehnten Lebensjahr auswendig kannte. Die Karte wurde monatlich von meinen Eltern ausgeglichen.
»Danke für Ihre Spende, Mr und Mrs Owens«, säuselte ich. Wenn sie schon nicht den Anstand aufbrachten, sich um ihren eigenen Sohn zu kümmern, konnte ihr Geld zumindest anderen jungen Menschen helfen, die sich in einer ähnlichen Situation befanden.
Ich öffnete den Messenger und schickte eine Nachricht an meine beste Freundin Lilly: Abendessen?
Ihre Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
Lilly: Keine Zeit. Skype-Date mit Tanner.
Ich: Morgen. B&B?
Lilly: Gern.
Ich: 16 Uhr?
Lilly: 17 Uhr, hab noch eine Lerngruppe.
Ich: Perfekt. Ich freu mich!
Lilly: Ich mich auch. Bis morgen!
Ich: Bis morgen. Und viel Erfolg!!!
Lilly: Danke. <3
Ich lächelte voller Stolz auf meine beste Freundin. Lilly war mit Abstand die mutigste, ehrgeizigste und liebenswerteste Person, die ich kannte, und ich konnte es kaum erwarten, sie in einigen Monaten in ihrem Talar zu sehen und mitzuerleben, wie sie ihren Highschoolabschluss bekam; vermutlich mit Auszeichnung, so wie ich sie kannte.
Plötzlich klopfte es an der Tür. Benommen blickte ich von meinem Laptop auf. Das musste irgendein Nachbar sein, der sich vorstellen wollte. Bisher kannten nur Lilly und meine Eltern meine neue Adresse.
Ich klappte den Laptop zu und stellte ihn zur Seite, ehe ich zur Tür ging. Eilig strich ich mein Wonder-Woman-Shirt glatt, das ich auf der letzten Comic Con gekauft hatte, und fuhr mir mit den Fingern durch die Haare. Es gab in meiner Wohnung noch keine Spiegel – was vermutlich auch besser war, denn so konnte ich mir vorstellen, dass ich nicht so schmuddelig und verschwitzt aussah, wie ich mich fühlte. Ich öffnete die Tür, bereit, meinen Nachbarn ein freundliches »Guten Abend!« entgegenzuschleudern, brachte jedoch keinen Ton heraus, als ich meinen Besuch sah.
Vor meiner Tür standen eine junge Frau und ein Mann, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Sie war klein und zierlich, mit roten Haaren und Haut so hell, dass ich ihr am liebsten etwas von meiner Sonnencreme angeboten hätte. Der Kerl neben ihr hingegen war schwarz und gut zwei Köpfe größer als sie, mit breiten Schultern und dunklen Augen, aus denen er mich interessiert ansah. Dabei waren es nicht ihre äußerlichen Unterschiede, die mich sprachlos machten, sondern ihre Gemeinsamkeit: Sie waren beide als Elben verkleidet.
Die zwei grinsten mich an, sichtlich amüsiert angesichts meiner Verwunderung.
Langsam fand ich meine Sprache wieder. »Hallo, Tauriel. Hallo …« Ich geriet ins Stocken, denn mir wollte kein schwarzer Herr-der-Ringe-Charakter einfallen. Gab es überhaupt einen? Es war Jahre her, dass ich die Filme das letzte Mal gesehen hatte. »Nicht-Tauriel«, beendete ich den Satz lahm und verzog entschuldigend die Lippen.
»Schon in Ordnung. Das hat Tolkien verbockt, nicht du«, sagte der Kerl und betastete nervös seine spitzen Ohren. Er trug ein Kostüm aus braunem Leder, das an eine Kriegeruniform erinnerte, mit zahlreichen Schnallen und Gürteln, an denen allerlei Waffen befestigt waren. Ich war mir sicher, dass sie nicht echt waren, obwohl sie so wirkten.
»Sein Pech. Du siehst fabelhaft aus.« Ich sah zu seiner Begleitung und korrigierte mich sofort. »Ihr beide seht fantastisch aus.« Sie trug ein Kleid aus grüner Baumwolle, ihre Unterarme bedeckten dunkle Ledermanschetten, und ein Köcher mit Pfeilen baumelte an ihrer Hüfte. Nur der dazu passende Bogen fehlte.
»Danke, sehr freundlich.« Sie deutete eine Verneigung an, die zu ihrem mittelalterlichen Kostüm passte. »Du musst Michaella sein. Zumindest steht das auf dem neuen Klingelschild unten an der Tür.«
»Micah. Nur meine Eltern nennen mich Michaella.«
»Okay, dann Micah. Ich bin Cassie.« Sie deutete auf den Mann. »Und das ist Auri.«
»Auri?«, hakte ich mit einer hochgezogenen Augenbraue nach, obwohl ich sicher war, mich nicht verhört zu haben. Der niedlich klingende Name passte überhaupt nicht zu der Person, die vor mir stand. Der Kerl war riesig, und seinen massiven Oberarmen nach zu urteilen, drückte er mein Gewicht auf der Pressbank zum Aufwärmen.
»Eigentlich Maurice, aber Auri ist auch in Ordnung.«
»Auri ist ein toller Name«, warf Cassie ein und blickte aus ihren großen grünen Augen zu ihm auf. Die beiden standen so dicht beieinander, dass sie ihren Kopf dafür beinahe vollständig in den Nacken legen musste. Sicherlich war Rumknutschen in der Vertikalen bei einem solchen Größenunterschied nicht leicht.
Auri lächelte auf sie herab. »Das musst du sagen. Du hast ihn dir schließlich ausgedacht.«
»Patrick Rothfuss hat ihn sich ausgedacht«, sagte sie entschieden und erklärte an mich gewandt: »Auri ist ein Charakter aus Der Name des Windes, unserem Lieblingsbuch. Kennst du es?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, leider nicht.«
»Ich kann dir meine Jubiläumsausgabe mit den Illustrationen ausleihen, wenn du versprichst, keine Eselsohren reinzumachen.« Sie warf Auri einen strafenden Blick zu.
»Das würde mir nie im Leben einfallen«, erwiderte ich umgehend. Ich war zwar keine große Leserin, zumindest nicht von Büchern, aber ich pflegte meine Comics mit größter Sorgfalt und bekam jedes Mal einen halben Herzanfall, wenn versehentlich eine Seite in einem meiner Notizbücher oder meinem Zeichenblock einriss.
»Wohnst du allein hier?«, fragte Auri und beugte sich neugierig vor. Er war groß genug, um ungehindert über meinen Kopf hinweg in meine Wohnung zu sehen. Nicht dass es viel zu sehen gab, abgesehen von meiner Festung, den Möbelkartons und meiner mit Folie abgedeckten Couch.
»Ja«, antwortete ich und wechselte das Thema, bevor sie sich erkundigen konnten, woher ich das Geld nahm. Mir war das Vermögen meiner Familie bisher nie unangenehm gewesen, aber in diesem Moment schämte ich mich dafür, vermutlich weil ein Teil von mir wusste, wie falsch es war, ihre Kreditkarten und Schecks anzunehmen, während ich sie insgeheim für die Sache mit Adrian verabscheute. »Studiert ihr?«
Cassie nickte. »Literaturwissenschaften im dritten Semester.«
»Grafikdesign«, antwortete Auri. »Und Sport.«
»Football?«
Er grinste. »Ja, mit Stipendium.«
»Angeber«, murmelte Cassie, worauf er ihr einen sanften Stoß in die Seite verpasste. »Und was ist mit dir?«
»Jura«, antwortete ich und versuchte, dabei nicht allzu verbittert zu klingen.
Die Einführungswoche war inzwischen vorüber, und die Vorlesungen hatten begonnen. Nach dem ersten Tag hatte ich mich dem verrückten Glauben hingegeben, dass es womöglich nicht so schlimm werden würde wie erwartet. Doch bereits der zweite Tag hatte mich eines Besseren belehrt. Ich hasste es. Ich hasste jede Minute. Ich hasste jedes Wort, das meine Professoren sagten. Und ich hasste das amerikanische Rechtssystem. Nur meine Kommilitonin Aliza machte die Sache erträglich.
»Welches Semester?«, erkundigte sich Auri.
»Erstes.«
Cassie klatschte in die Hände. »Oh, ein Frischling. Ich kann dich gern herumführen.«
Ich lächelte. »Lieb von dir, aber ich komme aus Mayfield.«
»Ach so.« Verdutzt blinzelte sie mich an. »Verstehe. Ich dachte nur, wegen der eigenen Wohnung und so.«
»Ja … Nein. Ich war einfach bereit, bei meinen Eltern auszuziehen.« Wäre die Sache mit Adrian nicht passiert, hätte ich vermutlich noch bei ihnen gewohnt. Oder auch nicht, denn wäre Adrian noch bei uns gewesen, hätte ich gemeinsam mit ihm in Yale und nicht allein am MFC studiert. »Wo kommt –« Ich verstummte, als ich plötzlich etwas hörte. Mit angehaltener Luft lauschte ich auf das schabende Geräusch, das aus der Wohnung nebenan zu kommen schien. Ein klägliches Miauen mischte sich unter das Kratzen.
»Oje, da hat jemand Hunger«, bemerkte Auri.
Schuldbewusst verzog Cassie die Lippen. »Wir hätten ihn schon vor zwei Stunden füttern müssen.«
»Ist das eure Katze?«, fragte ich erfreut. Anscheinend hatte ich genau die richtigen Nachbarn getroffen. Zwar konnte ich mir endlich selbst ein Haustier halten, aber ich wollte nichts überstürzen. Vielleicht nachdem ich mich besser eingelebt und das erste Semester überstanden hatte.
Cassie nahm die Pfeile aus ihrem Köcher, ehe sie hineingriff und einen Schlüsselbund hervorzog. »Laurence gehört unserem Mitbewohner, aber der arbeitet samstags immer lang, also kümmern wir uns um ihn.«
Irritiert sah ich Cassie an. »Was sagtest du? Wie heißt der Kater?«
»Laurence.« Sie lachte. »Ich weiß, ein ziemlich merkwürdiger Name für ein Kätzchen.«
Ich nickte zustimmend, aber in Gedanken war ich bereits einen Schritt weiter. Das konnte kein Zufall sein. Ausgeschlossen. Wie viele Kater namens Laurence konnte es in Mayfield geben? Nicht viele, und das bedeutete, dass der Kellner von der Dinnerparty meiner Eltern Cassies und Auris Mitbewohner sein musste. Julian. Hatte er Cassie nicht sogar erwähnt? Ich war mir nicht mehr sicher, aber so oder so hätte ich nicht erwartet, ihn jemals wiederzusehen. Seit dem Abend vor zwei Monaten hatte ich immer wieder an ihn denken müssen, nicht zuletzt wegen meines schlechten Gewissens. Aber wenn er hier wohnte, bedeutete das, dass ich eine zweite Chance bekam. Ich konnte wiedergutmachen, was ich verbockt hatte.
»Euer Mitbewohner heißt nicht zufällig Julian, oder?«, fragte ich und versuchte, meine Aufregung zu verbergen.
Cassie runzelte die Stirn. »Doch. Julian Brook. Kennt ihr euch?«
»Sozusagen«, antwortete ich verlegen und fragte mich, ob er ihnen von mir erzählt hatte. Wussten sie von der arroganten Ziege, die schuld an seiner Kündigung gewesen war? Oder hatte er diesen Teil des Abends ausgelassen? »Wir haben uns auf einer Feier kennengelernt.«
Auris Augenbrauen schossen in die Höhe. »Wirklich?« Er klang überrascht.
»Ja.«
Die beiden wechselten einen bedeutungsschweren Blick, der einige Sekunden anhielt, bevor sich Cassie wieder an mich wandte, ihre Pfeile noch immer in der Hand. »Was war das für eine Party?«
»Eine langweilige«, antwortete ich verhalten. »Er hat dort gearbeitet.«
»Aaah.« Erkenntnis erhellte ihr Gesicht. »Verstehe.«
»Was verstehst du?«
Auri schnaubte. »Julian würde nie freiwillig auf eine Party gehen.«
»Nie?«, fragte ich verwundert.
Cassie schüttelte den Kopf. »Niemals.«
»Der Junge ist ein krankhafter Workaholic«, erklärte Auri und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich sag ihm ständig, er soll mal einen Gang runterschalten, aber wenn er nicht am MFC ist, geht er einem seiner tausend Jobs nach.«
Tausend Jobs. Und ich hatte ihn auch noch um die fünfundsiebzig Dollar meiner Eltern gebracht.
»Ist er gerade auch kellnern?«, fragte ich mit vager Hoffnung. Immerhin war es Samstagabend, die perfekte Zeit für einen Cateringjob. Und vielleicht hatte meine Mom tatsächlich vergessen, ihn bei seinem Chef anzuschwärzen.
Nachdenklich schürzte Cassie die Lippen. »Ich bin mir nicht sicher.«
»Nein, ist er nicht«, sagte Auri. »Mr Gordon hat ihn doch rausgeschmissen. Erinnerst du dich nicht? Deswegen bringt er auch keine Häppchen mehr mit nach Hause.«
»Stimmt, die Häppchen, von denen ich nie etwas abbekommen habe.«
»Du meintest, sie schmecken dir nicht.«
»Die mit dem rohen Fisch mochte ich nicht. Die anderen schon.«
»Oh, dann habe ich das wohl falsch verstanden.«
Cassie verdrehte die Augen. »Natürlich hast du das.«
Es war unterhaltsam, den beiden beim liebevollen Streiten zuzusehen, allerdings beschlich mich langsam das Gefühl, dass sie Julian nicht sonderlich gut kannten. Wer wusste nicht oder nur anhand fehlender Häppchen, ob sein Mitbewohner gefeuert worden war? Mein schlechtes Gewissen war damit nicht im Geringsten erleichtert, aber Julians Kater sollte meinetwegen nicht noch länger auf sein Futter warten müssen. Er hatte das ganze Gespräch über unaufhaltsam an der Tür gekratzt. »Ihr solltet wohl besser Laurence füttern gehen.«
»Oh Gott, ja.« Cassie schob eilig ihre Pfeile zurück in den Köcher und begann, an ihrem Schlüsselanhänger herumzupfriemeln, an dem mindestens ein Dutzend Schlüssel hingen.
»Wir sind furchtbare Katzeneltern«, stellte Auri fest und zog Cassie, die noch immer nach dem richtigen Schlüssel suchte, in Richtung ihrer Wohnungstür.
»Wäre es unsere Katze, wäre das anders.«
»Wir hätten keine Katze, sondern einen Hund.«
Statt etwas darauf zu erwidern, wandte sich Cassie noch einmal mir zu. »War schön, dich kennenzulernen, Micah. Wir sehen uns sicher bald wieder.«
»Bestimmt! Hat mich gefreut.« Ich winkte den beiden zum Abschied, und sie huschten eilig durch einen schmalen Spalt in ihr Apartment, damit Laurence nicht in den Flur entkommen konnte.
Ich blieb noch einen Moment stehen und starrte auf die geschlossene Wohnungstür. Julian Brook. Wer hätte das gedacht?
3. Kapitel
»Endlich!« Lilly sprang von ihrem Stuhl auf, als ich mit einer Viertelstunde Verspätung das Beans & Bread betrat, unser Lieblingscafé seit der Middleschool.
Wir hatten es vor Jahren durch Zufall entdeckt, als ich ein paar meiner Kleidungsstücke in den Secondhandladen nebenan hatte bringen wollen. Heute gab es diesen nicht mehr, und das schrullige Café wurde stattdessen von einem verdunkelten Erotikshop und einem Nagelstudio flankiert, dessen Schaufenster mit nervig blinkenden Lichtern geschmückt waren.
»Tut mir leid, viel Verkehr.« Ich umarmte Lilly zur Begrüßung, ehe ich mich zu Lincoln hinabbeugte und ihm einen Kuss auf das hellbraune Haar drückte.
Er blickte auf und grinste mich an. »Micah!«
»Na, wie geht’s meinem Großen?«
»Mom hat gesagt, ich soll dir ein Bild malen.« Er griff eifrig nach dem Blatt, das vor ihm auf dem Kinderstuhl lag, und hielt es stolz in die Höhe.
Darauf zu sehen war … Keine Ahnung, was das sein sollte. Ein Löwe? Ein explodierender Alien? Eine abstrakte Darstellung des Universums? Ich wusste es nicht, dennoch setzte ich ein Lächeln auf und lobte Link.
Das Funkeln in seinen Augen wurde noch strahlender, und sofort machte er sich wieder an die Arbeit. Wild kratzte er mit einem Buntstift über das Papier.
Fragend sah ich zu Lilly.
Optisch war meine beste Freundin das genaue Gegenteil von mir. Sie hatte blaue Augen und blonde Haare, die ihr mithilfe eines Brazilian Blowouts glatt über den Rücken fielen. Ganz anders als meine naturbelassenen Zotteln, die nie taten, was ich wollte. Vor allem meinen Pony zu bändigen war eine Herausforderung, und jeden Morgen sagte ich ihm aufs Neue mit dem Glätteisen den Kampf an.
Sie zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf.
Beruhigt, dass nicht einmal Links Mom erkannte, was das Etwas auf dem Bild sein sollte, setzte ich mich und zog die Speisekarte aus dem Ständer. Eine reine Gewohnheit, denn bei Rick bestellte ich immer dasselbe.
»Du wirst niemals erraten, wer in der Wohnung neben mir wohnt.«
»Nick Robinson!«
Ich schnaubte. »Klar, und unter mir residiert Keiynan Lonsdale.«
»Schade, hätte ja sein können.«
»Natürlich«, pflichtete ich ihr bei, als wäre es wirklich möglich, dass die Love-Simon-Schauspieler zu meinen Nachbarn gehörten. »Ein Tipp: Es ist kein Promi.«
»Hmmm.« Nachdenklich tippte sie sich mit dem Zeigefinger ans Kinn. »Alexandra Courtin?«
Alex hatte einige Jahre dieselbe teure Privatschule besucht wie Lilly und ich, bis ihr Dad wegen Geldwäsche festgenommen worden war und die Familie ihr gesamtes Vermögen verloren hatte. Danach waren sie angeblich untergetaucht. In Wirklichkeit hatten sie Mayfield aber nie verlassen, sondern sich nur aus den Kreisen der selbst ernannten High Society zurückgezogen.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, auch nicht Alex. Ich sag es dir: Julian Brook.«
Lilly runzelte die Stirn. »Wer?«
Ich schob die Speisekarte zurück in den Ständer. »Julian. Der Kellner.«
»Ah. Den du hast feuern lassen?«, fragte Lilly und griff gleichzeitig nach ihrer Handtasche, aus der sie ein Taschentuch zog, um Link damit die Nase zu putzen.
»Ich habe ihn nicht feuern lassen. Eine Verstrickung unglücklicher Umstände hat dazu geführt, dass meine Mom ihn gekündigt hat«, antwortete ich, aber sofort waren meine Schuldgefühle zurück und mein Verstand beschwor die Erinnerung an Julian herauf, wie er mir mit kalter, verschlossener Miene den Rücken zugewandt hatte.
»Und, was hat Julian gesagt, als er dich gesehen hat?«
»Nichts. Wir haben uns noch nicht getroffen.« Ich hielt einen Buntstift auf, der vom Tisch zu rollen drohte, und reichte ihn Link. Prompt begann er, violette Striche über seinen explodierenden Alien-Löwen zu malen. »Seine Mitbewohner standen gestern vor meiner Tür, da hab ich es zufällig rausgefunden.«
»Und du bist nicht sofort zu ihm gegangen?«
Ich verdrehte die Augen. Sie kannte mich einfach zu gut. »Er war arbeiten.«
»Und heute Morgen?«
»Wollte ich ihn ausschlafen lassen.« Fragend hob Lilly eine Augenbraue. Ich seufzte. »Vielleicht oder vielleicht auch nicht war ich bis zwei Uhr nachts wach und habe zufällig mitbekommen, dass er nicht nach Hause gekommen ist. Oder er hat sich superleise an meiner Wohnung vorbeigeschlichen.«
»Oder er hat bei seiner Freundin übernachtet.«
»Oder das.« Ich verstummte, als ich aus dem Augenwinkel sah, wie Rick, der Inhaber des Beans & Bread, auf unseren Tisch zukam.
»Guten Morgen, Ladys«, begrüßte er uns mit schwerem schottischem Akzent. »Wie geht es euch?«
»Hervorragend. Und dir?«, fragte Lilly mit einem Lächeln.
Link hatte den Blick von seinem Bild gelöst und starrte nun Rick an. Er war in seinen Fünfzigern, mit einem deutlichen Bauchansatz, grauen Haaren und einem ebenso hellen Bart, der ihn das ganze Jahr über aussehen ließ wie den Weihnachtsmann.
»Kann mich nicht beklagen.« Er lächelte. »Was darf ich euch bringen?«
»Einen Apfelsaft für Link. Einen Chai Latte für mich und …« Lilly verstummte und spähte an Rick vorbei zu der Auslage mit dem Gebäck. Voller Sehnsucht betrachtete sie die Zitronenmuffins.
Ich hasste es, sie zögern zu sehen. Sie wollte den Muffin, aber sie glaubte ihn nicht verdient zu haben. In ihrer Schwangerschaft hatte sie dreißig Pfund zugenommen, und inzwischen waren zehn weitere hinzugekommen. Was nicht schlimm war, vor allem wenn man bedachte, dass sie nicht nur ein Kleinkind erzog, sondern gleichzeitig ihren Schulabschluss nachholte. Doch Lilly machte sich wegen ihres Gewichts ständige Vorwürfe.
Schließlich schüttelte sie den Kopf. »Nichts weiter. Das wäre alles.«
Rick nickte. »Und für dich?«
Ich lächelte. »Dasselbe wie immer.«
»Ein doppelter Espresso und ein Scone mit Marmelade. Kommt sofort.« Er sauste in die Küche, von der aus sich der herrliche Duft von karamellisiertem Zucker im ganzen Café verteilte. Das Mobiliar im Beans & Bread war wild zusammengewürfelt. Grüne Tische, rote Stühle und gelbe Sessel, in den verschiedensten Formen und Nuancen. Nichts passte zusammen. Als hätten Rick und seine Frau den Laden Stück für Stück mithilfe des Secondhandladens von nebenan ausgestattet.
Ich klaute mir einen von Links Buntstiften und ein Stück Papier. »Wie geht es Tanner?«, fragte ich Lilly und begann, die Skizze einer Frau zu zeichnen. Ständig auf irgendetwas herumzukritzeln war ein Tick von mir, für den mich meine Eltern schon oft zurechtgewiesen hatten. Sie glaubten, es wäre ein Ausdruck von Langeweile oder Desinteresse, aber das stimmte nicht. Meist half das Zeichnen mir sogar dabei, mich besser zu konzentrieren.
»Princeton stresst ihn. Er wollte eigentlich am Wochenende nach Hause kommen, aber die Professoren schütten ihn mit Arbeit zu. Vor Ende des Monats wird es vermutlich nichts mit einem Besuch.« Mit einem müden Lächeln sah Lilly zu Link, der sich ebenfalls ein neues Blatt genommen hatte und in wilden Bewegungen schwarze Kreise auf das Papier zeichnete. »Er fragt jeden Abend nach seinem Dad.«
»Natürlich. Er vermisst ihn. Aber Tanner kommt ja bald.«
Lilly seufzte. »Hoffentlich.«
Ich beugte mich vor und legte meine Hand auf ihre. Sie zeigte nur selten Schwäche, weil sie für Lincoln stark sein wollte. Doch nun waren ihre Augen feucht, und ich erkannte, wie sehr sie sich nach Tanner sehnte. Nicht nur nach Tanner, dem Vater ihres Sohnes. Sondern auch nach Tanner, dem Jungen, den sie bereits seit einem halben Jahrzehnt liebte.
Er war drei Jahre älter als sie und studierte im fünften Semester in Princeton. Dort war er bereits angenommen worden, bevor Lilly von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte. Um bei der Geburt dabei zu sein, hatte er sein Studium ein Semester später begonnen als geplant. Er hatte sogar überlegt, ans MFC zu wechseln, aber ein Abschluss an der Elite-Uni würde ihm später mehr Türen öffnen. Außerdem war ein Studium in Princeton in seiner Familie Tradition. Diese zu brechen hätte nur zu noch mehr bösem Blut geführt; die ungewollte Schwangerschaft einer Minderjährigen war in den Augen ihrer beiden Eltern schon schlimm genug für den Ruf der Familien gewesen.
»Ganz sicher. Und du wirst sehen, die nächsten Wochen vergehen wie im Flug.«