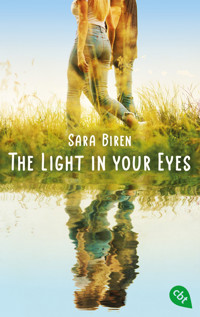
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein gefallener Rockstar, ein Mädchen mit einer Agenda und die Chance auf die große Liebe
Gabes Leben ist ein einziges Chaos: Nachdem ihn sein Debütalbum über Nacht zum Star gemacht hat, ist sein zweites Album komplett gefloppt; er wurde gerade von seiner Freundin abserviert und braucht dringend Geld, um einen massiven Fehltritt wiedergutzumachen. Der einzige Ort, an den ihm die Paparazzi und Gerüchte nicht folgen können, ist die Farm seiner Großmutter – die Farm, die seit Jahren von Junipers Familie geführt wird. Als Juniper erfährt, dass Gabe die Farm erben wird, ist sie sicher, dass er sie verkaufen wird. Also beschließt sie kurzerhand, sich mit Gabe anzufreunden, um ihn davon abzuhalten. Was leichter gesagt als getan ist, denn Gabe und Juniper könnten nicht unterschiedlicher sein. Doch je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto näher kommen sie sich – bis ihre eigenen Probleme und Geheimnisse drohen, die beiden auseinanderzureißen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Autorin
Sara Biren lebt mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern am Rand von Minneapolis, Minnesota. Als waschechtes Minnesota-Urgestein liebt sie Eishockey und verbringt ihre Freizeit gerne am See. Sie geht außerdem gerne auf Konzerte, schaut mit ihrer Familie Filme und trinkt eine Menge Kaffee. Sara Biren hat einen Master in Kreativem Schreiben von der Minnesota State University und arbeitet als Werbetexterin sowie als freie Lektorin.
Von Sara Biren sind bei cbj erschienen:
Cold Day in the Sun
Übersetzerin
Doris Attwood ist Diplom-Übersetzerin. Nach ausgedehnten Reisen durch Neuseeland und Kanada arbeitet sie nun seit vielen Jahren als freiberufliche Übersetzerin. Am liebsten übersetzt sie Kinder- und Jugendbücher, aber auch Filmuntertitel und Drehbücher, Fantasy-Romane und Reiseführer. In ihrer Freizeit liest sie gerne, genießt auf Trekkingtouren mit ihrem Mann die Natur und testet mit Freunden neue Backrezepte.
Mehr über cbj auch auf Instagram
Sara Biren
The Light in Your Eyes
Aus dem Englischen von Doris Attwood
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Juni 2023
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2021 Sara Biren
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Bend in the Road« bei Amulet Books, an imprint of ABRAMS, New York.
Published by arrangement with Rights People, London.
Aus dem Englischen von Doris Attwood
Covergestaltung: Suse Kopp, Hamburg,
unter Verwendung eines Motivs von © Arcangel / Ildiko Neer
sh · Herstellung: UK
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29068-9V001
www.cbj-verlag.de
Für meine Eltern – danke, dass Ihr immer an mich geglaubt habt.
Mom, Du bist die stärkste Frau, die ich kenne.
Dad, ich vermisse Dich jeden Tag.
Kapitel 1
GABE
Willkommen auf der Stone & Wool Farm.
Das Schild hängt an einer alten Steinsäule am Haupteingang der Farm. Hohe, ausladende Kiefern säumen eine Seite der lang gezogenen Einfahrt. Auf der anderen Seite malen Straßenlaternen Lichtkegel auf den Kies, einige von ihnen nur noch mit schwachem Schein, andere sind ganz erloschen. Franks Pick-up rumpelt durch die Spurrinnen der langen Straße zum Haupthaus.
»Bei Tag sieht hier alles besser aus«, sagt er.
Frank hat nicht viel gesprochen, seit er mich vor ein paar Stunden an der Gepäckausgabe im Minneapolis-St. Paul International Airport abgeholt hat. Ein grummeliges »Alles klar so weit, Kumpel?«, begleitet von einer festen, knochenbrechenden Umarmung. Ein paar Bemerkungen wie: »Also keine schicke Limo, was?« und »Hast du Hunger? Ich könnte jedenfalls ’nen Burger vertragen.«
Ich fand es schon immer gut, dass mein Onkel Frank ein Mann der wenigen Worte ist. Ein Mann, der weiß, dass man nicht jeden Moment der Stille mit bedeutungslosem Gerede füllen muss. Auf der ganzen Fahrt vom Flughafen hat er mich bisher nicht ein einziges Mal nach dem Album oder meiner seit Kurzem Ex-Freundin Marley gefragt, noch nicht mal nach Chris. Schlau ist er nämlich auch. Er weiß die Stimmung in einem Raum zu lesen. Oder die auf dem Beifahrersitz eines Pick-ups, wenn wir’s ganz genau nehmen wollen.
Wir folgen weiter der Schotterstraße, bis Frank auf Grans Einfahrt abbiegt und auf das große weiße Haus mit der Rundumveranda und den Steinsäulen zurollt. Die Außenlichter sind an, so als wüsste jemand, dass wir kommen.
»Ich hab dich doch gebeten, das hier für dich zu behalten«, sage ich, meine Worte hart und kalt. Mein Puls rast und ich kann dieses vertraute Gewicht der Angst spüren, das tief in meinen Bauch sinkt.
»Ich hab’s Laurel erzählt«, erwidert er. »Das ist alles. Ich musste schließlich dafür sorgen, dass die Hütte überhaupt bewohnbar ist, Gabe. Sie wird sicher keine Paparazzi anrufen, falls du dir deswegen Sorgen machst.«
Ich schüttle den Kopf. »Die Paparazzi sind mir scheißegal.« Das entspricht zwar nicht ganz der Wahrheit, aber auch das ist mir scheißegal.
»Deinem Dad hab ich nichts verraten, darüber musst du dir also auch keine Sorgen machen.« Er seufzt.
»Laurel wird’s ihm aber sagen, falls sie es nicht schon längst getan hat. Ist schließlich ihr Job.«
»Ich hab sie gebeten, es nicht zu tun. Komm schon, Kumpel, ein bisschen was kannst du mir schon zutrauen.«
Er hat recht. Ich weiß, dass ich Frank vertrauen kann. Darum hab ich ihn ja überhaupt angerufen. Ich atme tief durch und versuche, den Ziegel der Angst in meinem Bauch aufzulösen. Irgendwann werde ich mit Chris reden müssen, während ich versuche, aus diesem ganzen Schlamassel wieder rauszukommen. Aber noch bin ich nicht so weit.
»Danke«, murmle ich. »Ich wette, du warst nicht auf dieses ganze Drama vorbereitet, als du in diese Familie eingeheiratet hast.«
Er zuckt mit den Schultern und stellt den Motor ab. »So schlimm ist es gar nicht. Außerdem lohnt sich das bisschen Drama allein schon für die kostenlosen Konzerttickets und Backstage-Pässe, hab ich recht? Also, komm jetzt. Ich bin hundemüde, und die Kühe melken sich morgen früh nicht von allein.«
Wahrscheinlich hätte ich mir einen Wagen mieten sollen, anstatt einen Typen anzurufen, der jeden Morgen vor Sonnenaufgang aufsteht, um Kühe zu melken und was immer zur Hölle er sonst noch so macht. Sich den Arsch aufreißen, um eine Farm und eine Familie über Wasser zu halten. Und hier auf der Farm helfen. Aber ich habe ihn angerufen, und er hat alles stehen und liegen lassen und ist zweieinhalb Stunden zum Flughafen gefahren, weil ich erbärmlicher Blödmann inkognito bleiben und so tun wollte, als wäre ich niemand Besonderes und würde deshalb von einem ganz normalen Kerl mit Bart und einer Baseballmütze der Minnesota Wild in einer rostroten Carhartt-Jacke vom Flughafen abgeholt werden.
Die Wahrheit ist: Ich tue nicht nur so. Wie sich herausgestellt hat, bin ich wirklich niemand Besonderes.
Blätter rascheln unter meinen Füßen, als wir die Einfahrt und dann den Pfad hinauf zur Veranda trotten, an der die angegraute Farbe überall abblättert. Ich umklammere meine Gitarre noch fester, schwinge meine Reisetasche wieder auf meine Schulter und greife nach dem Holzgeländer, das unter meiner Berührung wackelt. Meine Erinnerungen an diesen Ort sind ziemlich spärlich und, wenn ich ehrlich bin, sehr verschwommen. Nach Grans Tod – vor inzwischen fünf, sechs Jahren? – hatten wir keinen wirklichen Grund mehr, hierherzukommen. Chris verbringt zwar immer noch jeden Sommer ein paar Wochen hier und auch zwischendurch mal ein paar Tage, aber ansonsten steht das Farmhaus leer. Leer und noch genauso, wie Gran es nach ihrem Tod hinterlassen hat. Laurel leitet die Farm. Sie fragt Chris hin und wieder, ob er möchte, dass sie die Schränke ausräumt oder Grans Habseligkeiten zusammenpackt, und er antwortet jedes Mal so was wie: »Das ist mein Problem, nicht deins. Ich kümmere mich schon drum, sobald es nötig ist.« Einmal, kurz nachdem Gran gestorben war, hab ich ihn gefragt, ob er vorhat, das Haus irgendwann zu verkaufen, weil er sowieso nicht oft dort ist. Er hat nur mit den Schultern gezuckt und gesagt: »Mal sehen.«
Frank hält mir die Schlüssel hin. »Pass gut auf den alten Schuppen auf.« Als ich einen Moment länger als nötig brauche, um etwas zu erwidern, fügt er hinzu: »Und du bist dir wirklich sicher? Du weißt, dass du bei uns zu Hause immer willkommen bist.«
»Nee, schon gut.« Ich schüttle den Kopf und nehme ihm den Schlüsselbund ab.
»Also, einer ist für die Rundscheune. Einer für die große Scheune. Dann für die Garage – aber komm bloß nicht auf Ideen, was den Mustang angeht. Laurel und Chris sind die Einzigen, die einen Schlüssel für den Wagen haben.« Er sagt es einfach so dahin, als wäre es keine große Sache. Aber ich hätte nichts dagegen, mich mal hinters Steuer von Chris’ Oldtimer zu setzen. »Und der Rest ist für noch ein paar andere Schuppen. Aber das findest du dann schon selbst raus.«
Ich zucke mit den Schultern. Kein Grund, irgendwas rauszufinden. Ich werde schließlich nur ein paar Tage lang hier sein. »Welcher ist fürs Haus?«
Er nimmt mir die Schlüssel wieder ab, geht sie durch und hält bei einem in der Mitte an: ein goldener Schlüssel mit breitem, eckigem Kopf. »Siehst du?«, fragt er und fährt mit seinem schwieligen Daumen über die Oberfläche. »Der hier ist alt.«
Ich nehme ihm den Schlüssel wieder ab und schaue ihn mir genauer an. Eine Gravur, fast komplett abgewetzt: Stone & Wool Farm 20.7.1964.
»Der Hochzeitstag deiner Großeltern. Dein Urgroßvater hat ihnen die Farm als Hochzeitsgeschenk übertragen und ist schon am nächsten Tag in die Hütte am Halcyon Lake gezogen. Das Grundstück ist seit 1907 in Familienbesitz, aber es ist noch viel älter.«
Ich habe meinen Urgroßvater oder meinen Großvater, der gestorben ist, als ich noch ein Baby war, nie kennengelernt. »Danke für die Lektion in Familiengeschichte.« Ich kann den sarkastischen Unterton nicht verhindern. Ich bin müde und muss mich endlich wieder hinsetzen, sonst breche ich noch zusammen. Und überhaupt: Was macht das alles schon für einen Unterschied? Die Vergangenheit der Farm hat mit meiner Gegenwart nicht das Geringste zu tun.
Er ignoriert mich. »Letzte Chance«, sagt er.
»Wofür?« Ich weiß genau, wofür.
»Komm schon, Gabe. Du bist siebzehn Jahre alt. Du bist noch ein Kind. Du solltest jetzt nicht allein sein. Komm mit zu uns und häng ein bisschen mit Ted ab. Janie hätte dich wirklich gerne bei uns. Sie wird dich nach Strich und Faden verwöhnen und dir alle deine Lieblingsgerichte kochen.«
Meine Lieblingsgerichte? Nicht mal ich selbst weiß noch, welches meine Lieblingsgerichte sind, obwohl ich mich von unseren kurzen Besuchen und Sommerwochenenden in der Hütte noch gut daran erinnern kann, dass meine Tante Janie eine unglaubliche Köchin ist.
Ich schüttle erneut den Kopf. »Danke, aber ich brauch ein bisschen Zeit für mich allein. Um mir über ein paar Sachen klar zu werden, weißt du?«
Er nickt. »Das verstehe ich. Wie lange willst du bleiben?«
»Ein paar Tage. Höchstens eine Woche.«
»Ich ruf dich morgen an, Kumpel«, sagt Frank. »Komm doch zum Abendessen bei uns vorbei. Ted kann dich abholen.«
»Klingt gut.«
Mehrere lange Sekunden schaut er mich nur nickend an. »Und du bist sicher, dass es dir gut geht? Janie findet …«
Ich schneide ihm das Wort ab: »Mir geht’s gut. Ich schwöre.«
Offensichtlich hat er die Fotos gesehen. Vielleicht kursiert sogar ein Video. Scheiße. Ich atme mit einem schweren Seufzen aus.
»Okay. Ruf an, wenn du was brauchst.«
Frank lässt mich auf der Veranda stehen, das grelle Licht der LEDs in den Wandleuchten steht in starkem Kontrast zu der abgeblätterten Farbe und dem losen Geländer. Gefühlt endlose Minuten lang stehe ich einfach nur da und versuche, mich dazu zu bringen, reinzugehen. Aber was bleibt mir anderes übrig? Frank ist weg, seine Rücklichter längst in der Dunkelheit des Farmgeländes verblasst. Es ist kalt hier in Nord-Minnesota, obwohl erst Mitte September ist. Es waren um die fünfundzwanzig Grad, als ich heute Nachmittag in L. A. abgeflogen bin. Ich bin froh, dass ich daran gedacht habe, eine Jacke einzupacken, obwohl ich sie ganz zuunterst in meine Reisetasche gestopft habe und mir ziemlich sicher bin, dass sie für diese kalten Temperaturen sowieso nicht warm genug ist.
Geh rein, befehle ich mir stumm. Trotzdem bleibe ich weiter vor der Tür stehen, wie gelähmt vor Unsicherheit und meiner Enttäuschung über mich selbst. Doch dann höre ich in nicht allzu weiter Entfernung ein Heulen. Irgendwo im Wald, an der Grundstücksgrenze, vielleicht hundert Meter weit weg. Wölfe? Kojoten? Ich habe keine Ahnung, aber ich möchte es auch lieber nicht rausfinden.
Ich schließe die Tür auf, nicht sicher, was ich erwarten soll, als ich diese andere Welt betrete, dieses Farmhaus, an das ich mich kaum erinnern kann. Ich gehe ein paar Schritte den Flur hinunter, kaum erhellt durch das Licht, das in der Küche im hinteren Teil des Hauses schon eingeschaltet ist. Ich greife nach dem Treppengeländer, um mich festzuhalten, während ich meine Vans abstreife.
Ich hätte nicht gedacht, dass mir direkt eine so lebendige, so eindrucksvolle Erinnerung entgegenschlägt, aber es ist, als würde Gran vor mir stehen, sich die Hände an einem grünen Geschirrtuch mit Schottenkaro abwischen und Chris dafür ausschimpfen, dass er zu spät kommt, während sie mich mit weit ausgebreiteten Armen ansieht.
»Wer ist denn dieser Junge?«, ruft sie. »Das kann nicht mein Gabey sein. Du bist ja so groß geworden! Komm in die Küche. Die Zimtschnecken warten nur noch auf ihre Ahornsirupglasur. Du kannst mir helfen.«
Irgendwie riecht dieses Haus immer noch genauso wie an jenem Tag, nach Zimtschnecken und Pekannüssen und Ahornsirup. Ich kann nicht älter als sechs oder sieben gewesen sein. Wir waren zu Grans Geburtstag angereist. Spät in der Nacht hab ich Gran und Chris damals streiten gehört. Du brauchst Hilfe, Christopher. Lass Gabe bei mir. Ich sehe ihn so gut wie nie. Er braucht seine Familie. Das tut ihr beide.
Ich muss an Grans Beerdigung denken, das letzte Mal, dass ich hier war. An dem Tag, als sie gestorben ist, hat Chris mich von unterwegs angerufen und es mir erzählt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich meiner Nachhilfelehrerin Persephone das Telefon wieder zurückgegeben und mir die Tränen und den Rotz mit dem Ärmel abgewischt habe. Chris und Elise waren damals noch zusammen. Elise hat irgendwo in Übersee gedreht, ist zur Beerdigung aber zurückgekommen. Sie ist reingerauscht, groß und zu dünn und wahrscheinlich high, und hat der kleinen weißen Kirche am Fluss sämtliche Luft entzogen. Sie hat ein schickes schwarzes Kleid und kilometerhohe Absätze getragen, einen eleganten Hut mit schwarzen Federn und einen kurzen Schleier, der schräg auf ihrem glänzenden platinblonden Haar saß. Damals fand ich, dass sie wunderschön aussah, glamourös, so bedeutend und besonders, meine fantastische Filmstarmutter. Perfekt. Aber was wusste ich schon? Ich war nur ein dummer kleiner Junge, der dachte, die ganze Welt würde sich um ihn und seine berühmte Familie drehen. Jetzt, in diesem Haus mit seiner Geschichte der harten Arbeit und Entbehrungen, kommt mir die Erinnerung an Elise an diesem Tag geradezu lächerlich vor, falsch und protzig.
Ich ziehe die Haustür hinter mir zu und schiebe den Riegel gegen die Dunkelheit und das jaulende Geheul draußen vor. Ich stelle meine Reisetasche und meine Gitarre auf dem Hartholzboden ab. Das Haus ist warm, ein Luftrausch pfeift durch alle Register. Ich sollte in einem der Schlafzimmer im oberen Stockwerk schlafen, aber ich bin mit einem Mal so erschöpft und kaputt, dass es mir wie eine unüberwindliche Aufgabe vorkommt, die Stufen hinaufzusteigen. Scheiß drauf. Ich gehe in dem winzigen Bad neben der Küche pinkeln und wasche mir die Hände. Ein frisches Handtuch und ein brandneuer Seifenspender, Duftnote Kiefernnadeln, warten auf mich. Ich trinke ein Glas Wasser aus dem Hahn in der Küche, lasse mich dann im Wohnzimmer aufs Sofa fallen und decke mich mit einer handgehäkelten Wolldecke zu.
Doch so müde ich auch bin, so lange dieser Tag auch war, ich kann nicht einschlafen. Mit Frank im Wagen, während wir durch die grelle, lebendige Nacht der Twin Cities und das stille, tiefe Schwarz von Nord-Minnesota fuhren – »Halt mit mir die Augen nach Rehen offen«, hatte er mich gebeten und ich habe mein Bestes getan, auch wenn ich mir nicht sicher war, wonach ich genau Ausschau halten sollte –, konnte ich mich auf meine Umgebung konzentrieren. Auf das bisschen, was ich ihm Licht der Scheinwerfer erkennen konnte. Ich musste nicht an Marley oder das Geld denken. An das Album. An diesen gottverdammten Ziegelstein der Angst.
Jetzt, im Wohnzimmer meiner toten Großmutter – unter eine Wolldecke, die sie vor Jahrzehnten gehäkelt hat, an der Wand über mir alte Fotos von Familienmitgliedern, die ich nicht kenne –, bricht alles auf einmal wieder über mich herein. Marley, die sturzbetrunken mit ihrem Gebrüll die Hochzeitsparty von völlig Fremdem am Strand sprengt. Die mit offenen Mündern gaffenden Gäste. Die Paparazzi, die wie immer aus dem Nichts auftauchen. Der Restaurantleiter, der mit ausgestreckten Händen dasteht, nicht sicher, ob er Marley anfassen soll oder nicht. Ein Türsteher hat sie sich schließlich über die Schulter geworfen und sie, während sie mit den Fäusten auf seinen Rücken trommelte, raus auf den Parkplatz getragen, auf dem ich den Bentley von ihrem Dad abgestellt hatte. Ich hab den Schlüssel aus meiner Hosentasche geholt und auf Entriegeln gedrückt, aber Marley wollte nicht in den Wagen steigen und hat mich nur angeschrien, dass sie überhaupt nie wieder irgendwo mit mir hingehen wollte.
All diese grauenvollen Dinge schossen wie Pfeile aus ihrem Mund.
Ich hasse dich. Du hältst dich für so viel besser als den Rest von uns. Du glaubst, du stündest ganz weit über allem anderen. Aber dein Album ist scheiße, Gabe. Du bist scheiße. Ich bin fertig mit dir. Ohne mich kommst du da nie wieder raus. Und willst du noch was wissen? Ich hab dich nie geliebt. Ich wollte nie mit dir zusammen sein. Es war alles nur gefakt, alles.
Der Türsteher warf sie auf den Rücksitz und ich verriegelte den Wagen, in der Hoffnung, Marley wäre zu besoffen, um rauszufinden, wie sie die Tür wieder öffnen kann. Sie donnerte gegen das Fenster, brüllte, aber ich konnte mich nicht bewegen, konnte die Tür nicht öffnen und einfach einsteigen und wegfahren. Ich hockte mich vor die Fahrertür, mein Kopf in den Händen, und schnappte gierig nach Luft, die sich wie scharfe Stahlflammen durch meine Lunge schnitt.
Steig in den Wagen. Alles, was ich hätte tun müssen, war, in den Wagen zu steigen, dann hätte ich wieder atmen können.
Ich hab dich nie geliebt. Ich wollte nie mit dir zusammen sein. Es war alles nur gefakt, alles.
Wie konnte ich nur so dumm sein, nicht zu kapieren, dass sie nur wegen der Publicity mit mir zusammen war?
Zwei Tage. Sie hat zwei ganze Tage gewartet, bevor sie mit mir Schluss gemacht hat, nachdem ich ihr das Geld gegeben hatte, um das sie mich förmlich angebettelt hat. Sie wollte einfach nicht locker lassen, nicht mal, nachdem ich ihr gesagt hatte, dass ich pleite war, dass die Kohle von meinem ersten Album weg war. Sie wollte nicht locker lassen, obwohl ich ihr erklärt habe, dass ich Chris nicht um Geld bitten kann. Dass ich ihn um gar nichts bitten kann.
»Bitte, Gabe«, schluchzte sie. »Ich stecke echt in Schwierigkeiten. Lass mich nicht hängen. Ich brauche dich. Du bist der einzige Mensch, der mir helfen kann.«
Ihre Hände zitterten, und ich umschloss sie ganz fest mit meinen, um sie zu beruhigen. »Hey«, sagte ich, »was immer es ist, wir bringen es wieder in Ordnung.«
Sie schaute zu mir hoch, ihre warmen braunen Augen so verloren, so verzweifelt, und ich wurde von einer Welle der Zuneigung zu ihr erfüllt. Meine älteste Freundin, mein Stern, meine Marley.
Ich wollte nicht wissen, wofür sie es brauchte, aber ich habe getan, was ich tun musste, um ihr dieses verdammte Geld zu beschaffen.
Jetzt atme ich ein paarmal keuchend ein und wieder aus und versuche, die grummelnde Übelkeit aus meinem Magen zu vertreiben, die immer in mir aufsteigt, wenn ich an das Geld oder Marleys Zusammenbruch denke. Ich schließe die Augen vor dem schmerzenden Film in meinem Kopf, dem Clip, der seit fast vierundzwanzig Stunden in Endlosschleife darin läuft.
In L. A. ist es inzwischen nach neun. Ich habe mich von sämtlichem Social Media, der Klatschpresse und all den Bloggenden ferngehalten, die meine Beziehung zu Marley Green seit zwei Jahren verfolgen und Spekulationen über uns anstellen, als wären wir die Royal Family oder so. Ich habe die Anrufe von Chris und meinem Manager ignoriert, und von diesem Widerling von der Plattenfirma. Sobald ich im Flieger saß, hab ich mein Handy ausgeschaltet und es seither nicht wieder angemacht.
Wir hatten einen Deal, Marley und ich, beide das Produkt von Rockstars und Hollywoodadel. Wir würden immer füreinander da sein, uns gegenseitig vor all diesen hinterhältigen Arschkriechern beschützen. Ich habe ihr vertraut. Ich habe Gefühle für sie, trotz des ganzen Hin und Hers, des Hollywooddramas und der ständigen Aufmerksamkeit, nach der sie so lechzt. Ich habe die Worte nie laut ausgesprochen, aber ich habe etwas empfunden, eine besondere Zärtlichkeit, nur für sie. Als die Drogen irgendwann mehr waren als nur ein gelegentlicher Spaß auf Partys, habe ich sie verteidigt, für sie gelogen. Ich habe für sie gestohlen.
Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Ich schätze, irgendwann hat sie sich wohl selbst davon freigesprochen, dasselbe tun zu müssen.
Ich musste weg aus L. A., weg aus diesem Ort, den ich kannte. Diesem Ort, an dem ich dachte, ich wüsste, wer ich war. Diesem Ort, an dem ich hart dafür gearbeitet habe, etwas aus mir zu machen, an dem ich so verflucht hart dafür gekämpft habe, mehr zu sein als nur der Sohn von Chris Hudson und Elise Benson-Beckett oder Marley Greens On/Off-Rockstar-Freund.
Heute Nacht bin ich nichts von alledem. Ich bin allein, ich bin pleite, ich bin gearscht.
Und hier, in diesem Farmhaus in Nord-Minnesota, das sich ebenso vertraut wie fremd anfühlt, bin ich noch etwas anderes, das ich vorher noch nie war: Ich bin untergetaucht.
Kapitel 2
JUNIPER
Das hier ist meine liebste Tageszeit, meine liebste Jahreszeit, mein absoluter Lieblingsort: ein ruhiger, kühler Morgen am Aussichtspunkt im Naturpark. Ich bin schon ganz früh hierhergekommen, um den Sonnenaufgang zu sehen, ein Rausch aus Pink und Orange und Tiefblau, wie über den Himmel ausgegossene Wasserfarben. Die Wanderung verschafft mir jedes Mal neue Energie, wärmt und lockert meine Muskeln. Noch konnte nichts diesen Tag verderben, und in der frischen, rauchigen Herbstluft habe ich das Gefühl, dass es auch gar nichts gibt, das es tun könnte.
Das Leben auf der Farm läuft für uns im Herbst langsamer, die Welt wird ruhiger und wir bereiten uns auf die Stille des Winters vor. Jedes Jahr um diese Zeit empfinde ich nichts als Zufriedenheit und inneren Frieden. Alles bewegt sich im richtigen Tempo. Genau dieses Gefühl habe ich auch heute, während ich auf den schnell dahinfließenden Fluss blicke, über das Wasser hinweg, dorthin, wo das Farmland auf die Uferlinie trifft.
Wir hatten einen guten Sommer. Uns geht es gut, Mom und mir. Wir kriegen das hin.
Ich werfe einen Blick auf meine Uhr. Es ist fast neun. Zeit zu gehen. Mom wartet in der großen Scheune auf meine Hilfe. Blätter knirschen unter meinen Füßen, als ich dem Pfad wieder bergab folge, an der Südseite des Naturschutzgebiets entlang, wo der Fluss eine sanfte Biegung nach Westen macht, zum Grundstück der Hudsons.
Unser Haus, das rote, wacht über alles. Es steht der Hauptstraße am nächsten und wurde mit seiner Redwood-Verkleidung in den Siebzigern im typischen Ranch-Style erbaut. Früher hat es mal einem alten Hippie-Imker und seiner Frau gehört, einer Künstlerin. Als sie nach New Mexico gezogen sind, um näher bei ihrer Familie zu sein, hat Chris es gekauft. Er hat es immer den Bienenstock genannt. Meine Eltern haben die Familienfarm damals schon seit ein paar Jahren bewirtschaftet, aber in einem Mietshaus in der Stadt gewohnt, und Chris meinte, es wäre viel sinnvoller, wenn sie direkt auf der Farm wohnten. Drei Jahre später wurde ich geboren. Es ist das einzige Zuhause, das ich je gekannt habe.
Manche Leute nennen es auch das Verwalterhaus, obwohl Mom sich selbst nicht als Verwalterin bezeichnet, genauso wenig wie Chris und seine Familie. Ihre offizielle Berufsbezeichnung ist allerdings ein ziemlicher Zungenbrecher: Immobilienmanagerin des Hudson-Familienunternehmens Stone & Wool Farm. Fragt man sie wiederum selbst, antwortet sie stets, dass sie schlicht und einfach Farmerin und Künstlerin ist und Kunst aus natürlichen Fasern erschafft.
Ich biege vom Pfad im Park auf das Farmgelände ab und fange an, die Bäume entlang der Hauptstraße zu zählen, wie ich es immer tue. Zweiundfünfzig Amerikanische Rot-Kiefern von der Landstraße bis zum Farmhaus. Die Zahl ändert sich nie, eine Konstante in den sich wandelnden Jahreszeiten. Ich gehe an unserem Haus vorbei und steuere auf die große Scheune zu.
Aber ich komme gar nicht so weit. Mom steht auf der Veranda vor dem Farmhaus und unterhält sich mit irgendjemandem, der einen altmodischen schwarzen Wollcaban trägt, den Jackenkragen hochgestellt. Mir stockt der Atem: nicht nur irgendjemand – Chris’ Sohn. Er trägt eine dunkle Sonnenbrille, hinter der er seine, wie ich zufällig weiß, atemberaubenden erdig-grünen Augen versteckt, genau wie die von seinem Dad. Er ist nicht besonders groß, aber gut einen halben Kopf größer als Mom, und steht auf seine Absätze gekippt, so als wollte er sich möglichst weit von ihr weglehnen. Eine zerzauste Lockenmähne, genauso schwarz wie seine Jacke, ergießt sich fast bis zu seinen Schultern. Mit seinem markanten Kinn, den hohen Wangenknochen und der langen, imposanten Nase wirkt er furchtbar ernst. Älter als seine siebzehn Jahre. Klassisch gut aussehend, wenn auch ein bisschen verlottert. Außerdem muss er in dieser dicken Jacke fast eingehen.
Er zieht über das, was Mom sagt, die Stirn in Falten. Ihre Hand zeigt nach oben und bewegt sich mit der Betonung und dem Rhythmus ihrer Worte, eine Geste, die ich sehr gut kenne, weil sie so immer versucht, ihren Standpunkt zu verdeutlichen. Er schüttelt den Kopf. Aus irgendeinem Grund erkenne ich diesen Ausdruck der Enttäuschung und Frustration wieder, diese Sorgenfalte zwischen seinen Augen, und mir rumort nervös der Magen. Irgendetwas stimmt nicht.
Nicht, dass mich das interessiert.
Ich kenne ihn nicht, jedenfalls nicht wirklich, aber ich würde ihn trotzdem überall wiedererkennen, den Sohn des liebsten – und manchmal missratensten – Sohns unserer Stadt: Gabe Hudson. Der Gabe Hudson, Superstar. Musiker, genau wie sein Vater. Seine Musik ist nicht schlecht – das erste Album zumindest, das mich an Dig Me Under, Chris’ Band, erinnert. Grüblerischer, eindringlicher Grunge-Sound, teilweise etwas heavy, teilweise nachdenklich, teilweise laut. Gabes neuestes Album hab ich noch nicht gehört.
Er ist der letzte Mensch, den ich je hier erwartet hätte. Die Beerdigung seiner Grandma Leona ist schon Jahre her, das einzige Mal, dass wir uns je unterhalten haben. Und nachdem er an jenem Tag bewiesen hatte, dass die Gerüchte allesamt der Wahrheit entsprachen – dass er eingebildet, angeberisch und unhöflich war –, wäre ich nicht enttäuscht gewesen, wenn er nie wieder hierher zurückgekehrt wäre.
Warum ist er jetzt hier? Ich mache einen Schritt auf ihn zu und ein Zweig knackt unter meinem Schuh. Gabes Kopf wirbelt in meine Richtung herum und auch Mom dreht sich mir zu. »Juniper!«, ruft sie. »Schau mal, wer hier ist!«
Er schiebt die Sonnenbrille auf seine Locken hoch, als ich mich nähere, und schaut dann wieder weg.
»Da ist Juniper«, sagt Mom mit strahlendem Lächeln. »Ihr seid beide schon so erwachsen.«
Er steckt die Hände in die Jackentaschen und nickt kurz, sagt aber nicht Hallo.
»Du erinnerst dich doch noch an Gabe, oder?«, lässt Mom nicht locker.
»Oh, wie könnte ich ihn jemals vergessen?«, frage ich und bin mir sicher, dass ihr die Schärfe meines Tonfalls nicht entgeht. »Aber natürlich kenne ich dich auch aus dem Internet, du weißt schon.«
Eigentlich sollte das eine weitere bissige Bemerkung sein, aber sie klingt eher, als wäre ich ein zwölfjähriges Mädchen, das online nach Fotos von ihm sucht und sie sich als Hintergrundbild aufs Smartphone runterlädt. Als wäre ich in ihn verknallt gewesen, wie alle anderen damals in der Middleschool. Und als würde ich auch jetzt noch in der Highschool auf ihn stehen und mir vorstellen, falls er jemals in die Stadt käme, würde er sich Hals über Kopf in eins der Mädchen hier verlieben, so als hätten wir hier alle ein besonderes Anrecht auf ihn.
Ich werde nie so sein.
»Aus dem Internet«, wiederholt er, schüttelt langsam den Kopf und schaut zu seinen Schuhen hinunter: solide schwarze Vans. »Natürlich.«
Einen unbehaglichen Augenblick lang sagt keiner von uns etwas. Mom blickt von Gabe zu mir und wieder zurück zu Gabe, bevor sie sagt: »Wir sind so froh, dass du nach Hause gekommen bist.« Sie legt eine Hand auf seine Schulter, drückt sie und nimmt die Hand dann wieder weg. Aber das hier ist nicht sein Zuhause. Das hier wird niemals sein Zuhause sein.
»Was immer du brauchst, sag einfach Bescheid«, fährt Mom fort.
»Ich brauche die Schlüssel«, erwidert er. »Für den Twister. Weißt du, wo Chris sie aufbewahrt?«
Direkt zum Punkt.
Ich kann nicht anders. Ich stoße ein Lachen aus, ein leises Ha, das ich noch hinunterzuschlucken versuche. Falls Gabe es hört, lässt er es sich nicht anmerken.
»Oh, da muss ich ihn erst fragen, Gabe.« Sie lächelt, ihre Augen freundlich und sanft. »Ich bin mir sicher, das weißt du.« Natürlich wird Mom ihm nicht einfach so die Schlüssel zu Chris’ Mustang aushändigen, einem seltenen, restaurierten Modell aus den frühen Siebzigern in makellosem Zustand. Als er den Wagen vor ein paar Jahren gekauft hat – nachdem er den Grammy gewonnen hatte, nach Leonas Tod –, hat er die Garage komplett umgebaut. Und er hat sich noch einen neueren Mustang besorgt, einen petrolfarbenen Chevy: ein Pick-up mit kurzer Ladefläche, der ihn an den Wagen von seinem Grandpa erinnert hat. Außerdem hat er in L. A. auch noch eine ganze Garage voller alter Klassiker.
»Na schön«, sagt Gabe. »Ich brauche den Wagen nicht. Ich lass mir meine Lebensmittel liefern.«
Ich stoße ein Schnauben aus. »Von wem?«
Jetzt dreht er sich doch zu mir um. »Einem Lieferservice?«
»Einem Lieferservice«, wiederhole ich und schüttle den Kopf. Typisch arroganter Hollywood-Kinderstar.
»Schreib eine Liste«, schlägt Mom hilfsbereit vor. »Juniper kann heute Morgen für dich einkaufen, während du dich häuslich einrichtest.«
»Ich?«, platze ich heraus. »Was bin ich, seine persönliche Assistentin?«
»Juniper«, sagt sie mit warnendem Unterton. »Gabe ist unser Gast.«
Na, das ist schon näher an der Wahrheit, als ihn zu Hause willkommen zu heißen.
»Ich komm schon klar«, erwidert Gabe und macht einen Schritt rückwärts in Richtung Haustür. Er schaut mich direkt an, und mir fallen diese tiefgrünen Augen jetzt erst richtig auf. »Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden«, sagt er so traurig, so leise, dass ich beinahe glaube, er hätte es gar nicht wirklich gesagt. Er macht die Tür auf, verschwindet im Haus und schließt sie mit einem leisen Klick wieder.
»Juniper!«, zischt Mom. Sie ist klein und hat ihre langen strohblonden Wellen – durch die sich mehr graue Strähnen ziehen, als ihr lieb ist – zu ihrem üblichen Pferdeschwanz zusammengefasst. Ihr braun gebranntes Gesicht ist von Sorgen und harter Arbeit gezeichnet, ihre Augen von Lachfalten umspielt. Arbeite hart, liebe intensiv. Das habe ich sie schon eine Million Mal sagen hören. Wir nehmen keinen einzigen Tag für selbstverständlich. »Ich kann nicht glauben, wie unhöflich du gerade zu ihm warst.«
»Ich? Und was ist damit, wie unhöflich er war?«
Ich habe Mom nie erzählt, was bei Leonas Beerdigung passiert ist. Dad war im Jahr zuvor gestorben, aber ich habe immer noch jeden Tag um ihn geweint und mich an die Worte geklammert, die Mom an dem Tag zu mir gesagt hat, als wir ihn verloren haben: »Ich weiß, dass der Schmerz jetzt fast unerträglich ist. Und morgen wird er es auch noch sein. Aber er wird dir nicht immer so unerträglich vorkommen, versprochen.« Ich habe damals dasselbe zu Gabe gesagt, als er diesen Schmerz empfunden haben muss, aber er hat überhaupt nichts erwidert. Er hat sich nur umgedreht und ist weggegangen, ohne mich anzusehen, ohne mir zu danken, ohne sich in irgendeiner Form so zu benehmen, wie es ein anständiger Mensch tun sollte. Ich wünschte, ich hätte diese Worte nicht mit ihm geteilt, diese Worte, die mir so viel bedeuteten. Worte, die er wie Abfall einfach weggeworfen hat. Es fühlte sich wie eine Beleidigung für meinen Vater, für sein Andenken an.
»Was macht er überhaupt hier?«, will ich wissen. »Ich meine, abgesehen davon, dass er ganz offensichtlich nicht hier ist, um Freunde zu finden?«
»Was spielt das für eine Rolle?« Sie stemmt die Hände in die Hüften. »So behandeln wir andere Leute nicht.«
»Und wie konntest du meine Hilfe einfach so anbieten, ohne vorher mit mir darüber zu reden?«, zicke ich sie an. »Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, gehörten Lebensmittellieferungen nicht zu meiner Stellenbeschreibung.«
»Du hast keine Stellenbeschreibung«, kontert Mom. »Du tust, worum ich dich bitte.«
»Na, das war schon mal dein erster Fehler: Du hast mich nicht gebeten. Ich bin im Gewächshaus, falls du mich noch für irgendwas anderes brauchst. Irgendwas, das nichts damit zu tun hat, die Einkäufe für Gabe Hudson zu erledigen.«
»Diese Unterhaltung ist noch nicht vorbei«, ruft sie mir hinterher, als ich die Einfahrt zu unserem Haus wieder hinaufgehe. »Ganz im Gegenteil. Und vergiss nicht: Du bist mit dem Mittagessen dran, und ich lade Gabe zu uns ein.«
Falls es irgendjemanden gibt, der genauso stur ist wie ich, dann ist es meine Mutter. Ich weiß, dass sie diese Sache nicht einfach auf sich beruhen lassen wird. Aber ich werde genauso wenig klein beigeben.
Kapitel 3
GABE
Auf gar keinen Fall lasse ich mir von Juniper Blue meine Einkäufe liefern oder mich auch nur zum Supermarkt fahren, damit sie auf dem Parkplatz auf mich wartet, während ich einkaufe. Ich lasse sie überhaupt nichts für mich machen. Ich bleibe sowieso nicht lange in Harper’s Mill und bin, wie ich ihr direkt gesagt habe, auch nicht hier, um Freunde zu finden.
Ich habe zwei Erinnerungen an Juniper Bell. Erstens, wie ich sie im Fernsehen gesehen habe, als sie bei den Grammys mit Chris über den roten Teppich lief, völlig überwältigt und wie erstarrt vor lauter Superstars und total unbeholfen in ihrem fluffigen blassrosa Kleid und den hohen Schuhen. Ihr Nachname ist Bell, aber Juniper Blue ist der Name, der sie bei den Grammy Awards vor ein paar Jahren für sage und schreibe dreißig Sekunden berühmt gemacht hat, als Dig Me Under den Song performt haben, den Chris für sie geschrieben hat.
Ich hab mir die Show damals live in Elises New Yorker Penthouse angeschaut – sie und Chris hatten sich mal wieder getrennt, sind aber natürlich wieder zusammengekommen, als er die Trophäe mit nach Hause gebracht hat – und mir hinterher Millionen von Clips auf YouTube angeguckt. Aber jedes Mal dachte ich dabei, das hätte ich sein sollen, obwohl ich mit meinem Vater und meiner Mutter, manchmal auch mit beiden, schon bei unzähligen Preisverleihungen gewesen war. Inzwischen bin ich selbst zu ein paar von ihnen eingeladen gewesen und hab meine erste Single, »Burden«, bei den Radio KidCo Awards performt, als ich für den Song des Jahres im Rennen war. Mein Song hat nicht gewonnen – zu heavy für dieses spezielle Publikum –, aber die Tatsache, dass ich mit der KidCo-Prinzessin zusammen war, hat mir wohl aus reiner Höflichkeit eine Nominierung beschert, schätze ich.
Meine zweite Erinnerung an Juniper, ein paar Monate später, ist ein wenig verschwommener: ein Moment in Grans Wohnzimmer nach der Beerdigung, das letzte Mal, dass ich hier war. Damals war sie ein ziemlich dürres kleines Ding, ihre Locken eher ein kaltes Weißblond als warmer, goldener Sonnenschein. Sie kam zu mir und hat praktisch gezittert, das einzige Mal, dass sie je mit mir gesprochen hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was sie gesagt hat oder ob ich irgendwas darauf erwidert habe. Ich weiß nur noch, dass ich es so satthatte, dass mir alle ihr herzliches Beileid aussprachen. Ich hatte Minnesota satt, die schwere, feuchte Luft und den hässlichen braunen Fluss, der durch die Stadt und hinter Grans Haus vorbeifloss. Ich wollte nur noch nach Hause, oder besser gesagt: an den Ort, der einem Zuhause für mich am nächsten kam.
Es stört mich nicht mehr, dass »Juniper Blue« das Comeback für Dig Me Under bedeutet hat. Es ist mir egal, dass Chris einen Song für sie geschrieben und sie zu den Grammys mitgenommen hat. Es kümmert mich nicht, dass er an diesem einen Wochenende wahrscheinlich mehr gemeinsame Zeit mit ihr verbracht hat als jemals mit mir. Juniper ist nur ein Mädchen, das zufällig auf der Farm wohnt, das ist alles.
Ich muss allerdings zugeben, dass Juniper mich heute überrascht hat. Ich hatte nicht erwartet, dass sie so klein ist, das ist mal das eine, aber auch nicht, dass sie so … keine Ahnung … scharfzüngig ist. So faszinierend. Sie packt definitiv ziemlich viel Selbstbewusstsein in ihr Yoda-Format: Ihr blondes Haar hatte sie zu zwei lockeren, bis zu ihrem unteren Rücken reichenden Zöpfen geflochten, die khakigrüne Cargohose bis zu den Knöcheln hochgekrempelt, dazu trug sie ein langärmliges graues T-Shirt mit der Aufschrift Mehr Wandern, weniger Sorgen in blumiger Schrift und dazu abgenutzte Wanderstiefel. Ihre Wangen waren leuchtend rot von der kühlen Herbstluft und ihre eisblauen Augen haben vor Entrüstung aufgeblitzt.
Ich stehe in Grans Küche und begutachte den kleinen Lebensmittelvorrat, den Chris hier immer im Schrank hat. Thunfischdosen. Dosen mit Tomatensuppe. Irgendein Mikrowellen-Reisgericht. Nichts davon wirkt sonderlich verlockend, aber zum ersten Mal seit Tagen habe ich tatsächlich ein wenig Appetit. Zum ersten Mal seit Tagen habe ich die ganze Nacht durchgeschlafen, obwohl das Sofa im Wohnzimmer nicht unbedingt bequem ist. Heute Morgen habe ich eine noch ungeöffnete Packung Kaffee gefunden und die Kaffeemaschine hat auch funktioniert, was ich als ersten Erfolg verbuche.
Aber ich muss was essen.
Und so sehr es mir auch widerstrebt, ich muss Verstärkung rufen. Ich schnappe mir meine Reisetasche, die ich im Wohnzimmer habe liegen lassen, und schütte den Inhalt auf dem Boden aus. Mein Handy steckt in der Seitentasche. Als ich es anschalte, vibriert es vor Nachrichten: Chris. Elise. Mein Manager. Rocky.
Mir krampft sich der Magen zusammen. Ich kann jetzt nicht an Rocky denken. Ich wische sie alle weg, klicke auf die Unterhaltung mit meinem Cousin Ted und schreibe: Hey, du hast wahrscheinlich schon gehört, dass ich in der Stadt bin. Ich wollte dich um nen Gefallen bitten.
Keine dreißig Sekunden später sehe ich, dass er zurückschreibt, und lese dann: Was brauchst du kann in 15 Min da sein.
Er ist in zehn da. Er trampelt die Verandastufen hoch, platzt zur Haustür rein, ohne anzuklopfen, und jagt mir dabei eine noch viel größere Scheißangst ein als die Wahrscheinlich-Kojoten letzte Nacht.
»Gabey Baby«, ruft er und durchquert das Wohnzimmer. »Deine Kutsche erwartet dich, Prinz Charming, zack, zack. Beweg deinen Hintern, ich hab noch anderen Scheiß zu tun.«
Wer braucht Juniper oder einen Lieferdienst, wenn er diesen Kerl hat?
Ich stehe auf und greife nach dem kurzen Wollmantel meines Großvaters, den ich vorhin über die Lehne einer übermäßig gepolsterten, geblümten Monstrosität von einem Ohrensessel geworfen habe. Die Jacke, die ich mitgebracht habe, kann gegen die Kälte hier nichts ausrichten. Der Caban ist mir zwar zu groß und riecht dank der Mottenkugeln in dem Zedernholzschrank oben, in dem ich ihn zusammen mit einer die letzten rund fünfzig Jahre umspannenden Garderobe entdeckt habe, ziemlich modrig, aber für dem Moment muss er reichen.
»Freut mich auch, dich zu sehen, Theodore«, sage ich. »Wie läuft’s so?«
»Wie immer, bla, bla, bla. Wie läuft’s bei dir so? Bist du also endlich diese Psychotante losgeworden, ja? Ehrlich, das nenn ich mal vernünftige Unterhaltung. Viel besser als ihre letzte KidCo-Serie.«
Ich zucke mit den Schultern. Ich bin mir sicher, dass unsere sehr öffentliche, sehr spektakuläre Trennung ziemlich großes Kino war, aber es tut trotzdem weh. »Ich wusste gar nicht, dass du so ein KidCo-Fan bist. Magst du die Zeichentrickserien oder die Spielfilme lieber?«
Ted ignoriert mich. »War der Sex gut?«, fragt er grinsend. »Ach, vergiss es. Wer will schließlich Knochen vögeln, stimmt’s?«
Ted wurde ohne Filter geboren, das komplette Gegenteil seines verschwiegenen Vaters. Er ist der klassische Farmersohn/Running Back der örtlichen Highschool aus dem Mittleren Westen, der später mal Geschichte unterrichten und drei Sportteams an seiner ehemaligen Schule trainieren will, dieselben drei, in denen er selbst Höchstleistungen gebracht hat: Football, Basketball, Baseball.
Er ist aber auch einer der nettesten Typen auf diesem Planeten, allzeit hilfsbereit, ohne Fragen zu stellen. Darin ist er genau wie sein Dad. Er ist groß, breitschultrig, muskulös, mit gesundem Teint, Flanellhemd, dreckiger Jeans und Allis-Chalmers-Truckerkappe. Ich vermute, dass er seinem Vater heute auf der Farm hilft. Noch anderen Scheiß zu tun bedeutet vermutlich, dass er tatsächlich Kuhmist schippen muss.
Wir sehen uns nicht oft oder quatschen viel. Aber wir haben früher in den paar Wochen in der Hütte immer zusammen rumgehangen und schicken uns hin und wieder Nachrichten. Chris hat die Familie ein paarmal nach L. A. einfliegen lassen und wir haben das übliche Touristenzeug unternommen: Hollywood Walk of Fame, Strand, Universal Studios, Disneyland. Letztes Jahr hat Ted mich gefragt, ob ich ihm Ariana Grande vorstellen kann und mir gesagt, dass ich mich selbst verarschen kann, als ich ihm erklärt habe, dass ich sie nicht kenne. Er ist einer von den Guten.
Ich atme langsam seufzend aus. »So gerne ich dich auch auf den neuesten Stand bringe«, sage ich, »ich könnte wirklich ein paar Sachen aus dem Supermarkt gebrauchen.«
Er prustet vor Lachen. »Das ist der Gefallen, um den du mich bitten wolltest? Eine Taxifahrt zum Supermarkt? Warum nimmst du nicht einfach eins von Chris’ Autos?«
»Ich hab um den Mustang gebeten, aber die Bitte wurde abgelehnt.«
Ted lacht wieder. »Chris würde total durchdrehen, wenn dem 1970er Ford Mustang Mach 1 Twister Special was passieren würde.« Chris spricht immer mit »vollem Namen« von seinem Baby, worüber Ted sich bei jeder Gelegenheit lustig macht. »Oh, verflucht, mir ist gerade wieder eingefallen, wie du und Marley damals mit dem BMW die Küste raufgefahren seid …«
Ich hebe eine Hand, um ihn davon abzuhalten, mir noch mal detailliert zu erzählen, wie sich das Cabriodach damals nicht mehr schließen ließ und wir bei Sturm und Regen mit offenem Wagen zurückfahren mussten. Marley hat tagelang kein Wort mehr mit mir gesprochen, weil natürlich jemand Fotos von uns geschossen hat, klatschnass, frustriert und wütend aufeinander. Chris war allerdings noch schlimmer. Er hat mir mit dramatischer Geste die Schlüssel abgenommen und gedroht, mir eine gebrauchte Schrottkarre zu kaufen – was er auch getan hat: einen hässlichen orangefarbenen RAV4, erste Generation, der überraschenderweise den Abgastest bestanden hatte und auf dem Parkplatz der Barlow-Winston Academy nicht zu übersehen war.
»Ich erinnere mich.«
Er lacht wieder. »Okay, und warum kann Laurel dich nicht fahren? Oder Juniper?«
»Frag nicht.« Ich werde dazu nichts weiter sagen. Ich weiß, dass Ted und Juniper Freunde sind.
»Okayyyyy, dann mal los.«
Ted quatscht auf der ganzen Fahrt in die Stadt, labert ohne Punkt und Komma von dem Footballspiel gestern Abend – sie haben 17:14 gewonnen, und es war übrigens das erste Spiel, das mein Dad je versäumt hat, weil er dich Penner vom Flughafen abholen musste –, von der Farm, vom Major League Baseball, von den Minnesota Vikings.
In der Stadt lenkt er den Wagen vor Bjerke’s SuperValu in eine Lücke und stellt den Schalthebel auf Parken. Die meisten Parkplätze sind leer und ich bin ein bisschen erleichtert, dass wenigstens nicht die halbe Einwohnerschaft von Harper’s Mill sehen wird, wie ich Lebensmittel einkaufe.
Ted greift nach dem Türgriff, hält dann jedoch inne. »Okay«, sagte er, »ich gehe mal davon aus, dass du nicht unbedingt sämtliches Social Media nach dem neuesten Klatsch und Tratsch durchforstet hast, aber du solltest wahrscheinlich wissen, dass deine feine Marley dich total den Löwen zum Fraß vorgeworfen hat.«
Ich zucke mit den Schultern, öffne die Tür, trete auf den rissigen Asphalt und knalle die Tür wieder zu. »Du interessierst dich also doch noch für was anderes als Sport?«
»Ihre Eltern haben sie wieder in die Betty Ford geschickt.« Wir überqueren den Parkplatz und betreten den Laden. »Irgendein Reporter behauptet, sie hätte in einem Exklusivinterview mit ihm gesagt, dass sie das Heroin von dir hatte und ihr zusammen gefixt habt.«
Ich setze eine finstere Miene auf und ziehe einen Einkaufswagen aus der Schlange. »Das ist Bullshit. Du weißt, dass das Bullshit ist.«
Wenn Marley in einer Entzugsklinik ist – wo sie definitiv sein sollte –, wie soll sie mir dann die Kohle besorgen? Für achtundzwanzig Tage – oder noch länger. Und was ist danach? Sie schuldet mir einen Sauhaufen Geld, aber wenn sie mich angelogen hat wegen … na ja, wegen allem, dann stehen die Chancen gut, dass sie auch dabei gelogen hat und sowieso die ganze Zeit vorhatte, mich über den Tisch zu ziehen. Gott, ich bin so ein Idiot.
»Vielleicht ist es Bullshit«, erwidert Ted. »Aber wenn du nicht die Hosen runterlässt, um es mal so zu formulieren, und erklärst, wo du bist und was du treibst, dann werden die Leute annehmen, dass du auch ’nen Entzug machst. Wie der Vater, so der Sohn, du weißt schon. Gerüchten zufolge bist du im Hazelden. Jemand hat am Flughafen Fotos von dir gemacht.«
Natürlich. Warum sollte ich wohl sonst nach Minnesota fliegen, wenn nicht, um demselben berühmten Therapiezentrum einen ausgedehnten Besuch abzustatten, das Chris nicht nur einmal, sondern gleich zweimal das Leben gerettet hat?
Als ich nichts erwidere, fügt Ted hinzu: »Gabe … Ich hab das Video gesehen.«
Ich lache schnaubend. »Da musst du schon genauer sein. Welches Video?«
Er seufzt. »Das, in dem der Türsteher Marley auf den Rücksitz eines Bentleys wirft und du verflucht noch mal total ausflippst.«
»Ah. Dann gibt’s also ein Video.«
»Ja. Und es tut nicht besonders viel dafür, deine Behauptung zu stützen, du hättest nichts genommen.«
Bevor ich richtig darüber nachdenken kann, entgegne ich: »Eine Panikattacke sieht nicht aus wie ein schlechter Trip.« Das glaube ich jedenfalls. Ich hab mir schließlich noch nie selbst zugeguckt, wenn es passiert. Vielleicht sollte ich mir das Video doch mal anschauen.
»Eine Panikattacke, ja? Also, diese spezielle sah aber schon aus wie ein schlechter Trip.«
»Was interessiert mich das? Sollen sie doch glauben, ich hätte Speed genommen oder was weiß ich.« Ich lenke den Einkaufswagen in den ersten Gang und steuere auf die kleine, ziemlich jämmerlich aussehende Obst- und Gemüseabteilung zu. Das Rad hinten links wackelt ein bisschen, deshalb lehne ich mich vor und zwinge den Wagen in die richtige Bahn. Vor einem Aufsteller mit Bananen bleibe ich stehen, aber sie sind alle voller brauner Flecken und überreif.
»Keine gute Idee«, findet Ted. »Also, wie sieht dein Plan aus?«
Wie mein Plan aussieht? Mein Magen gibt ein tiefes, grollendes Knurren von sich. Mit der ganzen Klatschpressesituation bin ich vertraut, aber ich befinde mich hier trotzdem auf Neuland, weil ich mir mein Essen selbst kaufen muss. Mein Plan ist, zumindest im Moment, mich in diesem Drecksladen von einem Supermarkt zurechtzufinden und mir zu überlegen, was zur Hölle ich in den nächsten paar Tagen essen soll.
»Tiefkühlpizza, schätze ich«, sage ich zu Ted. »Und mit einer Packung Makkaroni und Käse komme ich wahrscheinlich auch klar.«
Teds Handy klingelt und mir rutscht der Magen in die Kniekehlen. Er schaut nur flüchtig aufs Display, bevor er drangeht. »Jap, hab ihn«, meldet er sich. Dann reicht er mir das Smartphone. »Ich geh nur kurz … Ich warte draußen auf dich. Onkel Chris will mit dir reden.«
Kapitel 4
JUNIPER
Das Gewächshaus war nur eine Ausrede, und Mom weiß das. Ich musste allein sein. Gabe zu sehen hat mich irgendwie aufgewühlt, so als hätte sich etwas verändert, weil er hier ist. Er mag vielleicht aussehen wie Chris, aber sie wirken beide so verschieden. Sicher, Chris ist ein weltberühmter Rockstar, aber für mich ist er ein ganz normaler Kerl, der beste Freund von meinem Dad. Er tut nicht so, als wäre er was Besseres als der Rest von uns. Sein Sohn sollte sich echt mal eine Scheibe von ihm abschneiden.
Ich werkle ein bisschen vor mich hin, gieße alles und schaue nach der Teepflanze, die inzwischen zu blühen begonnen hat, bevor ich etwas Rucola und Basilikum pflücke. Das Gewächshaus war Dads Baby, sein Spezialprojekt. Kurz nachdem meine Eltern hierhergezogen sind, hat er angefangen, mit dem Beratungsservice der University of Minnesota für nachhaltiges Design zusammenzuarbeiten und Studien für sie durchzuführen. Er und ich haben hier drin eine Menge Zeit zusammen verbracht, aber ich werde nie das Gefühl haben, dass es genug war. Er hat mir die Grundlagen vermittelt, aber ich hab immer noch jede Menge zu lernen. Nach seinem Tod hab ich es lange nicht geschafft, das Gewächshaus auch nur zu betreten, ohne anzufangen zu weinen, deshalb habe ich es komplett gemieden.
Leona hat mich im Frühjahr vor ihrem Tod davon überzeugt, dass es an der Zeit war, es noch mal zu probieren. »Du hast den grünen Daumen von deinem Vater geerbt«, sagte sie. »Lass dieses Talent nicht einfach so verkommen, Juniper. Er wäre sonst sehr enttäuscht. Also, geh da rein, heul dich mal richtig aus, und dann fang an, wieder Sachen wachsen zu lassen. Das Leben ist kurz, darum muss man immer im Sonnenschein leben.« Sie erinnerte mich mit ihrem Rat natürlich an die alten Farmregeln dazu, wie man sein Leben führen sollte. Ihr Schwiegervater hatte die Regeln vor langer Zeit an die Wand der Rundscheune geschrieben: Lebe im Sonnenschein, schwimme im Meer, trinke die wilde Luft, ein Zitat von Ralph Waldo Emerson. Leona war damals schon krank und ihre Prognose war nicht gut.
Also bin ich ins Gewächshaus gegangen, hab mich richtig ausgeheult und dann ein paar simple Kräuter gepflanzt: Basilikum, Schnittlauch, Minze. Dort habe ich meine Trauer verarbeitet. Na ja, dort und mithilfe eines Therapeuten in Fred Lake, bei dem ich nach Dads Tod etwa zwei Jahre lang regelmäßig Sitzungen hatte.
Jetzt hilft mir Frank Sr. dabei, das Gebäude in Schuss zu halten. Den meisten Platz nehmen die Beete ein – Kräuter, Salate, ein paar blühende Pflanzen für meine Tees –, der Rest ist meine Arbeitsecke, in der ich Pflanzen trockne und mit Teemischungen experimentiere. Ich hab sogar einen kleinen Schreibtisch aufgestellt – nur für den Fall, dass mich die Inspiration ereilt – und das schlichte Regal darüber ist mit Notizbüchern voller Rezepte und anderer Ideen, alten Ausgaben von Mother Earth News und Old Farmer’s Almanac sowie einem Saatenkatalog gefüllt, den ich in einer Holzkiste gefunden habe und in dem Dad haufenweise Anmerkungen notiert hat.
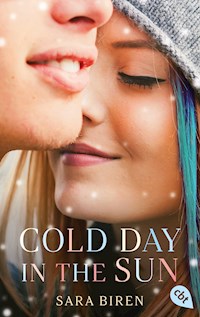













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














