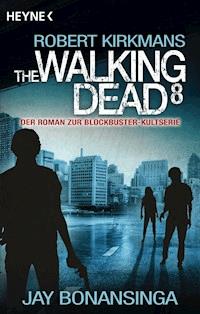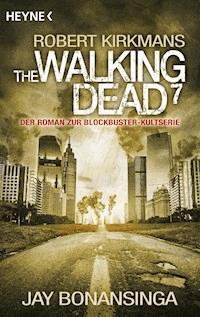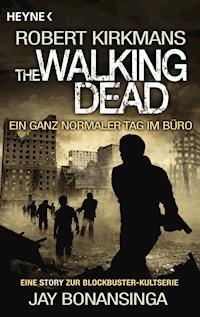9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: The Walking Dead-Romane
- Sprache: Deutsch
Der Kampf um Woodbury hat gerade erst begonnen
Von dem einst so malerischen Städtchen Woodbury sind nur noch rauchende Trümmer übrig geblieben. Lilly und ihre Freunde haben sich in die verlassenen alten Minen unter dem Stadtgebiet zurückgezogen, wo sie zunächst in Sicherheit sind vor den Horden von Beißern, die oben durch die Straßen streifen. Doch Lilly gibt nicht auf, sie will ihr geliebtes Woodbury zurückerobern. Währenddessen entwickelt der psychotische Prediger Jeremiah, der mit seinen letzten drei Getreuen aus Woodbury fliehen musste, einen teuflischen Plan: Mit einer neuen Schar von Anhängern und einer neuen, grausigen Geheimwaffe, will er zum Schauplatz seiner Niederlage zurückkehren und an Lilly und den letzten Überlebenden von Woodbury tödliche Rache nehmen. Doch nicht einmal Jeremiah ahnt, welches Grauen er damit heraufbeschwört …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Von dem einst so malerischen Städtchen Woodbury sind nur noch rauchende Trümmer übrig geblieben. Lilly und ihre Freunde haben sich in die verlassenen alten Minen unter dem Stadtgebiet zurückgezogen, wo sie zunächst in Sicherheit sind vor den Horden von Beißern, die oben durch die Straßen streifen. Doch Lilly gibt nicht auf, sie will ihr geliebtes Woodbury zurückerobern. Währenddessen entwickelt der psychotische Prediger Jeremiah, der mit seinen letzten drei Getreuen aus Woodbury fliehen musste, einen teuflischen Plan: Mit einer neuen Schar von Anhängern und einer neuen, grausigen Geheimwaffe will er zum Schauplatz seiner Niederlage zurückkehren und an Lilly und den letzten Überlebenden von Woodbury tödliche Rache nehmen. Doch nicht einmal Jeremiah ahnt, welches Grauen er damit heraufbeschwört …
Die Autoren
Jay Bonansinga studierte Filmwissenschaften am Columbia College in Chicago und zählt heute zu den vielseitigsten Thriller- und Horrorautoren der Gegenwart. Gemeinsam mit The Walking Dead-Erfinder Robert Kirkman arbeitet er an den Romanen zur Erfolgsserie. Jay Bonansinga lebt mit seiner Familie in Evanston, Illinois.
Robert Kirkman ist der Schöpfer der mehrfach preisgekrönten und international erfolgreichen Comicserie The Walking Dead. Die gleichnamige TV-Serie wurde von ihm mit entwickelt und feierte weltweit Erfolge bei Kritikern und Genrefans gleichermaßen. Zusammen mit dem Krimiautor Jay Bonansinga hat er nun seinen ersten Roman aus der Welt von The Walking Dead veröffentlicht.
Mehr zu The Walking Dead und den Autoren auf:
diezukunft.de
Jay Bonansinga
Robert Kirkman’s
The Walking Dead 6
Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
THEWALKINGDEAD – INVASION
Deutsche Übersetzung von Wally AnkerDer Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Deutsche Erstausgabe 07/2016
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Copyright © 2015 by Robert Kirkman, LLC
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München978-3-641-18431-5www.diezukunft.de
Für James J. Wilson
Ein weiterer Draufgänger und Gefährte, der viel zu früh von uns gegangen ist
Teil 1
Das Gebaren der Schafe
Möge der Herr alle Tyrannen der Kirche vernichten. Amen.
Michael Servetus
Eins
Bitte, um Himmels willen, HÖRTFÜREINENAUGENBLICKMITDEMVERMALEDEITENGEZETERAUF!« Der große Mann hinter dem Lenkrad tut sein Bestes, um den verbeulten Escalade bei gleichbleibender Geschwindigkeit auf der Straße zu halten, ohne ihn auf einen mitten auf dem Asphalt querliegenden Laster zu lenken oder eine der vielen toten Gestalten zu überfahren, die an den Straßenrändern umherlaufen. Er ist heiser vor lauter Schreien, und es fühlt sich an, als ob jeder einzelne Muskel seines Körpers vor Anstrengung brennt. Seine Augen sind voller Blut von der Wunde, die offen über seiner linken Stirn klafft. »Ich habe bereits versprochen, dass wir euch bald schon medizinisch versorgen können, aber erst müssen wir diese verfluchte Herde hinter uns lassen!«
»Ich sag ja nur … Es sieht nicht gut aus, Pfarrer … Ich glaube, ich habe ein Loch in einem Lungenflügel!« Der junge Mann auf der Rückbank – einer von zwei Passagieren in dem SUV – lehnt den Kopf gegen die kaputte Scheibe, während das Auto erneut an einer Gruppe zerlumpter finsterer Gestalten am Straßenrand vorbeirast, die sich um etwas Dunkles, Feuchtes streitet.
Stephen Pembry wendet sich vom Fenster ab und presst vor Schmerzen die Augen zusammen, während er verzweifelt keucht und sich die Tränen aus dem Gesicht wischt. Ein Haufen blutbesudelter Kleider liegt neben ihm auf der Rückbank. Durch ein klaffendes, scharfkantiges Loch in der Scheibe bläst der Wind und spielt mit den Fetzen und seinen blutverschmierten Haaren. »… kann kaum noch atmen – … krieg keine Luft mehr in meine Lunge. Ich will nur sagen, dass ich aufgeschmissen bin, wenn wir nicht bald einen Arzt finden, Pfarrer.«
»Glaubst du etwa, mir ist das nicht klar?« Der hochgewachsene Geistliche packt das Lenkrad jetzt so fest, dass seine riesigen knochigen Hände aschfahl werden. Seine breiten Schultern – noch immer ummantelt von seiner schwarzen, kampferprobten Priesterkutte – lehnen sich gekrümmt über das Armaturenbrett, und das grüne Licht der Instrumente beleuchtet sein längliches, gefurchtes, markantes Gesicht. Er ähnelt einem in die Jahre gekommenen Revolverhelden mit all den Pocken und den vielen Falten, an denen man die harten, auf dem Rücken der Pferde verbrachten Zeiten ablesen kann. »Okay … Pass auf … Es tut mir leid, dass ich die Kontrolle verloren habe. Also, Bruder, wir haben beinahe die Staatsgrenze erreicht. Bald geht die Sonne auf, und wir werden Hilfe finden. Das verspreche ich dir. Reiß dich zusammen, wir schaffen das.«
»Je früher, desto besser, Pfarrer«, murmelt Stephen Pembry inmitten eines harten, stakkatoartigen Hustenanfalls. Er schlingt sich die Arme um den Bauch, als ob seine Eingeweide jeden Augenblick aus seinem Inneren herauszuquellen drohen. Er starrt auf die sich bewegenden Schatten hinter den Bäumen. Seitdem sie Woodbury verlassen haben, sind sie mindestens dreihundert Kilometer gefahren, aber selbst hier, in einer solchen Entfernung, wimmelt es noch immer von Streunern der Superherde.
Pfarrer Jeremiah Garlitz hebt den Kopf und blickt in den Rückspiegel, dessen Glas mit Sprüngen übersät ist. »Bruder Reese?« Er sucht die Schatten auf der Rückbank ab und mustert den jungen Mann um die zwanzig, der mit geschlossenen Augen gegen das andere kaputte Fenster lehnt. »Wie sieht es bei dir aus? Ist alles im Lot? Rede mit mir. Weilst du noch unter uns?«
Das jungenhafte Gesicht von Reese Lee Hawthorne wird für einen Augenblick sichtbar, als sie an einem entfernten Feuer vorbeifahren, dessen oranger Schein über seine Miene huscht – entweder ein Bauernhof, ein Wald oder eine kleine Gemeinde Überlebender, die komplett in Flammen aufgeht. Es handelt sich um eine Feuersbrunst, die sich über eineinhalb Kilometer erstreckt und Flocken weißer Asche in den Himmel spuckt. Kurz hat es den Anschein, als ob Reese das Bewusstsein verloren hat, schläft oder ohnmächtig geworden ist. Dann aber öffnet er die Augen und schüttelt sich auf seinem Sitz, als ob er einen Stromschlag bekommen hat. »Oh – Ich habe gerade – oh mein Gott … Das war vielleicht ein krasser Traum.« Er versucht sich zu orientieren. »Es geht mir gut, kein Problem … Es hat aufgehört zu bluten … Aber mein lieber Schwan, das war ein grässlicher Albtraum.«
»Rede nur weiter.«
Keine Antwort.
»Erzähle uns von deinem Traum.«
Noch immer keine Antwort.
Sie fahren eine Weile schweigend vor sich hin. Jeremiah kann durch die blutverschmierte Windschutzscheibe im Scheinwerferlicht die weißen Streifen erkennen, die an ihnen vorbeihuschen. Kilometer um Kilometer bringen sie auf dem pockennarbigen und mit Wracks übersäten Asphalt hinter sich. Es gleicht einer nicht enden wollenden Landschaft irgendwo in der Apokalypse, eine desolate Einöde landschaftlichen Zerfalls beinahe zwei Jahre nach Beginn der Seuche. Skelettartige Bäume, die in den brennenden feuchten Augen des Pfarrers schemenhaft verschwimmen, säumen den Highway auf beiden Seiten. Seine Rippen schmerzen bei jeder Bewegung seines Oberkörpers und rauben ihm den Atem – vielleicht nur ein Bruch, vielleicht aber auch Schlimmeres. Alles Wunden, die er in der stürmischen Auseinandersetzung zwischen seinen Gefolgsleuten und den Einwohnern Woodburys davongetragen hat.
Er geht davon aus, dass Lilly Caul und ihre Anhänger in demselben riesigen Heer aus Beißern untergegangen sind, das ein solches Chaos und eine solche Verwüstung über Woodbury gebracht hat, als es die Barrikaden überrannt, sämtliche Fahrzeuge umgeworfen, alle Häuser und Gebäude gestürmt, sowohl die Unschuldigen als auch die Bösen vernichtet und Jeremiahs Plan des glorreichen Rituals ruiniert hat. Hat der Herr etwa Anstoß an Jeremiahs fantastischem Plan genommen?
»Rede mit mir, Bruder Reese.« Jeremiah lächelt den abgezehrten jungen Mann im Rückspiegel an. »Warum erzählst du uns nicht von deinem Albtraum? Schließlich … hast du ein unfreiwilliges Publikum, das dir nicht entkommen kann. Also, schieß los.«
Aber die betretene Stille hält weiter an. Nur das Rauschen des Windes und das Fahrgeräusch der Reifen auf dem Asphalt bilden eine hypnotische musikalische Untermalung ihres Elends. Der junge Mann auf der Rückbank atmet einmal tief durch und beginnt endlich, seine Geschichte in einem sanften, aber doch rauen Tonfall zu erzählen: »Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt Sinn ergibt, aber wir waren in Woodbury und wollten gerade allem ein Ende setzen und zusammen wie geplant ins Paradies übergehen.«
Eine Pause.
»Ja …« Jeremiah nickt ihm ermunternd zu. Im Rückspiegel kann er sehen, wie Stephen sich bemüht, seine Wunden zu ignorieren, um seinem Kompagnon zuzuhören. »Mach ruhig weiter, Reese.«
Der junge Mann zuckt mit den Achseln. »Tja … Das war eben ein Traum, wie man ihn ab und zu hat. Ihr wisst schon … so real. Es war fast so, als ob ich die Hände ausstrecken und alles anfassen konnte. Wir waren in der Arena – und es war wirklich genau so wie letzte Nacht. Wir waren damit beschäftigt, uns auf das Ritual vorzubereiten.« Er senkt den Blick und schluckt, entweder vor Schmerz oder in Andacht an diesen erhabenen Moment – vielleicht aber auch aus einer Mischung beider Gründe.
»Anthony und ich haben gerade den heiligen Trunk durch einen der unzähligen Gänge getragen. Dann haben wir das Licht am Ende des Tunnels gesehen und konnten deine Stimme hören. Sie wurde immer lauter und erklärte, dass diese Gaben das Fleisch und Blut des einzigen Sohnes darstellten, geopfert, damit wir für immer in Frieden leben können … Und dann … Und dann … Wir gehen in die Arena, und du stehst am Pult, und alle unsere Brüder und Schwestern stehen in Reih und Glied vor dir, vor den Tribünen, und können es kaum erwarten, den heiligen Trunk zu sich zu nehmen, der uns alle ins Paradies schickt.«
Er hält einen Augenblick lang inne, um sich wieder zu fangen. Seine Augen glühen vor Furcht und Qual. Er holt erneut tief Luft.
Jeremiah lässt ihn im Rückspiegel nicht aus den Augen. »Erzähle weiter, mein Sohn.«
»Ab jetzt wird es ziemlich heikel.« Er schnieft und zuckt bei einem scharfen Schmerz in seiner Seite zusammen. Inmitten des Chaos von Woodburys Untergang wurde der Escalade umgeworfen, und seine Insassen mussten dabei erhebliche Wunden erleiden. Allein bei dieser Aktion wurde mehr als nur ein Rückenwirbel in Reeses Rückgrat ausgerenkt. Jetzt aber schluckt er den Schmerz wieder hinunter. »Einer nach dem anderen nimmt einen Schluck aus den Plastikbechern, was auch immer sich darin befand …«
»Willst du wissen, was ich glaube?«, unterbricht ihn Jeremiah mit verbitterter und betrübter Stimme. »Der alte Hinterwäldler Bob hat den Inhalt mit Wasser vertauscht. Wir können davon ausgehen, dass er jetzt den Rasen von unten wachsen sieht. Oder vielleicht hat er sich verwandelt, zusammen mit dem Rest der Bande – vor allem diese verlogene Schlange, diese Lilly Caul.« Jeremiah schnauft verächtlich. »Ich weiß, dass es nicht unbedingt sehr christlich von mir ist, wenn ich das sage, aber die haben wirklich ihre gerechte Strafe erhalten. Wichtigtuer … Feiglinge. Heiden, jeder einzelne von ihnen. Wir können alle drei Kreuze machen, dass dieser Unrat nicht mehr unter uns weilt.«
Eine weitere angespannte Pause folgt, ehe Reese mit schwacher, monotoner Stimme fortfährt: »Wie auch immer … Was als Nächstes passiert, im Traum, meine ich … Das kann ich kaum … Das war so fürchterlich, dass ich es kaum in Worte fassen kann.«
»Dann lass es sein«, meldet sich Stephen aus dem Schatten der Rückbank neben ihm zu Wort. Seine Haare flattern im Wind. In der Finsternis lassen ihn seine schmalen, einem Frettchen gleichenden und mit Blut und Gewebe verschmierten Gesichtszüge wie eine Figur aus einem Roman von Dickens aussehen – ganz wie ein Schornsteinfeger, den man zu lange im Schlot gelassen hat.
Jeremiah stöhnt. »Lass den jungen Mann sich doch seinen Kummer vom Leib reden, Stephen.«
»Ich weiß, dass es nur ein Traum war, aber das schien alles so echt«, erzählt Reese unbeirrt weiter. »Unsere Leute, von denen die meisten jetzt tot sind, haben alle einen Schluck genommen, und ich habe gesehen, wie ihre Gesichter dunkler werden, als ob man den Vorhang vor einem Fenster zuzieht. Sie schlossen die Augen, ließen die Köpfe hängen. Und dann … Und dann …« Er kann sich kaum dazu überwinden, es laut zu sagen. »Und dann haben sie sich … verwandelt.« Er kämpft gegen die Tränen an. »Einer nach dem anderen, all die feinen Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin … Wade, Colby, Emma, Bruder Joseph, die kleine Mary Jean … Sie öffneten die Augen, aber sie waren keine Menschen mehr … Sie waren Beißer. Ich habe ihre Augen im Traum genau gesehen … Sie waren weiß und milchig und haben geglänzt wie Fischaugen. Ich habe versucht, zu schreien, aber dann habe ich … Dann habe ich etwas anderes gesehen.«
Plötzlich verstummt er. Jeremiah blickt erneut in den Rückspiegel, aber es ist zu dunkel, um den Gesichtsausdruck des jungen Mannes ausmachen zu können. Jeremiah wirft einen Blick über die Schulter. »Alles okay?«
»Ja«, erwidert Reese nervös nickend.
Jeremiah dreht sich wieder Richtung Straße um. »Dann fahre fort. Erzähl uns, was du gesehen hast.«
»Ich glaube, dass ich das nicht möchte.«
Jeremiah stöhnt auf. »Mein Sohn, manchmal verschwindet das Böse einfach, wenn man darüber redet.«
»Da bin ich mir nicht so sicher.«
»Jetzt benimm dich nicht wie ein kleines Kind …«
»Pfarrer …«
»ERZÄHLUNSEINFACH, WASDUINDEINEMGOTTVERDAMMTENTRAUMGESEHENHAST!!« Jeremiah zuckt bei dem stechenden Schmerz zusammen, den sein Ausbruch in seiner Brust ausgelöst hat. Er fährt sich mit der Zunge über die Lippen und holt tief Luft.
Reese Lee Hawthorne zittert währenddessen auf der Rückbank und wischt sich nervös den Mund ab. Er will einen Blick mit Stephen austauschen. Der aber wendet sich ab, senkt den Kopf zu Boden und schweigt. Reese wendet sich wieder von ihm ab und starrt auf den Hinterkopf des Pfarrers. »Es tut mir leid, Pfarrer. Es tut mir wirklich leid.« Er schnappt nach Luft. »Was ich in dem Traum gesehen habe, das warst du … Ich habe dich in dem Traum gesehen.«
»Du hast mich gesehen?«
»Genau.«
»Und …?«
»Du warst anders.«
»Anders? Soll das heißen, dass auch ich mich verwandelt habe?«
»Nein, Sir, nicht verwandelt … Du warst einfach … anders.«
Jeremiah kaut auf seiner Backe und lässt sich das Gesagte durch den Kopf gehen, während er weiterfährt. »Wie anders?«
»Es ist schwer zu beschreiben, aber du warst kein Mensch mehr. Dein Gesicht … Dein Gesicht hat sich verändert … Es ist zu einem … Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.«
»Einfach raus damit, mein Sohn.«
»Ich weiß nicht …«
»Es war doch nichts weiter als ein wirrer Traum, Reese. Ich werde es dir schon nicht übel nehmen.«
Nach einer langen Pause meint Reese endlich: »Du warst eine Ziege.«
Jeremiah verschlägt es die Sprache. Stephen Pembry setzt sich auf und blickt nervös um sich. Jeremiah atmet schwer aus, teils ein Kichern, teils ein fassungsloses Grunzen, aber ihm fehlen jegliche Worte.
»Oder vielmehr ein Ziegen-Mann«, fährt Reese fort. »So etwas in der Art. Pfarrer, das war aber nur ein irrer Fiebertraum, der absolut nichts zu bedeuten hat!«
Jeremiah wirft erneut einen Blick in den Rückspiegel auf die Bank hinter sich und sieht Reeses in Schatten getauchtes Gesicht.
Reese zuckt unbehaglich mit den Schultern. »Aber wenn ich es mir recht überlege, glaube ich gar nicht, dass du es warst … Ich glaube, das war der Teufel. Nur eines weiß ich – es war auf keinen Fall ein Mensch … Das war der Teufel in meinem Traum. Halb Mensch, halb Ziege … Und er hatte große geschwungene Hörner und gelbe Augen. Und als ich ihn in meinem Traum sah, da wusste ich sofort …«
Reese hält mitten im Satz inne.
Jeremiah starrt in den Rückspiegel. »Was hast du sofort gewusst?«
Reese antwortet sehr leise: »Ich wusste, dass der Satan von nun an das Sagen hat.« Seine kratzende Stimme, durchdrungen von Furcht, ist kaum noch hörbar. »Und wir waren in der Hölle.« Er zuckt zusammen. »Ich wusste, dass wir im Jenseits waren, im Jenseits sind.« Er schließt die Augen. »Das hier ist die Hölle, und niemand hat gemerkt, wie wir dorthin gekommen sind.«
Auf der Rückbank ihm gegenüber wappnet sich Stephen Pembry und wartet auf die unvermeidliche Reaktion des Mannes hinter dem Lenkrad, hört aber lediglich eine Reihe leiser, gehauchter Geräusche vom Fahrersitz zu ihm nach hinten dringen. Anfangs glaubt Stephen, dass der Geistige hyperventiliert. Oder vielleicht erleidet er einen Herzstillstand, hat einen Anfall. Stephen fährt es eiskalt den Nacken und seine Glieder hinab, und die kalte Furcht schnürt ihm den Hals zu, als er merkt, dass die merkwürdigen Geräusche die Vorboten eines Lachanfalls sind.
Jeremiah lacht.
Plötzlich wirft der Pfarrer den Kopf nach hinten und stößt ein Glucksen aus, das sich zu einem wiehernden Gelächter entwickelt, was die beiden jungen Männer völlig aus der Fassung bringt. Und der Pfarrer lacht weiter, brüllt immer lauter. Jetzt schüttelt er vor lauter Heiterkeit den Kopf, schlägt die Hände auf das Lenkrad, johlt und gackert und schnaubt, als ob er soeben den lustigsten Witz der Welt gehört hat. Gerade beugt er sich nach vorne und droht vor lauter Hysterie die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren, als er ein Geräusch hört und sich wieder aufrichtet.
Die beiden Männer auf der Rückbank stoßen einen Schrei aus, als die Scheinwerfer des Escalade ein Bataillon zerlumpter Gestalten erhellt, das direkt vor ihnen steht.
Jeremiah reißt am Steuer, aber sie sind viel zu schnell unterwegs, um der Phalanx vor ihnen ausweichen zu können.
Jeder, der schon einmal einen Beißer über den Haufen gefahren hat, wird einem erzählen, dass die Geräusche das mit Abstand Schlimmste sind. Es ist zweifelsfrei nicht leicht, solch ein horrendes Schauspiel mitzumachen, und der Gestank, der sich in jeder Ritze des Autos festsetzt, ist beinahe unerträglich. Und doch sind es die Geräusche, die einen danach Tag und Nacht verfolgen. Sie bestehen aus einem nicht enden wollenden schmierigen Knirschen und erinnern an das dumpfe Aufprallen einer Axt auf verfaultes, von Termiten zerfressenes Holz. Die grässliche Symphonie hört damit aber nicht auf, denn die Untoten werden danach unter den Reifen zu einer Paste zermalmt – eine rasche Serie dumpfer Knall- und Platzgeräusche, die von den zerquetschten Organen, Blasen, Knochen und Schädeln stammen, die der flachen Straße gleichgemacht werden und die qualvolle Reise eines jeden Monsters zu einem jähen Ende bringen.
Und es sind genau diese fürchterlichen Geräusche, die die beiden jungen Männer auf der Rückbank des mitgenommenen Cadillac Escalade jetzt zu hören kriegen.
Sowohl Stephen Pembry als auch Reese Lee Hawthorne stoßen vor Ekel und Grauen Schreie aus, krallen sich an den Vordersitzen fest, als ob ihr Leben daran hängt, während der SUV holpert und stolpert und auf den schleimigen Überresten der Beißer ins Schleudern kommt. Die meisten der nichtsahnenden Kadaver werden von dem Wagen erfasst, fallen wie eine Reihe Dominosteine zu Boden und lösen sich unter dem drei Tonnen schweren Metallboliden aus Detroit in Luft auf. Einige Fleischfetzen und durch die Gegend geschleuderte Extremitäten landen auf der Kühlerhaube und hinterlassen grässliche ranzige Spuren aus Blut und anderen Körperflüssigkeiten auf der Windschutzscheibe, während andere Körperteile in hohem Bogen durch die Luft fliegen.
Der Pfarrer zeigt sich gefasst, ist die ganze Zeit über das Lenkrad gebeugt und starrt mit entschlossener, konzentrierter Miene auf die Straße. Seine muskulösen Arme halten das zappelnde Steuer, wann immer die Hinterräder wegzurutschen drohen. Der Motor heult in Protest gegen den plötzlichen Traktionsverlust laut auf, und das Quietschen der riesigen Stahlgürtelreifen vervollständigt das Getöse. Jeremiah reißt am Lenkrad und steuert so gut er kann dagegen, um nicht die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren, als er plötzlich bemerkt, dass etwas in dem großen Loch in der Scheibe der Fahrertür steckt.
Der abgetrennte Kopf eines Beißers befindet sich nur wenige Zentimeter von seinem linken Ohr entfernt. Der Kiefer arbeitet trotz des steifen Grinsens, das er aufgesetzt hat, weiter. Der Schädel hat sich in den scharfen Zacken der Scheibe verfangen, und kaum haben die milchig weißen Augen den Pfarrer wahrgenommen, beginnen die schwarzen Schneidezähne nach dem Geistlichen zu schnappen. Der Anblick allein ist so entsetzlich, so schrecklich und so surreal – der knarzende Kiefer versucht den Pfarrer mit der hohlen, scheinbar autonomen Kraft einer Bauchrednerpuppe zwischen die Zähne zu kriegen –, dass Jeremiah unfreiwillig ein weiteres Glucksen ausstößt. Es hört sich wieder wie ein Anflug seines vorherigen Lachanfalls an, ist aber dunkler, wütender, bissiger, und der Wahnsinn klingt bedrohlich in seiner Stimme mit.
Er zuckt zurück und realisiert im Handumdrehen, dass der reanimierte Schädel durch den Aufprall des SUVs vom restlichen Körper abgerissen wurde. Jetzt, noch immer unversehrt, fährt er fort, nach lebendigem Fleisch zu suchen, immer weiter zu jagen, immer weiter zu kauen und zu fressen und doch nie genug zwischen die fletschenden Zähne zu bekommen.
»AUFGEPASST!!«
Der Schrei entfährt den flackernden Schatten des Wagenfonds, und in der Aufregung kann Jeremiah nicht ausmachen, wer ihn ausgestoßen hat – war es Stephen oder Reese? Aber die Frage ist rein akademisch, denn der Pfarrer versteht den Grund für den Schrei völlig falsch. In dem Bruchteil einer Sekunde, in der sich seine Hand durch den Haufen an Sachen wühlt, die auf dem Beifahrersitz liegen – Landkarten, leere Verpackungen von Süßigkeiten, ein Stück Seil und diverse Werkzeuge, während er verzweifelt nach der 9 mm-Glock sucht –, glaubt er, dass der Schrei ihn vor dem Maul des amputierten Schädels warnen soll, der nur wenige Zentimeter von ihm entfernt nach ihm schnappt. Endlich spürt er den Griff der Glock, ergreift die Waffe und richtet den Lauf mit einer fließenden Bewegung Richtung Fenster. Er drückt ab, und die Kugel trifft den grotesken, aufgespießten Schädel aus nächster Nähe zwischen die Augenbrauen. Der Kopf zerplatzt in einem feinen rosaroten Nebel und spaltet sich wie eine Melone in zwei Hälften. Gewebefetzen landen in Jeremiahs Haar, ehe der Wind sie fortwehen kann. In dem Raum, der gerade noch von dem Schädel ausgefüllt wurde, entsteht ein Vakuum, das sich mit einem lauten Knall auflöst.
Es sind nicht einmal zehn Sekunden vergangen, seitdem sie den ersten Beißer umgefahren haben, aber jetzt bemerkt Jeremiah den wahren Grund für den Warnschrei von der Rückbank. Es hat nichts mit dem abgetrennten Schädel zu tun, nein. Der wahre Grund, warum Jeremiah hätte aufpassen sollen, erscheint jetzt auf der anderen Fahrspur des Highways zu ihrer Rechten. Er wird rasch größer, und sie schlingern auf den feuchten Überresten der Untoten darauf zu.
Jeremiah dreht erneut hektisch am Steuer, um zu spüren, wie der Wagen reagiert und an den Überresten des Wracks eines VW Käfers vorbeizukommen. Sie rutschen auf dem Schotter der Standspur und stürzen dann die steile Böschung hinab. Das finstere Unbekannte eines kleinen Waldes kommt ihnen rasch näher. Äste und Gebüsch kratzen und schlagen auf die Windschutzscheibe ein, während der Wagen die steinige Böschung hinuntergleitet. Die Stimmen auf der Rückbank erheben sich zu einer panischen Kakophonie.
Endlich spürt Jeremiah, dass die Böschung flacher wird. Er behält lange genug Kontrolle über den SUV, bis die Reifen im Waldboden Halt finden, und gibt dann Vollgas, sodass der Wagen aus eigener Kraft nach vorne schießt.
Der riesige Kühlergrill und die Reifen kämpfen sich mit ungeheurer Leichtigkeit durch das Gebüsch, hüpfen über umgefallene Baumstämme und preschen durch das Gestrüpp, als ob es nicht vorhanden wäre. Der Höllenritt scheint unendlich lange zu dauern, und die Erschütterungen drohen Jeremiahs Rückgrat zu stauchen und seine Milz zerplatzen zu lassen. In dem verschwommen Bild im Rückspiegel kann er gerade noch die beiden jungen Männer sehen, wie sie verzweifelt versuchen, sich festzukrallen, um nicht aus dem hin und her schaukelnden Auto geschleudert zu werden. Plötzlich erwischt Jeremiah einen Baumstamm, und der seitliche Aufprall lässt seine Backenzähne beinahe zu Staub zerbröseln.
Aber er fängt den Wagen wieder, und sie rasen für eine weitere Minute quer durch den Wald.
Als sie endlich in einer Explosion aus Erde, Laub und sonstigem Gestrüpp aus den Bäumen schießen, schaut Jeremiah sich um und sieht, dass sie auf einer zweispurigen Straße gelandet sind. Er steigt in die Eisen, sodass die Köpfe der beiden Männer auf der Rückbank hart gegen die Vordersitze schlagen.
Jeremiah starrt eine Weile lang vor sich hin und atmet tief ein, um wieder Luft in seine Lungen zu saugen. Dann blickt er sich um. Die Männer auf der Rückbank stöhnen, rücken sich wieder zurecht und halten sich vor Schmerzen die Wunden. Der Motor tuckert im Leerlauf vor sich hin und wird von einem Rattern begleitet – wahrscheinlich ein Kugellager, das von der vielen Rüttelei während ihrer improvisierten Off-Road-Safari seinen Geist aufgegeben hat.
»Tja«, meint der Pfarrer leise. »So kann man auch eine Abkürzung nehmen.«
Er erhält keine Antwort. Sein humorvoller Beitrag scheint seinen beiden Jüngern überhaupt nicht aufgefallen zu sein.
Über ihren Köpfen erhellt sich der schwarze, undurchdringliche Himmel durch ein sanftes Schimmern des bevorstehenden Morgengrauens. In dem dumpfen phosphoreszierenden Licht kann Jeremiah ausmachen, dass sie auf einer Zubringerstraße gelandet sind. Der Wald hat einem Sumpfgebiet Platz gemacht. Im Osten führt eine Straße über ein bräunlich trübes Gewässer, von dem Nebelschwaden aufsteigen – wahrscheinlich der Rand des Okefenokee-Sumpfs –, und im Westen steht ein rostiges Schild mit der Aufschrift »State Road 441 – 5Km«. Zumindest sind weit und breit keine Beißer zu sehen.
»Wenn man von dem Schild ausgeht«, fährt Jeremiah fort, »scheinen wir gerade die Grenze nach Florida überquert zu haben.«
Er legt einen Gang ein, macht vorsichtig eine Kehrtwende und fährt dann gen Westen. Sein ursprünglicher Plan, Zuflucht in einer der größeren Städte wie Lake City oder Gainesville entlang dem Zitrusfrüchte-Anbaugebiet im Norden Floridas zu finden, scheint noch immer im Bereich des Möglichen zu liegen, auch wenn der Motor jetzt die merkwürdigsten Geräusche von sich gibt. Irgendetwas ist bei ihrem Ritt durch die Wildnis in die Brüche gegangen – eine Tatsache, die Jeremiah ungemein beunruhigt. Sie sollten zeitnah irgendwo anhalten, sodass er den Wagen genauer unter die Lupe nehmen kann. Außerdem müssen ihre Wunden versorgt werden, und mit etwas Glück stolpern sie vielleicht auch über Proviant und ein wenig Treibstoff.
»Hey! Schaut doch mal, dort drüben!«, meldet sich Reese von hinten zu Wort und deutet Richtung Südwesten. »Dort, hinter dem Grundstück.«
Jeremiah fährt weitere hundert Meter, ehe er den Wagen auf dem Kies am Straßenrand anhält. Er schaltet den Motor ab, sodass plötzlich völlige Stille herrscht. Es fällt kein Wort; alle starren lediglich auf das Schild in geringer Entfernung vor ihnen. Es ist eines dieser billigen, halb durchsichtigen Konstruktionen aus weißem Fiberglas auf Rädern mit großen austauschbaren Buchstaben. Es gibt unzählige davon auf dem Land, und sie müssen für restlos alles, von Flohmärkten bis hin zu religiösen Veranstaltungen, herhalten. Auf diesem steht geschrieben:
C-A-L-V-A-R-Y B-A-P-T-I-S-T C-H-U-R-C-H
A-L-L-E W-I-L- -K-O-M-M-E-N
S-O-N-N-T-A-G 9-&-11
Die Straße ist von dürren Zypressen und vielen Kiefern gesäumt, aber durch eine Lücke sieht Jeremiah den weißen Kiesel des verwaisten Parkplatzes. Er ist lang und schmal und endet vor einem in sich zusammengefallenen Fachwerkgebäude. Die kaputten Buntglasfenster sind hier und da mit Brettern und Dielen verschlagen. Der Kirchturm ist auf einer Seite eingefallen und versengt, und es hat den Anschein, als ob er einem Luftangriff zum Opfer gefallen ist. Jeremiah starrt auf das Gebäude. Das riesige stählerne Kreuz auf dem Kirchturm – es ist völlig verrostet – wird nur noch von einigen lockeren Schrauben an Ort und Stelle gehalten.
Es hängt kopfüber herab und droht jeden Augenblick zu Boden zu stürzen.
Jeremiah starrt weiter andächtig auf das kaputte, verkehrt herabhängende Kruzifix – ein Zeichen des Teufels –, aber die Symbolik des auf den Kopf gestellten Kreuzes ist für ihn nichts weiter als der Anfang. Jeremiah ist sich nämlich bewusst, dass dies ein Zeichen sein kann, dass sie zurückgelassen wurden, dass sie sich bereits in der Entrückung befinden und das hier die Vorhölle ist. Ab jetzt müssen sie mit den Umständen fertigwerden, wie Hunde auf einem Müllplatz oder Ratten auf einem sinkenden Schiff. Sie müssen zerstören, oder sie werden zerstört.
»Kann mir jemand sagen …«, beginnt Jeremiah endlich beinahe flüsternd, ohne das Gebäude in der Ferne aus den Augen zu lassen. Eines der Fenster weiter hinten schimmert gelb, und aus dem Schornstein steigt ein dünner Rauchschleier in den heller werdenden Himmel. »Wie viel Munition haben wir aus Woodbury mitgenommen?«
Die beiden jungen Männer auf der Rückbank tauschen einen raschen Blick aus.
»Ich habe eines dieser Magazine mit dreiunddreißig Kugeln für die Glock und eine Schachtel mit zwei Dutzend .380er für die andere Pistole. Mehr ging nicht«, antwortet Reese.
»Immerhin mehr als ich«, murrt Stephen. »Ich habe nur das dabei, was schon in der Mossberg steckte – vielleicht noch acht Patronen, vielleicht aber auch nur sechs.«
Jeremiah schnappt sich die Glock vom Beifahrersitz und überlegt, wie oft er damit seit ihrer Flucht aus Woodbury geschossen hat – es sollten noch sechs Kugeln im Magazin sein. »Nun gut, Gentlemen … Ich will, dass ihr alles mitnehmt, die ganze Ausrüstung. Voll geladen, versteht sich.« Er öffnet die Tür. »Und beeilt euch.«
Die beiden Männer steigen aus dem SUV und stellen sich neben dem Pfarrer im goldenen Licht der Morgendämmerung auf. Irgendetwas stimmt hier nicht. Reese spürt, wie seine Hände zittern, als er ein neues Magazin in den Griff seiner Pistole steckt. »Pfarrer, ich verstehe das nicht ganz«, gibt er endlich zu. »Warum bewaffnen wir uns bis an die Zähne? Ich bezweifele, dass wir in der Kirche irgendetwas finden, außer mit etwas Glück vielleicht ein paar Überlebende. Was also soll das?«
Der Geistliche aber hat sich bereits auf den Weg in Richtung des Gotteshauses gemacht. In seiner riesigen Hand hält er die Glock feierlich wie einen Blumenstrauß als Willkommensgeschenk. »Wir befinden uns in der Entrückung, Jungs«, murmelt er beiläufig, als ob er den heutigen Tag beiläufig als einen neuen Feiertag ausruft. »Heutzutage gibt es so etwas wie eine ›Kirche‹ nicht mehr. Heutzutage kann sich jeder holen, was er will.«
Die beiden Männer tauschen erneut einen Blick aus, ehe beide dem Pfarrer hinterhereilen.
Zwei
Sie nähern sich dem Gebäude von hinten an und schleichen durch eine Ansammlung erbärmlicher Eukalyptusbäume, die am Rande des Kirchengrundstücks gepflanzt sind. Jeremiah kann den ihm wohlbekannten penetranten Gestank von Menthol und Ammoniak riechen, der in der Luft liegt, während er über den mit Unkraut überwucherten Kies geht. Er bemüht sich, mit seinen großen schweren Gummistiefeln so leise wie nur möglich zu sein. Mittlerweile ist die Morgendämmerung angebrochen, sodass das Licht hinter dem einen Kirchenfenster nicht mehr zu erkennen ist. Außerdem hat sich das Zirpen der Zikaden wieder gelegt, sodass sich die Stille wie ein Sargtuch über die Landschaft gelegt hat und Jeremiah das Schlagen seines eigenen Herzens hören kann.
Er hält hinter einem Baum keine zwanzig Meter vor dem Fenster inne.
Hastig bedeutet er den beiden anderen, die sich hinter einer Eiche versteckt halten, zu ihm zu kommen. Stephen humpelt hinter dem Baum hervor und hält das Jagdgewehr mit Pistolengriff gegen seinen Solarplexus, als ob es sich um eine rudimentäre Bandage handelt. Hinter ihm erscheint Reese. Er hat die Augen weit aufgerissen, ist nervös und zuckt bei jedem Schritt vor Schmerz zusammen. Jeremiah schaut sie an und weiß, dass es sich bei ihnen nicht um die Crème de la Crème der neuen Überlebenden handelt. Auch sind sie nicht die besten Jünger, die ein großer spiritueller Anführer wie er sich wünschen kann, aber vielleicht sollte er sie in dem Licht sehen, wie sie wirklich sind: Ton, den man angesichts dieser neuen Welt, dieser Hölle auf Erden leicht umformen kann. Wie Jeremiahs Vater immer zu sagen pflegte, indem er 1. Thessalonicher 5 zitierte: »… denn ihr selbst wisset genau, daß der Tag des HERRN wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleichwie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen.«
Jeremiah gibt ihnen ein weiteres Zeichen und deutet mit dem Zeigefinger mehrmals auf den hinteren Teil des Gebäudes.
Einer nach dem anderen nähern sich die Männer einem kleinen Anbau aus Holz – ihnen voran Jeremiah, die Pistole in beiden Händen und auf den Boden gerichtet. Mit jedem Schritt kriecht die Sonne ein Stück weiter über den Horizont, und sie merken, dass etwas im Argen liegt. Die Fenster im Rückgebäude – vielleicht das Pfarramt, das einmal dem Pfarrer gedient hat – sind mit Aluminiumfolie verhüllt. Das Fliegengitter ist aus den Angeln gerissen und die Tür dahinter kreuzweise mit Brettern verschlagen. Der Gestank von Beißern erfüllt die Luft und wird immer stärker, je näher sie kommen.
Jeremiah erreicht das Gebäude als Erster. Er stellt sich mit dem Rücken gegen die Tür und legt einen Finger an die Lippen, um den anderen zu bedeuten, dass sie keinen Ton von sich geben sollen.
Sie treten so leise wie möglich an ihn heran und vermeiden, auf den Müll und das trockene Laub zu steigen, mit dem der frühmorgendliche Wind spielt. Die beiden stellen sich mit gezückten Waffen neben dem Geistlichen auf, einer links, der andere rechts von ihm. Der Pfarrer beugt sich hinab, steckt die Hand in einen seiner verschrammten Gummistiefel und holt ein dreißig Zentimeter langes Randall-Messer hervor. Vorsichtig schiebt er die Klinge unter eines der Bretter in der Nähe des Schlosses und zieht dann ruckartig am Griff.
Die Tür zeigt sich widerspenstig. Jeremiah versucht erneut, das Brett herauszuhebeln, und er ist dabei lauter, als ihm wohl ist, hat aber keine andere Wahl. Ein Fenster einzuschlagen und einzusteigen würde nur noch mehr Aufsehen erregen. Die Nägel geben ein wenig nach, doch das knarzende, rostige Geräusch der Metallstifte scheint in der stillen Morgenluft noch lauter. Er hat keine Ahnung, was sie im Inneren des Gebäudes erwartet, aber er ist sich recht sicher, dass sich sowohl Menschen als auch Beißer dort drinnen befinden.
Beißer machen kein Feuer, und der normale Überlebende mit Zugang zu Wasser und Seife riecht nicht nach aufgewärmtem Tod.
Endlich gibt die Tür nach, und die beiden jungen Männer drängen sich mit erhobenen Waffen um den Pfarrer.
Einer nach dem anderen gehen sie hinein.
Sie befinden sich in einem leeren Raum, der von trübem gelben Licht erhellt wird und nach abgestandenem Rauch und altem Schweiß riecht. Jeremiah durchquert langsam das Zimmer. Die Holzdielen knarzen unter seinen schweren Stiefeln. Er bemerkt einen kleinen Kanonenofen, in dem verglimmende Asche liegt und der noch immer leichte Hitze ausstrahlt. Davor liegt ein geflochtener, mit altem Blut besudelter Teppichläufer auf dem Boden. In einer Ecke steht ein Zustellbett. Die Arbeitsplatte des Rollschreibtischs ist von alten Teebeuteln, Geschirr mit abgeplatzten Rändern, Verpackungen von Süßigkeiten, Klatschmagazinen und zerknautschten Zigarettenschachteln übersät.
Er geht zum Schreibtisch und mustert die Spielkarten, die in einer typischen Patience-Auslage darauf aufgedeckt sind. Es scheint ganz so, als ob jemand – höchstwahrscheinlich eine einzelne Person – den Raum vor Kurzem hastig verlassen hat. Ein Geräusch hinter einer der Türen erregt plötzlich seine Aufmerksamkeit. Er dreht sich in Windeseile herum. Reese und Stephen stehen beide auf der anderen Seite des Zimmers und blicken ihren Anführer verlegen an.
Jeremiah hebt erneut den Zeigefinger und legt ihn an die Lippen, um sie anzuweisen, keinen Mucks zu machen.
Die beiden Männer warten bei der Tür. Ihre Augen glühen förmlich vor nervöser Anspannung. Auf der anderen Seite des Türblatts hören sie jetzt ein Schlurfen, das immer lauter wird – ein sicheres Zeichen für das schleppende Hinterherziehen ungelenker Füße. Außerdem werden der Verwesungsgestank sowie der penetrante Geruch nach Methangas immer stärker. Jeremiah erkennt die Geräusche wie auch die Gerüche und liest sie wie ein Buch: es handelt sich um Beißer, die in einem Raum gefangen sind. Er dreht sich zu Stephen um, der das Gewehr in den Händen hält.
Einige wenige lautlose Gesten später versteht Stephen, dass er auf das Schloss zielen soll. Reese wird ihm als Rückendeckung zur Seite stehen. Keiner der beiden jungen Männer ist besonders angetan von dem Plan. Stephens Gesicht ist aschfahl, während Reese in Schweiß zu schwimmen scheint. Zudem haben beide schlimme Verletzungen davongetragen und leiden höchstwahrscheinlich unter inneren Blutungen. Sie scheinen nicht erfreut über die Aussicht, gegen eine unbestimmte Anzahl Beißer kämpfen zu müssen. Aber Jeremiah ist ein Anführer mit unwiderstehlichem Durchsetzungsvermögen, und allein der Blick in seinen Augen reicht, um erst gar keine Gegenwehr aufkommen zu lassen. Er hält drei Finger in die Luft und zählt sie dann ab.
Drei, zwei …
Eine blasse blaue Hand voller Schimmel erscheint plötzlich durch eine Schwachstelle im Holz.
Nichts scheint sich in Wirklichkeit so abzuspielen, wie Stephen Pembry es sich vorstellt. Als kränkelnder, dürrer Junge wuchs er in Macon, Georgia auf und führte das Leben eines unbeholfenen Tagträumers. Ständig stellte er sich seine heroischen Taten vor, wie er sich gegen Tyrannen wehrte, holde Maiden vor bösen Buben rettete und auch sonst ein tadelloses Leben führte, aber die Realität auf dem Spielplatz konnte solchen Illusionen rasch einen Riegel vorschieben, und viele Veilchen später wandte Stephen sich an Gott und an Muskeltraining, um seine Widerstandskraft gegenüber der realen Welt zu stählen. Er würde zwar nie ein Supermann werden, aber zumindest war er in der Lage, sich gegen seine Widersacher zu wehren.
Leider aber hat der Teufel die Gewohnheit, einem Hürden in den Weg zu werfen, und seit dem Tag, an dem die Seuche ausbrach, ist jeder Plan, jede Aktion Stephen Pembrys vereitelt worden. Wie zum Beispiel, als er für den Tod einer Frau in Augusta verantwortlich war oder das frische Magazin fallen ließ und es im Gulli verschwand – eine Tatsache, die ihm über Tage hinweg Schelte von Bruder Jeremiah einbrachte. Selbst jetzt glaubt Stephen, dass seine Umwelt ihm stets einen Schritt voraus ist.
Er stolpert über seine eigenen Füße, die rasch den Rücktritt antreten wollen, und fällt hin. Die Schmerzen in seinen Rippen schießen durch seinen Körper. Die Mossberg fliegt ihm aus der Hand. Im selben Augenblick bohrt sich ein weiteres Paar Hände durch die marode Tür, und Jeremiah zieht etwas aus seinen Stiefeln hervor. Stephen sieht, wie die schimmernde Klinge eines Messers durch die Luft schwebt. Selbst ein Metzger, der eine widerspenstige Schweinshaxe filetiert, hätte die grauen Extremitäten nicht schneller und entschiedener amputieren können. Jeremiah fährt mit der Klinge durch Gewebe und Knorpelmasse, bis er am Knochen ankommt, den er einfach durchsägt.
Hände fallen zu Boden wie Heckenschnitt.
Stephen kann die Augen nicht abwenden. Er versucht, sich aufzurichten. Seine Kehle schnürt sich zusammen, beginnt zu brennen und droht, den kaum vorhandenen Inhalt seines Magens auszuwerfen. Jetzt geschieht alles ganz schnell. Reanimierte Hände zappeln um Stephen wie frisch gefangene Fische auf einem Kutter. Nur langsam kommen sie zur Ruhe, als die elektrischen Impulse des reanimierten Nervensystems erschöpft sind. Stephen kann nicht mehr klar sehen, alles ist verschwommen, die Gedanken zischen in seinem Kopf hin und her, und ein Schwindelanfall ergreift ihn, als seine punktierte Lunge versucht, nach Luft zu schnappen.
Jeremiah hat bereits das auf dem Boden liegende Gewehr aufgelesen und befördert die Patronen mit einem einzigen Zucken seines Armes in den Lauf, während er sich wieder der Tür zudreht. Stephen schafft es, sich aufzuraffen, und kickt die schauderhaften Hände aus dem Weg. Jeremiah tritt mit seinen Stiefeln gegen die Tür, die in sich zusammenfällt und die Sicht in das dunkle Innere des Kirchenschiffs freigibt.
Stephen kann gerade noch einen Blick des Altarraums erhaschen, ehe der erste Schuss das Bild zerstört.
Was früher einmal ein malerisches Kirchenschiff mit polierten Kirchenbänken aus Holz, weinrotem Teppich und bemalten Fenstern war, welche die Geschichte der Wiederauferstehung abbildeten, gleicht jetzt einem Schlachthaus direkt aus dem Fegefeuer. Dutzende von Beißern, vielleicht sogar vierzig oder fünfzig, sind mit diversen Seilen und Kabeln an die Kirchenbänke gefesselt. Sie reagieren auf das Licht, das durch die aufgebrochene Tür hineinströmt. Es scheint, als hätte Jeremiah einen Stein umgedreht, unter dem allerlei Ungeziefer umherkriecht.
Leblose Gesichter drehen sich nach dem Geräusch um. Ihre metallenen Augen reflektieren die Bewegung von der anderen Seite des Kirchenschiffs. Die meisten Gemeindemitglieder tragen ihr Sonntagsgewand – Anzüge von der Stange und billigste Sommerkleider, ausgefallene Hüte und verwelkte Ansteckbuketts. Allein der Anblick ihrer feierlich anmutenden Kleidung schnürt Stephens Herz zusammen. Die meisten Untoten scheinen afroamerikanischer Abstammung zu sein, aber die Leichenblässe und graue Totenstarre lassen sie alle gleich aussehen und verdecken zum größten Teil ihre ethnische Herkunft. Das Merkwürdigste jedoch ist, wie Stephen in dem Sekundenbruchteil vor dem Schuss registriert, dass sich jemand um diese reanimierten Kreaturen zu sorgen scheint.
Gesangbücher mit aufgebrochenen Buchrücken liegen zerfleddert vor jedem untoten Gefangenen wie tote Vögel. Einzelne Happen – entweder überfahrene Tiere oder nicht identifizierbare menschliche Überreste – warten neben jedem Geschöpf auf Verzehr. Der Altarraum ist mit Kerzen erleuchtet, die auf Ständern um den bescheidenen kleinen Altar brennen. Aus dem Nichts ertönt das Summen eines angeschalteten Mikrofons, und die Luft stinkt nach verfaulter Jauche, gemischt mit beißendem Desinfektionsmittel.
Es erweckt den Anschein, als ob jemand vergeblich versucht, die täglichen Gottesdienste weiterzuführen.
Stephen erhascht noch einen letzten Blick von Jeremiah, ehe der Schuss ihm die Sinne raubt. Das Angesicht des Pfarrers ist furchterregend: eine Mischung aus Schmerz, Wut, Verlust, Wahnsinn und Bedauern – das Gesicht eines Mannes, der sich dem gnadenlosen Abgrund gegenübergestellt sieht. Und dann beginnt der Kugelhagel.
Der erste Schuss ertönt wie eine Explosion und streckt den Beißer, der ihnen am nächsten steht, in einer Wolke aus Gehirngewebe nieder. Die Kugel bohrt sich durch den Schädel und reißt ein Stück aus dem Sturz über der Tür. Drei darauffolgende Schüsse ertönen in der flackernden Dunkelheit, sodass Stephens Ohren klingeln. Sie erlegen drei weitere Kreaturen, die sich anscheinend von ihren Fesseln befreit haben. Das von Schmerz gepeinigte Gesicht des Geistlichen ist mit Schlieren von Schießpulver bedeckt, und er drängt tiefer in das Kirchenschiff vor und nimmt sich die anderen Beißer vor.
Es dauert nicht länger als ein paar Minuten – die Luft leuchtet auf, als ob Tausende von Feuerwerkskörpern abbrennen. Jeremiah schreitet rasch von einer Kirchenbank zur anderen und lässt entweder die Schädel mit Kugeln zerplatzen oder rammt sein Messer durch verrottete Nebenhöhlen, ehe die Gemeindemitglieder eine Chance haben, auch nur ein einziges Mal nach ihm zu schnappen. Stephen taumelt Richtung Tür, um das Schauspiel besser beobachten zu können. Dann bemerkt er Reese wenige Meter hinter sich im Altarraum; er kniet auf dem Boden und sieht mit weit geöffnetem Mund auf das fürchterliche Geschehen.
Jeremiah trägt eine grauenerregende Miene zur Schau, als er die letzten der Monster mit harten, raschen Messerstichen zur Strecke bringt. Die Mossberg ist leergeschossen. Acht Schrotspuren bedecken die Wände hinter dampfenden Haufen verfaulten Fleisches. Der Geistliche ist von oben bis unten mit schmierigem Blut besudelt, und seine Augen leuchten von unergründlichen Emotionen – er scheint absolut verzückt, als er den letzten der reanimierten Untoten umbringt.
Für einen schaurigen Augenblick denkt Stephen Pembry, als er die Szene von unter dem Türrahmen in sich aufnimmt, an einen Mann, der gerade einen Orgasmus hat. Der Pfarrer stößt einen wollüstigen Seufzer der Erleichterung aus, als er den Schädel einer älteren Frau aufspießt, die ein mit Rüschen besetztes Kleid aus Baumwolle trägt. Die Alte sackt gegen den Rücken einer Kirchenbank. Sie war einmal eine Mutter, eine Nachbarin, hat vielleicht Kekse für ihre Enkel gebacken, ihren von allen geschätzten Brotpudding an Kirchentagen verteilt, ihren über alles geliebten Mann nach siebenundvierzig Jahren Ehe zu Grabe getragen und auf dem mit Kopoubohnen gesäumten Friedhof hinter der Pfarrei beerdigt.
Der Pfarrer hält inne, um nach Luft zu schnappen. Er starrt auf die auf dem Boden liegende Frau und beginnt leise zu beten. Sein Kopf ist gesenkt, und seine Lippen bewegen sich. Plötzlich hört er auf, blickt sich um und kneift die Augen zusammen. Er neigt den Kopf zur Seite und spitzt die Ohren. Anscheinend lauscht er einem Geräusch, das aus einem anderen Teil des Gebäudes stammt. Schließlich blickt er Reese an und fragt leise: »Hast du das auch gehört?«
Reese reißt sich zusammen und nickt langsam.
Der Pfarrer blickt zu dem Geländer der Chorempore sechs Meter über dem Kirchenschiff auf. Er greift nach seinem Messer und zieht die blutige Klinge aus dem Gürtel, ehe er seinen Männern das Signal gibt, ihm zu folgen.
Sie eilen einen schmalen Flur im ersten Stock entlang, der von der Chorempore wegführt, ehe sie auf die Frau in der Toilette am Ende des Korridors stoßen. Sie ist korpulent, von afroamerikanischer Herkunft und trägt ein verdrecktes Trauergewand mit einem Vichy-Muster, uralte Tennisschuhe sowie ein Haarnetz. Sie hockt in einer Kabine und zittert vor Angst, als die drei Männer die Damentoilette betreten. Jeremiah tritt die Kabinentür ein und sieht, wie ihr gigantischer Hintern über den Toilettensitz quillt. »Kommen Sie heraus, Ma’am«, befiehlt er ihr ruhig, aber bestimmt, als ob er mit einem Haustier spricht.
Die Frau dreht und windet sich und hält ihm plötzlich eine Police Special Kaliber .38 vor die Nase. »Hau ab, Wichser! Ich drück ab! Ich schwöre dir, ich drück ab!«
»Langsam! LANGSAM!« Jeremiah nimmt die Hände über den Kopf und hebt die Augenbrauen, als Reese und Stephen sich hinter ihm mit erhobenen Waffen aufstellen, ihre Läufe auf die Frau gerichtet. »Jetzt alle mal ganz ruhig … Es gibt wirklich keinen Grund, dass einer von uns hier ausrasten müsste.«