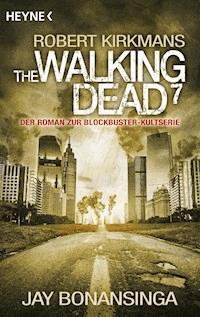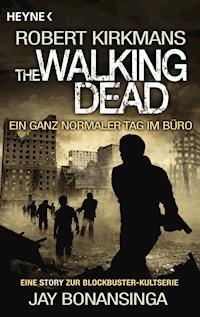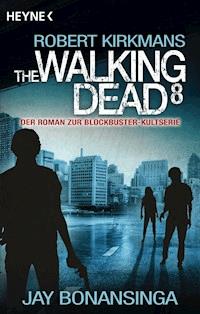
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Walking Dead-Romane
- Sprache: Deutsch
Vier Jahre hat sie sich durch die Apokalypse gekämpft. Sie hat Dinge getan, die sie sich nicht einmal in ihren schlimmsten Albträumen hätte ausmalen können. Und doch hat sie überlebt – ja mehr noch, sie hat für sich und ihre Leute einen sicheren Platz geschaffen. Hoch über den von Untoten bevölkerten Straßen Atlantas hat sie auf den Dächern der Stadt eine neue Heimat gefunden. Und doch kann Lilly Caul Woodbury nicht vergessen. Zusammen mit wenigen Gefährten beschließt sie zurückzukehren, doch zwischen ihr und Woodbury wartet mehr als nur eine tödliche Gefahr auf sie ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Die Überlebenden um Lilly Caul verlassen die trügerische Sicherheit einer Ikea-Filiale, um das niedergebrannte Woodbury neu aufzubauen. Auf ihrem Weg wird die Gruppe zerrissen und muss sich nicht nur der Untotenhorden, sondern auch des wahnsinnigen Sektenführers Spencer-Lee Dryden erwehren. Neben vielen anderen Verbündeten fällt auch der junge Tommy Dupree der Seuche zum Opfer – doch wenigstens steht am Ende, zurück in Woodbury, die Hoffnung auf eine friedlichere Zukunft für Lilly, David Stern und ihre kleine Gemeinde.
Die Autoren
Jay Bonansinga studierte Filmwissenschaften am Columbia College in Chicago und zählt heute zu den vielseitigsten Thriller- und Horrorautoren der Gegenwart. Gemeinsam mit The Walking Dead-Erfinder Robert Kirkman schreibt er die Romane zur Erfolgsserie. Jay Bonansinga lebt mit seiner Familie in Evanston, Illinois.
Robert Kirkman ist der Schöpfer der mehrfach preisgekrönten und international erfolgreichen Comicserie The Walking Dead. Die gleichnamige TV-Serie wurde von ihm mit entwickelt und feierte weltweit Erfolge bei Kritikern und Genrefans gleichermaßen.
Mehr zu The Walking Dead auf:
Jay Bonansinga
Robert Kirkman’s
The Walking Dead 8
Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: ROBERT KIRKMAN’S THE WALKING DEAD – RETURN TO WOODBURY
Deutsche Übersetzung von Wally Anker
Deutsche Erstausgabe 05 / 2018
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Copyright © 2017 by Robert Kirkman LLC
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld, unter Verwendung von Fotolia/windu
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-21718-1V002
www.heyne.de
Für all die Walker-Stalkers dieser Welt.
Prolog
Los Dias Finales
Siehe, es wird eine Plage kommen von einem Volk zum andern, und ein großes Wetter wird sich erheben von den Enden der Erde.
Jeremias 25,32
Dreißig Kilometer vor der Küste von Guantánamo, Kuba erwacht ein Mann auf der kleinen Insel Ile de la Lumière und kann sich des Gefühls nicht erwehren, dass sich ein gewaltiges Unwetter zusammenbraut.
Anfangs hat er noch keine Vorstellung, welche Form es annehmen wird, sondern ahnt nur, dass sich über seinem Kopf etwas zusammenbraut. Er lugt von seiner Pritsche durch das Loch im Dach seines Schlafplatzes sechs Meter über ihm. Die Stürme haben ein Stück Wellblech von seinem Gefängnis gerissen, und durch die dadurch entstandene kleine Lücke starrt er jetzt zum aufgewühlten Himmel empor. Schwere graue Wolken ziehen von Süden her auf, und etwas Kaltes, Schneidendes schnalzt immer wieder wie eine Peitsche gegen das Gebäude und lässt es in seinen Grundfesten erzittern. Ein Sturm gigantischen Ausmaßes wartet nur darauf, seine Macht zu entfachen.
Rafael Rodrigo Machado setzt sich auf und streckt seine müden Knochen. Dieser Morgen ist der 1825. in seinem Gefängnis, und seine ausgemergelten Gliedmaßen und von der Sonne gebräunte Haut zeugen offenkundig von seiner Zeit in Einzelhaft auf dieser gottverlassenen Landmasse, bestehend aus menschenleeren Stränden, Felsen und mit Schlangen verseuchten Urwäldern. Während der letzten fünf Jahre hat jeder Wärter, jeder Verwalter und jeder Gefangene entweder die Flucht ergriffen oder sich den Lauf einer Waffe in den Rachen gesteckt. Die Selbsttötungen – so glaubt Rafael zumindest – haben diesen Menschen endlich die ersehnte Ruhe verschafft. Jetzt verrotten ihre leblosen Körper unter der erbarmungslosen Sonne. Vielleicht streifen ihre Seelen in der Vorhölle umher, wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Das Einzige, dessen Rafael Machado sich absolut sicher ist, ist die Einsamkeit, aber selbst daran hat er sich mittlerweile gewöhnt. Und einsam sein heißt für ihn noch lange nicht verzweifelt sein. Rafael fühlt sich nämlich in seiner hermetisch abgeriegelten Bruchbude von Gefängnis geradezu pudelwohl, insbesondere angesichts der Geschehnisse der ungefähr letzten vier Jahre.
Er rappelt sich auf und begrüßt den kommenden Tag mit derselben morgendlichen Routine, die er während der vergangenen achtundfünfzig Monate, drei Wochen und zwei Tage konstant gepflegt hat. Er schlurft hinüber zum Waschbecken, benetzt sich mit Regenwasser und holt dann sein Frühstück aus dem schlecht bestellten Gärtchen (seitdem die Gefängnisangestellten ihn verlassen haben, ernährt er sich ausschließlich von Kohl und Süßkartoffeln). Er wirft wie jeden Morgen einen kurzen Blick durch die Bretter seines Gefängniszauns in der Hoffnung, dass sich dort draußen vielleicht etwas verändert hat.
Er späht die steile Felsenklippe im Westen hinab und erblickt die in sich zusammengesackte Dachschräge der Igreja do Sagrado Coração – der traurigen, kleinen Kapelle, auf die er seit Monaten jeden Morgen starrt. Derselbe vom Wind gebeutelte Kirchenturm erwidert wie allmorgendlich seinen Blick. Dasselbe Kreuz hängt beinahe ironisch kopfüber von seiner kaputten Halterung. Und in dem umzäunten Vorhof sieht er dieselben dreizehn Gemeindemitglieder, die wie Tiere fauchen und knurren, besessen von os demonios do inferno.
Rafael hat mit anschauen müssen, wie unzählige Menschen während der letzten zwei Jahre dem Teufel verfallen sind. Er hat gesehen, wie sich die Wächter unlauteren Geistern hingegeben und sich gegenseitig aufgeschlitzt haben. Er war dabei, als seine Mitgefangenen erfolgreich flüchteten, nur um sich daraufhin die östlich von hier gelegenen Klippen hinabzustürzen. Er hat Rauchschwaden am Horizont gesehen, die von Küstenstädten aufstiegen, und das unheilvolle Raunen der Besessenen in der Nacht gehört, das dem Heulen von Schakalen glich. Rafael ist fest davon überzeugt, dass er den Anfang von Los Dias Finales durchlebt – dem Ende aller Tage. Und aus irgendeinem ihm nicht ersichtlichen Grund hat man ausgerechnet ihn in seiner kleinen Vorhölle aus Blech, Stacheldraht, Mauern und Tipuana-tipu-Holz verschont.
Manchmal fragt er sich, ob er einer von den Zurückgelassenen ist, sozusagen ein kosmisches Waisenkind. Beschweren mag er sich deswegen nicht, denn seit dem Anfang der Endzeit ist er mit der Einsamkeit seines zusammenfallenden Gefängnisses gesegnet. Die Umarmung dieser vier Wände – gebaut, um Verbrechern Einhalt zu gebieten – dient ihm jetzt dazu, die Monster von ihm fernzuhalten. Er hat genügend Lebensmittel und Wasser und reichlich Freiraum, um Spaziergänge zu unternehmen. Zeit ist sowieso reichlich vorhanden, sodass er sich in Gebeten für die Gnade, die ihm erwiesen wurde, bedanken kann. Ansonsten schnitzt er, spielt Domino und denkt den ganzen Tag lang nach. So läuft seine Routine schon seit vielen, vielen Monaten … bis zum heutigen Morgen.
Jetzt sieht er, wie der Himmel über dem südlichen Atlantik immer schwärzer wird. Die unzähligen Blitze an den Rändern der Front gleichen flackernden Flammen. Er starrt auf die finsteren grauen Regenschwaden – sie sind noch einige Kilometer entfernt, kommen aber in rasanter Geschwindigkeit näher – und sieht mit zunehmender Besorgnis das immer unruhiger werdende Meer. In der Ferne erkennt er eine Flutwelle, die sich wie der Schlund eines Monsters zu öffnen scheint. Es scheint, als ob der gesamte Ozean von demselben immerwährenden Hunger besessen ist wie die armen Seelen vor der Kapelle.
Er weiß genau, was es bedeutet und welche Folgen es für ihn haben wird. Der Wind beginnt, sich gegen die müden Wände aufzubäumen, und rüttelt an den Fundamenten seines trauten Heims. Es ist, als ob ein übergroßes Kind ein Spielzeughaus schüttelt. Rafael schluckt die Furcht hinunter und dreht sich dann langsam einmal um die eigene Achse. Er weiß, was zu tun ist. Er muss nur auf den richtigen Moment warten. Doch dann heißt es, schnell zu handeln … ehe seine gesamte Welt um ihn herum zusammenbricht.
Er muss nicht lange warten, denn exakt um 11 Uhr 41 kubanischer Zeit weht der Sturm die an den Garten grenzende Südwand fort. Das Brechen des Holzes klingt wie eine rasch abgefeuerte Salve aus einer vollautomatisierten Waffe. Zudem gibt jetzt auch noch der Zaun der Schockwelle nach und beugt sich zu Boden, während Rafael hinter einer Säule kauernd Schutz sucht.
Er trägt eine gelbe Regenjacke, die er sich aus den verlassenen Unterkünften der Wächter geholt hat, mit Panzerband abgedichtete Stiefel, ein Messer an der Hüfte und einen Schal, den er eng um seine untere Gesichtshälfte geschlungen hat. Als der Boden unter seinen Füßen von der Wucht der einstürzenden Wand bebt, zuckt er zusammen. Horizontaler Regen peitscht mit der Heftigkeit eines Rammbocks gegen die Säule, vernichtet seine Ernte, und der Wind reißt alles mit sich, was nicht niet- und nagelfest ist. Rafael sammelt sich, holt noch einmal tief Luft und stürzt sich dann in das Tohuwabohu der Außenwelt.
Er hat schon die Hälfte des steilen Wegs hinter sich gebracht, als er ausrutscht und beinahe hundert Meter weit auf dem Hosenboden durch den Schlamm rutscht. Er kommt erst zum Halten, als er gegen einen dichten Busch prallt. Es gießt wie aus Kübeln, und jeder Tropfen fühlt sich wie eine Stecknadel in seinem Gesicht an. Er ist bis auf die Haut durchnässt, und seine Lungen scheinen mit Zement gefüllt. Der Wind pfeift wie ein außer Kontrolle geratener Zug in seinen Ohren. Er rappelt sich wieder auf und stolpert mehr schlecht als recht den Rest des Weges entlang auf den Strand am Nordufer der Insel zu.
Der Platz, auf dem die Polizei sämtliche beschlagnahmten Objekte der ehemaligen Drogenschmuggler und -kartelle sammelte, liegt in dem brodelnden grauen Nebel in fünfhundert Meter Entfernung. Rafael senkt den Kopf und läuft, so schnell er kann, auf den Friedhof alter Autos, Flugzeuge, Waffen und sonstiger nützlicher Gerätschaften zu, die früher einmal dem Schmuggel dienten. Er war Pilot für eine der größten dieser Organisationen gewesen, hatte die Ware selbst aber nie ausprobiert, nie seine Ladung gekostet. Er hatte sich selbst stets als professionell eingeschätzt und die unfeinen Attribute des Geschäfts gehasst: das Blut, die Fehden, das Morden, die internen Machtkämpfe, das Ausbreiten der Sucht unter den Armen und jungen Menschen. Rafael glaubte, darüberstehen zu können. Er war nichts weiter als ein einfacher Zusteller gewesen. Jetzt hofft er, dass sein alter Bell-Jet-Ranger-Helikopter noch immer an seinem Platz neben der Anlegestelle steht und der Rest seiner beschlagnahmten Ausrüstung weiterhin in dem kleinen Schuppen daneben auf ihn wartet. Er weiß, dass die Zeit drängt. Er hat wahrscheinlich keine halbe Stunde, ehe neunzig Prozent der Insel – die Anlegestelle inbegriffen – unter Wasser stehen.
Sein Ziel erscheint durch den Regenvorhang und die unzähligen Wirbel aus Trümmern, die wie Säulen in der Luft schweben. Jetzt sind es nur noch hundert Meter. Anfangs flimmern die spukhaften Silhouetten von völlig verrosteten Humvees, Motorrädern und mit Kugellöchern übersäten Wracks wie eine Fata Morgana in der Luft – ein Anachronismus aus den Tagen, in denen Treibstoff, Elektrizität und korrupte Politiker noch keine Mangelware waren. Jetzt aber stolpert Rafael durch die Fluten, kämpft gegen den immer stärker werdenden Orkan an und richtet den Blick auf den Platz, an dem er seinen Bell vermutet.
Sein Herz hüpft, als er den alten Hubschrauber in einer Ecke auf einem Kiesstreifen angekettet stehen sieht. Der Schuppen daneben steht ebenfalls noch, droht allerdings jeden Augenblick in seine Einzelteile zu zerfallen. Seine Gebete gelten jetzt dem Tank des Jet Ranger. Er stapft durch den Hurrikan, geht auf den Schuppen zu und tritt wiederholt gegen die mit einem Vorhängeschloss verriegelte Tür, bis die verrosteten Angeln nachgeben. Inmitten der vielen Spinnweben und Staubmäuse findet er seine alte Waffensammlung – unterschiedlichste Kaliber und Größen im Überfluss, genug, um eine kleine Revolte zu starten.
Der Wind weht inzwischen noch heftiger. Jetzt kracht eine Böe gegen die Seitenwand des Schuppens, sodass dieser in seinen Grundfesten erzittert und sich dann um Rafael in Luft aufzulösen scheint. Die Waffen und Munition werden auf den vom Regen gegeißelten Strand gepustet. Viel zu schnell atmend, schnappt Rafael sich eine Armladung und wickelt den Hängegurt einer Waffe darum, um sie besser tragen zu können. Er rafft sich wieder auf die Beine, muss nur noch die zehn Meter zwischen sich und dem Hubschrauber zurücklegen, aber sie scheinen ewig lang. Der Wind peitscht ihm ins Gesicht, treibt den Regen in seinen Mund und drückt ihn bis in die Nebenhöhlen.
Als er endlich vor dem Helikopter steht, ist das Wasser bereits so weit angestiegen, dass es bis zum Kies hochschwappt. Irgendwie schafft Rafael es mit seinen eiskalten, vom Regen glitschigen Fingern, eine Patrone in eine abgesägte Schrotflinte mit Pistolengriff zu stecken. Er zielt mit dem Lauf auf die Kette und zieht am Hahn. Die Waffe bellt und qualmt, und die Kette löst sich in Luft auf.
Im Lauf der nächsten hundert Sekunden hat Rafael Machado mehr Glück als Verstand. Er reißt an der Tür des Helikopters und wirft die Waffen in die Pilotenkabine, ehe er sich selbst ins Innere hievt. Die Federn knarzen, als sein Hinterteil auf den Sitz trifft. Panisch beäugt er das Armaturenbrett mit den unzähligen Zeigern. Wundersamerweise ist die Batterie noch nicht ganz leer, und er hört das ihm wohlbekannte Piepen, als er die Bordelektrik anschaltet. Dann hebt er eine Hand und vergewissert sich, dass alle Sicherungen eingeschaltet sind, ehe er ins Standgas schaltet.
In der Zwischenzeit hat die Flut den Strand verschlungen, und das Wasser strudelt und speit bereits unter dem Hubschrauber und wirft ihn seitwärts. Rafael drückt auf den Startknopf, und der Turbinenmotor fängt zu singen an. Die Strömung droht, ihn Richtung Strand zu reißen, aber die Rotoren drehen sich bereits.
Der Tsunami kommt immer näher.
Rafaels Herz rutscht ihm in die Hose, als die Wogen auf den Helikopter treffen und ihn beinahe auf die Seite werfen. Er spielt mit dem Gas, zieht am Steuerknüppel und betet, als die Strömung ihn mit sich reißen will. Der Chopper sinkt und rutscht auf die alles verschlingende Schwärze des offenen Meeres zu.
»Vamos!«, krächzt Rafael mit seiner Reibeisenstimme. Er ist es nicht mehr gewohnt, sie zu benutzen, aber der brasilianische Akzent seines Heimatlands ist deutlich vernehmbar. »VAMOS! VAMOS! VAMOS!«
Der Jet Ranger beginnt zu wackeln, der Rumpf droht auseinanderzufallen, und Rafael befürchtet, dass die Nieten jeden Augenblick nachgeben.
Er gibt Vollgas, spürt, wie die Rotoren ihn nach oben zerren wollen … bis das Gerät sich endlich, Gott sei Dank, aus dem Wasser erhebt und in den dunklen, brutalen Sturm aufsteigt.
Dann, irgendwo über der Nordküste von Haiti und gepeinigt und gebeutelt von den Winden, verliert Rafael das Bewusstsein.
Er ist sich dessen gewahr, denn gerade noch starrt er auf die Instrumente und kämpft mit dem Steuerknüppel, um durch die grauen Regenwände zu navigieren, jetzt aber hat er, den Oberkörper nach vorne gebeugt, den Boden der Kabine vor Augen.
Er schüttelt sich, kommt wieder zu Sinnen, spürt den pochenden Schmerz in seinem Kopf – er hat ihn sich offenbar an der Decke angeschlagen – , und schafft es gerade noch, den Hubschrauber wieder zu fangen, ehe er in die Wogen des wütenden Ozeans abtaucht. Er nimmt den Kurs wieder auf, indem er nach Norden abbiegt und an Höhe gewinnt. Mit etwas Glück sind es nur noch fünfhundert Kilometer bis zur Küste Floridas.
Die nächste Stunde verbringt Rafael damit, gegen das Monster von Hurrikan anzukämpfen, das über der nördlichen Karibik wütet. Der Jet Ranger wird hin und her geworfen, taumelt und torkelt. Er bebt, zittert, rattert und knarzt bei den Anstrengungen gegen die turbulenten Luftmassen. Die Zeit scheint stehen zu bleiben, und Rafaels Hände sind blutverschmiert von seinen Bemühungen, sich ihnen mit dem Steuerknüppel entgegenzustellen. Und um es noch schlimmer zu machen, sieht er, dass er kaum mehr Treibstoff hat. Er reicht vielleicht noch für dreihundert Kilometer, sodass es verdammt knapp werden wird. Rafael macht sich allerdings nicht allzu große Sorgen, denn diese Situation kennt er zur Genüge von früher.
Im Laufe der Jahre musste er bereits des Öfteren flüchten und teilweise enorme Risiken eingehen. Hochgeschwindigkeitskämpfe in ungeahnten Höhen mit schwer bewaffneten Hubschraubern sind nichts Neues für ihn. Außerdem hat er keine Probleme, auf ihm unbekannten Plätzen inmitten eines Feuergefechts zu landen. Verdammt, er ist in weniger als zehn Meter Abstand über felsige Bergpässe in Brasilien geflogen. Alles im Dienst des brutalsten, skrupellosesten, amoralischsten Kartells Südamerikas. Deswegen entschied er sich auch für eine zehnjährige Haftstrafe, statt ein Spitzel zu werden.
Irgendwo westlich der Bahamas wird er vom Kurs abgebracht. Mit nur noch wenigen Tropfen Treibstoff im Tank und hustendem Motor zerrt er seinen Gürtel aus der Hose und bindet seine Hand am Steuerknüppel fest. Der Helikopter stöhnt auf, lehnt sich vorwärts und verliert an Höhe. Die Wolken lockern sich, und durch die sich auflösenden Schwaden kann er den grenzenlosen blauen Ozean unter sich ausmachen. Die weiße Gischt auf den Wellen scheint immer näher zu kommen.
Er weiß, dass er sterben wird, kann sich aber nicht davon abhalten, auf die atemberaubenden Wellen zu starren, die unter ihm das Meer aufwühlen … und plötzlich erinnert er sich, was es bedeutet, wenn Wellen und Gischt immer häufiger auftreten.
In der Ferne des weiten Horizonts erscheint eine grüne Perlenkette aus Inseln. Er kennt die Florida Keys noch aus seiner Kindheit. Seine Großmutter war mit ihm einmal von São Paulo auf die Keys geflogen, um seine Tante Anita zu besuchen. Der Jet Ranger hustet und prustet, der Motor pfeift aus dem letzten Loch. Rafael schwebt keine sechs Meter über dem Wasser.
Die Rotoren hören auf, sich zu drehen. In zweihundert Metern Entfernung sieht er den bleichen Sand der Keys. Sein Herz pocht heftig in seiner Brust. Seine Hand scheint zu brennen, als er den Steuerknüppel in einem letzten verzweifelten Versuch zu sich reißt. Der Jet Ranger neigt sich kurz in einem Fünfundvierziggradwinkel in der Luft und stürzt dann ab.
Der Aufprall wirft Rafael gegen das Armaturenbrett, und das Wasser rauscht in die Kabine. Er tritt die Tür auf und schnappt sich die Waffen und zwei Schwimmwesten. Der Hubschrauber geht unter, und Rafael hat alle Mühen, sich mitsamt seiner unhandlichen Ladung zu befreien.
Der Helikopter verschwindet unter ihm, und Rafael paddelt panisch wie ein Hund auf die weiße Sandküste zu, die in weniger als hundert Metern Entfernung Rettung verspricht. Irgendetwas tief in seinem Inneren treibt ihn voran, schließlich wäre es ungeheuer schade, es so weit geschafft, so viel durchgemacht zu haben, nur um beim nahen Anblick der Landmasse der Vereinigten Staaten elendig zu ertrinken.
Die letzten zwanzig Meter sind die reinste Qual. Rafael paddelt und paddelt, seine Lungen scheinen in Flammen aufzugehen, und seine Augen können das Gesehene nicht mehr vernünftig verarbeiten. Als er endlich seichteres Gewässer erreicht, beginnt er zu husten und zu keuchen. Er hat Salzwasser geschluckt und weiß, dass man ab einer gewissen Menge davon sterben kann. Dann spürt er den weichen Sand unter den Füßen, und er hievt das Bündel Waffen hoch und wirft es auf den Strand, ehe er selbst auf die Knie geht, umfällt und milchig weiße Magensäure und Gallenflüssigkeit auf den Sand kotzt.
Er rollt sich auf den Rücken. Die Welt um ihn herum dreht sich. Die Nacht rückt näher, und die düsteren Wolken hängen tief im Himmel. Bald schon wird der Sturm auch die Florida Keys erreichen. Aber er dankt seinem Herrn, dass er es bis ans Festland geschafft hat.
Die Vereinigten Staaten werden seine Rettung sein. Die Amerikaner wissen, was zu tun ist. John Wayne, Tony Montana, Snoop Dogg, die Dallas Cheerleaders, Pam Grier und General George S. Harter Hund Patton. Diese amerikanischen Ikonen aus seiner Kindheit schwirren in seinem Kopf herum, während er zum Himmel aufblickt. Der amerikanische Himmel. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Er hat es geschafft. Er ist frei und in Sicherheit. Hier, in den Vereinigten Staaten von Amerika, werden ihm die Leute Antworten auf seine Fragen geben.
In jener Nacht wütet der Hurrikan, während Rafael sich ins Landesinnere schleppt. Er findet einen alten verlassenen Picknick-Unterschlupf mit Reetdach, sammelt Zypressenzweige und Bananenblätter, zündet sie an, ruht sich aus und trocknet seine Sachen. Wabernde Regenschleier peitschen gegen den Unterschlupf, und Rafael kann sich des Gefühls nicht erwehren, dass er sich in einem Raumschiff befindet, mit dem er einsam durch das schwarze Nichts des Universums rauscht.
Die erste Kreatur gibt sich erst in der Dämmerung des nächsten Morgens zu erkennen.
Rafael döst noch, als sie plötzlich aus dem angrenzenden Wäldchen in die Regenschwaden stolpert. Sie wird von der noch glühenden Asche des Feuers angezogen. Es handelt sich um einen groß gewachsenen Mann in zerfetzter Arbeitskleidung, vielleicht ein ehemaliger Fischer, der offensichtlich von den gleichen Geistern besessen ist wie die armen Seelen auf Rafaels Insel. Dieser hier ist aufgedunsen, schleimig und verbreitet einen Gestank, der an einen Schlachthof erinnert.
Rafael hat keine Zeit, enttäuscht zu sein – er hatte gehofft, dass die Vereinigten Staaten unberührt von diesem Fluch Satans geblieben seien. Dann wirft sich die Kreatur auf ihn, die Zähne hungrig klappernd, die Augen milchig weiß. Im letzten Moment legt Rafael die Hand um die halbautomatische Beretta .45 ACP. Er verschwendet keine Zeit, sondern versenkt drei Kugeln im Kopf des Mannes, der augenblicklich in tausend Stücke explodiert. Tentakel aus Blut und Gewebefetzen fliegen durch die Luft.
Auch in der Wissenschaft gilt oft: Probieren geht über Studieren. Auch sie hat ihre Kontrollgruppen, wiederholte Experimente und genaue Beobachtungen, die zusammengenommen zu Hypothesen führen. Rafael steht einen Augenblick lang da, schockiert von dem Anblick der Kreatur mit nur noch halbem Schädel, die jetzt zu Boden sackt. Der Dämon ist besiegt von … ja, von was? Hirntod? Ist das die magische Lösung? Muss man den Schädel platzen lassen? Rafael kann sich noch erinnern, was auf Lumière passiert war. Eine der Wachen hatte geschrien: »Solo la cabeza! – SOLOLACABEZA! Nur den Kopf! Nur wenn man ihnen in den Kopf schießt, gehen sie nieder!«
Jetzt schaut Rafael zu, wie die Kreatur nach hinten ins Feuer fällt. Funken sprühen und springen auf die Kleidungsfetzen an ihrem Körper über, bis sie zu brennen beginnt. Flammen züngeln den Körper hinauf, hüllen ihn in neu entfachtem Eifer komplett ein. Wie merkwürdig, denkt Rafael und schaut dem grässlichen Spektakel zu, dass Flammen allein die Verdammten nicht besiegen können. Ist es denn möglich, dass ich es hier mit Dämonen der Hölle zu tun habe? Aber … Rafael hat keine Zeit, weiter zu sinnieren, denn die wilden, fürchterlichen Geräusche der Besessenen ertönen jetzt überall um den Unterschlupf und erheben sich über dem Prasseln des Regens.
Als die finsteren Gestalten sich um die Oase des Lichts scharen, sammelt Rafael rasch seine Sachen zusammen. Letzte Nacht noch hat er aus einem Stück Seil, das er fand, einen Tragegurt gebastelt. Außerdem hält jetzt ein Stück Plane seine Waffen trocken. Eilig wirft er sich das Bündel über die Schulter und sichert es mit seinem Gürtel, ehe er ein paar Kugeln in die näher und immer näher kommende Schar von Untoten ballert.
Er tritt in die glühende Asche und verbreitet sie im Unterschlupf, sodass sogleich einige der Kreaturen in Flammen aufgehen. Die Ablenkung reicht aus, um ungeschoren entkommen zu können.
Irgendwo in den Falten und Windungen seines Gehirns erinnert sich Rafael Machado an bessere Zeiten. Er weiß noch, wie er die Straße über dem Meer entlangfuhr, welche die gut hundertfünfzig Kilometer lange Kette der Florida-Keys-Inseln mit dem Festland verbindet. Auch ist ihm noch gegenwärtig, wie er in der alten Rostlaube seiner Tante Anita über die »All American Road« düste und Dutzende von Brücken überquerte. Ihm war damals, als ob er auf einem fliegenden Teppich saß und über das in der Sonne glitzernde Wasser des Golfs von Mexiko raste, während er den Refrain des Liedes »Se Essa Rua Fosse Minha« (»Wenn diese Straße mir gehörte«) krächzte.
Jetzt jedoch drückt der schlechte Zustand der Straße schwer auf Rafaels Gemüt, wie er sie so mit seinen Waffen im Schlepptau entlangstolpert. Von der Sonne gebleichter Müll liegt auf dem Gehweg verstreut, und der salzige Wind hat einige Dosen bis auf das pure Metall von Farbe und Aufdruck befreit. Den Autos ist es ähnlich ergangen. Auch sie liegen blank da, die Reifen haben sich in nichts aufgelöst, die Scheiben sind eingeschlagen, Gräser und Unkraut wachsen aus den Hohlräumen. Hier und da liegen Körperteile herum, die Knochen sonnengebleicht. Einige der Schädel sind von schwarzen Lachen umgeben – ihre eigenen Säfte, die mittlerweile getrocknet und so hart und glänzend wie Onyx sind.
Es dauert zwei Tage, ehe er in Marathon ankommt – der Ortschaft, die auf halbem Weg zwischen den Keys und dem Festland liegt. Rafael geht es nicht mehr besonders gut. Er ist vollkommen dehydriert und sehr schwach auf den Beinen. Seit nunmehr drei Tagen hat er nichts mehr zwischen die Zähne gekriegt. Das Einzige, was er zu sich genommen hat, sind ein paar Regentropfen aus Flaschen, die er auf der Straße gefunden hat. Er kann sich kaum noch aufrecht halten, als er durch die ehemalige Luxussiedlung mit ihren Strandhäusern stolpert, in denen es nur so von Besessenen wimmelt.
Rafael hat einen Namen für diese unheiligen Geschöpfe, diese entweihten Seelen gefunden. Für ihn heißen sie jetzt Hungerdämonen oder monstro da fome – »Hungrige« in der Kurzfassung. Er geht ihnen so weit wie möglich aus dem Weg, anstatt wertvolle Munition zu verschwenden. Bisher war ihm kein anderer lebendiger Mensch über den Weg gelaufen. Ist es denn möglich, dass er der letzte Mann auf Gottes Erde ist? Die Möglichkeit lässt ihm die Nackenhaare zu Berge stehen. Aber anstatt sich dem Gedanken hinzugeben, konzentriert er sich auf das eine Ziel, das er vor Augen hat – zu überleben. Und das heißt, dass er unbedingt Wasser und Nahrungsmittel aufspüren muss.
Marathon, Florida ist kaum mehr als eine Geisterstadt. Selbst wenn man hier eine Atombombe zündet, könnte das dem Städtchen keinen Schaden mehr zufügen. Müll weht durch die Flure ehemaliger Luxushotels, Alligatoren wandern auf den Fußwegen vor verschlagenen Cafés, und die Luft stinkt nach Verwesung, Schimmel und totem Fleisch. Die allumfassende Weltuntergangsstimmung wird noch von dem immer wiederkehrenden, allgegenwärtigen Dröhnen untoter Stimmbänder unterstrichen.
Rafael will die Suche schon aufgeben und sich wieder gen Norden aufmachen, als er einen kleinen Schuppen hinter einem Strandhaus erspäht, der noch intakt zu sein scheint. So leise wie möglich entfernt er das rostige Vorhängeschloss, um einen wahren Schatz im Inneren vorzufinden.
»Obrigado, Deus – danke – danke, Gott«, murmelt er beinahe ehrfürchtig, während er sich durch den Inhalt des Schuppens wühlt. Das meiste ist völlig unnütz und gehört zu der unausweichlichen Ausrüstung eines Lebens am Strand – Bälle, die schon lange keine Luft mehr gesehen haben, verstaubte Frisbees, Einzelteile von Gartenmöbeln, zusammengeklappte Strandliegen, Boogiebretter und sonstige Gerätschaften, mit denen man sich auf die eine oder andere Art auf dem Wasser fortbewegen kann. Doch dann entdeckt er einige Rucksäcke mit Trageriemen, eine große Flasche Wasser, einen Picknickkorb mit Geschirr und Utensilien, eine Kiste voller Pringles-Kartoffelchips (noch immer eingeschweißt) sowie einen Fünfzig-Liter-Tank aus Plastik mit der Aufschrift TREIBSTOFF, gefolgt von der Krönung: einem kleinen, geländegängigen Quad-Bike in bestem Zustand.
Eine Stunde später verlässt Rafael Machado Marathon, Florida, sitzend und motorisiert. Auf dem Sozius liegen ein voller Reservetank und seine frische Ausrüstung, und sein Bauch ist mit Kartoffelchips und lauwarmem Trinkwasser gefüllt.
In den nächsten Tagen, während sich der Hurrikan über dem Süden der Vereinigten Staaten austobt, schafft Rafael kaum mehr als dreihundert Kilometer am Tag. So weit wie möglich benutzt er die großen Highways. Hin und wieder muss er auf kleinere Straßen ausweichen, um Ansammlungen von Hungrigen aus dem Weg zu gehen. Natürlich hält er stets Ausschau nach etwaigen Zeichen von Überlebenden. Unterwegs schlaucht er Treibstoff aus verlassenen Autos ab und findet sogar Munition, die auf dem Boden eines Reisebusses herumliegt. Kurz vor Orlando, es ist schon beinahe Nacht, sieht er in einigen Fenstern Lichter brennen. Vielleicht werden sie von Generatoren gespeist, aber er entscheidet sich dagegen, sie weiter zu untersuchen, und macht sich stattdessen wieder auf den Weg. Er hatte viel zu viel Zeit im Gefängnis verbracht, um das Risiko eingehen zu wollen, wieder gefangen, überfallen oder in die Enge getrieben zu werden. Orlando fühlt sich einfach nicht richtig an. Am nächsten Tag, in der Nähe von Gainesville, erspäht er eine Gruppe von Leuten auf Pferderücken auf einer Brücke über dem Highway. Als er winkt, winken sie nicht zurück, was auch schon das volle Ausmaß der Interaktion darstellt. Er macht sich wieder auf den Weg. Überhaupt scheint das der Schlüssel zu allem zu sein: sich wieder auf den Weg zu machen.
Am Ende des dritten Tags um genau 19 Uhr 13 ostamerikanischer Sommerzeit passiert er ein von Kugeln durchlöchertes sonnengebleichtes Schild, das am Straßenrand steht:
Willkommen
Wir freuen uns,
dass Sie an Atlanta denken
Olympiastadt von 1996
Rafael bemerkt, wie die Landschaft sich auf einen Schlag verändert. Die mit Buschwerk bewachsenen, sonnengebleichten Orangenhaine des nördlichen Florida machen den weicheren, dunkleren, rollenden Hügeln mit dichtem Wald und von Kopoubohnen überwucherten Tabakfeldern Platz.
Er hält an einer menschenleeren Raststätte an und verbringt die Nacht dort. Die Toiletten der Ruine bestehen aus nichts weiter als heruntergebrannten, verkohlten Brettern, herabfallendem Putz und in die Luft ragenden Metallstäben, die an Knochen erinnern. Er schläft im hintersten, abgeschiedenen Teil der Raststätte unter dem Dach eines weiteren Picknickunterschlupfs. Dort ist er vor neugierigen Blicken vom Highway geschützt und von einer Reihe von Stolperdrähten und herumliegenden Dosen umgeben. Er träumt von seiner Freundin, dem Tod seiner Mutter und der Exekution seines Freundes Ramon, der dem Kartell Geld geraubt hat. In kalten Schweiß gebadet wacht er auf. Der Wind peitscht immer wieder stichelnden Regen gegen den Unterschlupf. Komischerweise fühlt er sich erholt und spürt irgendwie, dass das Schicksal ihn an diesen Ort geführt hat. Er weiß zwar nicht, wieso oder weshalb, aber zum ersten Mal hat er das Gefühl, dass sein Leben einen Sinn hat.
Etwas später und ungefähr hundertzwanzig Kilometer nördlich der Staatsgrenze erfährt er mehr über diesen speziellen Sinn, als die Nadel seiner Tankanzeige auf E sinkt. Er steigt ab und biegt von der vierspurigen Fahrbahn ab, um nach Treibstoff zu suchen.
Über eine Stunde durchstreift er die Nebenstraßen in seiner grellgelben Öljacke wie ein geisterhafter Wiederkehrer auf der Suche nach einem verlassenen Auto oder einer Tankstelle, die noch nicht komplett demoliert worden ist. Auf dem Rücken trägt er sein Bündel Waffen in Form eines Rucksacks. Die Läufe zeigen allesamt nach oben, wie die Äste von Anzündholz. Sämtliche Scheunen und Bauernhöfe sind geplündert. Die Überreste alter Autos liegen wie Tierkadaver auf dem Dach im Regen, umschlungen von wildem Wein und Unkraut. Sämtliche Tanks hinter den landwirtschaftlichen Geschäften enthalten keinen einzigen Tropfen mehr. Was seine Lage noch verschärft, ist die Tatsache, dass es in den Wäldern von dem erbärmlichen Samen Satans nur so wimmelt. Alle fünf Minuten muss Rafael einem weiteren Pack von ihnen ausweichen. Ab und zu ist er versucht, das Feuer zu eröffnen, aber er weiß wohl, dass der Lärm nur noch mehr von ihnen aus den Schatten locken würde.
Er schmiedet bereits einen Plan B. Vielleicht findet er ja ein Pferd, das er mitgehen lassen kann. Schließlich dringen die ersten Anzeichen einer weiteren Horde an seine Ohren. Sein Schicksal führt ihn weiter gen Norden, durch die Wälder zu einer kleinen Stadt namens Thomaston.
Rafael schleicht durch den Wald und kauert sich dann hin, um zu lauschen. Der Wind trägt eine einzelne Stimme an seine Ohren, aber sie ist über dem Prasseln des Regens kaum hörbar. Sie klingt rau und angespannt vor Angst, vielleicht auch vor Ärger – über diese Entfernung ist es schwierig, die Gefühle zu deuten. Er ist sich aber ziemlich sicher, dass es sich um einen Mann handeln muss.
Rafaels Englisch funktioniert mehr schlecht als recht – seine Tante brachte ihm Elementarkenntnisse der Sprache bei, als er noch ein Junge war – , und im Laufe der Jahre bei seinen Geschäften mit den Drogenbaronen Nordamerikas hatte er einige recht farbenfrohe Redewendungen aufgeschnappt. Aber etwas an dieser männlichen Stimme lässt Rafael nicht los – etwas Menschliches, Intelligentes, gar Freundliches – , worin angesichts der Tatsache, dass das Wort, das wiederholt gerufen wird, dämlich lautet, eine gewisse Ironie liegt. Rafael kennt dessen Bedeutung, und es weckt seine Neugier so weit, dass er ein Scharfschützengewehr aus seinem Tornister zieht und sich der Quelle vorsichtig nähert.
Es dauert einige Minuten, die angrenzende bewaldete Steigung hinaufzuklettern, denn der Boden ist voller Laub und extrem rutschig. Die Regenfälle haben Georgias roten Lehmboden in einen Untergrund mit der Konsistenz von Schmierfett verwandelt. Er erreicht den Kamm und sieht Bewegung auf der Lichtung circa dreißig Meter unter ihm. Er lugt durch den Sucher des Scharfschützengewehrs, um sich ein besseres Bild von dem Geschehen dort unten machen zu können. Ein Mann mittleren Alters in einer leicht abgetragenen Jacke, Jeans und Wanderstiefeln ist von mindestens einem Dutzend besessener Seelen umzingelt. Er fuchtelt mit einer selbst gebauten Fackel herum – einem dicken Ast, dessen eines Ende er höchstwahrscheinlich in irgendeinen Brandbeschleuniger gesteckt hatte. Die Fackel lodert, spuckt Flammen und Funken im Regen und hält die ungefähr zwölf Hungrigen tatsächlich in Schach. In dem schmalen, aber vergrößerten Blickfeld des Suchers sieht Rafael, dass der Mann seine grauen Haare nach hinten gekämmt hat. Die Augen glänzen vor Erregung, und die Wunden in seinem Gesicht und Nacken sehen wie Verbrennungen dritten Grades aus. Auch seine Kleidung ist hier und da versengt oder verbrannt.
»Dämlich – dämlich! – DÄMLICH!«, wiederholt der Mann immer wieder, bis Rafael merkt, dass er sich selbst rügt. Rafael ist sich nicht sicher, wieso er etwas derart Absurdes tut, aber schließlich ist niemand sonst da, den er meinen könnte. Die dämonischen Seelen scharen sich enger um den Pechvogel in der Jacke. Ihre schwarzen Mäuler schnappen unentwegt nach ihm, und ihre Augen gleichen denen von Haien. Die Fackel kann nicht viel gegen diese Verdammten ausrichten, dient lediglich zur Ablenkung, denn die Hitze hat keinerlei Effekt auf das abgestorbene Nervensystem der Monster.
Plötzlich spült eine Welle der Emotionen über Rafael hinweg. Einerseits empfindet er ungeheures Mitgefühl für den Mann in der Jacke, die aussieht, als ob sie aus Seide sei. Aber es ist einzig der Gnade Gottes zu verdanken, dass nicht Rafael dort unten steht – allein, umzingelt, gepackt von Todesangst, verloren – , sondern dieser Mann. Und dann noch dieser hämische Tonfall, in welchem der arme Kerl ständig das Wort dämlich wiederholt. Höchstwahrscheinlich rügt er sich, weil er irgendeinen dummen Fehler begangen hat und deswegen umzingelt worden ist. All das beschäftigt Rafael. Langsam legt er den Finger um den Abzugshahn und zielt mit der Vorrichtung auf die erste besessene Seele.
Die Kugel durchschneidet die Luft. Im Visier sieht Rafael ein wenig Blutnebel, der von dem Schädel der Kreatur zum Himmel aufsteigt. Der Besessene geht zu Boden. Der Mann in der Jacke hält überrascht inne und blickt sich kurz um, aber wirklich nur kurz. Er kann die Augen nicht länger als einen Sekundenbruchteil von seinen Angreifern nehmen, ohne Gefahr zu laufen, gebissen zu werden. Er winkt mit der Fackel, und ein Schweif Funken fliegt durch die Luft. Der Regen prasselt auf die Flamme nieder, während Rafael eine weitere Patrone in den Lauf schiebt, auf das zweite Opfer zielt und abdrückt.
Erneut sieht er, wie der Mann zusammenzuckt, als der nächste Angreifer zu Boden sackt. Durch das Visier sieht Rafael Verwirrung und gleichzeitig Besorgnis in seinem Gesicht. Er wirft einen weiteren Blick über die Schulter, und Rafael verspürt einen Schauer der Erregung, als die beiden für den Bruchteil einer Sekunde Augenkontakt herstellen. Vielleicht hat der Mann den metallenen Lauf seines Scharfschützengewehrs inmitten des dichten Blattwerks aufblitzen sehen.
Rafael atmet tief ein und hält die Luft an, genau wie er es viele Jahre zuvor in der Armee gelernt hat, ehe er auch die anderen Angreifer ins Visier nimmt – einen nach dem anderen. In einem rhythmischen Ablauf zieht er am Hahn, lädt erneut eine Patrone in den Lauf und wiederholt den Prozess, bis er das Teufelsdutzend erledigt hat.
Nachdem der letzte Schuss gefallen und der Mann auf der Lichtung das einzige Wesen ist, das noch auf den Beinen steht, lichtet sich der Schießpulvernebel um Rafael. Der Mann in der Jacke aus Seide blickt zu ihm auf. Er ruft nicht, winkt nicht einmal. Sein Gesichtsausdruck spiegelt lediglich seinen absoluten Verdruss wider. Dann bewegt er die Lippen, aber auch wenn Rafael kein Wort verstehen kann, ist es doch eindeutig, was er von sich gibt: »Was. Zum. Teufel.«
Rafael wirft die letzte Patrone aus, und der dumpfe Aufschlag der hohlen Metallhülle, die jetzt auf den Stein unter ihm prallt, ist gerade noch über dem monotonen Prasseln des Regens zu hören. Das Geräusch bildet einen pointierten Schluss zu der gesamten Szene – wie würde Rafael sie nennen? Einen Gnadenakt? Vielleicht gar eine Dämonenaustreibung?
Der Mann auf der Lichtung hat sich nicht vom Fleck bewegt, sondern starrt weiterhin wie versteinert und mit unveränderter Miene voller Ehrfurcht zum Kamm auf. Der Moment scheint kein Ende nehmen zu wollen. Es regnet weiterhin wie in Strömen. Der Boden um die gefallenen Monster weicht langsam auf, und der Mann in der Jacke senkt den Blick und starrt auf die Überreste seiner Angreifer, die um ihn herum verstreut sind, traurige Haufen Fleisches, so regungs- und harmlos wie Kuhfladen. Er wirft die selbst gebaute Fackel fort, deren Flamme bereits ihren letzten Todeskampf aufgenommen hat.
Rafael senkt die Waffe und wischt sich das Regenwasser aus dem Gesicht, denn die Kapuze allein hatte es nicht vermocht, ihn trocken zu halten. Er weiß nicht, was er tun oder sagen könnte. Soll er sich vielleicht einfach umdrehen und abhauen? Vertraut er diesem Mann? Er wartet. Worauf, weiß er nicht, aber während er dasitzt, hebt er das Visier erneut ans Auge und mustert den Mann in der Seidenjacke abermals.
Bei genauerem Hinsehen durch das Fadenkreuz erkennt Rafael, dass der Mann einen robusten, insgesamt ziemlich guten Eindruck macht. Vielleicht hat er in seinem früheren Leben gar nicht so schlecht ausgesehen. Auf jeden Fall besitzt er vor Intelligenz funkelnde, wenngleich schwermütige Augen, was auch die schlimmen Verbrennungen, die seine eine Gesichtshälfte bedecken, nicht verbergen können. Sein sauber geschnittener Ziegenbart ist eisengrau, und sein Haar, völlig durchnässt und an seinem Schädel klebend, ist von silbernen Strähnen durchsetzt. Jetzt scheint er älter als zuvor, die Krähenfüße um seine Augen sind tief und markant und die Furchen in seinem Gesicht zahlreich.
Endlich erhebt der Mann auf der Lichtung die Stimme: »Wenn Sie glauben, dass Sie sich vor mir verstecken können, dann kann ich Ihnen verraten, dass Ihre gelbe Regenjacke wie ein bunter Hund aus dem Wald bellt.«
»¿Habla inglés?«, erkundigt sich der Mann in der Seidenjacke, nachdem sie sich aus dem Regen gerettet haben. Anfangs wahren sie noch Abstand, stehen an gegenüberliegenden Enden der verlassenen Fußgängerbrücke, die zweihundert Meter von der Lichtung entfernt liegt.
Der Mann wartet geduldig auf eine Antwort und wischt sich das Gesicht mit einem Taschentuch trocken.
»Si … Ich meine … Ja«, antwortet Rafael, dessen Hand auf dem Pistolengriff ruht. »Aber ich bin kein Latino.«
»Ach, wirklich?« Die Augen seines Gegenübers blitzen in mildem Interesse auf. »Ich dachte, dass ich da einen Akzent herausgehört habe.«
»Ich bin Brasilianer.«
»Ach, dann ergibt alles Sinn. Entschuldigung, mein Fehler.« Trotz seiner Verletzungen lächelt der ältere Mann. »In dem Fall bin ich mir sicher, dass Ihr Englisch besser ist als mein Portugiesisch.«
Rafael zuckt mit den Schultern. Er zittert und bekommt am ganzen Körper Gänsehaut. Der stechende Gestank der Verwesung scheint ihn zu umzingeln. Die Brücke – früher einmal eine idyllische Überquerung für Wanderer, Radfahrer und Naturfreaks – spannt sich über einen kleinen Flusslauf, der jetzt so weit angestiegen ist, dass er den benachbarten Wald überflutet und sogar durch den verworfenen Bretterverschlag des Brückenbodens quillt. Die Luft in der überdachten Brücke stinkt nach Schimmel, und der unnachgiebige Regen prasselt auf das Dach, sodass die beiden Männer sich nur schwerlich verständigen können.
»Ich heiße Stern«, ruft der ältere Mann über dem Getose. »Vorname David. Oder Dave, wenn Ihnen das lieber ist, aber meine Frau kann es nicht ausstehen, wenn man mich Dave nennt. Barbara meint, es erinnert sie an die Werbung von Wendy’s Hamburgers.«
Rafael versteht gerade mal die Hälfte von dem, was der Mann ruft. »Rafael«, sagt er schließlich. »Ich heiße … Rafael Machado.«
»Nett, Sie kennenzulernen, Rafael. Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie mir auf der Lichtung den Arsch gerettet haben.«
Rafael zuckt mit den Schultern. Wieder hat er nicht alles verstanden, was der ältere Mann von sich gegeben hat.
David wirft ihm einen Blick zu und nickt dann in Richtung Scharfschützengewehr. »Sie scheinen nicht schlecht mit dem Ding umgehen zu können.«
»Ich war … Soldat. Aber das ist schon lange her«, erklärt Rafael und zuckt erneut mit den Achseln. »Ich sah, wie die Hungrigen Sie hatten. Wie heißt es noch mal?« Wieder ein Zucken. »Umzingelt? Umzingelt … oder gefangen?«
David Stern schmunzelt und lacht dann laut auf. Er wischt sich die Augen mit dem Handrücken trocken. »›Hungrige‹ … Das ist nicht schlecht.«
»Sie sind besessen, oder?«
Davids Gelächter verstummt augenblicklich. »Einen Augenblick … Wie bitte? Besessen? Meinen Sie etwa, dass sie so etwas wie Dämonen sind?«
»Dämonen, genau … Diabo… Äh … Was Sie den Teufel nennen, ja?«
David stöhnt. »Also, fangen wir mal von vorne an. Ich bin Jude … In meiner Religion gibt es so etwas nicht wirklich. Und darf ich Ihnen zweitens eine persönliche Frage stellen?«
Rafael kaut auf der Innenseite seiner Wange und zögert einen Augenblick, während er die Worte verarbeitet. Er ist sich nicht sicher, wie weit er sich diesem Mann anvertrauen soll. Was, wenn es sich hier nur um einen ausgeklügelten Trick handelt? Was, wenn das hier ein Plan des Teufels ist, um auch seine Seele zu ergattern? Endlich antwortet er: »Ja, schon.«
»Wo kommen Sie her?«
»Hier und da.«
»Passen Sie mal auf … Rafael, nicht wahr?«
»Ja.«
»Sie haben mir das Leben gerettet. Sie scheinen schwer bewaffnet, und mir geht es nicht so gut. Ich habe viel durchgemacht. Ist auch egal, aber möglicherweise können wir einander von Nutzen sein. Was halten Sie davon?«
Rafael holt tief Luft und sieht sich für einen Moment allein in dieser verlassenen, apokalyptischen Welt, in der ihn unreine Geister umgeben, die ihm bei jeder Bewegung nachjagen. Dann denkt er an die einsamen fünf Jahre, in denen er sich von nichts anderem als Süßkartoffeln, Kohl, Regenwasser und einem Hauch Hoffnung ernährt hat. Er erinnert sich an die finsteren Nächte, in denen er zusammengekauert dem Heulen der Schakale lauschte. Damals hatte er beinahe den Verstand verloren, dort, in dem schäbigen Pferch, den Naturgewalten ausgesetzt, dem Ende nahe und komplett verlassen. Er hebt den Blick und schaut dem verwundeten Mann mit der Jacke in die Augen. »Ja, das wäre gut … Wir sollten einander helfen.«
Und dann – das erste Mal seit Jahren – schenkt Rafael Rodrigo Machado einem anderen Menschen ein freundliches, ehrliches Lächeln.
Sie tun sich zusammen. David Stern hat ein Pferd samt Wagen keine zwei Kilometer von der Brücke entfernt abgestellt. Sie legen den Weg zu Fuß zurück, stapfen Seite an Seite durch den Regen, die Augen stets auf den Waldrand und die mit Schatten behafteten Ecken der überfluteten Landschaft gerichtet, um etwaige Hungrige frühzeitig zu erkennen. Nach und nach tauen die beiden auf.
David erklärt, dass er jede Religion respektiert, macht Rafael aber gleichzeitig klar, dass die Hungrigen – oder Beißer, wie David und viele andere Amerikaner sie auch nennen – weder Kreaturen des Teufels noch in irgendeiner anderen Art übernatürlich sind. Niemand weiß genau, welche biologischen Prozesse schuld an dieser bizarren Seuche sind, die sich über die Menschheit gelegt hat – Tote, die wieder auferstehen, um sich von den Lebenden zu ernähren. Aber ganz gleich, welche katastrophalen Pathologien hier am Werk sind – David Stern ist sich absolut sicher, dass die Götter es aussitzen wollen. Tee trinken und abwarten, so lautet ihr Motto. Was oder wer auch immer die Schuld an diesem fürchterlichen Ausbruch trägt, David kann Rafael eines garantieren: Es waren einzig und allein die Lebenden – in all ihrer imperfekten, faulen, narzisstischen Pracht – , die den Stein ins Rollen gebracht haben.
»Da sind wir schon«, meint David und hält hinter einem großen Haufen umgefallener Baumstämme und Felsbrocken an. Als er die Plane von dem alten, umfunktionierten VW-Käfer zerrt, bei dem das Vorderteil bis zur Achse abgetrennt ist, stürzt eine Flut angesammelten Wassers auf sie nieder. Ein Pferd wiehert und scharrt mit den Hufen, und Rafael dreht sich sofort zu dem neuen Geräusch um, das hinter einer Wand aus Blättern zu kommen scheint. Dort, im Schatten, steht ein alter Schimmel hinter den Ästen einer Eiche und wühlt den Schlamm unaufhörlich mit seinen Hufen auf. »Das ist Shecky«, erklärt David mit einer Geste in Richtung des Pferdes. »Ich war gerade dabei, ihm etwas zu fressen zu bringen, als diese Beißer mich auf der Lichtung umzingelten.«
Sie satteln das Pferd. Die Waffen und den Picknickkorb voller Proviant legen sie auf die Rückbank der behelfsmäßigen Kutsche und nehmen dann auf den Vordersitzen Platz. Kaum haben sie es sich bequem gemacht, schnalzt David mit den Zügeln, und der alte Shecky zerrt sie aus dem Matsch auf eine baufällige asphaltierte Straße, die David liebevoll den Scheißweg nennt.
»Darf ich Sie etwas fragen?«, erkundigt sich Rafael Augenblicke später, während David sie um umgestürzte Autowracks lenkt, die noch immer die zweispurige Straße blockieren.
David lässt die Augen nicht vom Asphalt und hält die Zügel stets fest in den Händen. »Aber selbstverständlich.«
»Was haben Sie hier eigentlich getan? Ich meine, so ganz allein?«
»Ich habe meine Frau gesucht.«
»Barbara?«
David wirft ihm einen Seitenblick zu. »Sehr gut. Genau, Barbara. Man hat sie entführt.«
»Wann ist das passiert?«
David seufzt auf. »Vor knapp über einem halben Jahr. Und dabei lief alles so reibungslos. Wir hatten ein nettes Leben in einer kleinen Ortschaft, die von einem Sicherheitswall umgeben war. Woodbury hieß sie. Wir waren um die zwei Dutzend Überlebende, von jung bis alt und aus allen Milieus und Schichten. Dafür haben wir uns eigentlich recht gut vertragen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Wir führten ein sicheres, nachhaltiges Leben, verfügten über Solarzellen, hatten eine Art Biobauernhof. Aber man hatte es auf uns abgesehen.«
»Auf Sie abgesehen?«
David schießt ihm einen weiteren Blick zu. »Es schien wirklich so, als ob jeder Junkie, jeder Tunichtgut, jeder Biker und überhaupt alle Verrückten in einem Umkreis von hundert Kilometern, die noch am Leben waren, sich das Ziel setzten, uns das Leben zur Hölle zu machen und uns alles zu nehmen, was wir aufgebaut hatten. Und die, die sich bereits verwandelt hatten, sahen in uns ein schmackhaftes Mittagessen. Aber wir haben uns mit Händen und Füßen gewehrt und die meisten dorthin zurückgetrieben, wo sie hergekommen waren.«
»Und ist deswegen Ihre Frau gekidnappt worden?«
David starrt nun auf die Straße, während die Hufe laut auf dem schwarzen Teer klappern und die Pause in ihrer Unterhaltung nur noch unterstreichen. »Bis zum heutigen Tag habe ich keine Ahnung, warum man mir meine Frau weggenommen hat. Es geschah, als die meisten von uns auf den Feldern arbeiteten.« Er senkt den Blick und holt angestrengt Luft, als ob allein die Tatsache, die Geschichte zu erzählen, ihn aufs Äußerste mitnimmt. »Diese paramilitärische Gruppe oder Miliz überfiel uns und hat sämtliche Kinder mitgenommen. Und ich glaube, sie brauchten Barbara, um die Kleinen ruhig zu halten.« Tränen trüben seine Augen. »Babs hatte schon immer eine besondere Art, mit Kindern umzugehen, obwohl wir keine eigenen haben. Sie war immer die Lieblingstante Babs gewesen.«
Rafael runzelt die Stirn. »Die haben also die Kinder genommen? Warum das?«
David wischt sich die Augen und zuckt mit den Schultern. »Das ist eine verdammt gute Frage. Aber wie auch immer, wir waren uns sicher, dass sie die Kinder und Babs mit nach Norden, nach Atlanta genommen hatten – das sind gut hundert Kilometer von hier. Also entsandten wir einen Rettungstrupp. Eine Frau namens Lilly Caul war die Anführerin und gleichzeitig so eine Art Bürgermeisterin unserer Gemeinde in Woodbury. Die ist hart im Nehmen, aber ihrerseits nie wiederaufgetaucht. Ich habe die letzten drei Monate damit verbracht, jeden Winkel der Stadt abzusuchen, aber nichts außer Beißern gefunden. Ganz egal, wo man hinschaut, überall sind diese verdammten Viecher. Zudem gibt es hier und da noch einzelne Gruppen von Überlebenden, die man aber am besten meidet … Nach jemandem zu suchen ist ein absolut hoffnungsloses Unterfangen.«
»Haben Sie sich dabei etwa verbrannt? Es sieht aus … wie sagt man … frisch?«
David nickt. »Ist letzte Woche passiert. Seitdem bin ich auf der Flucht.« Er holt tief Luft. »Als ich in Atlanta nach Babs suchte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte den gröbsten Fehler überhaupt gemacht. Und dabei hatte ich gedacht, ich sei mit allen Wassern gewaschen.«
Rafael kämpft mit der Redewendung. »Mit allen Wassern gewaschen? Mit welchem Wasser? Es tut mir leid, ich verstehe nicht ganz …«
»Ach, das sagt man nur so. Ich will damit nur sagen, dass ich verdammt dumm gewesen bin und gegen eine uralte Regel verstoßen habe. Wenn man getrennt wird, dann soll man nicht losstarten und nach seiner Partnerin suchen, sondern bleiben und warten, bis sie dich findet. Wenn nämlich beide nach einander suchen, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich nie findet. Was ich damit sagen will, ist, dass ich mich bei der Suche in Atlanta festgebissen habe. Und dann fiel bei mir endlich der Groschen. Sie könnten ja auch nach mir suchen. Ich wollte also so schnell wie möglich zurück nach Woodbury.«
Rafael nickt. »Okay … ich verstehe. Aber wie haben Sie sich so schlimm verbrannt?«
»Ich muss wohl kaum erklären, dass Woodbury bei meiner Rückkehr nicht mehr das Woodbury war, das ich verlassen hatte. Während meiner Abwesenheit sind so gut wie alle geflohen, und der Abschaum der Menschheit hat sich dort breitgemacht. Die Hälfte der Stadt war mit Beißern infiziert, die andere Hälfte mit Banditen und Kriminellen. Sie haben sich unsere Häuser genommen, unsere Ressourcen, unsere Vorräte – und dabei waren die meisten nicht einmal alt genug, um sich eine Flasche Whiskey kaufen zu können. Aber wild waren sie, wie Tiere. Halt, nein, ich will keine Tiere beleidigen.« Er verstummt einen Augenblick, lässt einen Zügel schnalzen und führt das Pferd in einem engen Bogen um ein Autowrack.
Ein paar Beißer stolpern am Straßenrand herum und strecken die Arme nach der Kutsche aus, als David sie an ihnen vorbeilenkt.
Seine Stimme klingt jetzt belegter und rau vor Wut. »Ich habe eines dieser Arschlöcher gesehen, wie er Barbaras Schal um seinen Kopf gewickelt hatte. Und da bin ich durchgedreht. Ich hatte mich im Gebüsch versteckt und sah ein letztes Mal zu, wie unsere kleine Stadt vor die Hunde ging. Ich hielt es nicht länger aus. Ich wusste nicht einmal, ob ich Babs oder Lilly oder die anderen jemals wieder zu Gesicht bekommen würde … und ich … ich habe einfach den Verstand verloren.«
Er verstummt abermals. Das Prasseln des Regens vermischt sich mit den Schlägen der Hufe auf dem Asphalt. Rafael wartet einen Augenblick, fragt dann aber nach: »Und was ist passiert? Was haben Sie getan?«
»Ich habe die Stadt abgefackelt.« David sackt in seinem Sitz zusammen, und sein Kopf baumelt von einer Seite zur anderen. Man weiß nicht, ob er gleich lachen, weinen oder schreien will. Schließlich kullern ihm die Tränen die Wangen hinab, und seine Schultern beginnen zu beben. Er schluckt den Schmerz, die Schuld, die Scham hinunter und wischt sich dann die Augen mit dem Handrücken. »Wir hatten eine ganze Reihe Propangasflaschen gelagert, die wir auf unseren Streifzügen fanden. Ich schmuggelte sie in die Stadt, öffnete sie und rollte sie hinter das Gerichtsgebäude. Dann zündete ich den Laden an, in dem der ganze Schnaps gelagert war. Mittlerweile war das Methan in der Gasse zwischen den beiden Gebäuden so konzentriert, dass man es hätte schneiden können.«
Wieder lässt er seine Worte verklingen, und Rafael sitzt einfach da und denkt über das Gesagte nach. »Sie wurden also in einem Feuer verbrannt? Haben Sie sich so die Wunden zugefügt?«
David Stern wirft dem jüngeren Mann einen Blick zu, und seine vernarbten Gesichtszüge verziehen sich zu einem schiefen, beinahe verrückten Lächeln. Die gespannte Haut lässt sein Gesicht wildkatzenhaft aussehen. »Mir ist nur ein bisschen warm geworden. Weitaus weniger warm als den anderen Scheißern.«
Rafael starrt ihn einen Moment lang an und lässt den Blick dann durch das offene Fenster über die vorbeiziehende Landschaft schweifen. Egal, wohin er blickt, er sieht nichts anderes als verfaulte Wälder und sich bewegende Schatten. Rafael kann sich es nicht anders erklären, als dass der Teufel persönlich die Fäden dieser Welt in der Hand hält. Er wendet sich wieder dem älteren Mann zu und fragt: »Haben Sie aufgegeben?«
David schaut ihn an. »Aufgegeben? Was soll ich aufgegeben haben?«
»Glauben Sie, dass Sie Ihre Frau Barbara noch finden werden?«
David stößt ein lautes Stöhnen aus. »Nein, die Hoffnung werde ich nie aufgeben.« Er atmet tief ein und scheint den Trübsinn von sich abzuschütteln. »Ich muss einfach daran glauben, dass sie irgendwo dort draußen sind … am Leben. Babs, Lilly, Tommy, Norma, Jinx, Miles und all die süßen Kleinen … Die sind da draußen … Irgendwo besser als Woodbury … Wo sie was zu essen und zu trinken haben und einen warmen Platz, an dem sie es sich bequem machen können und wo sie in Sicherheit sind. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass es so ist, dass sie leben und dass sie einen Ort gefunden haben, den sie ihr Zuhause nennen können.«
Teil 1
Exodus
Lass vor dich kommen das Seufzen der Gefangenen; durch deinen starken Arm erhalte die Kinder des Todes.
Psalm 79, 11
Kapitel Eins
Auf den ersten Blick erscheinen die Gestalten, die durch diese perfekt eingerichteten Gemäuer wandeln, wie Gutsherren, Anwohner eines eleganten alten Gehöfts, die inmitten ihrer mit Eiche vertäfelten Flure und pompös ausgestatteten Säle schlendern. Ab und zu stoßen sie sich gegenseitig an, und immer wieder hebt einer sein teigig bleiches Gesicht, um einen knurrenden Urschrei auszustoßen, aber dennoch wirken sie im Großen und Ganzen in diesen düsteren Räumen und tadellosen Gemächern nicht fehl am Platz. Einer ist soeben aus Versehen rückwärts über einen skandinavischen Divan gestolpert, wobei ihm die klebrigen purpurnen Eingeweide in schimmernden Fäden aus dem Bauch hängend zu Boden gefallen sind. Der ehemalige Automechaniker – noch immer in ein zerfetztes Arbeitshemd mit dem aufgestickten Namen FRED