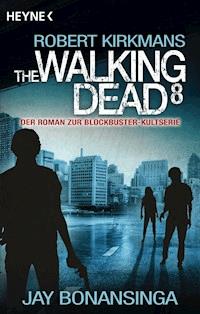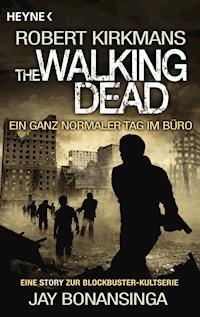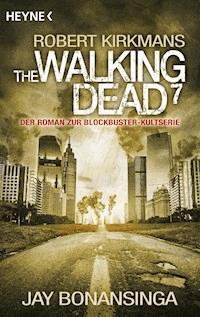
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Walking Dead-Romane
- Sprache: Deutsch
Fast scheint es, als könnten Lilly Caul und die anderen Überlebenden im Städtchen Woodbury eine Atempause schöpfen. Die Bedrohung durch den verrückten Prediger und seine Anhänger ist abgewendet, und nun denken Lilly und ihre Mitstreiter an den Wiederaufbau von Woodbury ...
Bis nach einem blutigen Überfall all ihre Kinder entführt werden. Diesmal steht alles auf dem Spiel, und Lilly schwört Rache. Mit seinem postapokalyptischen The-Walking-Dead-Universum hat Robert Kirkman ein internationales Bestseller-Phänomen erschaffen, in dem er einen schonungslosen Blick in die Abgründe der menschlichen Natur wirft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Fast scheint es, als könnten Lilly Caul und die anderen Überlebenden im Städtchen Woodbury eine Atempause schöpfen. Die Bedrohung durch den verrückten Prediger und seine Anhänger ist abgewendet, und nun denken Lilly und ihre Mitstreiter an den Wiederaufbau von Woodbury. Geplant ist sogar, die Straße nach Atlanta wieder instand zu setzen. Bis das Team nach einem langen Baueinsatz wieder nach Woodbury zurückkehrt und nur noch brennende Ruinen und ermordete Erwachsene vorfindet – aber keine Kinder. Nur wer hat sie entführt? Und warum auf einmal, wie aus dem Nichts, diese sinnlose Gewalt? Lilly schwört Rache. Die aufreibende Suche nach den Kindern beginnt. Niemand hat jedoch die Überlebenden auf das Grauen vorbereitet. Das wahrhaft Böse wartet da draußen … und es sind nicht bloß die Untoten.
Die Autoren
Jay Bonansinga studierte Filmwissenschaften am Columbia College in Chicago und zählt heute zu den vielseitigsten Thriller- und Horrorautoren der Gegenwart. Gemeinsam mit The Walking Dead-Erfinder Robert Kirkman schreibt er die Romane zur Erfolgsserie. Jay Bonansinga lebt mit seiner Familie in Evanston, Illinois.
Robert Kirkman ist der Schöpfer der mehrfach preisgekrönten und international erfolgreichen Comicserie The Walking Dead. Die gleichnamige TV-Serie wurde von ihm mit entwickelt und feierte weltweit Erfolge bei Kritikern und Genrefans gleichermaßen.
Mehr zu The Walking Dead auf:
www.diezukunft.de
Jay Bonansinga
Robert Kirkman’s
The Walking Dead 7
Roman
Deutsche ErstausgabeWILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
ROBERT KIRKMAN’S THE WALKING DEAD – SEARCH AND DESTROY
Deutsche Übersetzung von Wally Anker
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.Deutsche Erstausgabe 07/2017
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Copyright © 2016 by Robert Kirkman LLC
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld,
unter Verwendung von Fotolia/windu
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-20495-2V001www.diezukunft.de
Dieses Buch ist allenvermissten Kindern gewidmet
Teil 1
Steinsuppe
Errette, die man zum Tode schleppt, und entzieh dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken.
Sprüche 24,11-12
Eins
An jenem drückend heißen Altweibersommermorgen hat keiner der Eisenbahnarbeiter auch nur eine Ahnung davon, was gerade in der kleinen Siedlung von Überlebenden, ehemals bekannt als Woodbury, Georgia geschieht. Die Reparatur der Schienenstränge zwischen dem Städtchen Woodbury und den Vororten Atlantas bedarf ihrer ganzen Konzentration – das beschäftigt sie rund um die Uhr, und zwar schon seit beinahe zwölf Monaten –, und der heutige Tag bildet keine Ausnahme. Bald schon haben sie die Hälfte geschafft. In etwas weniger als einem Jahr haben sie die Strecke einer Länge von circa dreißig Kilometern geräumt und mit einem von Maschendraht verstärkten Weidezaun auf beiden Seiten abgesichert, um das Eindringen herumstreunender Untoter, wilder Tiere oder sonstiger Störenfriede, die über die Schienen wehen, sickern, wachsen, kriechen oder ranken, zu verhindern.
In diesem Augenblick hört die Anführerin der Gruppe, Lilly Caul, zu graben auf, erhebt sich und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Sie hat keine Ahnung, dass sich gerade eine Katastrophe mitten in Woodbury aufbaut.
Reflexartig hebt sie den Blick zum aschfahlen Himmel. Die Luft vibriert vom Brummen der vielen Insekten und trägt den faulen Geruch der umliegenden brachen Felder an ihre Nase. Das gedämpfte Wummern von Vorschlaghämmern – um Stifte in uralte Bahnschwellen zu treiben – liefert einen synkopierten Rhythmus für die schwitzenden Arbeiter. Unweit sieht Lilly die große Frau aus Haralson – jeder nennt sie Ash –, die die Baustellengrenze mit einer Bushmaster AR-15 an der Hüfte patrouilliert. Sie macht eine Show daraus, die Augen nach herumlungernden Untoten offenzuhalten, die von dem Lärm der Baustelle angelockt werden, aber auf einer tieferen Ebene ist sie hyperwachsam. Irgendetwas scheint nicht richtig. Niemand vermag es in Worte zu fassen, aber jeder spürt es.
Lilly zieht sich die verdreckten Handschuhe von den Händen und streckt die wunden Finger. Sie trägt ihre goldbraunen Haare in einem hastig geflochtenen französischen Zopf, sodass der unbarmherzige Sommer Georgias die Sonne auf ihren feingliedrigen, geröteten Nacken herabbrennen lässt. Ihre haselnussbraunen Augen, umringt von kleinen Krähenfüßen, suchen die Baustelle ab. Ihr Blick schweift über den Fortschritt der anderen Arbeiter entlang des Zauns. Obwohl Lilly Caul noch keine vierzig ist, haben sich bereits Sorgenfalten gebildet, die man erst bei viel älteren Frauen erwartet. Ihr schmales, jugendliches Gesicht ist in den vier harten Jahren, seitdem die Seuche über sie hereingebrochen ist, finsterer geworden. Ihre unerschöpflichen Energiereserven ließen während der letzten Monate nach, und ihre immerwährend hängenden Schultern verleihen ihr das Auftreten einer Frau mittleren Alters, obwohl sie noch immer ihre übliche Hipsterkluft in Form eines zerlumpten Indie-Rock-T-Shirts, einer kaputten Jeans, zerfledderter Motorradstiefel und unzähliger lederner Armreifen und Ketten trägt.
Jetzt erspäht sie einige umherwandelnde Untote hundert Meter westlich von ihr, die sich durch die Bäume schleppen – auch Ash hat sie bereits gesichtet. Man muss sich ihretwegen noch keine Sorgen machen, aber sie weiter im Auge behalten. Lilly betrachtet die anderen Mitglieder ihres Teams, die in regelmäßigen Abständen am Schienenstrang verteilt sind und den widerspenstigen, von Kopoubohnen und Scheinastern durchwurzelten Boden mit Handbaggern bearbeiten. Sie blickt in vertraute Gesichter, andere hingegen sind erst seit einigen Tagen dabei. Dort stehen Norma Sutters und Miles Littleton, unzertrennbar, seit sie vor über einem Jahr nach Woodbury kamen. Dahinter arbeitet Tommy Dupree, ein Junge im Alter von vierzehn Jahren, der wie dreißig wirkt. Die Pandemie hat ihn gestählt. Er ist ein Wunderknabe, wenn es um Feuer- oder Schlag- und Stichwaffen geht. Jinx Tyrell, eine Eigenbrötlerin aus dem Norden, hat sich als wahre Untoten-Killermaschine herausgestellt. Jinx zog vor wenigen Monaten nach Woodbury, nachdem Lilly sie angeheuert hatte. Das Städtchen benötigt Neuzugänge, um zu gedeihen, und Lilly ist dankbar, diese krassen Typen auf ihrer Seite kämpfend zu wissen.
Zudem arbeiten vereinzelte Anführer der umliegenden Ortschaften mit, die zwischen Woodbury und Atlanta liegen. Es handelt sich um gute, vertrauenswürdige Menschen wie zum Beispiel Ash aus Haralson, Mike Bell aus Gordonburg und eine Anzahl anderer, die sich Lillys Mannschaft aus Gründen gemeinsamer Interessen, Träume und Ängste angeschlossen haben. Einige sehen ihre Mission, die Ortschaften mit der großen Stadt im Norden anhand dieser eher schlecht als rechten Eisenbahnlinie zu verbinden, noch immer mit skeptischen Augen, aber viele haben sich ihr trotzdem angeschlossen, weil sie an Lilly glauben. Sie scheint diesen Effekt auf Menschen auszuüben – eine Art Osmose der Hoffnung –, und je länger diese Menschen an dem Projekt mitarbeiten, desto mehr werden sie Teil davon. Mittlerweile sehen sie es sowohl als einen bewundernswerten Versuch, ihre außer Rand und Band geratene Umwelt zu kontrollieren, als auch als eine Anstrengung, eine lang verlorene Zivilisation wieder herzustellen.
Lilly will sich gerade die Handschuhe wieder anziehen und weiterarbeiten, als der Mann namens Bell in einem knappen halben Kilometer Entfernung auf seinem Pferd mit merklichem Senkrücken von Norden um die Ecke galoppiert kommt. Der Anführer einer kleinen Gruppe Überlebender, die sich in einer Ortschaft, die sich früher einmal Gordonburg nannte, wacker schlagen, ist Mitte dreißig, klein gewachsen und weist einen rotblonden Schopf auf, der jetzt hinter ihm im Wind weht, während er sich rasch den Arbeitern nähert. Die anderen – Tommy, Norma, Miles – schauen von ihrem Tun auf, wie immer besorgt um ihre Freundin und Anführerin.
Lilly hüpft über den Schienenräumer auf den Schotter, als der Mann auf seinem räudigen Rotschimmel durch den trockenen Dunst auf sie zureitet.
»Da ist wieder einer im Weg«, ruft er ihr zu. Bei dem Pferd, ein unruhiger Zosse mit kräftigem Hals, handelt es sich wahrscheinlich um einen Mischling mit einem Schuss Arbeitsrappen. Bell bewegt sich mit dem ungeschickten Auf und Ab des autodidaktischen Reiters. Er zerrt an den Zügeln und hält auf dem Kies vor Lilly an, sodass er eine kleine Staubwolke aufwühlt.
Das Pferd wirft den Kopf wild hin und her, und Lilly kümmert sich sofort darum, nimmt es am Zaum und versucht es zu beruhigen. Dreckiger Schaum tropft aus seinem Maul, und es ist schweißnass. »Wieder ein was?«, fragt sie und blickt zu Bell auf. »Ein Untoter? Ein Wrack? Vielleicht ein Einhorn? … Was denn?«
»Eine Bockbrücke«, entgegnet Bell und gleitet vom Pferd, um mit einem Grunzen hart auf dem Boden zu landen. Der ehemalige IT-Typ aus Birmingham hat ein jungenhaftes, sonnenverbranntes Gesicht mit Sommersprossen und trägt selbstgemachte Cowboy-Überhosen aus Planen. Er hält sich für einen Jungen vom Land, aber allein die Art, wie er mit seinem Pferd kämpft, und sein nahezu makelloser Akzent weisen eindeutig auf einen Städter hin. »Ungefähr einen knappen Kilometer gen Norden«, fügt er hinzu und weist mit dem Daumen in die angegebene Himmelsrichtung. »Das Land fällt ab. Die Schienen führen fünfzig Meter über das klapprige Gerüst.«
»Und? Wie lautet die Prognose?«
»Du meinst mit der Brücke? Schwer zu sagen, aber das Holz ist schon ganz schön bemoost.«
»Hast du es dir genauer angeschaut? Oder bist du drüber geritten, um es zu testen oder so was?«
Er schüttelt mit dem Kopf. »Tut mir leid, Lilly. Ich dachte nur, du solltest sofort Bescheid wissen.«
Sie reibt sich die Augen und denkt nach. Es ist schon eine Weile her – mehrere Monate –, seit sie über eine Bockbrücke mussten. Und die war nur ein paar Meter lang. Sie macht den Mund auf, um etwas zu sagen, als das Pferd sich plötzlich aufbäumen will – entweder hat ein Geräusch oder ein von Menschennasen nicht aufspürbarer Geruch es erschreckt. Lilly wendet sich an das Tier und streichelt sanft seinen Widerrist. »Schhhhhh«, besänftigt sie es und fährt mit der Hand über die verfilzte Mähne. »Ist schon gut, Freundchen, beruhige dich wieder.«
Das Tier riecht nach Ziege. Seine mit Dreck verkrusteten, schweißnassen Fesseln geben einen moschusartigen Duft ab. Seine Augen sind ganz rot vor Anstrengung. Es ist vielleicht überraschend, aber dieser in Grund und Boden gerittene Rotschimmel – wie so ziemlich alle seine Artgenossen – ist mittlerweile so wertvoll für die Überlebenden wie bereits im neunzehnten Jahrhundert für solche Menschen, die versuchten, den Wilden Westen zu bändigen. Funktionierende Autos und Laster sind ein immer seltener werdender Anblick – auch wird das Pflanzenöl immer rarer, um Biodiesel herzustellen. Menschen mit Elementarkenntnissen der Pferdezüchtung sind heiß begehrt und werden als weise Führungspersonen angesehen, von denen erwartet wird, dass sie ihr Wissen weitergeben. Auch Lilly hat einige von ihnen in Woodbury eingebürgert.
Während der vorangegangenen Monate haben sie viele der uralten, völlig verrosteten Autokarosserien entzweigeschnitten und sie zu behelfsmäßigen Kutschen umfunktioniert, die von einem oder mehreren Pferden gezogen werden. In den Jahren seit Anbeginn der Seuche hat sich der Asphalt derart verschlechtert, dass an Reparaturen nicht mehr zu denken ist. Die Überreste der überwachsenen, zerfallenen und unwegsamen Straßen stellen einen Fluch für jeden Überlebenden dar. Das ist auch der Grund, warum sie ein sicheres, verlässliches und schnelles Transportsystem erschaffen wollen.
»Der führt sich schon den ganzen Tag so auf«, erklärt Bell und nickt respektvoll in Richtung Pferd. »Irgendetwas dort draußen gefällt ihm nicht, das mit Untoten aber nichts zu tun hat.«
»Und woher weißt du das? Es könnte doch ein Schwarm oder so etwas in der Art sein.«
»Wir sind heute früh an einigen von ihnen vorbeigeritten, was ihn nicht einmal gekratzt hat.« Er legt die Hand auf den Widerrist und flüstert dem Pferd zu: »Oder, Gipsy? Oder?« Bell blickt Lilly in die Augen. »Nein, heute liegt etwas anderes in der Luft. Ich kann es nicht genau ausmachen.« Er seufzt und wendet den Blick wie ein schüchterner Schuljunge ab. »Es tut mir leid, dass ich die Brücke nicht auf ihre Belastbarkeit geprüft habe – das war schon verdammt dumm von mir.«
»Verschwende keinen weiteren Gedanken daran, Bell«, lächelt Lilly ihn an. »Über sieben Brücken musst du gehen und so weiter.«
Bell kichert ein wenig zu hysterisch, hält Lillys Blick ein wenig zu lange. Andere halten in der Arbeit inne und schauen zu den beiden. Tommy stützt sich auf seine Schaufel und grinst. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Bell sich Hals über Kopf in Lilly verschossen hat, aber es ist nichts, was Lilly sonderlich interessiert. Sich um die Dupree-Kinder zu kümmern füllt bereits ihr ganzes Privatleben, und außerdem trauert sie noch immer all den Menschen nach, die sie je geliebt hat. Sie ist einfach noch nicht bereit, sich in einer weiteren Liebschaft zu verlieren, was aber nicht heißt, dass sie nicht ab und zu an Bell denkt – für gewöhnlich nachts, wenn der Wind durch die Gassen fegt und die Einsamkeit sie schier zu erdrücken droht. Sie träumt davon, mit den Fingern durch Bells großartigen dichten Rotschopf zu fahren, stellt sich vor, wie sein heißer Atem auf ihr Schlüsselbein trifft …
Lilly schüttelt das wehmütige Nachsinnen von sich und zieht eine alte Westclox-Taschenuhr aus der Hüfttasche. Sie hängt an einer angelaufenen Uhrenkette – ehemals war sie im Besitz von Bob Stookey, Lillys bestem Freund und Mentor, der vor etwas über einem Jahr einen heroischen Tod starb, indem er unter anderem auch die Kinder von Woodbury rettete. Vielleicht ist das der Grund, warum Lilly so gut wie jedes Waisenkind in Woodbury adoptiert hat. Sie trauert noch immer ihrer Fehlgeburt nach, dem Funken Leben, der Josh Hamiltons Nachkömmling hätte sein können, den sie aber im Tumult des Regimes des Governors verloren hatte. Vielleicht ist sie deswegen als Ersatz-Mama wie geschaffen. Zudem ist es ein integraler Bestandteil des Überlebens an sich – ein angeborener Teil ihrer eigenen Zukunft wie auch der Zukunft der gesamten Menschheit.
Sie wirft einen Blick auf das vergilbte Ziffernblatt und ist überrascht, dass es schon fast Mittag ist.
Sie hat keinen blassen Schimmer davon, dass ihre Stadt bereits seit über einer Stunde angegriffen wird.
Als Lilly noch ein kleines Mädchen war, erzählte ihr Vater, Everett Caul, ihr einmal eine Geschichte über die Steinsuppe. Es handelt sich um ein beliebtes Volksmärchen mit unzähligen Versionen in verschiedenen Kulturen. Drei umherwandernde, völlig ausgehungerte Fremde stoßen auf ein kleines Dorf. Einer der Fremden hat eine Idee. Er sucht und findet einen weggeworfenen Kochtopf, sammelt Steine zusammen und füllt den Topf mit Wasser aus dem naheliegenden Bach auf, woraufhin er Feuerholz sammelt und es anzündet, um die Kieselsteine zu kochen. Die Dorfbewohner werden neugierig. »Ich mache Steinsuppe«, erzählt er ihnen auf die Frage, was er denn dort treibe. »Und ich lade Sie gerne zum Essen ein, wenn sie fertig ist.« Ein Bewohner nach dem anderen zeigt sich hilfsbereit. »Ich habe ein paar Karotten im Garten«, offeriert einer. »Wir haben ein Huhn«, meint ein anderer. Und bald schon wird aus der Steinsuppe ein wohlriechendes Mahl aus Gemüse, Fleisch und Kräutern aus dem Dorf.
Vielleicht erinnerte sich Lilly Caul ja an ihre Lieblingsgutenachtgeschichte, als sie sich dazu entschied, die diversen Gemeinden von Überlebenden mit der großen Stadt im Norden anhand der brachliegenden Schienenstrecke zu verbinden.
Ihr kam die Idee das erste Mal Anfang letzten Jahres nach einem Treffen mit den Anführern der fünf größten Siedlungen. Es fand in Woodburys ehrwürdigem alten Gerichtsgebäude statt und sollte eigentlich darum gehen, Ressourcen und Informationen zu bündeln und zu teilen und sich gegenüber den anderen Städtchen im zentralen Georgia gefällig zu zeigen. Als die Anführer sich aber darüber ausließen, wie angespannt ihre eigene Lage angesichts der Nahrungsmittelknappheit und der Gefahren war, die stets auf Reisen um jede Ecke lauerten, und wie isoliert sie sich in ihrem Stück Hinterland fühlten, entschied Lilly sich, dagegen anzugehen. Anfangs erzählte sie niemandem von ihrem Plan. Stattdessen begann sie einfach damit, die uralten und brachliegenden Schienen der West-Central-Georgia-Chessie-Seaboard-Linie, die durch Haralson, Senoia und Union City führten, zu säubern und zu reparieren.
Sie fing klein an, nicht mehr als einige Stunden am Tag, zusammen mit Tommy Dupree, Hacke, Schaufel und einer Harke. Es war mühsame Arbeit – sie schafften nicht mehr als zwei oder drei Dutzend Meter am Tag, und das bei brütend heißem Sonnenschein und der immerwährenden Präsenz von Untoten, die von dem Lärm angezogen wurden. In diesen Anfangstagen mussten sie und der Junge unzählige Zombies aus dem Weg schaffen, die allerdings das geringste ihrer Probleme darstellten, denn der Boden machte ihnen wesentlich mehr zu schaffen.
Niemand kann sich die Tatsache erklären, aber das Ökosystem hat sich seit Anbeginn der Seuche während der letzten vier Jahre stark verändert. Opportunistisches Unkraut und wilde Gräser erobern Entwässerungsgräben, verstopfen Bachbetten, lassen ganze Straßen unter sich verschwinden. Kopoubohnen haben sich derart vermehrt, dass ganze Werbetafeln, Scheunen, Bäume und Telefonmasten unter ihren Ranken begraben sind. Die grüne Revolution bewirkt, dass alles unter einem Teppich saftiger Vegetation nach Atem ringt, selbst die unzähligen menschlichen Überreste, die noch immer in Gattern und Gräben liegen. Die Welt hat Haare bekommen, und die schlimmsten haben sich um den stählernen Schienenstrang der Chessie-Seaboard-Line in widerspenstigen Ranken so dick wie Kabel gewickelt.
Wochenlang kämpften Lilly und der Junge gegen die unerbittlichen Schlingpflanzen an, schwitzten in der Sonne, zogen den Bollerwagen mit quälender Langsamkeit hinter sich über den gerodeten Boden gen Norden. Aber die laute Arbeit – ähnlich wie der kochende Sud der Fremden in der Geschichte der Steinsuppe – zog neugierige Blicke auf sich. Menschen lugten über die Verteidigungswälle ihrer Gemeinden entlang des Wegs. Manche traten hervor und halfen mit. Es dauerte nicht lange, ehe Lilly mehr Mitarbeiter zur Verfügung hatte, als sie sich je zu erträumen gewagt hätte. Es gab sogar Leute, die ihre Werkzeuge wie Stangenbohrer, Handrasenmäher und Sensen zur Verfügung stellten. Andere brachten ihr Karten der stillgelegten Bahnlinien, die sie aus Bibliotheken entwendet hatten, handbetriebene Handfunksprechgeräte, die für Kommunikations- und Aufklärungszwecke unabdinglich wurden, und Waffen zur Verteidigung. Es herrschte allgemeine Faszination über Lillys donquijotisches Vorhaben, den Schienenstrang den gesamten Weg bis Atlanta freizulegen, und es dauerte nicht lange, ehe diese Faszination einen ungewollten Nebeneffekt heraufbeschwor, der sogar Lilly überraschte.
Im zweiten Monat des Projekts sahen die Menschen Lillys törichtes Projekt als Vorbote einer neuen Ära, gar als einen Anstoß für eine neue regionale Regierung in dieser postapokalyptischen Welt. Und niemand konnte sich einen besseren Anführer für dieses neue Regime vorstellen als Lilly Caul höchstpersönlich. Zu Beginn des dritten Monats wurde Lilly einstimmig als offizielle Repräsentantin von Woodbury gewählt, eine Tatsache, die ihr viel Verdruss bereitete. Sie sah sich nicht als Politikerin oder Anführerin oder – Gott verhüte – als Governor. Das höchste der Gefühle für sie war vielleicht ein Posten im mittleren Management.
»Für den Fall, dass es jemanden interessiert«, ertönt eine Stimme hinter Lilly, als sie in ihrer Tasche nach ihrer dürftigen Brotzeit herumkramt. »Wir haben gerade die Vierzig-Kilometer-Marke geknackt.«
Die Stimme gehört Ash. Sie gebärdet sich mit dem selbstbewussten Stolzieren einer Sportlerin, o-beinig und muskelbepackt. Heute trägt sie einen Patronengurt aus der Zeit des Vietnamkriegs mit einer Reihe von Magazinen à zwanzig Patronen über ihrem Hank-Williams-Jr.-Tanktop und ein Kopftuch um ihre rabenschwarzen Haare. Ihre Kluft lässt nicht auf ihren ehemaligen, eher aristokratischen Lebensstil in einer reichen Enklave des Nordostens schließen. Sie schlendert mit einer halb gegessenen Dose Frühstücksfleisch in der einen Hand und einer zerknüllten Karte in der anderen herbei. »Der Platz da noch frei?«, erkundigt sie sich und zeigt auf einen nicht besetzten Baumstumpf.
»Mach’s dir bequem«, lädt Lilly sie ein, ohne aufzublicken, während sie noch immer in ihrer Tasche nach der Portion getrockneter Früchte und Rinderdörrfleisch sucht, die sie bereits seit Wochen rationiert. Sie sitzt auf einem mit Moos bewachsenen Stein. Endlich hält sie ihr Mittagessen in den Händen. In letzter Zeit sah man kaum noch etwas anderes als Nahrungsmittel mit langen Verfallsdaten – wie etwa Rosinen, Dosenfutter, getrocknetes Fleisch oder Tütensuppen – in Woodbury. Die Gärten waren komplett abgeerntet, und es ist schon eine Weile her, dass sich Frischfleisch in Form von Wild oder Fisch in die Nähe des Städtchens verirrte. Woodbury musste unbedingt seine landwirtschaftlichen Kapazitäten erweitern, und Lilly beackerte bereits seit Monaten die umliegenden Felder.
»Dann lass uns das mal ausrechnen.« Ash steckt die Karte zurück in ihre Tasche, setzt sich neben Lilly und führt einen weiteren Löffel des Frühstücksfleischs in den Mund. Sie leckt sich die Lippen, als ob es Foie Gras wäre. »Wir sind seit letztem Juni an der Arbeit. Und wenn wir so weitermachen – dann was? Dann würden wir die Stadt nächsten Sommer erreichen?«
Lilly schaut sie fragend an. »Und? Ist das gut oder schlecht?«
Ash lächelt. »Ich bin in Buffalo aufgewachsen, wo ein Bauprojekt länger andauert als die meisten Ehen.«
»Das heißt dann wohl, dass wir ganz gut in der Zeit liegen.«
»Besser als nur ganz gut.« Ash wirft einen Blick über die Schulter auf die anderen Arbeiter, die auf der Baustelle verstreut ihr Mittag essen. Einige sitzen auf den Schienen, andere im Schatten der riesigen uralten knochigen Eichen. »Ich frage mich nur, ob wir dieses Tempo beibehalten können.«
»Glaubst du etwa nicht?«
Ash zuckt mit den Achseln. »Einige der Leute beschweren sich, dass sie kaum noch Zeit mit ihren Familien verbringen.«
Lilly nickt und mustert den Dschungel aus Kopoubohnen, der sich über den Boden erstreckt. »Ich finde, wir können eine Pause im Herbst einlegen, wenn die Regenfälle einsetzen. Dann haben wir auch eine Chance …«
»Tut mir leid, wenn ich wie eine Schallplatte mit einem Sprung klinge«, meldet sich eine Stimme hinter Ash, unterbricht sie und zieht Lillys Aufmerksamkeit fort von der dichten Flora im Osten. Sie sieht den schlaksigen, x-beinigen Mann mit dem Fedora-Hut und den Kakishorts, der von den Pferden weg auf sie zuschreitet. »Aber kann mir jemand erzählen, warum niemand auch nur die geringste Ahnung hat, wie es um unsere Treibstoffvorräte bestellt ist?«
Lilly seufzt. »Atme tief durch, Cooper. Iss dein Mittagsmahl, damit dein Blutzucker wieder den normalen Pegel erreicht.«
»Das ist kein Witz, Lilly.« Der knochige Mann stellt sich, die Hände in die Hüften gestemmt, vor ihr auf, als ob er auf einen Bericht wartet. An seinem Sam-Browne-Gürtel hängt ein Halfter mit einem Colt Single Action Army, und von der anderen Seite baumelt ein aufgerolltes Seil. Er streckt sein markantes Kinn beim Reden vor, sodass er wie ein draufgängerischer Abenteurer wirkt. »Das habe ich schon viel zu oft mitmachen müssen.«
Lilly wirft ihm einen Blick zu. »Was hast du schon viel zu oft mitmachen müssen? Hat es schon einmal eine Seuche gegeben, die ich verpasst habe?«
»Du weißt genau, was ich meine. Ich komme gerade von dem Depot in Senoia, und die haben noch immer keinen Treibstoff in der Umgebung gefunden. Lilly, ich sage es dir im Guten, aber ich habe mit eigenen Augen zu viele Projekte scheitern sehen, weil die Treibstoffsituation außer Kontrolle geriet. Wenn du dich erinnerst, war ich mit dabei, als wir …«
»Ich weiß, das hast du uns bereits gesagt, und zwar mehr als nur einmal. Wir kennen die Geschichte in- und auswendig. Deine Firma hat mehr als ein Dutzend der höchsten Wolkenkratzer in Atlanta gebaut.«
Cooper schnaubt, und sein hervorstehender Adamsapfel bebt vor Frustration. »Ich will damit nur sagen, dass … dass ohne Treibstoff nichts geht. Ohne Sprit machen wir uns die ganze Mühe umsonst. Dann liegen die Schienen sauber geputzt da, führen aber nirgends hin.«
»Cooper …«
»Damals in ’79, als die OPEC an der Preisschraube gedreht und der Iran die Hähne zugemacht hat, mussten wir drei Projekte, drei Wolkenkratzer auf der Peachtree an den Nagel hängen. Die Fundamente standen da wie Dinosaurier in Teergruben.«
»Okay, jetzt hör mal bitte zu …«
Eine weitere Stimme hinter Ash meldet sich zu Wort. »Hey, Indiana Jones! Jetzt halt doch endlich den Mund!«
Alle Köpfe drehen sich zu Jinx um, der jungen Landstreicherin, die Lilly Anfang des Jahres aufgenommen hat. Sie ist eine wechselhafte, brillante, durchgeknallte Person mit bipolarer Störung und trägt ständig ihre schwarze Lederweste, sodass ihre vielen Tattoos zur Schau gestellt werden, eine Reihe Messer, die von ihrem Gürtel hängen, und die runde Sonnenbrille im Steampunk-Stil. Sie kommt in rasanter Geschwindigkeit auf Lilly und Cooper zu und hat die Hände zu Fäusten geballt.
Cooper Steeves weicht zurück, als ob er es mit einem tollwütigen Tier zu tun hat.
Jinx stellt sich vor ihm auf, ihr Körper angespannt wie ein Bogen. »Warum hast du es dir eigentlich zur Aufgabe gemacht, diese Frau tagein tagaus zu nerven?«
Lilly steht auf und versucht Jinx zu beruhigen. »Ist schon gut. Ich habe das im Griff.«
»Lass es gut sein, Jinx. Wir unterhalten uns hier nur.« Cooper Steeves lautes Gepolter vermag seine Angst vor der jungen Frau kaum zu verschleiern. »Du benimmst dich vollkommen daneben.«
Jetzt springen auch Miles und Tommy auf und stellen sich hinter Ash. Ihre Gesichter sind zerknirscht. Sie warten offensichtlich ab, ob sie eingreifen müssen. Während des letzten Jahres, wahrscheinlich mehr der enormen Hitze geschuldet als dem Stress, sich im Freien zu befinden, ist es immer wieder zu fürchterlichen Streitereien und sogar zu einigen Faustkämpfen entlang der Baustelle gekommen. Jetzt aber ist jeder wachsam. Selbst Norma Sutters, Vollweib und Zen-artige ehemalige Chorleiterin, legt langsam ihre dicke Hand auf den Griff ihres .44ers.
»Jetzt beruhigt euch alle!« Lilly hebt die Hände und spricht in angespanntem, aber entschiedenem Tonfall. »Jinx, verschwinde. Und Cooper, du hörst mir jetzt gut zu. Deine Bedenken sind vollkommen gerechtfertigt. Ich muss dir aber auch mitteilen, dass wir uns mehr und mehr Biodiesel zusammenbrauen und bereits eine Lok in Woodbury steht, die wir umfunktioniert haben und die mit dem Saft läuft. Außerdem haben wir Pferdewägen und einige Draisinen, mit denen wir auf den Schienen fahren können, bis wir mehr Loks umgebaut haben. Okay? Bist du jetzt glücklich?«
Cooper Stevens senkt den Blick zu Boden und stößt einen frustrierten Seufzer aus.
»Okay, jetzt hört alle zu!« Lilly lässt den Blick über die gesamte Truppe schweifen. Kurz hebt sie ihn gen Himmel, kneift die Augen zusammen, richtet sich dann aber wieder an die Menschen. »Lasst uns zunächst essen. Dann roden wir noch hundert Meter und zäunen sie ein, ehe wir für heute Schluss machen.«
Um vier Uhr an jenem Nachmittag rollte eine dünne Wolkenschicht über Central Georgia und blieb dort hängen. Der Nachmittag wurde grau und windig. Der Wind wehte den Menschen den Geruch von Rost und Verwesung in die Nasen. Das Tageslicht wurde diffus, reduzierte sich zu einem bloßen Leuchten hinter den Hügeln im Westen. Erschöpft, in Schweiß gebadet, mit vor unerklärlicher nervöser Anspannung prickelndem Nacken, ruft Lilly das Ende der Arbeiten aus. Endlich sieht sie ebenjene, Unheil verheißende Bockbrücke in der Ferne, von der Bell ihr erzählte. Die Schienen führen über sie in eine dicht bewaldete Senke. Die Brücke erinnert an das Bollwerk einer gotischen Zugbrücke. Das uralte, mehr als reparaturbedürftige, schimmelschwarze Gebälk ist mit Ranken und wildem Efeu überwachsen und schreit förmlich nach Befreiung und Fürsorge – das aber bedeutet einen irrwitzigen Aufwand, den Lilly auf morgen zu verschieben mehr als willig ist.
Sie möchte zusammen mit Tommy Dupree in einer der behelfsmäßigen Kutschen nach Hause reiten – die ausgebrannte Karosserie eines SUVs, dessen Motor, Vorderreifen und Seitenwände abmontiert und ausgebaut wurden, damit zwei Arbeitspferde davor gespannt werden konnten. Tommy hat ein ausgeklügeltes Zügelsystem mit unzähligen Laufknoten entworfen, und zwischen dem Schnauben und dem Hufklappern der Pferde und dem Knarren und Knarzen der ausgebrannten Karosserie veranstaltet die behelfsmäßige Kutsche einen Höllenlärm, als sie den Schotterweg hinabfahren, der in die südlichen Tabakfelder mündet.
Einspurig fahren sie vor sich hin, Tommys Kutsche allen voran. Dahinter befinden sich die restlichen Arbeiter, einige auf Pferderücken, andere in ähnlich zusammengebastelten Fuhrwerken.
Als sie den Highway 85 erreichen, teilt sich der Konvoi, um zurück nach Hause gen Osten und Norden zu fahren. Bell Cooper und seine Männer nicken den anderen zu, als sie gen Westen abbiegen und im trockenen Dunst des späten Nachmittags verschwinden. Ash winkt Lilly noch einmal zu und führt dann das halbe Dutzend ihrer Leute um die Überreste eines umgestürzten Greyhound-Busses, der auf der nach Norden führenden Spur liegt, zurück nach Haralson. Mit den Jahren ist die Karosserie völlig ausgeblichen und von der Vegetation völlig verschlungen, sodass es den Anschein erweckt, als ob die Erde selbst sich die metallene Schale einverleibt. Lilly wirft einen Blick auf ihre Taschenuhr. Es ist beinahe fünf. Sie würde es bevorzugen, vor Einbruch der Dunkelheit in Woodbury anzukommen.
Erst als sie die bedachte Brücke über den Elkins Creek erreichen, sehen sie die ersten Anzeichen des Angriffs.
»Warte … Was soll das? Was zum Teufel …?«, entfährt es Lilly, und sie rutscht auf ihrem Sitz nach vorne und starrt auf den zinnfarbenen Himmel über Woodbury, das in ungefähr drei Kilometern Entfernung vor ihnen liegt. »Was zum Geier geht da vor sich?«
»Warte!« Tommy reißt an den Zügeln und lenkt die Kutsche durch die Finsternis der bedachten Brücke. »Was war das, Lilly? War das etwa Rauch?«
Die dunklen Schatten scheinen sie einen Augenblick lang zu verschlucken, als die Pferde das Gefährt über die stinkende Brücke ziehen. Der Lärm hallt von den mit verwittertem Holz beschlagenen Wänden und dem Dach wider. Als sie auf der anderen Seite wieder das Tageslicht erblicken, ist Jinx längst an ihnen vorbeigeritten und lenkt ihr Pferd auf einen naheliegenden Hügel zu.
Lillys Herz beginnt zu rasen. »Jinx, kannst du etwas erkennen? Ist das Rauch?«
Sie erreicht den Scheitelpunkt, reißt an den Zügeln, um das Pferd anzuhalten, und holt dann ihr Fernglas hervor. Sie lugt hindurch und regt keinen Muskel ihres Körpers. Zwanzig Meter unter ihr tut Tommy Dupree es ihr gleich und hält die Kutsche auf dem Schotterweg an.
Lilly hört, wie die anderen hinter ihnen ebenfalls zum Stillstand kommen. Sie hört Miles Littletons Stimme: »Was geht da vor sich?«
Lilly wendet sich wieder zu Jinx um und brüllt: »Jinx, was passiert da?«
Jinx aber sitzt so steif wie ein Mannequin auf ihrem Pferd und starrt weiterhin durch den Feldstecher. In der Ferne erhebt sich eine Rauchwolke, so schwarz wie Tusche, vom Zentrum ihres Städtchens gen Himmel.
Zwei
Sie nähern sich von Nordosten. Die Gespanne holpern über stillgelegte Schienenstränge, als sie den Rangierbahnhof überqueren. Die Luft knistert und stinkt nach brennendem Holz und Schießpulver. Die Überreste von Untoten liegen überall auf dem verlassenen Grundstück neben dem Bahnhof herum, und der Verteidigungswall vor ihnen weist Reihen über Reihen von Einschlaglöchern auf, die wie die aneinandergereihten Perlen an einer Halskette aussehen. Innerhalb der sicheren Zone steigt Rauch aus einer Reihe von Gebäuden auf, der entweder einem Feuer oder einem andauernden Feuergefecht geschuldet ist. Lilly kämpft gegen die Versuchung an, sich Hals über Kopf in den Kampf zu begeben – sie muss zuerst die Lage sondieren, einschätzen, mit wem und was sie es zu tun haben. Während der letzten zehn Minuten hat sie erfolglos versucht, David Stern auf dem Handfunksprechgerät zu erreichen, und die Funkstille hallt jetzt in ihrem Schädel wider.
Sie sieht ein Auto mit kaputter Windschutzscheibe an der Ecke von Dogwood und Main Street stehen. Die Fahrertür ist weit aufgerissen, und schwarzer Rauch quillt von einem Stück des Verteidigungswalls empor, der dem Ansturm offensichtlich nicht standgehalten hat. Lillys Herz pocht noch schneller, als sie die Verwüstung anschaut – all die schwelenden Flammen innerhalb des Walls, die Einschlaglöcher, die zerborstenen Fenster und die Reifenspuren und Trümmer, die sich über dem Baugelände zwischen Jones Mill und dem Whitehouse Parkway erstrecken. Diese kreisförmigen Spuren und die unzähligen zerfetzten Pappkartons und Scherben lagen heute früh noch nicht dort, als die Arbeiter Woodbury verließen.
Lilly überprüft ihre Pistole. Seit dem Anfang der Seuche trägt sie die Ruger SR22 bei sich. Ein ehemaliger Bewohner Woodburys namens Martinez hat einmal sechs auf einen Schlag in einem Walmart gefunden und Lilly davon zwei gegeben. Den größten Vorteil dieser Waffe bildet zunächst die Tatsache, dass es einen Überfluss an passender Munition gibt: .22-Kaliber-Patronen wurden in quasi jedem Sportladen im Süden der Vereinigten Staaten verkauft und kosteten weniger als fünf Cent pro Stück, sodass Lilly normalerweise stets ganze Kartons auf Regalen, in Schließfächern oder Schreibtischschubladen mitgehen lassen konnte – ganz gleich, wo sie sich befand. Es schienen immer irgendwelche Überreste von American Eagle oder Remington-Hohlspitzgeschossen herumzuliegen. Aber das war damals, und jetzt ist jetzt, und in letzter Zeit ist sie nicht mehr so oft fündig geworden. Lilly hat nur noch einhundert kupferplattierte CCI-Patronen übrig, die sie sich einteilen muss. So verschwendet sie zum Beispiel keine Munition mehr an Untote, wenn es eine Schaufel oder eine Axt genauso tut.
»Wir lassen die Kutsche und die Pferde hier. Es ist besser, wenn wir zu Fuß weitergehen«, weist sie Tommy an, der sofort einlenkt und den Konvoi um die Ecke zum nördlichen Rand der Stadt führt. Er hält neben einer kleinen Gruppe Palmen an, reißt an den Zügeln und klettert aus der Kutsche, um die Pferde festzubinden. Lilly wirft einen Blick über die Schulter und sieht Jinx und Miles, die rasch zu ihnen aufholen. Norma sitzt in ihrer Kutsche und lässt in den giftigen Wind Staubteufel aufsteigen. Unbeholfen bringen sie ihre Pferde zum Stehen, steigen ab und überprüfen ihre Waffen. Lilly zieht das Magazin heraus und checkt, wie viel Munition sie noch hat. Es ist voll. Zehn Kugeln warten auf ihre Opfer. »Es hat ganz den Anschein, als ob das Schlimmste schon längst vorbei ist.«
Der düstere Tonfall ihrer Stimme verbreitet eine unheilvolle Atmosphäre, die aber eher ihrer Erschöpfung als ihrer Angst geschuldet ist, und lässt Tommy aufhorchen.
»Wer würde denn so etwas tun?«, fragt er, und es klingt, als ob seine Kehle vor lauter Verzweiflung und der Unfassbarkeit der Situation zugeschnürt ist. Er lässt den Blick über die verlassene Post aus Ziegelstein schweifen, deren Fenster mit Brettern verschlagen sind, gefolgt von uralten Postern von lächelnden Postboten und fein säuberlich hergerichteten Familien, die ihr Glück kaum fassen können, endlich ein Paket von ihrer Tante Edna zu empfangen. »Wieso zum Teufel sollte jemand so etwas …?«
»Konzentriere dich, Tommy.« Lilly deutet auf den dicht bewachsenen Hain Richtung Süden. »Wir gehen durch das Südtor … wenn es denn überhaupt noch existiert.« Sie schaut die anderen über die Schulter hinweg an. »Haltet stets die Augen nach Feinden offen. Kämpft euch geduckt vor und haltet euch den Rücken frei.« Alle nicken. »Okay, dann mal los.«
Eine Welle der Emotionen droht Lilly zu ertränken, als sie die Meute an dem Piggly-Wiggly-Laden vorbei Richtung Tor anführt. Die Stille scheint sie alle zu zermürben. Bisher gibt es noch kein Lebenszeichen von David oder Barbara, keine Geräusche von Überlebenden von der anderen Seite des Walls. Sie sehen aber auch keine Untoten. Wo verdammt nochmal stecken die bloß alle? Adrenalinschocks schießen Lillys Rückgrat hinunter. Das Verlangen, die Stadt zu stürmen, ist so heftig, dass es ihr beinahe den Atem raubt. Ihre Gedanken gelten den Dupree-Kindern, die sich irgendwo dort drinnen befinden, den Sterns, Harold und Mama May und Clint Sturbridge. Aber sie kämpft erfolgreich dagegen an, denn sie weiß, dass sie zuallererst das Risiko einschätzen muss. Sie müssen rasch und leise vorgehen und herausfinden, mit wem sie es zu tun haben.
Lillys Blick wird kurzzeitig abgelenkt und richtet sich auf das Wäldchen hinter dem Supermarkt-Parkplatz. Dort liegen die Überreste Dutzender Untoter in der Nähe der Baumgrenze inmitten der noch immer dichten blauen Schießpulverschwaden.
Langsam fügen sich die Puzzleteile vor ihrem inneren Auge zusammen und ergeben ein Bild des Angriffs. Wer auch immer die Stadt überfallen hat, kam wahrscheinlich von Nordosten. Zuerst schalteten sie die umherstreunenden Zombies aus, die bis zu diesem Morgen in dem Wäldchen verweilten. Und bei dem Anblick des Gemetzels – die meisten Kreaturen waren mit einem einzigen Kopfschuss abgefertigt worden und lagen nun in einer Reihe entlang der Waldgrenze – kommt Lilly zu dem Schluss, dass ihre Widersacher bis aufs Äußerste durchorganisiert und Meister ihres Handwerks sind. Aber wieso? Warum verschwenden die ihre Energie und Ressourcen auf etwas nahezu Unmögliches wie den Angriff auf eine Stadt?
Sie schluckt die in ihr aufsteigende Panik wieder hinunter, während sie über die Folk Avenue zum Tor eilen. Während des letzten Jahres ist Woodbury stetig autarker geworden – ein weiteres Ziel Lillys –, sowohl vor dem Verteidigungswall als auch in der sicheren Zone. Die kleinen einstöckigen Häuser an der Folk Avenue wurden mit behelfsmäßigen Solarpaneelen ausgerüstet. Riesige Tanks waren voller gefilterten Wassers, das zum Duschen und Waschen genommen werden konnte, und in jedem Garten stand ein riesiger Komposthaufen, um Muttererde herzustellen. Vor einigen Monaten begann David Stern damit, Pferdeäpfel zu sammeln und auf die Komposthaufen zu werfen, um auch die letzten ihrer natürlichen Ressourcen nicht verkommen zu lassen.
Lilly hält vor dem Tor inne. Sie redet schnell, flüstert gerade laut genug, dass jeder sie über den Wind hören kann. »Haltet euch zusammen. Vermeidet zu reden, es sei denn, es ist unbedingt notwendig, und spart Munition. Falls ihr über einen Zombie stolpert, benutzt die Klinge. Und seht euch vor. Ich will auf gar keinen Fall, dass einem von uns etwas passiert.«
Tommy schluckt hart. »Und was, wenn es eine Falle ist?«
Lilly senkt den Blick zu Boden, transportiert eine Kugel in den Lauf ihrer Ruger und vergewissert sich, dass sie auch tatsächlich am beabsichtigten Ort ist, ehe sie die Waffe entsichert, um sich dann endlich wieder Tommy zu widmen. »Wenn es eine Falle ist, werden wir uns aus ihr herauskämpfen.«
Mit einem Nicken packt sie ihre Waffe mit beiden Händen und führt die anderen durch das Tor.
Während der ersten zwei Jahre der Seuche mussten die Überlebenden die harte Wahrheit über einander lernen: Während die Untoten nichts weniger als eine Herausforderung für die Menschheit darstellten, so ließ es sich doch nicht verleugnen, dass die echten Gefahren von den Lebenden ausgingen. Eine ganze Zeit lang schien die Welt der Menschen nichts weiter als eine Arena für Stammeskonflikte, Barbarei, opportunistische Verbrechen und territoriales Machtgehabe zu sein. Seit Kurzem aber sieht das anders aus. Die Anzahl der Verbrechen, die von Lebenden an ihren Mitmenschen ausgeübt werden, sind seltener. Grundlose Angriffe stehen schon lange nicht mehr auf der Tagesordnung. Es hat beinahe den Anschein, als ob die Überlebenden die Schnauze voll haben, sich zu prügeln – es nimmt zu viel Zeit in Anspruch, stört den normalen Betrieb und ist einfach völlig unlogisch. Einzelne Egos haben sich dem drohenden Untergang unterworfen. Die Kraft ist viel besser eingesetzt, wenn man sich auf die Defensive konzentriert. Das sind die Hauptgründe, warum Lilly und ihre Truppe sich den Kopf über diesen unerklärlichen Angriff zerbrechen. Noch rätselhafter ist das, was sie auf dem Boden vor der Treppe zum Gerichtsgebäude erwartet.
»Halt!«, zischt Lilly den anderen zu, reißt eine Hand in die Luft und gibt ihnen mit einer raschen Bewegung derselben zu bedeuten, sich gegen die Wand der Gasse zu drängen, von der aus man den kleinen Platz mit Bäumen überschauen kann, der vor dem altertümlich gehaltenen Gebäude angelegt worden war.
Mit der abblätternden weißen Farbe, den dekorativen Säulen und der kupferfarbenen Kuppel steht das im römischen Stil gehaltene Gerichtsgebäude seit über hundert Jahren hier und hat seit Beginn der Seuche als eine Art Gemeinschaftszentrum für das Städtchen gedient. Die verschiedenen Regimes, die hier ihre Macht ausübten – auch der Tyrann Philip Blake –, benutzten es für zeremonielle Zusammenkünfte, Nachbesprechungen, Planungsgespräche und für die Lagerung gemeinschaftlicher Ressourcen. Auch heute noch tagt der Rat der fünf Siedlungen im Hinterzimmer des Gerichtsgebäudes. Jetzt stehen die beiden Flügeltüren oben auf der Treppe weit offen, und Papier und Müll liegen auf dem Boden des Foyers verstreut umher. Es sieht aus, als sei es geplündert worden. Aber das stört Lilly in diesem Augenblick gar nicht so sehr. In dieser unheimlichen Stille, die sich über das Städtchen gelegt hat – die Feuer haben sich so gut wie ausgebrannt, der blaue Rauch verzieht sich bereits, die Angreifer sind schon längst über alle Berge –, stört Lilly mehr als alles andere, dass sie noch keinen ihrer Mitbewohner gesehen oder gehört haben.
Bis jetzt.
»Um Gottes willen«, ertönt die angespannte Stimme Norma Sutters hinter Lilly. »Ist das etwa Harold? Lilly, ist das Harold?!«
»Norma, reiß dich zusammen!« Lilly schaut die anderen ernst an. »Das gilt für euch alle. Reißt euch zusammen und rührt euch nicht vom Fleck!«
In fünfzig Meter Entfernung liegt der Körper eines betagten Afroamerikaners bewegungslos in der Lache seines eigenen Bluts auf dem Boden. Miles Littleton nähert sich Norma und legt einen Arm um sie. »Ist schon okay, Schwester.«
»Lass mich zufrieden!« Norma schnaubt empört und voller Schmerz und befreit sich von ihm. »Das ist Harold!«
»Reiß dich zusammen, verdammt nochmal!« Lilly hält ihre Waffe schussbereit an der Hüfte vor dem Körper, kurz unterhalb ihres Blickfelds – genau wie Bob es ihr beigebracht hatte –, während sie rasch die Umgebung der Leiche auf der steinernen Treppe absucht. Trotz der beunruhigenden Stille und dem toten leeren Wind, der durch das Stadtzentrum bläst, kann Lilly sich nicht des Eindrucks erwehren, dass es sich hier tatsächlich um eine Falle handelt.
Sie lässt den Blick von Dach zu Dach schweifen, von dem vom Sonnenschein gebleichten Wasserturm bis hin zu dem in Weiß getünchten kleinen Pavillon in der nordwestlichen Ecke des Platzes, aber sie kann weder Scharfschützen noch einen Hinterhalt irgendeiner Art ausmachen. Selbst die umherwankenden Untoten, die sich anscheinend durch die offenen Tore in die Stadt verlaufen haben, wurden rasch und auf effizienteste Weise von den unbekannten Angreifern getötet. Viele der unansehnlichen Überreste liegen auf den Straßen und in Gräben. Das Städtchen entspricht dank des so ruhigen, verschlafenen und ländlichen Eindrucks, den es erweckt, seiner wahrscheinlichen historischen Realität von 1820, als es als kleiner Eisenbahnknotenpunkt aus dem roten Lehm Georgias wuchs.
»LASS MICH ENDLICH LOS!«
Norma Sutters befreit sich endgültig aus Miles Littletons Umarmung, und die beleibte Frau rennt über die Straße auf das Gerichtsgebäude zu.
»NORMA!« Lilly eilt ihr hinterher, gefolgt von den anderen. Norma erreicht die Rasenfläche und stolpert beinahe über den Bordstein, als sie auf den Platz und über das Gras läuft. Noch immer mit ihrer .44-Bulldog in einer Hand wirft sie sich auf den zusammengesackten Körper auf dem Kopfsteinpflaster. Lilly und die anderen rasen ihr hinterher, während sie besorgt um sich schauen.
»Um Gottes willen. Gütiger Himmel. Nein, nein, nein.« Der Chorleiterin entfahren diese Worte aus einem tiefen Brunnen der Emotionen, von dem sie vielleicht gar nicht wusste, dass er für diesen in die Jahre gekommenen Mann existierte. Sie kniet sich vor ihm hin, legt die Hände um seinen Hals und fühlt nach einem Puls, ehe sie merkt, dass er schon eine ganze Weile tot sein muss – Stunden vielleicht. Die Todesursache bilden vermutlich drei großkalibrige Einschusslöcher in seiner Brust. Aber seine zu Krallen geballten Fäuste und der Ausdruck seiner dunklen, zerfurchten Miene zeugen von Anspannung und inneren Qualen. Es liegt auf der Hand, dass er keinen einfachen Tod gestorben ist, sondern bis zum Ende kämpfte. Normas Bluse ist voller Blut, als sie seinen schlaffen Körper an sich drückt und mit der Hand über seine melierten Haare fährt. Sie weint sanft. »Oh Gott – Oh Gott – Oh Gott – Oh Gott – Oh Gott – Oh Gott – Oh Gott – Oh Gott – Oh Gott – Oh Gott – Oh Gott …«
Lilly schließt zu ihr auf, bewahrt aber eine respektvolle Distanz. Die anderen treffen nach ihr ein, die Waffen stets schussbereit, falls die Kugel eines Scharfschützen einschlägt. Norma schluchzt, wiegt den Leichnam des Mannes, in den sie sich verliebt hatte. Tränen strömen ihre bleich gewordene Haut hinab. Lilly wendet sich ab. Dann bemerkt sie etwas, das von großer Wichtigkeit sein könnte.
Hinter Harold Staubachs Leichnam befinden sich Blutspuren auf dem Bürgersteig. Offensichtlich schleppte sich der Mann über eine nicht unerhebliche Distanz hinweg, ehe ihm das Blut ausging und er seinen letzten Atem hauchte. Wovor ist er weggekrochen? Oder wollte er noch im Todesringen etwas verfolgen? Lilly wendet sich den offenen Flügeltüren und dem Müll zu, der vom Wind ergriffen und durch die Luft gewirbelt wird. Sie denkt einen Augenblick nach, dreht sich dann weg und mustert den Rest des Städtchens.
Die Erkenntnis trifft sie wie ein Hammer zwischen die Augen. Sie richtet sich an Miles und Jinx. »Okay, hört mir genau zu. Ich will, dass ihr beiden zu den Sterns geht und euch gründlich umschaut. Danach macht ihr euch zur Wache auf. Sofort. Tommy und ich sehen bei der Rennstrecke nach dem Rechten. Wir treffen uns in zehn Minuten wieder hier. Und lasst euch nicht in den Rücken fallen. Also, LOS!«
Zuerst tauschen Miles und Jinx einen peinlich berührten Blick aus. Dann schaut Miles Lilly fragend an: »Und wonach sollen wir suchen?«
Lilly sprintet bereits auf die Kreuzung nördlich des Platzes zu und ruft ihm über die Schulter zu: »Die Kinder! Wir müssen die Kinder finden!«
Vor Jahrzehnten, lange bevor jemand überhaupt auf die Idee kommen konnte, dass die Toten reanimiert würden, um das Fleisch der Lebenden zu fressen, hatte jemand den brillanten Einfall, dass das Leben in Woodbury ohne Stockcar-Rennen nicht mehr lebenswert war. Es war wichtiger als ein neuer Sportplatz für die Schule, wichtiger als eine Modernisierung des Krankenhauses, wichtiger als alles andere … Woodbury brauchte einfach eine Rennstrecke. Zwei lokale Geschäftsleute trieben die nötigen Gelder während des Winters von 1971 und des Frühlings von 1972 ein. Sie bedienten sich des wohl erprobten Zuckerbrots in Form von Arbeitsplatzbeschaffung, Tourismus und wirtschaftlicher Entwicklung. Das Führungsgremium brachte etwas unter einer halben Million Dollar zusammen – genug, um das Fundament des riesigen Bauvorhabens zu stemmen, wobei sie auch an Werkstätten im Keller, Tribünen für fünfundsiebzigtausend Fans, eine Pressekabine und Boxen auf dem modernsten Stand der damaligen Technik dachten. Der Rest der Gelder wurde im Laufe des folgenden Jahres eingetrieben, und am ersten Juli 1974 öffnete der Woodbury Veterans Speedway das erste Mal die Tore.
Wenn er irgendwo anders auf der Welt errichtet worden wäre, hätte man sich gescheut und ihn als Affront gegen den ländlichen Charme der umliegenden Landwirtschaft gesehen. Das hier aber war der Süden, und die Menschen schätzten die Feinheiten des NASCAR mehr als alles andere. Der Gestank heißen Gummis und dampfenden Asphalts, der Lärm großzylindriger Boliden in der Luft, der Schein der Sonne Georgias, der sich auf den metallic lackierten Motorhauben widerspiegelte, die in unvorstellbarer Geschwindigkeit an den Tribünen vorbeirasten, das Recken der Hälse, als der Favorit auf der letzten Runde des Ovals die Oberhand gewann – all das war ein integraler Teil der südlichen Gene und genauso unabdinglich wie der Himmel für Spatzen. Und während des letzten Vierteljahrhunderts hat sich Woodbury zum Aushängeschild für die Southeastern United States Short Track Racing Association gemausert.
Erst Anfang des neuen Millenniums begann der Niedergang des Woodbury Veterans Speedway – steigende Treibstoffkosten, die immer weiter zunehmende Verbreitung elektronischer Medien und entsprechenden Entertainments, der Konjunkturrückgang und die Instandhaltungskosten zwangen den Speedway in die Knie, bis er die Tore für immer schloss. Als die Seuche dann über das Land fegte, war der riesige Komplex am westlichen Stadtrand – mit seinen Tribünen in Form einer fliegenden Untertasse, dem Labyrinth unterirdischer Werkstätten und Boxengassen so groß wie ein Flugzeugträger – kaum mehr als ein Kuriosum, ein nutzloses Etwas, ein weißer Elefant. Jahrelang diente er als Lagerraum, als Parkplatz für Schulbusse und das ein oder andere Country-Musik-Festival wie auch als Gerüst für das außer Kontrolle wachsende Unkraut – darunter auch Kopoubohnen, die sich um die oberen Tribünen wie byzantinische Schlangen in einem Bosch-Triptychon über die neun Vorhöllen winden.
Als Philip Blake (auch bekannt als der Governor) hier vor einigen Jahren die Macht gleich einer satanischen Schlingpflanze an sich riss – und dabei die Stadt in eine Diktatur verwandelte, die selbst die Dritte Welt in Angst und Schrecken versetzt hätte –, wurde die Arena zum Symbol all dessen, was zu diesen apokalyptischen Zeiten unheilig war. Der Governor transformierte den Halbkreis der Tribünen, die riesigen Eingangstore, das asphaltierte Oval mit seinen Steilkurven und das gewaltige Innere voll verbranntem Gras und mit Ölflecken beschmutzter Boxen in eine Arena samt Gladiatoren, auf die ein römischer Zirkus stolz gewesen wäre. In den Spektakeln, bei denen es um Leben und Tod ging und gefangene Untote festgekettet waren, um zu versuchen, an die Kämpfenden in der Mitte zu gelangen, fochten die Gangster des Governors untereinander das Recht zu leben aus. Nur der tapfere Gewinner durfte seinem geliebten Imperator weiterhin dienen. Die Theorie – so Blake – lautete, dass der blutige Rummel eine Läuterung für die Bevölkerung darstellte. Die Menschen wahrten die Ruhe, waren zufrieden und kontrollierbar. Es machte nichts, dass jede Show von vornherein abgesprochen war, ganz wie die der World Federation Wrestling. In Lillys Augen – und sie hatte eine lange Zeit in Woodbury verbracht – wohnte diesen Schauspielen etwas zutiefst Beunruhigendes inne. Das obszöne, surreale Gefühl, die Untoten anzustarren, die unter Halogenscheinwerfern angekettet die Menge wie die Äffchen eines Musikorgelspielers unterhielten, verfolgte sie bis in ihre Träume und wirft bis heute Schatten auf ihr Gemüt.
Das sind nur einige der Gründe, warum die Wogen der Emotionen sie jetzt zu übermannen drohen, während sie ihr Team aus Rettern entlang des nördlichen Maschendrahtzauns der Arena führt. Sie halten kurz nach den Drehsperren inne.
Innerhalb der letzten zehn Minuten sind sie auf ein halbes Dutzend weiterer Leichen gestoßen: Clint und Linda Sturbridge, Mama May, Rudy und Ian. So gut wie jeder neue Bewohner Woodburys ist kaltblütig ermordet worden … aber wieso? Wer auch immer die Stadt angriff, war nicht an dem gebunkerten Treibstoff in den Tanks hinter dem Markt interessiert. Auch die Nahrungsmittelvorräte im Lagerhaus an der Main Street hatten sie nicht angerührt, und der Markt an der Jones Mill ist ebenfalls intakt geblieben. Wonach also suchten diese Schakale?
»Jinx und Miles, geht hinten herum und überprüft den Lieferanteneingang.« Lilly zeigt auf die gigantischen grauen Betonpfeiler, die den gesprungenen Asphalt der Laderampen einsäumen. »Der Rest von uns nimmt den Haupteingang.« Lilly dreht sich zu Tommy und Norma um. »Entsichert eure Waffen, vergewissert euch, dass ihr Patronen im Lauf habt, und denkt dran: Was immer wir auch finden, Untote, Feinde oder sonst was – vermeidet unbedingt den Tunnelblick, lasst euch nicht gegen Wände drängen und legt den Finger nicht an den Hahn, bis ihr gezielt habt.« Sie blickt Tommy in die Augen. »Erinnerst du dich an alles, was ich dir beigebracht habe?«
Tommy antwortet mit einem kurz angebundenen Nicken und errötet erzürnt. »Ich erinnere mich, Lilly. Verdammt, ich bin kein Kleinkind mehr.«
»Nein, das bist du nicht.« Lilly nickt den anderen zu. »Also, folgt mir.«
Einer nach dem anderen schleichen sie an der Laderampe vorbei in Richtung des riesigen Bogens des Haupteingangs, während Jinx und Miles um die Arena eilen und in den Schatten der verlassenen Rampen verschwinden.
Schubkarren voller Torf und Muttererde stehen neben den Portalen; Schaufeln und Hacken und große Rollen Hühnerdraht liegen beim Haupteingang. Im Tunnel, der zu den Tribünen führt, stehen eine Reihe Kutschen und Säcke voller Hafer für die Pferde. Während des letzten Jahres hat Lilly die Leute dazu angehalten, das Innenfeld des Speedways landwirtschaftlich zu nutzen. Die harte Arbeit wurde von Pferden bewerkstelligt, die die Pflüge zogen. Die meisten Tiere bewohnten die Werkstätten unterhalb der Tribünen – die großen Räumlichkeiten entlang der Tunnel wurden kurzerhand zu behelfsmäßigen Ställen umfunktioniert. Es war ein feuchter Frühling gewesen, und Lilly hoffte inniglich und betete, dass die überernteten Pflanzen sich rasch wieder erholten. Jetzt aber verschwendet sie keinen einzigen Gedanken an sie.
Sie führt Tommy und Norma durch den Bogen, über dem die windgepeitschte Skulptur des Merkur aufragt – römischer Gott der Geschwindigkeit und des Handels sowie, ironischerweise, der Begleiter durch die Unterwelt.
Sie betreten den dunklen, feuchten und schimmligen Betontunnel. Die Luft stinkt nach Trockenfäule, Rattenkot und altem Urin. Zu ihrer Linken erstreckt sich das mit Müll überhäufte und mit Blut bespritzte Halbgeschoss, in dem sich früher einmal die Fressbuden und Toiletten befanden. Zu ihrer Rechten liegen die steinernen Treppen, die hinunter in die Untergeschosse unterhalb der Tribünen führen.
Lilly gibt durch Handbewegungen Anweisungen und fuchtelt mit dem Lauf ihrer .22er umher, als sie die beiden die Stufen hinunterführt. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die Kinder im Notfall hierher bringt. Barbara Stern hätte sich höchstwahrscheinlich der Aufgabe angenommen. Die unterirdischen Werkstätten glichen einem Schutzraum oder Bunker in Woodbury. Lilly führt die Gruppe weiterhin an, als sie den Fuß der Treppe erreichen.
Kaum ist sie in den Gang getreten, drängen sich ihr eine ganze Reihe von Sinneswahrnehmungen gleichzeitig auf – der Geruch von Pferdeäpfeln und vergärendem Heu, das Geräusch tropfenden Wassers, die Atmosphäre, die der eines Gewächshauses gleicht. Sie hören das Schnauben der Pferde in ihren Gehegen. Einige treten nervös mit den Hufen gegen die Wände, während andere zu wiehern anfangen, als sie den menschlichen Geruch in ihren Nüstern wahrnehmen. Lilly geht vorsichtig weiter, die Waffe stets in beiden Händen, die Füße in etwa dem gleichen Abstand wie die Schultern, mit ihrer führenden Schulter voran. Die beiden anderen folgen ihr mit weit aufgerissenen Augen.
Als sie ans Ende des Gangs gelangen, sehen sie, dass die metallene Tür des Schutzraums offen steht.
Lilly schlägt das Herz bis zum Hals, als sie einen Blick in den Raum wirft und ihn leer vorfindet. Kindergartenstühle und Kinderbücher liegen überall verstreut auf dem Boden, und Wasserlachen breiten sich von den umgestürzten Pappbechern auf den niedrigen Tischchen aus. Kein Blut, keinerlei Anzeichen von Untoten. Einige Dinge fehlen offensichtlich: die kleine Spielzeugkiste, Decken, eine Wiege. In Lillys Schädel dreht sich alles. Was geht hier vor sich? Sie dreht sich zurück zum Gang um.
»Lilly, was soll das?« Tränen der Furcht steigen in Tommys Augen. Seine Baby-Schwester und sein kleiner Bruder sind nicht mehr da. »Wo können sie nur sein?«
»Vielleicht daheim?«, rät Norma, weiß aber genau, dass das kaum der Fall sein kann.
Lilly schüttelt den Kopf. »Da sind wir auf dem Weg hierher vorbeigekommen, und es stand leer.«
Tommy blickt sich in dem kalten Gang um. Seine Lippen beben vor Schrecken. »Wir haben weder David noch Barbara gesehen. Vielleicht sind sie bei den Kindern.«
»Ja, vielleicht … vielleicht«, murmelt Lilly und versucht, einen klaren Gedanken zu fassen. »Vielleicht sollten wir zurückgehen und …«
Sie wird von einem Geräusch unterbrochen. Blitzartig dreht sie sich zu dessen Quelle am anderen Ende des Gangs um. Auch die anderen haben es gehört, eine entstellte Stimme, die einem Untoten gehören könnte. Alle richten die Läufe auf den Ursprung und spannen die Hähne. Die Kreatur befindet sich vielleicht gute dreißig Meter vor ihnen in einem der Gänge.
Lilly legt einen Finger auf die Lippen. Langsam bewegen sie sich auf die kreuzenden Gänge zu, die Waffen schussbereit, die Läufe erhoben, um den Schädel irgendeines verwesenden Untoten zerplatzen zu lassen. Als sie zu der Abzweigung kommen, ist ihr Mund trocken. Irgendwo hinter ihr schnaubt ein Pferd nervös. Andere scharren mit den Hufen. Lillys Hände sind ganz nass vor Schweiß, als sie sich gegen die Wand presst, um dann mit einem Satz in Schussposition in den anderen Gang zu springen.
In zehn Metern Entfernung liegt ein Mann mittleren Alters kümmerlich auf dem Boden, den Rücken gegen die Rampe gelehnt, die in die Freiheit führt. Sein Leben hängt am seidenen Faden. Einen Arm hat er nach oben ausgestreckt. Er trägt eine zerlumpte, schillernde Roadie-Jacke. Der Bob-Seger-Band-Aufnäher auf dem Rücken ist von blutumrandeten Einschusslöchern zerfetzt, und sein ganzer Körper bebt vor Anstrengung, Luft in seine Lungen zu saugen. Sein graues durchfurchtes Gesicht liegt auf dem Boden, und mit jedem qualvollen Atemzug wirbelt er ein wenig Staub auf.