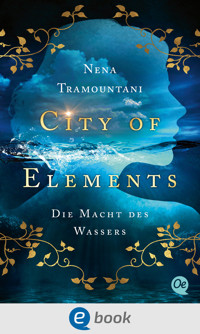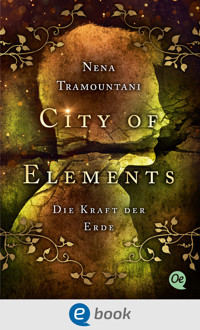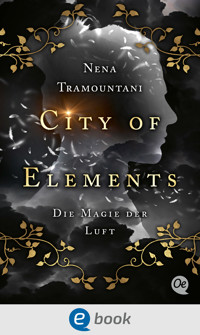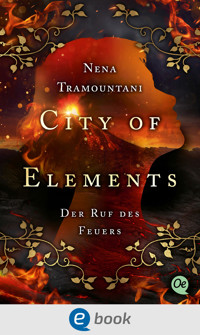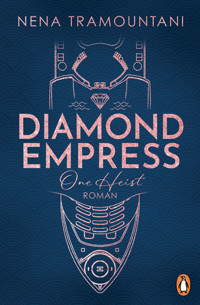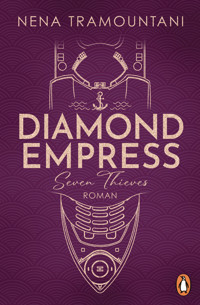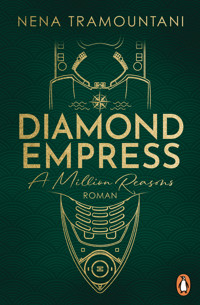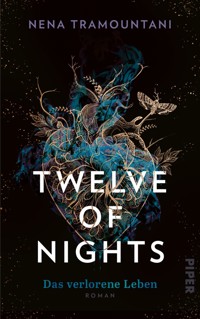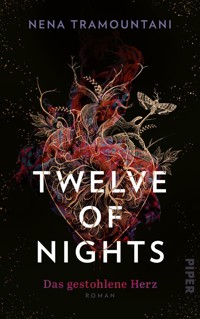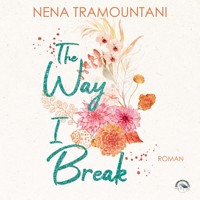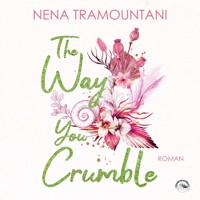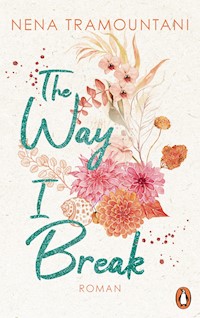
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hungry Hearts
- Sprache: Deutsch
Victoria & Julian: Nie wieder möchte sie als Gourmetköchin arbeiten. Kann er ihre Leidenschaft neu entfachen?
Trotz ihrer erfolgreichen Karriere als junge Starköchin will Victoria nur noch weit weg von London – und von ihrem manipulativen Freund. Kurzerhand flieht sie in die idyllische Hafenstadt Goldbridge, wo ihre Mutter einst im Sternerestaurant Prisma arbeitete. Victoria will endlich verstehen, warum ihre Mum sie für diesen Ort und ihre Karriere verließ, und nimmt dort unerkannt einen Kellnerjob an. Doch in dem Versuch, ihre Sorgen in Alkohol zu ertränken, gibt sie einem attraktiven Fremden zu viel Intimes über sich preis – ohne zu ahnen, dass Julian einer der Söhne der Restaurantinhaber ist. Und er besitzt die Frechheit, Victoria einen Vorschlag zu machen: Er behält das Geheimnis ihrer wahren Identität für sich – wenn sie ihm Nachhilfe beim Kochen gibt. Victoria kann sich nicht erklären, warum dieser unverschämte Deal eine Flamme in ihrem Herzen entzündet …
Der Auftakt der süchtig machenden Hungry-Hearts-Reihe.
Entdecken Sie auch die weiteren Bände der Hungry-Hearts-Reihe:
1. The Way I Break
2. The Way You Crumble
3. The Way We Melt
Alle Romane können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
NENATRAMOUNTANI, geboren 1995, liebt Kunst, Koffein und das Schreiben. Am liebsten feilt sie in gemütlichen Cafés an ihren gefühlvollen Romanen und hat dabei ihre Lieblingsplaylist im Ohr. Nach ihrer erfolgreichen Soho-Love-Reihe nimmt sie ihre Leserinnen mit ihrer neuen Hungry-Hearts-Trilogie mit auf eine kulinarisch-prickelnde Reise in ein Sternerestaurant an der englischen Küste. Nena Tramountani lebt in Stuttgart.
Außerdem von Nena Tramountani lieferbar:
Fly & Forget
Try & Trust
Play & Pretend
Nena Tramountani
The Way I Break
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).
Covergestaltung: bürosüd GmbH
Covermotiv: www.buerosued.de
Redaktion: Melike Karamustafa
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-28530-2V002
www.penguin-verlag.de
Liebe Leser*innen, dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet sich auf hier eine Triggerwarnung. Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis. Nena Tramountani und der Penguin Verlag
Für alle, die gegangen sind, um bei sich zu bleiben.
1. Kapitel Victoria
I had a dream, I got everything I wanted
»Auf dich, Vicky.« Leo hob sein Glas. Seine eisblauen Augen blitzten.
Jetzt war es offiziell – er hatte den Verstand verloren. »Nimm das hellgraue Etuikleid für nach der Arbeit mit«, hatte er heute früh zu mir gesagt und mir zugezwinkert, während er sich die Krawatte vor unserem Schlafzimmerspiegel gebunden hatte. »Heute Abend wird gefeiert.«
Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen. Die Gesichter um mich herum froren ein. Schock, Neid und Hass stürzten mir von allen Seiten entgegen. Ich kannte die Gefühlspalette. An manchen Tagen bescherte sie mir Genugtuung (»Schaut her, ich bin die Auserwählte, ich bin besser als ihr, eines Tages wird die ganze Welt meinen Namen kennen.«). Heute führte sie dazu, dass ich nach vorne preschen, Leo das Sektglas aus der Hand reißen, das Grinsen von seinen perfekten Lippen wischen und einen Mord begehen wollte.
»Es gibt niemanden, der es mehr verdient hätte, Souschefin zu werden«, schloss er seine kleine Rede.
Wow, die anderen wären mir bei dem Mord definitiv behilflich gewesen. Niemanden, der es mehr verdient hätte? Wie wär’s mit jeder einzelnen Person in dieser Küche?
Ich lächelte. Es war eine Kettenreaktion. Er lächelte, ich lächelte. Er hob sein Glas, ich hob meines. Er wollte Glück? Ich war der glücklichste Mensch Großbritanniens.
»Auf Vicky«, echoten meine Kollegen. Respekt, dass nur knapp die Hälfte so klang, als hätte sie lieber Gift geschluckt, als auf mich angestoßen. Nicht einmal Henry, der Chefkoch des Jubilee Room, der neben Leo stand, verzog eine Miene. Todsicher war er vorgewarnt worden. Ganz im Gegensatz zu mir.
»Danke«, hauchte ich und unterdrückte gerade so ein hysterisches Lachen.
Leos Miene veränderte sich. Sein Gesicht war nach wie vor perfekt, trotz des sterilen Lichts. Perfekte Wangenknochen, perfekter Dreitagebart, perfekte Nase, perfekter Mund. Sogar eine perfekte goldblonde Locke fiel ihm ins Gesicht. An manchen Tagen drohte ich an seiner Perfektion zu ersticken.
Für andere war die Verhärtung seines Blickes vermutlich kaum sichtbar. Das leichte Zucken unter seinem rechten Auge. Doch ich kannte jede seiner Regungen und wusste, was sie bedeuteten.
Ich musste überzeugender sein. Durfte diesen Moment nicht versauen. Mein Magen war mit Zement gefüllt, und das Schlucken fiel mir schwer. Und trotzdem lächelte ich breiter.
»Ich … Ich fasse es nicht!«, brachte ich hervor und fing Arabellas Blick links von mir auf. Ja, ich hasste mich auch. Vielleicht sogar mehr als sie mich in diesem Augenblick. Aber wenn schon, dann richtig. Mit der freien Hand tastete ich nach meinem Herz. »Mein Leben lang habe ich davon geträumt …« Ich schnappte nach Luft. Theatralisch, aber den Umständen entsprechend passend. »Es ist ein absoluter Traum.« Ein Albtraum, um genau zu sein. »Die allergrößte Ehre. Danke. Wirklich von Herzen: danke.«
Von Herzen … Wer redete so? Wer war ich? Was tat ich hier?
Ich hatte es mir anders überlegt. Ich wollte doch nicht Leo umbringen. Sondern mich.
Wir stießen an. Ich nahm die Glückwünsche entgegen. Ließ mir von Leo einen Kuss auf die Wange drücken und krallte meine Finger in seine graue Anzugjacke. Er hatte sie farblich auf mein Kleid abgestimmt. Sanft schob er mich ein Stück zurück. Vor den anderen berührte er mich nie länger als wenige Sekunden. Wir waren professionell. Ich fröstelte, als unsere Blicke sich trafen.
»Schau nicht so«, sagte er. »Ich wollte dich überraschen.«
Du musst überzeugender sein, verfluchte Scheiße!
Ich strahlte ihn an. »Überraschung gelungen.«
Fast hätte er es mir abgenommen. Doch im nächsten Moment zuckte ich zusammen. Bauchkrämpfe aus der Hölle. Unterleibsschmerzen? Gott, ich hoffte, das waren Unterleibsschmerzen.
Bloß weg hier.
»Ich … Ich bin gleich zurück«, raunte ich ihm zu, dann stellte ich mein Glas auf der Theke hinter ihm ab und stürzte durch die Pendeltüren aus der Küche.
Der Sitzbereich war verlassen, die Reinigungskräfte schauten nicht auf, als ich an ihnen vorbei zu den Toiletten lief. Vor einer Stunde, nach der Frühschicht, hatten wir das Restaurant geschlossen. Es würde um achtzehn Uhr wieder für den Abendandrang öffnen. Londons Hochhäuser hoben sich hinter der verglasten Fensterfront in den bewölkten Nachmittagshimmel empor. Ein Meer aus Wolkenkratzern. Früher der schönste Anblick für mich. Jetzt Teil meines Albtraums.
Ich huschte in die Toilettenräume und dort in die erste Kabine. Zog mir das Kleid hoch und den Slip samt Feinstrumpfhose runter. Ich hatte extra einen alten, löchrigen Schlüpfer gewählt. Damit ich ein einziges Mal in meinem Leben stark blieb. Verwaschenes Grün, bedruckt mit pinken Erdbeeren. Aus der Pre-Leo-Zeit. Er hätte einen Anfall bekommen, wenn er den an mir gesehen hätte.
Sobald ich das Blut erblickte, begann ich zu zittern. Und schließlich lachte ich. Für ein paar Sekunden erlaubte ich mir, in der Erleichterung zu baden. Zwei Worte gingen mir in Dauerschleife durch den Kopf: Nicht schwanger. Nicht schwanger. Nicht schwanger.
Mein Lachen verschwand so schnell, wie es gekommen war.
Jetzt gab es kein Zurück mehr. Ich war zweiundzwanzig Jahre alt. Für alle außer Leo immerhin vierundzwanzig. So lange hatte ich auf diesen Moment hingearbeitet. Hatte vollen Einsatz gezeigt und war besser und besser geworden.
Ich war gut, das wusste ich. Das Durchschnittsalter einer Souschefin – die Vertretung des Chefkochs und damit zweitwichtigste Person in einer Großküche – war einunddreißig. Es gab Ausnahmetalente. Natürlich gab es die. In unserer wie in jeder anderen Branche.
Ich war nicht die Ausnahme. Ich war gut, aber nicht so gut. Ich war die Freundin des Restaurantbesitzers.
Und das war alles, was ich jemals sein würde, wenn ich blieb.
2. Kapitel Victoria
It might have been a nightmare
»Bitteschön.«
Für ein Lächeln fehlte mir inzwischen die Energie. Ich nickte dem Kerl nur zu und griff nach meinem Koffer. Das Teil war nagelneu, Hartschale, bronzefarben. Seit vorgestern hatte er in dieser schummrigen Bar auf mich gewartet. The Philosopher’s. Ich hatte sie durch Zufall entdeckt. Hier würde ich niemandem begegnen, den ich kannte. Schon gar nicht jemandem, der Leo kannte. Es war das reinste Studentenmilieu. Der Barkeeper hatte keine Fragen gestellt. »Klar, solange du ihn bald abholst«, hatte er gesagt und den Koffer nach hinten in den Lagerraum getragen. Jetzt sah er mich fragend an. Vielleicht wirkte mein Gesichtsausdruck zu schuldbewusst.
Mein Herz raste, seit ich das Jubilee Room verlassen hatte. Niemand hatte mich aufgehalten. Bis die Aufzugstüren sich geschlossen hatten, hatte ich die Luft angehalten. Und dann noch mal, bis ich alle dreiundzwanzig Stockwerke nach unten gefahren war. Wieso hatte mich niemand aufgehalten? Wieso war Leo in den letzten beiden Tagen nicht aufgefallen, wie viele Klamotten im Kleiderschrank fehlten? Wieso war es so einfach? Wäre es schon immer so einfach gewesen?
»Brauchst du sonst noch was?«
Ich zuckte zusammen. Der Typ fixierte mich mit seinen graublauen Augen. Besorgnis schlug mir daraus entgegen.
»Alles gut«, brachte ich hervor, und dann, weil heute der verrückteste Tag überhaupt war und ich nicht fassen konnte, was ich im Begriff war zu tun: »Ich werde nie wieder einen Fuß in diese Drecksstadt setzen.«
Seine Augen weiteten sich leicht. Dann zuckten seine Mundwinkel. »Okay?«
»Ich wünsche dir ein schönes Leben. Du hast mir sehr geholfen.«
Bevor er antworten konnte, ertönte die Stimme seines Kollegen hinter der Bar: »Noah, wie wär’s, wenn du mal deinen Hintern bewegst und mir hilfst?«
Noah verdrehte die Augen. »Dir auch ein schönes Leben«, sagte er dann und drehte sich um.
Ich hievte den Koffer die Treppenstufen nach oben auf den Bürgersteig, gönnte mir keine Verschnaufpause, sondern lief weiter, immer weiter, bis zur nächsten U-Bahn-Station, wo ich in die Central-Line stieg. Es war stickig und schwül, typisch London im Juni, und am liebsten hätte ich mir das unbequeme Kleid vom Leib gerissen. Stattdessen kniff ich die Augen für einen Moment zusammen, umklammerte den Koffergriff und zwang mich durchzuatmen. Mein Herz konnte ich dadurch nicht beruhigen, doch immerhin bekam ich keinen Schreikrampf in der überfüllten Bahn. An der Station Lancaster Gate stieg ich aus und nahm die Rolltreppe nach oben, wo mich noch mehr Schwüle erwartete. Am Himmel hatte sich ein bleigraues Wolkengemisch zusammengebraut, aber das Gewitter würde ich wohl nicht mehr mitbekommen. Zumindest nicht mehr in London.
Mir blieben noch siebenundzwanzig Minuten bis zur Abfahrt meines Zuges. Der Schweiß sammelte sich in meinem Dekolleté und verstärkte das Unwohlsein. Ich setzte einen Fuß vor den anderen, bis Paddington Station in Sicht kam.
Die nächste halbe Stunde verflog wie im Zeitraffer, mein donnernder Herzschlag ein stetiges Hintergrundgeräusch. Erst steuerte ich einen Geldautomaten an. Sechstausend Pfund. Das Abhebelimit auf der Kreditkarte. Die hohe Summe war mehr Leos als meinem Einkommen zu verdanken. Anschließend besorgte ich, was ich schon vor Tagen, ach was Wochen, auf meine mentale Einkaufsliste gesetzt hatte.
Als ich am Gleis stand und auf den einfahrenden Zug starrte, bebte ich am ganzen Körper.
Du bist irre. Du kannst das niemals durchziehen. Du wirst dich jetzt umdrehen, den Koffer entsorgen, zurück zu Leo fahren, ihm eine Ausrede auftischen und den Rest des Tages hart daran arbeiten, dass er dir diesen Abgang verzeiht. Noch ist es nicht zu spät. Du hast deine Beförderung zu feiern, so wie er es für dich geplant hat.
Tränen schossen mir in die Augen.
Mit einem Quietschen kam der Zug zum Stehen. Die Türen sprangen auf, Menschen strömten heraus. Ich schaffte es nicht mal, einen Schritt zur Seite zu machen. Böse Blicke begegneten mir. Keiner so schlimm wie Leos vorhin, als ich mich nicht angemessen gefreut hatte.
»Kann ich Ihnen mit dem Koffer helfen?«
Eine Anzugträgerin mittleren Alters und mit lediglich einer Brieftasche in der Hand stand neben mir und sah mich freundlich an.
Ich presste die Lippen zusammen. »Nein, danke, ich habe mich geirrt. Das ist der falsche Zug.« Das sollte ich sagen. Stattdessen nickte ich. Ich nickte so heftig, dass mir schwindelig wurde.
Sekunden später befand sich mein Koffer im Zug und wurde von der Frau auf den Gepäckhalter neben dem Eingang gehievt. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen.
»Danke«, krächzte ich. Meine Umgebung verschwamm vor meinen Augen. Mir war schlecht.
Die Frau sagte noch etwas, das ich nicht verstand, und verschwand dann den dunklen Gang hinunter.
Wie in Trance bewegte ich mich auf den erstbesten freien Fensterplatz zu und ließ mich darauf sinken. Ich schloss die Augen. Atmete zehnmal tief durch. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Währenddessen stellte ich mir vor, wie sich Fesseln um meine Hand- und Fußgelenke legten. Sodass ich mich nicht von der Stelle rühren konnte, bis …
Der Zug setzte sich in Bewegung. Eine elektronische Ansage hieß mich willkommen.
Meine Tränen liefen über.
Aber ich blieb sitzen. Ich blieb sitzen und ließ die Augen geschlossen, bis der nächste Halt angesagt wurde und London hinter uns lag. Als ich sie das nächste Mal öffnete, war mein Körper vollkommen ruhig. Keine Schweißausbrüche. Kein Zittern. Nicht mal Herzrasen.
Es war die schwerste Sache auf der Welt gewesen. Bis ich den letzten Schritt gegangen war. Und plötzlich wurde sie zur einfachsten.
3. KapitelVictoria
Like mother, like daughter
Eine Schere und ein völlig überteuerter Lippenstift in der Farbe »Ruby Red«.
Ich starrte in den verschmierten Spiegel vor mir, die Schere in meiner vollkommen ruhigen Hand. Leo hasste »unnatürliches« Make-up. Genau wie kurze Haare bei Frauen, erst recht bei seiner eigenen Freundin.
Die ersten drei Punkte auf meiner Checkliste waren bereits abgehakt. Zuerst hatte ich das Kleid gegen eine Jogginghose und meinen bequemen Lieblingspullover getauscht. Er war blassgelb mit bunten Punkten und von innen ganz weich. Dann hatte ich mich um die SIM-Karte gekümmert. Ursprünglich hatte ich sie zerschneiden wollen, aber dann hatte ich sie stattdessen aus dem Zugfenster geworfen. Das war poetischer. Mein altes Ich würde hier sterben – es sollte mich keine Sekunde länger begleiten. Anschließend hatte ich die Kontaktlinsen rausgenommen, sie in meinem Rucksack verstaut und stattdessen meine Brille hervorgeholt, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr getragen hatte.
Und jetzt waren die Haare dran.
Ich zögerte keine Sekunde. Mit entschlossenen Schnitten kürzte ich sie auf Schulterlänge und lächelte mir selbst zu, während dicke rotbraune Strähnen auf den Boden der engen Zugtoilette fielen. Meine hellblauen Augen strahlten, meine Sommersprossen tanzten. Die Schere war nicht scharf genug, aber das machte nichts. Ich hatte Naturlocken, es würde nicht auffallen, wenn es nicht ganz perfekt wurde. Und außerdem ging es hier nicht um Schönheit.
Es muss nie wieder um Schönheit, geschweige denn Perfektion gehen, wenn du das nicht willst.
Der Gedanke berauschte mich ebenso sehr, wie er mir Angst machte. Ich hatte die letzten Jahre nach Perfektion gestrebt, und jetzt hatte ich an einem einzigen Tag alles hingeworfen. Nachdem ich den Höhepunkt meines bisherigen Lebens erreicht hatte. Souschefin des Jubilee Room. Leos Freundin.
Und dann war da auch noch Dad, der mir diesen Abgang garantiert nicht verzeihen würde.
Dad. Das schlechte Gewissen meldete sich, aber ich verdrängte es. Er würde schon klarkommen. So wie ich meine ganze Kindheit und Jugend damit klargekommen war, dass er sich nur ein Zimmer weiter mit verschiedenen Frauen vergnügte, statt sich wie mein Vater aufzuführen. Die Kosten für die Pflegekraft sowie die nächsten Arztbesuche waren gedeckt. Es war alles unter Kontrolle. Ich würde ihm eine Mail schreiben, sobald ich mein Ziel erreicht und mich ein wenig eingelebt hatte.
Zufrieden betrachtete ich mein Werk. Das transparent-braune Gestell meiner Brille passte gut zu meiner Haarfarbe, und der neue Schnitt ließ mich erwachsener aussehen. Nicht mal an meiner etwas zu großen, noch geröteten Nase verharrte ich zu lange. Nein, ich war gerade nicht schön. Aber ich hatte mich in einen anderen Menschen verwandelt. Und das war viel wichtiger.
Ich sammelte meine Haare auf, entsorgte sie in dem kleinen Mülleimer und verließ die Toilettenkabine.
»Du bist okay«, flüsterte ich mir selbst zu.
Wenn ich es nur oft genug wiederholte, würde ich es irgendwann glauben.
4. KapitelJulian
Fall back into place
Wir waren, gelinde gesagt, am Arsch. Ich wusste es. Alexis wusste es. Mum wusste es. Das restliche Team wusste es. Dad war mal wieder wie vom Erdboden verschluckt, aber ich war mir sicher, er wusste es auch.
Ich zog mein Handy hervor und öffnete den Chat mit Darcy.
Julian: Ich hoffe, du genießt deinen freien Tag. Zünde eine Kerze für mich an, wenn du bei St. Paul’s vorbeikommst. Bin mir nicht sicher, ob ich diesen Abend überlebe.
Ihre Antwort folgte, noch bevor ich das Handy zurück in die Tasche meiner Schürze gleiten lassen konnte.
Darcy: Du mich auch.
Meine Mundwinkel zuckten, obwohl mir seit Schichtbeginn vor drei Stunden so gar nicht zum Lachen zumute war. Ich wusste, was ihre Nachricht zu bedeuten hatte. Und ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, ehrlich, ich gönnte ihr den ersten freien Tag seit nahezu zwei Wochen – wären wir nicht so dermaßen am Arsch gewesen.
»Jules!« Mums gerötetes Gesicht erschien im Türrahmen. Sie musste die Bitte nicht aussprechen, die saubere Schürze in ihrer Hand sprach Bände. Sie war nicht nur sauber, sondern auch schwarz.
Ich nickte, bereits dabei, den Knoten an meiner mit Flecken übersäten weißen Schürze zu lösen.
»Tut mir leid«, schob sie hinterher, während sie mir half, die schwarze zuzubinden.
»Alles gut.« Ich drehte mich zu ihr um und lächelte so überzeugend wie möglich. Sie war den Tränen nahe, was so gut wie nie vorkam. Mum war normalerweise der härteste Fels in der Brandung. Für uns alle. Egal, wer in der Küche oder draußen einen Nervenzusammenbruch erlitt, egal, wie hektisch es wurde, sie war augenblicklich zur Stelle und glättete die Wogen, tröstete, heiterte auf. Und wenn sie ausnahmsweise nicht mehr konnte, war ich ihr Fels. Seit ich denken konnte, war das unser unausgesprochener Deal. Auch wenn ich lieber meine Handflächen auf die glühenden Herdplatten gelegt hätte, statt mich freiwillig in die Höhle des Löwen zu begeben. Wenn es etwas gab, für das ich noch weniger Talent als fürs Gourmet-Kochen hatte, dann war es Kellnern. Die Ironie des Schicksals wollte es allerdings, dass ich quasi ins Gastronomiegewerbe hineingeboren worden war.
»Du bist mein Held«, flüsterte sie brüchig. »Und du hast sicherlich mitbekommen, dass Tisch acht das Thunfischsteak schon zweimal zurückgehen lassen hat.«
Ich nickte vorsichtig.
»Es ist Mr. Huxley.«
»Was für eine Überraschung«, rief ich und lachte, um meine anbahnende Panik zu verschleiern. »Mit dem werde ich schon fertig.«
Oder ich ignoriere ihn so lange, bis Darcy hier in spätestens zwanzig Minuten aufkreuzt und mich rettet.
Mr. Huxley war der Bürgermeister von Goldbridge, und sagten wir es mal so: Hinge die Zukunft unseres Restaurants von ihm ab, hätten wir uns alle schon längst kollektiv von der nächsten Klippe gestürzt.
Niemand wusste, weshalb dieser Mistkerl jede verdammte Woche hier aufkreuzte, obwohl er nie zufrieden mit seinem Essen war. Wenn er besonders prächtige Laune hatte, schaffte er es sogar, seinen Wein oder – eine noch herausragendere Leistung – die Temperatur des kostenlosen (!) stillen Wassers in der Karaffe auf dem Tisch zu kritisieren. Aber da er nun mal ausnahmslos jede Woche erschien, mussten wir ihn wie einen König behandeln. Wir befanden uns gerade wirklich nicht in der Position, unsere Stammgäste zu vergraulen.
Ich nahm die Kellnertasche entgegen, in der sich das Handy mit dem Kassensystem und die Geldbörse mit Wechselgeld befanden, und wollte mich schon in Bewegung setzen, da registrierte ich Mums Blick. Sie schien geradewegs durch mich hindurch zu schauen. Ihre dunkelbraunen Augen, die mein kleiner Bruder und ich von ihr geerbt hatten, waren glasig.
»Hey.« Ich legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Was brauchst du?«
Sie blinzelte und sah mich dann an, als hätte sie kurzzeitig vergessen, wer vor ihr stand. Und wo sie sich befand. Ein reflexartiges Lächeln erschien auf ihren dunkelrot geschminkten Lippen. Obwohl sie heute schon länger als ich hier herumrannte, war kein einziger Schweißtropfen auf ihrem Gesicht zu sehen. Lediglich ein paar schwarze Strähnen hatten sich aus ihrer Flechtfrisur gelöst.
»Ich brauche dich draußen«, sagte sie in ungeduldigem Ton.
»Ich meine nicht, was alle anderen brauchen«, beharrte ich, »sondern was du brauchst.«
Sie kämpfte noch immer mit den Tränen. Schließlich schüttelte sie den Kopf. »Nicht jetzt. Später.«
Mein Herz zog sich zusammen. Ich wusste, was das zu bedeuten hatte. Es ging nicht darum, dass wir heute unterbesetzt waren und das Restaurant schon seit geraumer Zeit den Bach runterging. Es ging um Dad. Natürlich.
Mit einem Nicken wandte ich mich ab. Während ich mir meinen Weg durch die Küche nach draußen bahnte, erwiderte ich die mitleidigen Blicke meiner Kollegen. Niemand beneidete mich ums Kellnern. Doch wenn ich mich nicht täuschte, dann sah ich auch Erleichterung in einigen Gesichtern. Solange ich nicht in der Küche war, konnte ich dort auch keinen Schaden anrichten. Ich widerstand dem Bedürfnis, einen Abstecher in unsere Patisserie zu machen, wo Alexis vermutlich gerade mit den Limetten-Tartelettes beschäftigt war. Mein Stimmungsbarometer hatte noch nicht den absoluten Tiefpunkt erreicht, aber viel fehlte nicht mehr. Mein kleiner Bruder ahnte vielleicht, wieso unsere Eltern sich mal wieder gestritten hatten, aber garantiert würde er es mir nicht sagen. Es war nichts Persönliches. Es lag nur daran, dass ich die Worte, die er im vergangenen Jahr von sich gegeben hatte, an einer Hand abzählen konnte.
Ich atmete tief durch und schaute hastig in den Spiegel, der an der Metalltür angebracht war, welche die Küche von der Terrasse trennte.
Lächeln, stand in fetten Lettern über dem weiß-blauen Mosaikrahmen. Geflucht wird später.
Ich tat wie geheißen und zog die Mundwinkel nach oben. Meine Augen strahlten wie auf Knopfdruck. Gut, dass ich mich heute Morgen rasiert hatte. So sah ich wenigstens ein bisschen präsentabler aus. Meine rabenschwarzen Haare – ebenso Mums Verdienst wie die Augen – waren heillos verwuschelt, aber das würde schon passen.
Auf in den Kampf.
Der Geruch war wie immer das Erste, was mich traf, nachdem ich durch die Küchentür ins Freie getreten war. Salzige Luft und Knoblauch-Oregano-Duft. Dann kamen die Geräusche. Gesprächsfetzen, Besteckgeklapper und Meeresrauschen, dazu sanfte Pianomusik, die aus den Lautsprechern drang. Jetzt war mein Lächeln keine Farce mehr. Egal, wie ich oft ich hier war, egal, wie sehr ich meinen Job manchmal verfluchte und mir wünschte, in einer anderen Familie groß geworden zu sein und nicht diese Verantwortung zu tragen – dieser Anblick war die pure Magie.
Wir waren nicht nur das einzige Sternerestaurant der Stadt. Wir waren auch das einzige Restaurant weit und breit, das sich in einer Grotte befand. Der Hauptbereich umfasste dreißig weiß eingedeckte Tische mit Holzstühlen; links führte ein schmaler Absatz die Klippe entlang, auf dem weitere acht Tische standen – die Ehrenplätze sozusagen, weil man von dort aus direkt aufs Meer runtersehen konnte und etwas intimer saß. Alle Tische befanden sich im Freien. In kühleren Jahreszeiten sorgten Heizstrahler für Wärme, jetzt, im Juni, war das nicht nötig, auch wenn es mal windiger wurde, da die Grotte genug Schutz bot. Laternen funkelten über den Tischen wie kleine Sterne, und der Fels wurde in sanftem Türkis beleuchtet, was den mystischen Charakter dieses Ortes unterstrich.
Marco saß am schwarzen Flügel in einer kleinen Ausbuchtung des Felsens und spielte die Melodie von »Mad World«, obwohl er sich eigentlich lieber auf Debussy und Co. konzentrieren sollte. Ich unterdrückte ein Kichern. Er verliebte sich circa jede Woche in einen anderen Touristen, der Goldbridge dann wieder verließ, und litt somit fast durchgehend an Herzschmerz, den er an den Klaviertasten ausließ. Vor allem jetzt zur Sommersaison.
Banu und Piper, die eigentlich beide keine Vollzeitkellnerinnen waren, sondern noch andere Jobs hatten, aber schon seit Tagen einsprangen, eilten mit Armen voller leerer Teller an mir vorbei; es gelang ihnen nicht ganz, die Panik zu verbergen, als sie registrierten, dass ich zu ihrer Unterstützung hier war.
Das Lachen verging mir. Um ein Haar hätte ich ihnen eine Entschuldigung hinterhergerufen.
Ich steuerte die Klippentische an. Die besten Plätze hatten natürlich Mr. Huxley und seine Frau sowie ihre Teenagertochter Cassidy, die tödlich gelangweilt aussah. Auf dem Weg zu ihnen wurde ich dreimal aufgehalten – von einem japanischen Touristenpärchen, das mehr Brot wollte, von meiner ehemaligen Mathelehrerin Miss MacClery (»Juuulian, dich habe ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr zu Gesicht bekommen! Sag bloß, du arbeitest immer noch hier?«) und einem versnobten Kerl, der wissen wollte, ob wir immer sauren Primitivo einkauften oder ob wir einfach nur nicht in der Lage seien, ihn richtig zu lagern. Als ich endlich bei unserem herzallerliebsten Bürgermeister angekommen war, war mein Geduldsfaden bereits überspannt.
Tiefe Atemzüge. Tieeefe Atemzüge.
»Julian Bithersea«, begrüßte Mr. Huxley mich mit dröhnender Stimme, die sich mühelos über alle anderen Gespräche emporhob und sogar die Klaviermusik übertönte. Seine Stimme passte so gar nicht zu seinem Erscheinungsbild – er war schmächtig und gerade mal so groß wie ich. Außerdem hatte er ein beinahe vollkommen faltenfreies Gesicht, das an das eines kleinen Jungen erinnerte. Die Laternenlichter spiegelten sich auf seiner Halbglatze.
Prompt haute Marco fester in die Tasten, damit nicht sämtliche Gäste zu uns schauten.
Dankbarkeit durchflutete mich, doch sie hielt nicht lange an. Mrs. Huxley rümpfte die Nase und schob ihren halb vollen Teller von sich, als befände sich darauf kein exzellentes Jakobsmuschel-Weißwein-Risotto, sondern mindestens lebende Insekten.
Ich zwang mich zu einem höflichen Lächeln. »Was kann ich für Sie tun, Mr. Huxley?«
Er erwiderte mein Lächeln breit – ich ahnte Schreckliches –, nahm seine Aktentasche von dem Stuhl neben sich, reichte sie seiner Frau über den Tisch hinweg und bedeutete mir dann, mich neben ihn zu setzen.
Oh, verflucht noch mal.
Ich widerstand dem Bedürfnis, ihn übers Geländer zu schmeißen, und gehorchte wie der brave Kellner, der ich war.
»Julian Bithersea.«
Wenn er noch einmal meinen Namen sagte, würde ich zu schreien anfangen.
»Alfred Huxley«, erwiderte ich, so ruhig ich konnte.
Die Ader an seiner Stirn begann verdächtig zu pulsieren. Für eine Sekunde wirkte er abgelenkt, doch das legte sich schnell. Er fuhr sich übers Kinn und lehnte sich näher zu mir, sodass ich sein Rasierwasser riechen konnte. Erstaunlich angenehmer Duft. Ich sollte ihn fragen, welche Marke er benutzte.
»Was ist deiner Meinung nach besser: Es zu probieren und zu scheitern oder es nie zu probieren und somit in jedem Fall seine Würde zu bewahren?«
»Klingt nach einer Fangfrage.« Ich lachte, als wüsste ich nicht, in welche Richtung er dieses Gespräch lenken würde.
Cassidy, die mir gegenüber saß, schaute von ihrem Handy auf, warf mir einen schnellen Blick zu und verdrehte die Augen. Ihre Mutter nutzte den Moment und riss ihr das Handy aus der Hand. Sofort fingen die beiden an zu streiten. Mr. Huxley schien keine Notiz davon zu nehmen.
»Ich mag dich, Julian. Und ich mag auch deine Eltern. Doch meiner Meinung nach haben sie sich von Anfang an ein bisschen zu viel vorgenommen, würdest du mir da nicht zustimmen, mein Junge?«
Hass durchfuhr mich. Ich presste die Lippen aufeinander, damit ich nichts sagte, was ich später bereuen würde.
»Ich habe hier bereits gespeist, als du zur Schule gegangen bist und Brenda Fitzroy noch das Sagen in der Küche hatte. Das war Qualität, sage ich dir! Das war zwei Sterne wert.« Er deutete abfällig auf den Teller seiner Frau. »Es wundert mich nicht, dass der Guide Michelin euch einen aberkannt hat. Bitte entschuldige meine Direktheit, aber das hier ist nicht einmal einen Stern wert, von meinem Steak ganz zu schweigen. Vielleicht wäre es vernünftiger gewesen, es von Anfang an bei einem kleinen Pub zu belassen. Man sollte seine eigenen Grenzen kennen. Nur so bringt man es im Leben zu etwas.«
Okay. Es reichte. Ich war drauf und dran, mir den Teller mit dem Risotto zu schnappen und es ihm ins Gesicht zu drücken.
Da spürte ich eine Hand auf meiner Schulter.
»Julian.«
Ich drehte den Kopf.
Hinter mir stand Darcy, in Kellnerschürze, die glatten schwarzen Haare zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden, den kurzen Pony etwas zerzaust und die Wangen gerötet, als sei sie den Weg von unserer Wohnung bis hierher gerannt. Ihrem Blick nach zu urteilen, hatte sie das Ende von Huxleys Monolog mitbekommen.
»Thea braucht dich dringend in der Küche«, teilte sie mir in ruhigem Tonfall mit. »Ich übernehme hier.«
Am liebsten hätte ich sie in den Arm genommen, ihr Gesicht mit Küssen übersät und sie herumgewirbelt. Nicht einmal zehn Minuten hatte sie gebraucht.
Ich erhob mich, beließ es bei einem Nicken und einem vor Dankbarkeit glühenden Blick, während ich ihr die Kellnertasche reichte. Ich würde mir später überlegen, wie ich mich bei ihr revanchieren konnte.
»Herzlichen Dank für Ihre Verbesserungsvorschläge«, sagte ich zu Mr. Hornochse. »Wir werden sie uns zu Herzen nehmen. Genießen Sie Ihren restlichen Abend.«
Kaum dass die Tür zur Küche hinter mir zugefallen war, stieß ich einen Schwall Flüche aus. Ich hasste diesen Kerl. Ich hasste, hasste, hasste es, dass er ausgerechnet heute den Finger in die Wunde legen musste. Und vor allem hasste ich ihn dafür, dass ich mich an manchen Tagen fragte, ob er recht hatte.
Ende Januar, vor knapp fünf Monaten, war der diesjährige Guide Michelin rausgekommen. Der bekannteste Restaurantführer der Welt. Der, der mit diesen beschissenen kleinen Sternchen, die nicht mal wie Sterne, sondern eher wie Blumen aussahen, über das Schicksal eines Restaurants entscheiden konnte. Wir waren das einzige in ganz Großbritannien und Irland gewesen, das einen Stern verloren hatte. In gewisser Weise war das schlimmer, als niemals einen erhalten zu haben.
»Hey!«
Ich hob den Kopf. Piper stand mit gerunzelter Stirn vor mir und zupfte ihren blonden Pferdeschwanz zurecht. »Darcy ersetzt dich, oder?«
»M-hm.«
»Kannst du dann bitte nach deiner Mum schauen?« Sie deutete nach hinten, in Richtung Kühlkammer. Ihre mit silbernem Eyeliner umrandeten Augen waren voller Sorge. »Da bahnt sich ’ne Katastrophe an …«
Sofort setzte ich mich in Bewegung. Ich hatte angenommen, dass der Hinweis auf meine Mutter nur Darcys Vorwand gewesen war, um mich von Mr. Huxley zu erlösen. Oder besser gesagt: Ich hatte es mir gewünscht.
Ich ignorierte das Chaos in der Küche – schnappte lediglich ein paar Fetzen à la »kann sich sein Steak in den Allerwertesten stecken« auf – und betrat den Kühlraum.
Meine inneren Alarmglocken hatten bereits zu läuten begonnen, doch jetzt waren sie alles, was ich hören konnte. Meine Mutter kniete auf dem Boden, vor einem Haufen aus Scherben und kläglichen Halva-Resten mit Stückchen von getrockneten Früchten und karamellisierten Walnüssen. Sie machte gerade Anstalten, die Scherben mit bloßen Händen aufzusammeln, während sie eine Litanei griechischer Flüche ausstieß, von der ich nur die Hälfte verstand. Griechisch sprach sie normalerweise ausschließlich mit ihrer Mutter, da die kaum Englisch verstand. Mums Verhältnis zu ihrer Herkunft war kompliziert. Meine Brüder und ich hatten uns die Sprache selbst beigebracht, da Mum sich geweigert hatte, sie mit uns zu sprechen, aber inzwischen hatte ich den Großteil wieder vergessen.
Die Kälte hier drin machte der in meinem Inneren Konkurrenz.
»Mum.« Ich ging neben ihr in die Hocke und drehte sie mit sanfter Gewalt zu mir, griff nach ihren Händen und hielt sie in meinen fest. Ihr Gesicht war tränenüberströmt, und ein Schluchzen ließ ihren ganzen Körper erbeben. »Schau mich an.«
Am liebsten hätte ich mit ihr geheult; es gab wenige Dinge, die mich so fertigmachten, wie meine Mutter so zu sehen.
Sie blinzelte. »Du … Du sollst doch draußen …«
»Sch … Darcy ist gekommen. Es ist alles unter Kontrolle.«
Na ja, das war eine leichte Übertreibung, aber dies war nun wirklich kein Zeitpunkt für ungeschminkte Wahrheiten.
»Wir schaffen es.« Ich umklammerte ihre Hände fester. »Egal, was es ist, wir schaffen es, das schwöre ich. Wir müssen einfach ein bisschen durchhalten, bis wir Verstärkung bekommen. Es wird nicht immer so beschissen schwer sein.«
Ihre Mundwinkel zuckten, und sie schniefte. »Das arme Mädchen soll sich ausruhen.«
»Ach, du kennst sie. Wahrscheinlich saß sie nur bei uns zu Hause rum und hat drauf gewartet, dass ich ihr schreibe und nach Hilfe schreie. Du weißt, wie sehr sie es hasst, nicht Teil des Geschehens zu sein.« Ich probierte ein halbes Lächeln. »Und weißt du, wer sich noch ausruhen sollte?«
Sie verdrehte die Augen und löste sich aus meinem Griff, um sich aufzurichten und mich mit sich hochzuziehen.
Als wir beide vor dem klebrigen Scherbenchaos standen, verwuschelte sie mir die Haare und schüttelte leicht den Kopf. »Mein Gott, du solltest nicht so erwachsen sein müssen.«
»Und du solltest nicht im Kühlraum heulen.«
Sie grinste und schniefte noch mehr. »Du bist mein liebstes Sandwichkind.«
Jetzt war ich dran mit Augenverdrehen. »Sag doch einfach Lieblingskind, es ist eh kein Geheimnis.« Ich schluckte und wurde wieder ernst. »Wo ist Dad?«
Statt einer Antwort nahm sie mein Gesicht zwischen die Hände, beugte sich runter und lehnte ihre Stirn an meine. Eine Weile blieben wir so stehen und atmeten im Einklang, während die Geräusche im Nebenraum immer mehr aus meiner Wahrnehmung verschwanden.
»Wir schaffen es«, wiederholte sie schließlich meine Worte. »Auch wenn wir den Laden zu zweit schmeißen müssen. Wir schaffen es.«
In Bezug auf Dad bedeutete das, er würde sich heute vermutlich nicht mehr blicken lassen. Wie so oft in den letzten Monaten …
Ich gab mir alle Mühe, meine Wut runterzuschlucken, und konzentrierte mich schnell wieder auf Mum. »So weit wird’s nicht kommen.« Ich trat zurück und deutete hinter mich. »Hast du schon dein Team aus verlorenen Seelen vergessen, das du eigenhändig zusammengestellt hast und das dich vergöttert?«
Das entlockte ihr ein weiteres Lächeln.
Es stimmte. In unser Küche arbeiteten keine Leute, die die schicksten Abschlüsse und die beeindruckendsten Lebensläufe vorzuweisen hatten, sondern solche, die sonst nirgendwo einen Platz fanden. Mum litt an einem Menschenhelfersyndrom. Natürlich hatten wir talentiertes Personal. Aber wir hatten auch Personal mit, sagen wir mal, interessanterVorgeschichte. Sie weigerte sich, das als Grund für den Verlust des Sternes zu sehen. Und wenn ich ehrlich war, glaubte ich auch nicht daran. Wir befanden uns einfach in einer schwierigen Phase. Mit Dad und Alexis und dem Verräter, an den ich erst gar nicht denken wollte. Wenn es einen Grund gab, warum es zumindest finanziell bergab ging, dann den, dass Mum niemanden zum Hungerlohn schuften lassen wollte, wie es sonst in der Branche üblich war, obwohl wir über den Winter deutlich weniger Umsatz als zuvor gemacht hatten. Daraufhin hatten wir die Preise für Speisen und Getränke senken müssen – und trotzdem, oder gerade deswegen, noch weniger Umsatz gemacht. Außerdem war Mum kein Fan davon, die Tyrannin raushängen zu lassen, wie es Chefköchinnen und Chefköche sonst oft gerne taten. Und das würde ich ihr garantiert nicht vorwerfen.
»Ich mache hier sauber«, sagte ich bestimmt. »Und du gehst kurz runter ans Meer und machst fünf Minuten mal nichts anderes, als zu atmen. Okay?«
Für einen Moment fürchtete ich, sie würde erneut losweinen, dann nickte sie. »Du bist ein Geschenk des Himmels.« Sie wischte sich über die Wangen und deutete auf ihr verheultes Gesicht. »Auf einer Skala von eins bis zehn: wie …«
»Zwölf. Mindestens.«
Mit einem Lächeln wandte sie sich ab und verließ den Raum.
Meines erlosch, sobald sich die Tür hinter ihr schloss. Ich starrte auf die Lebensmittel, als könnte ich dort die Antwort auf meine drängendsten Fragen finden.
Was war mit Dad los?
Wie konnte ich Alexis dazu bringen, mit mir zu reden?
Warum war Mr. Huxley so ein Arschloch?
Und wie zur Hölle sollte ich Mum dabei helfen, das Restaurant zu retten, wenn ich zwei linke Hände besaß?
Mit einem Stöhnen machte ich mich daran, die Sauerei aufzuwischen.
Eins nach dem anderen. Diese Fragen stellte ich mir weiß Gott nicht zum ersten Mal. Zuerst musste ich diesen Abend überleben.
5. KapitelVictoria
When I’m furthest from myself
»Willkommen im Seascape Inn. Hast hoffentlich ’ne Reservierung?« Die junge Frau an der Rezeption hatte blau gefärbtes Haar und wirkte jünger als ich. Sie prustete los. »Kleiner Spaß. Niemand pennt hier freiwillig. Wir haben um die zehn freie Zimmer. Willste eins mit Meerblick?« Beim letzten Wort wurde sie vom nächsten Lachkrampf geschüttelt.
Ich hatte noch nie in meinem Leben so ein heruntergekommenes Motel gesehen. In der stickigen Lobby – und Lobby war nett ausgedrückt – befand sich ein graubraunes Sofa mit zerrissenem Bezug, auf dem ein großer Labrador lag und dem Anschein nach gerade dabei war, seine letzte Mahlzeit hochzuwürgen. Daneben standen weiße Plastikstühle, auf denen zwei Jungs kichernd die Köpfe zusammensteckten und im Windzug eines Ventilators etwas rauchten, das definitiv illegaler als Tabak roch. Die Fliesen wirkten selbst im spärlichen Licht der einzigen nackten Glühbirne, als wären sie das letzte Mal geputzt worden, als meine Mutter diese Stadt noch ihr Zuhause genannt hatte.
Das Seascape Inn befand sich lediglich zehn Gehminuten vom Bahnhof entfernt, was ich vielleicht als ersten Hinweis hätte erkennen sollen. Der zweite war die Tatsache, dass man nur 35 Pfund pro Nacht für ein Einzelzimmer zahlte.
Ich strahlte das Mädchen an und hoffte, dass man mir den nahenden Zusammenbruch nicht ansah.
»Gerne mit Meerblick. Und ich möchte für eine Woche im Voraus zahlen.«
Hätte ich mich doch bloß für ein Airbnb entschieden … Aber nein, das hier war deutlich unpersönlicher. Niemand würde sich an mich erinnern. Es war genau die Art Unterkunft, die ich brauchte. Und außerdem waren die Ferienapartments alle überteuert gewesen. Ich musste langfristig denken.
»Na dann.« Das Mädchen grinste und tippte auf ihrer Computertastatur rum, die eklig gelb verfärbt war. »Erstes Mal in Goldbridge?«
Ich nickte. Das Schlucken fiel mir schwer.
»Besuchst du Familie?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Urlaub?« Der ironische Unterton war nicht zu überhören.
Erneutes Kopfschütteln.
Sie hob eine hauchdünn gezupfte Augenbraue. »Auf welchen Namen?«
Mein Herzschlag beschleunigte sich, und mein Gesichtsausdruck war wohl das reinste Geständnis, denn im nächsten Moment verschwand jegliches Amüsement aus ihrer Miene und sie lehnte sich interessiert vor. »Bist du auf der Flucht oder so?«
»Ja, klar, ich habe eine Bank überfallen und muss jetzt untertauchen.« Meine Stimme zitterte, statt genervt zu klingen. Verdammter Mist.
Ein paar Sekunden starrten wir uns wortlos an – sie mich neugierig, ich sie flehend –, dann zuckte sie mit den Schultern und tippte wieder auf der Tastatur rum.
»Esmeralda Smith. So heißt du jetzt.«
Erleichtert atmete ich auf. Eindeutig viel besser als ein Airbnb, bei dem ich im Voraus meinen Namen hätte angeben müssen. Bei meinem Bewerbungsgespräch morgen musste ich trotzdem überzeugender sein. Wer wusste, wie lang ich noch ein solches Glück hatte …
Ich reichte ihr das Bargeld für eine Woche im Voraus, kritzelte irgendwas Unleserliches auf den Wisch, den sie mir zum Unterschreiben über den Tisch schob, und griff nach dem Schlüssel, den sie mir hinhielt. Die Zimmernummer darauf war fast vollständig verblichen.
»Erster Stock, gleich die erste Tür links«, klärte das Mädchen mich auf. »Der Aufzug ist kaputt, aber das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Brauchst du Hilfe damit?« Sie nickte mit dem Kinn in Richtung meines Koffers.
Hastig schüttelte ich den Kopf. Schnell weg hier. Mein Herz donnerte so heftig in meiner Brust, dass ich fürchtete, sie könnte es hören. Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn, und die Übelkeit war zurück. Die Hälfte der dreieinhalbstündigen Zugfahrt hatte ich geschlafen und fast meinen Stopp verpasst. In Plymouth war ich schlaftrunken aus dem Zug gewankt und in den Bus gestiegen. Eine Stunde später, gegen 23 Uhr, hatte ich mein Ziel erreicht. Und jetzt?
Mit letzter Kraft schleppte ich den Koffer die Stufen hoch. Im Treppenhaus roch es nach Verwahrlosung, Energydrinks und Gras. Meine Übelkeit wurde mit jedem Schritt schlimmer. Die Glühlampen waren größtenteils durchgebrannt, aber das war vermutlich etwas Gutes. Je weniger ich von der Einrichtung sah, desto länger konnte ich mir einreden, dass sie schon ganz okay war.
Im Zimmer angekommen, wurde der widerliche Geruch durch Essigreiniger ersetzt. Immerhin. Ich ließ die Tür hinter meinem Koffer und mir zufallen, atmete tief durch und schaltete das Licht ein.
Okay. Okay. Okay. Halb so schlimm. Direkt neben dem Eingang führte eine Tür, die völlig verkratzt war, ins Badezimmer mit Dusche. Von hier aus konnte ich nur drei faustgroße Schimmelflecken erkennen. Das war zu verkraften.
Das Schlafzimmer war keine zehn Quadratmeter groß. Ein Einzelbett, ein Schreibtisch mit Stuhl und ein nach außen vergittertes winziges Fenster darüber. (Das mit dem Meerblick war also definitiv ein Scherz gewesen.) Grauer Teppich mit mehreren Flecken, doch der Rest sah recht sauber aus. Ich lief zum Fenster und öffnete es.
Alles okay. Ich hatte es geschafft. Ich war stark und unabhängig und frei. Das war alles, wovon ich geträumt hatte. Mich einfach in den Zug setzen und abhauen. Und jetzt hatte ich es getan.
Ich ließ mich aufs Bett fallen – die Matratze ächzte – und vergrub das Gesicht in den Händen. Ich brauchte was zu trinken und zu essen. Und dann sollte ich schlafen gehen. Das wäre nur vernünftig. Morgen hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Auch wenn ich mich nicht angekündigt hatte, ich würde vorbeischauen und auf das Beste hoffen.
Mein verdammtes Herz wollte nicht zur Ruhe kommen.
Alles klar, Vernunft brachte mich offensichtlich nicht weiter. Alkohol musste her. Das war es, was ich jetzt wirklich brauchte. Schon vor Jahren hatte ich herausgefunden, was er bei mir bewirkte. Wenn ich ihn schlau dosierte, wurde ich normal: kein Herzrasen, keine Übelkeit. Die gruseligsten Situationen machten mir keine Angst mehr. Ich war in der Lage, Small Talk mit meinen Kollegen zu führen, mit denen ich sonst nichts anfangen konnte. Und ich hatte kein Problem damit, früher Feierabend zu machen und überzeugenden Sex zu haben.
Leider war es eine Herausforderung, ihn richtig zu dosieren. Ein Schluck zu viel, und die Wunderwirkung kippte ins Gegenteil und machte alles nur schlimmer.
Ich beugte mich vor und steckte den Kopf zwischen die Beine.
Alles okay.
Alles okay.
Alles okay.
Ich war frei. Egal, wie ich mich gerade fühlte, ich war frei.
Ich will nicht frei sein. Ich will Leo. Ich will mich in seinen Armen vergraben, seinen gewohnten Duft riechen, seine große Hand spüren, die mir sanft über den Hinterkopf streicht. Ich will ein Lächeln aufsetzen und die ganze Nacht feiern. Und morgen früh will ich aufstehen, mich an den Herd stellen und meiner Bestimmung nachgehen. Ich will meine Hände sich selbst überlassen, jeder Griff ein einstudiertes Spiel, die Geräusche im Hintergrund, das scharfe Messer, das auf das Schneidebrett trifft, das Zischen und Brutzeln und Klappern, die Befehle, der Schweiß, die Stille in meinem Kopf.
Einatmen.
Ausatmen.
Ein.
Aus.
Alles okay.
Ich wusste nicht, wie viel Zeit verging, bis ich den Kopf heben konnte. Die Übelkeit war besser geworden, aber mein Herz …
Mit fahrigen Bewegungen griff ich nach meiner Tasche und zog mein Handy hervor. Öffnete die Memo-App und begann die wichtigsten Aufnahmen zu hören, zum hundertsten Mal in den letzten Tagen.
Mein Schluchzen zerriss die Stille im Zimmer. Der Schmerz machte mir das Atmen schwer, doch er half. Sobald ich meine verzweifelte Stimme hörte, vermisste ich ihn nicht mehr so schlimm.
Ich hatte Jahre gebraucht, um mir die Wahrheit endgültig einzugestehen.
Ich schloss die Augen.
Du wirst jetzt duschen und dich umziehen. Und dann gehst du raus und gibst dir die Kante, bis du schlafen kannst.
6. KapitelJulian
I’m that guy
»Hey, du. Gehen wir noch zu Ash?«
Keine Ahnung, wie ich noch so fröhlich klingen konnte. Meine Beine und Arme zitterten, ich fühlte mich wie einmal verdaut und wieder ausgespuckt und war mir sicher, ich sah auch so aus. Mein kleiner Bruder hingegen wirkte wie das blühende Leben. Er war der Letzte in der Patisserie und gerade dabei, die verbliebenen Limettentörtchen zum Sorbet zu stellen. Seine Schürze war nach wie vor schneeweiß. Wie immer war es mir ein Rätsel, wie er eine komplette Schicht arbeiten und hinterher so aussehen konnte.
Alexis war deutlich talentierter als ich. In seiner Ausbildung hatte er sich im Gegensatz zu mir auf die Konditorei konzentriert. Ich kannte niemanden mit so viel Fingerspitzengefühl und Geduld wie ihn. Das ganze Restaurant hätte um ihn herum abbrennen können, er hätte nichts davon mitbekommen, solange er mit Zutaten abmessen, kneten oder verzieren beschäftigt war.
»Alexis.«
Erst jetzt hob er den Kopf. Uns trennte die Arbeitsplatte. Er war zwei Jahre jünger als ich, dafür aber zehn Zentimeter größer. Die größte Ähnlichkeit zwischen uns war die Augenform, der größte Unterschied unsere Haare (meine verwuschelt, seine abrasiert).
Ein trauriges Lächeln erschien auf seinen Lippen, und er schüttelte den Kopf.
»Musst du morgen wieder früh raus?«
Er nickte und hob eine Augenbraue, was vermutlich so viel wie »Du etwa nicht?« heißen sollte.
»Jo, ich auch, aber ich ertrage es nach heute nicht, direkt ins Bett zu gehen.«
Es sollte locker klingen. Tatsächlich klang es verzweifelt.
Scheiß drauf, wir wussten auch so beide, was mein Problem war.
»Sag mal, weißt du, was mit Mum und Dad ist?« Eigentlich hatte ich noch »Also abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich bald in Schulden versinken werden« hinzufügen wollen, aber Alexis zuckte so heftig zusammen, dass ich um die Anrichte herumlief und ihm eine Hand auf den Rücken legte.
Er ließ es genau zwei Sekunden zu, bis er sich befreite und einen Schritt zur Seite trat.
»Alles okay?«
Er nickte abrupt. Die Frage hätte ich mir sparen können.
Die gewohnte Gefühlsmischung aus Angst, Frust und Wut kochte in mir hoch. Ich presste die Lippen aufeinander, um ihr keine Luft zu machen. Der Familientherapeut hatte mir empfohlen, ruhig und gelassen zu reagieren. Danke für diesen grandiosen Tipp, Baldwin, darauf wäre ich nie gekommen.
Ruhe und Gelassenheit waren Fremdwörter für unsere Familie. Nachdem Alexis vor etwas über einem Jahr aufgehört hatte zu sprechen – zumindest mit seiner Familie –, hatte er erst ein paar erfolglose Sitzungen allein bei Baldwin gemacht, dann waren Mum, Dad und ich dreimal mitgegangen. Es hatte ebenso wenig gebracht, außer uns noch deutlicher vor Augen zu führen, wie beschissen es ihm ging. In der letzten Sitzung hatten wir einfach alle mit ihm geschwiegen und abwechselnd auf die große Wanduhr im Therapiezimmer gestarrt. Anschließend hatten wir beschlossen, dass es wohl sinnvoller war, so normal wie möglich weiterzumachen. Aber leider war das Verhältnis unser Eltern seitdem alles andere als normal …
Alexis’ Atemzüge beschleunigten sich, sein Blick suchte gehetzt nach etwas, woran er sich festkrallen konnte, weil die Alternative – mich anzuschauen – offensichtlich unerträglich für ihn war.
»Sorry«, murmelte ich. »Sorry, ich wollte nicht …«
Was wollte ich nicht? Ihn stressen, so wie diese beschissene Situation mich stresste? Versuchen, ihm näherzukommen, obwohl er die letzten Monate kaum was anderes getan hatte, als mich wegzustoßen?
Er zog das Handy aus seiner Jeanstasche hervor, tippte darauf herum und legte es vor mir auf die Arbeitsplatte.
Sobald ich das Profilbild im Chatfenster sah, erstarrte ich. Sonnenbrille, dunkelblondes Haar, eine verglaste Fensterfront hinter ihm und die Skyline, die auf eine Millionenstadt hindeutete – das Gegenteil von Goldbridge. Hauptsache das Gegenteil. Ich wollte nicht hinsehen, aber es war wie bei einem Unfall – man konnte nicht wegschauen.
Die letzte Nachricht war vor zehn Minuten eingegangen:
Nic: Alles gut bei euch, Alex?
Das Smiley. Die Wortwahl.
Sein arrogantes Grinsen erschien vor meinem inneren Auge.
»Touché«, zischte ich und wich zurück, als hätte er mich geschlagen. Ich erinnerte ihn an unsere Eltern, er mich zur Strafe an unseren großen Bruder.
Ohne Alexis noch eines Blickes zu würdigen, stürmte ich aus der Patisserie in den Flur, der zu den Umkleiden führte, und rannte in Darcy rein, die sich schon umgezogen hatte und genauso müde aussah, wie ich mich fühlte.
»Boah, wie kannst du noch so viel Energie haben?«, murmelte sie und hielt sich an meinen Schultern fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. »Gehen wir bitte endlich heim? Ich kann kaum noch die Augen …« Sie verstummte und zog die feinen schwarzen Brauen zusammen. Besorgt legte sie die Hände an meine Wangen. »Julian?«
»Ich hasse ihn«, brachte ich hervor und hasste mich gleich dazu, als mir Tränen in die Augen schossen.
Ihr Blick wanderte hinter mich, und Verwirrung machte sich auf ihrem vertrauten Gesicht breit. »Alexis?«
»Nicolas«, knurrte ich und blinzelte zornig die Tränen weg.
Ein Seufzen entwich ihr. »Was hat er gemacht?«
»Existieren.«
Sie öffnete den Mund, doch ich schüttelte den Kopf und zog sie näher zu mir, um sie in eine Umarmung zu schließen, die sie augenblicklich erwiderte. Darcy wusste immer, was ich brauchte.
»Themawechsel«, raunte ich in ihr Haar. »Danke für heute. Danke, danke, danke. Ich liebe dich.«
»Bitte, bitte, bitte. Ich dich auch.« Sie küsste mich auf die Nasenspitze. »Gehen wir pennen? Und klauen davor noch zwei Limetten-Tartelettes?«
Ich wich zurück.
Sie registrierte meinen Blick und brauchte nur einen einzigen Atemzug, um zu verstehen. »Echt jetzt?«
»M-hm. Würdest du …«
»Vergiss es.«
Unter anderen Umständen hätte ich mich ins Zeug gelegt und sie überredet, noch was mit mir trinken zu gehen. Doch heute hatte ich genug Gefallen von ihr eingefordert.
Ich gab ihr einen Kuss auf den Scheitel. »Schlaf gut. Wir sehen uns morgen.«
»Komm nicht zu spät«, erwiderte sie besorgt.
Das sagte sie nicht ihretwegen, sondern vor allem meinetwegen. Im Gegensatz zu ihr musste ich morgen früh raus.
»Okay.«
Ich sah ihr hinterher, wie sie den Flur entlanglief und Richtung Ausgang verschwand.
Mit einem Seufzen wandte ich mich ab und wollte gerade die Umkleiden ansteuern, als ich das Geräusch hörte. Ein lautes Schniefen. Gefolgt von beschwichtigendem Geflüster.
Meine Beine bewegten sich wie von allein, nicht in Richtung Umkleide, sondern die Wendeltreppe hoch. Vor der Bürotür blieb ich stehen. Sie war nur angelehnt. Der Raum war winzig, tagsüber mit einer wunderschönen Aussicht aufs Meer, da er sich über dem Restaurantbereich befand.
»Ich kann das nicht«, hörte ich Mum mit erstickter Stimme sagen. »Ich schaffe es nicht, Elliot. Es ist schon zu zweit eine Herausforderung, aber ohne dich …«
Mit angehaltenem Atem beugte ich mich vor, um durch den Türspalt zu sehen.
Sie war allein. Mit dem Rücken zu mir saß sie am Schreibtisch und hielt das Telefon in der Hand. Nur die kupferfarbene Tischlampe erhellte den Raum, aber selbst bei der schummrigen Beleuchtung war nicht zu übersehen, dass sie zitterte.
»Nein, verdammt, es ist mir egal, was diesmal deine Ausrede ist!«
Ich machte einen Schritt zurück und drückte mich gegen die Wand. Schloss die Augen. Es wäre so viel einfacher, wenn ich meinen Vater so hassen könnte, wie ich Nic hasste. Wenn ich ihm die Schuld für alles geben könnte. Dummerweise steckte in mir noch dieser kleine, ängstliche Junge, der sich wünschte, seine Eltern würden zu streiten aufhören und alles würde wieder gut werden.
Dad hatte irgendwelche Probleme, das wussten wir jetzt schon länger. Er war unser Souschef, deshalb fiel sein Fehlen im Restaurant besonders auf – und bedeutete noch mehr Arbeit für uns alle. Mum war mir gegenüber nicht ins Detail gegangen, aber das, was sie gesagt hatte, reichte aus, um mich wütend zu machen: »Wir müssen Geduld mit ihm haben. Er hat es nicht leicht.«
»Aber du hast es leicht, oder was?«, hätte ich ihr am liebsten entgegengeschrien. Ihr Schluchzen verfolgte mich manchmal bis in meine Träume.
Ein Schniefen erklang, und als sie sprach, senkte sie die Stimme; trotzdem verstand ich jedes Wort. »Ich weiß nicht, was ich ohne Julian tun würde.«
Ich erstarrte. Normalerweise war es schön, wertgeschätzt zu werden. Zu hören, dass ich gebraucht wurde, dass meine Mühen anerkannt wurden. Heute war es nicht schön. Heute schnürte es mir die Kehle zu. Ich wollte nicht gebraucht werden. Ich wollte, dass die Welt um mich herum sich weiterdrehte, auch wenn ich mal keine Lust hatte, sie zu retten.
Obwohl mein Körper rebellierte, zwang ich mich, den Rückzug anzutreten. Natürlich wollte ich zu ihr gehen, sie umarmen wie vorhin, ihr wieder und wieder sagen, dass wir es schaffen würden. Aber ich hatte meine Grenze erreicht. Ich brauchte frische Luft. Ich musste weg hier und mich daran erinnern, dass ich ein eigenständiger Mensch war, nicht bloß die einzige Hoffnung meiner Familie.
In Windeseile zog ich mich um und war heilfroh, dass mir niemand mehr begegnete. Als ich ins Freie trat und die frische Nachtluft inhalierte, zog ich mein Handy hervor und tippte eine Nachricht an meinen liebsten Pub-Besitzer der Stadt.
Julian: Halt mir einen Platz frei, ja? Bin in 10 min da.
Die Antwort kam keine Minute später.
Ash: Musst du morgen nicht arbeiten?
Ich stöhnte auf. In dieser Stadt gab es keine Geheimnisse.
Julian: Doch.
Ash: Oh je, ich fange schon mal zu mixen an … Wie immer?
Julian: Wie immer.
7. KapitelVictoria
On top of everything
Der alternative Pub mit dem klangvollen Namen Recipe for disaster befand sich etwa eine halbe Stunde zu Fuß von meiner Bleibe entfernt. Unmittelbar hinter der Tür befand sich ein dicker Samtvorhang, durch den ich ins Innere getreten war, die sechseckigen Fliesen waren rostrot und abgenutzt, und an den holzverkleideten Wänden hingen gerahmte Bilder mit vergilbten Motiven – Fischerboote, Strandpromenaden, Bier-Werbung, dazwischen war eine kleine Girlande mit Pride-Flaggen gespannt. Die Zeit schien hier stehen geblieben zu sein. Ich hatte bereits einen Vintage-Flipperautomaten und eine gigantische Jukebox entdeckt. Sie spielten Songs von Kate Bush, David Bowie und Imelda May – die stammten aber nicht von der Jukebox, sondern von einem mit Lautsprechern verbundenen Handy. Es war ein Lokal, das ich in London niemals betreten hätte, weil ich mich jahrelang nur in der gehobenen Gastroszene bewegt hatte – und damit der perfekte Ort für mich.
Die Rezeptionistin hatte mir den Laden empfohlen, nachdem ich sie gefragt hatte, wo ich um diese Uhrzeit noch was zu essen bekommen würde. Dem Anschein nach hatte sie anschließend das Telefon in die Hand genommen und direkt Bescheid gegeben, dass ich vorbeikommen würde. Der Pub war brechend voll, das Publikum gemischt. In einer Ecke saßen drei ältere Männer in gemusterten Strickpullovern und spielten Karten, auf der Sitzbank direkt gegenüber entdeckte ich eine Gruppe von Teenagern in quietschbunten Outfits, die lachend die Köpfe zusammensteckten, und dazwischen waren so ziemlich alle Altersgruppen vertreten. Doch alle hatten sie eines gemeinsam: Ich schien ihr Gesprächsthema Nummer eins zu sein. Manche Gäste tuschelten hinter vorgehaltener Hand, andere wiederum machten sich nicht mal die Mühe, leise zu sprechen. Von »Wer ist die Kleine?« bis hin zu »Süß, oder?« und »Hab gehört, sie hat ’ne Bank überfallen und ist jetzt auf der Flucht.« war alles dabei gewesen.
Vielleicht hätte ich spätestens bei letzterer Bemerkung das Weite suchen sollen, aber obwohl mein Puls raste, war ich sitzen geblieben, direkt an der Bar, auf einem der wenigen freien Plätze. Mein Hunger half. Genau wie die Gewissheit, dass es mir deutlich schlechter gegangen wäre, wäre ich allein im Motelzimmer geblieben. Komme, was wolle, ich musste die Gedanken an das Vorher zurückhalten. Ich durfte nicht daran denken, was ich getan hatte, sonst würde ich durchdrehen.
»Ein Green-Goddess-Sandwich für die rothaarige Göttin«, holte mich die Stimme der Barkeeperin aus meinen Gedanken.
Sie war bestimmt eins achtzig groß und trug ein abgeschnittenes dunkles Shirt, welches ein minimalistisches Tattoo auf ihrem Oberarm freigab. Ihre dunkelblonden Haare waren zu einem Faded Buzz Cut geschnitten, nur die vorderen Strähnen lockten sich leicht über der Stirn.
Mein Lächeln kostete mich nicht halb so viel Anstrengung wie erwartet. Das Sandwich duftete herrlich, und mein Magen zog sich freudig zusammen. Ich gab mir keine Mühe, langsam zu essen. Avocado, Spinat und mindestens zwei verschiedene Käsesorten zergingen mir auf der Zunge. In großen Bissen verschlang ich es und schüttete ein halbes Glas Birnencider hinterher. Ein warmes Gefühl machte sich in mir breit. Es war alles in Ordnung. Niemand würde mich erkennen. Ich war Hunderte Kilometer von London entfernt. Und außerdem trug ich noch immer die Brille, hatte kurze Haare und mir die Lippen knallrot geschminkt. Es war mir egal, dass der Ton sich mit meiner Haarfarbe biss. Heute Nacht war alles egal, solange ich meine Gedanken in Trab hielt, damit sie nicht in den Abgrund rutschten.
»Jules!« Die Barkeeperin kam hinter dem Bartresen hervor und lief mit leuchtenden Augen an mir vorbei. »Das wird dein Untergang sein!«
Jeder Blick nach hinten bedeutete, dass ich mindestens fünf neugierigen Augenpaaren begegnete, also schaute ich stur nach vorn. Über dem Bartresen befand sich ein riesiger ausgestopfter Hirschkopf mitsamt imposantem Geweih. Ich leerte mein Glas und bestellte noch eins bei einer Kellnerin, die eine rosa Kaugummiblase nach der anderen produzierte und zerplatzen ließ und mich dabei musterte, als hätte sie im Leben noch nie was Interessanteres gesehen.
»Ich bin Reena«, teilte sie mir mit, während sie mein Glas auffüllte. »Und du?«
Diesmal war ich vorbereitet. »Wäre schon ziemlich dumm, dir meinen Namen zu nennen, wenn ich gerade auf der Flucht bin.«
»Wie du willst.« Mit einem Lachen warf sie ihren geflochtenen Zopf über die Schulter. »Bist du auf der Durchreise?«
»Mal sehen.« Ich lächelte sie an, und plötzlich war es ganz einfach. Vielleicht lag es daran, dass mein Hunger endlich gestillt war und der Cider mich von innen wärmte, aber zum ersten Mal, seit ich angekommen war, fühlte ich mich nicht vollkommen fehl am Platz. »Mal sehen, wie gut es mir hier gefällt. Bisher kenne ich Goldbridge nur bei Nacht.«
Mein zweiter Drink war fertig, und sie schob ihn mir entgegen, doch als ich ihr das Glas aus der Hand nehmen wollte, ließ sie es nicht los.
»Dann lass dir eines gesagt sein: Es ist abgefuckt, die Leute haben alle einen Knall, und jeder Schritt, den du tust, wird kommentiert. Aber wenn du einmal dein Herz an Goldbridge verlierst, ist es vorbei. Du wirst nie wieder einen anderen Ort dein Zuhause nennen wollen.« Mit einem Grinsen ließ sie das Glas los. »Vor zwanzig Jahren bin ich hergekommen, um eine Freundin zu besuchen, und dann bin ich einfach geblieben.«
Mein Lächeln verschwand. Ich wollte ihr Fragen stellen, wollte sie reden lassen, doch alles in mir zog sich zusammen. War es das, was mit Mum passiert war? Sie hatte einfach ihr Herz an die Kleinstadt am Meer verloren und vergessen, dass eine Tochter in London auf sie wartete, deren Herz Tag und Nacht nach ihr schrie?
Ich begegnete Reenas prüfendem Blick. Hastig schaute ich weg und setzte das Glas an die Lippen. Trank und trank und trank. Am Rande nahm ich eine Bewegung links von mir und das Geräusch eines Barhockers wahr, der zurückgezogen wurde.
Widerstrebend wandte sich Reena von mir ab und griff nach einem schon vorbereiteten grünen Cocktail im Marmeladenglas, der mit Minze, Limette und einem Schirmchen garniert war. »Wie bestellt, Darling. Trink aus.«
Ich setzte mein Glas ab, ignorierte die aufwallende Übelkeit, weil ich zu viel auf einmal getrunken hatte, und wandte mich meinem neuen Sitznachbarn zu. »Lass mich raten – Jules?«
Er saß nur wenige Zentimeter von mir entfernt und war gerade dabei, sich aus seiner cremefarbenen Jeansjacke im Achtzigerjahre-Stil zu schälen. Ich schätzte ihn auf höchstens Mitte zwanzig. Seine Haare waren nachtschwarz und fielen ihm in wirren Strähnen in die Augen. Mit der linken Hand, an der zwei breite silberne Ringe glänzten, schob er sie sich nach hinten. Seine Augen waren bemerkenswert. Nicht wirklich schön, aber irgendwie magnetisch, sodass man nicht wegsehen konnte. Leicht hängende Schlupflider, mit geraden Wimpern und bläulichen Schatten darunter. Im schummrigen Barlicht wirkten sie ebenso schwarz wie seine Haare. Seine Nase war breit und markant, seine Oberlippe voller als die Unterlippe. An seinem Kinn war eine kleine Rötung zu erkennen, wahrscheinlich vom Rasieren. Der Pulli, den er unter der Jacke trug, war ausgebeult und der Aufdruck darauf verblichen.
In den Tiefen meines Gedächtnisses regte sich etwas. Hatte ich ihn schon einmal irgendwo gesehen? Erinnerte er mich an jemanden aus London?
Wir starrten uns an. Die Sekunden verstrichen, und ich konnte mich nicht losreißen. Im Hintergrund schallte »Tainted Love« aus den Lautsprechern. Normalerweise war ich echt schlecht darin, Musik zu erkennen, aber an diesen Ohrwurm erinnerte ich mich immer. Der Typ sah mich ebenso fasziniert an wie ich ihn. Sein Blick glitt über meine Haare, meine Augen, meinen Mund, mein dunkelgrünes T-Shirt-Kleid und wieder zurück. Seine Lippen teilten sich leicht. Getuschel und Gelächter erklangen hinter uns, mischten sich unter die dröhnende Musik.
Wärme erfüllte meinen Körper. Wärme und etwas, das sich wie Leichtsinn anfühlte. Vergessen war die Übelkeit, vergessen meine Regelschmerzen. Meine Umgebung kam mir mit einem Mal schöner vor, weicher, einladender.
Ich war heute schon so viele Schritte gegangen. Und ich könnte noch einen letzten gehen, um meine Verbindung zum Vorher endgültig zu kappen. Er war perfekt dafür. Gerade weil er so unperfekt war. Optisch kein bisschen wie Leo. Und er sah mich an, als hätte das Universum ihm soeben das größte Geschenk gemacht. Leo hatte mich auch so angesehen – nach der Kalt-und-distanziert-Phase. Aber Leo hatte ich geglaubt. Ich hatte ihm die Kontrolle überlassen. Ab sofort würde ich die Kontrolle übernehmen.
»Hi.« Wie auf Knopfdruck verzogen sich meine Lippen zu einem breiten Lächeln. Ich streckte ihm meine Hand hin.
Er griff sofort danach und lächelte ebenfalls, ein bisschen verdattert.
Mein Blick fiel auf sein Tattoo. Auf seinem rechten Handrücken befand sich das Abbild einer schwarzen Kordel, die sich um seinen Zeigefinger und Daumen schlang und bis zu seinem Unterarm reichte.
»Julian«, sagte er. »Oder Jules, ja. Oder Julianos, wenn du meine Jiajiá, also meine Gran fragst. Namenstage sind wichtig, weißt du. Wäre ’ne Schande, wenn kein Heiliger über mich wacht. Julian hat keinen. Julianos schon – den einundzwanzigsten Juni.« Er schüttelte den Kopf, als könnte er nicht fassen, was er da gerade gesagt hatte.
Ein Kichern entfuhr mir.
»Nenn mich, wie du willst. Und wie darf ich dich …«
»Vergiss es, Kleiner«, rief Reena ihm im Vorbeigehen zu, während sie ein Tablett mit vollen Biergläsern balancierte. »Sie will mysteriös bleiben.«
»Tori«, sagte ich. »Ich bin Tori.«