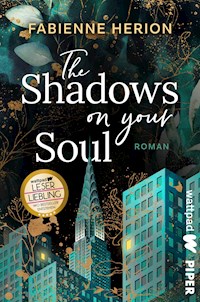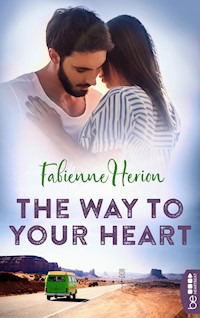
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine emotionale Reise quer durch die USA auf der Suche zu sich selbst.
Amber weiß nicht mehr weiter: Zuerst hat sie ihren Job verloren, um dann auch noch festzustellen, dass sie aus ihrer Wohnung geschmissen wurde. Völlig mittellos und verzweifelt sucht sie einen Unterschlupf für die Nacht - und findet einen schrottreifen, scheinbar verlassenen Mini-Bus. Doch verlassen ist er keinesfalls. Denn plötzlich steht dessen vollbärtiger, eigenbrötlerischer Besitzer Deacon vor ihr. Obwohl dieser wenig begeistert von dem blinden Passagier ist, lässt er Amber bleiben. Zusammen reisen sie quer durch die USA, leisten sich Gesellschaft, spenden sich Trost und kommen einander so schnell näher. Doch mit der Zeit werden beide von ihrer Vergangenheit eingeholt, und die stellt die zarten Gefühle auf eine harte Probe. Werden sie trotzdem zueinander finden?
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das sagen unsere Leserinnen und Leser:
"Die Kombination aus wundervoller Liebesgeschichte und dem Road-Trip macht das Buch absolut lesenswert, besonders für Fans der USA oder die, die es werden wollen." (Sumuel, Lesejury)
"Gefühlsbetont, Turbulent und romantisch :o) Das volle Spektrum für ein Liebesroman." (Tasmaniandevil8, Lesejury)
"Achtung Suchtgefahr! Ich habe das Buch nicht aus der Hand legen können und es regelrecht verschlungen." (Lea296, Lesejury)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Playlist
1. Kapitel: Philadelphia
2. Kapitel: Pennsylvania
3. Kapitel: Virginia
4. Kapitel: Tennessee
5. Kapitel: Tennessee II
6. Kapitel: Tennessee III
7. Kapitel: Tennessee IV
8. Kapitel: Arkansas
9. Kapitel: Arkansas II
10. Kapitel: Arkansas III
11. Kapitel: Texas
12. Kapitel: Texas II
13. Kapitel: Texas III
14. Kapitel: Colorado
15. Kapitel: Colorado II
16. Kapitel: Colorado III
17. Kapitel: Colorado IV
18. Kapitel: Colorado V
19. Kapitel: South Dakota
20. Kapitel: South Dakota II
21. Kapitel: Wyoming
22. Kapitel: Wyoming II
23. Kapitel: Utah
24. Kapitel: Nevada
25. Kapitel: Nevada II
26. Kapitel: Nevada III
27. Kapitel: Kalifornien
28. Kapitel: San Francisco
Danksagung
Über dieses Buch
Amber weiß nicht mehr weiter: Zuerst hat sie ihren Job verloren, um dann auch noch festzustellen, dass sie aus ihrer Wohnung geschmissen wurde. Völlig mittellos und verzweifelt sucht sie einen Unterschlupf für die Nacht – und findet einen schrottreifen, scheinbar verlassenen Mini-Bus. Doch verlassen ist er keinesfalls. Denn plötzlich steht dessen vollbärtiger, eigenbrötlerischer Besitzer Deacon vor ihr. Obwohl dieser wenig begeistert von dem blinden Passagier ist, lässt er Amber bleiben. Zusammen reisen sie quer durch die USA, leisten sich Gesellschaft, spenden sich Trost und kommen einander so schnell näher. Doch mit der Zeit werden beide von ihrer Vergangenheit eingeholt, und die stellt die zarten Gefühle auf eine harte Probe. Werden sie trotzdem zueinander finden?
Über die Autorin
Fabienne Herion, geboren 1994 in Karlsruhe, wohnt in der sonnigen Südpfalz. Seit ihrer glorreichen Idee in der Grundschule den »Der Herr der Ringe« umzuschreiben, begleitet sie die Faszination für Bücher schon ihr ganzes Leben. Ihre Inspiration findet Fabienne vor allem in der Natur bei Burgenwanderungen und auf Entdeckungstouren durch fremde Länder und Kulturen. Ihr erster Liebesroman »The Way to Your Heart« ist im Sommer 2021 bei beHEARTBEAT erschienen. Auf Instagram findet ihr sie unter @fabienneherion oder auf ihrer Homepage www.fabienne-herion.de.
Fabienne Herion
THE WAY TOYOUR HEART
beHEARTBEAT
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © MoreISO/iStock/Getty Images Plus; © Vasyl Dolmatov/iStock/Getty Images Plus; © Thomas Pajot/Adobe Stock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0523-3
be-ebooks.de
lesejury.de
Für Didi.
Playlist
Australia – Emilio Lanza, Sara Vanderwert
Nowhere – Black Match
Lys (feat. Menke) – Christian Löffler, Menke
Hold Me Down – James Gillespie
Permanent Way – Charlie Cunningham
Red – Mt. Wolf
Girl (Acoustic) – SYML
Fuel to Fire – Agnes Obel
Oceans – RY X, Ólafur Arnalds
Search Light – Jason Walker
Body – SYML
Still – Daughter
Promise – Ben Howard
After The Landslide – Matt Simons
Calm After The Storm – The Common Linnets
Philadelphia
Eine wackelnde Hulapuppe mit Bastrock, eine Miniaturausgabe der Golden Gate Bridge und ein Collegeblock mit verschiedenfarbigen Textmarkern – Erinnerungen an ein Leben, das mir in diesem Moment schon weit weg erschien.
»Wir verstehen, dass diese Situation für Sie nicht leicht ist. Seien Sie versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um Ihnen den Übergang so angenehm wie möglich zu gestalten«, hatte der Mann am anderen Ende des Landes gesagt.
Ich saß in einem spärlich beleuchteten Raum. Die schlechte Verbindung ließ sein Gesicht auf dem kleinen Bildschirm vor mir grotesk aufflackern. Ich dachte, er wollte mir die Wahrheit sagen – wie unfair das Leben nur allzu häufig sein konnte, wie enttäuschend. Doch ihm kamen keine anderen Worte über die Lippen außer denen, die schon viele meiner Kollegen vor mir hören mussten. Es tut uns leid waren keine davon.
Der Mann am anderen Ende der Leitung verlor ja auch nicht seinen Job. Er war nur irgendein externer HR-Mensch, der uns alle nicht einmal kannte. Nach einem Jahr, in dem ich wirklich hart gearbeitet und alles gegeben hatte, fanden sie keine anderen Worte für mich außer einem Verweis auf die Broschüren vor mir. Sie sollten mir die Motivation geben, nicht in der Niedergeschlagenheit steckenzubleiben, nach vorn zu blicken, eine Perspektive zu haben, auch wenn es mir im Moment so vorkam, als gäbe es kein Licht mehr am Ende des Tunnels.
Also packte ich meine Sachen in einen kleinen Karton und lief zum Aufzug, der mich in eine Welt voller Ungewissheit entlassen sollte.
Die von Sonnenlicht durchflutete Lobby hatte sich an diesem Tag in einen düsteren Ort des Chaos verwandelt. Eine Empfangsdame war dabei, alles, was in Reichweite lag, in Boxen zu verstauen. Sie legte auf besondere Sorgfalt keinen Wert. Bildschirme wurden mitsamt den Kabeln aus ihren Halterungen gerissen.
»Ist doch unglaublich, was hier passiert«, beschwerte sie sich lautstark bei mir. »Sollen sie doch alle zur Hölle fahren! Wenn sie mir meinen Lohn nicht geben wollen, nehme ich mir eben, was ich kriegen kann.«
»Dafür werden Sie aber mehr als ein paar Bildschirme brauchen«, antwortete ich entgeistert.
Unsere Löhne hatten sie schon seit einiger Zeit nicht mehr gezahlt. Wir dachten, es sei temporär – dass es uns, wenn wir nur genug arbeiten würden, bestimmt bald wieder besser ginge. Falsch gedacht. Keinen Cent würden wir jemals davon sehen.
»Sie haben sich verzockt. Sollen alles auf das falsche Pferd gesetzt haben, und wir sind jetzt die Leidtragenden.« Ein etwas älterer Kollege war Zeuge unserer Unterhaltung geworden und stimmte nun in die Anschuldigungen mit ein.
»Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll«, erwiderte ich.
»Schätzchen, das weiß keiner von uns.«
Das hier hätte mein Neuanfang sein sollen. Philadelphia. Eine fremde Stadt, fernab von allem, was ich kannte. Ich hatte mich auf meinen Job konzentriert, nichts anderes war wichtig gewesen. Ich hatte keine Freunde, und das, obwohl ich diese Stadt schon seit einem Jahr mein Zuhause nannte. Meine Familie war an der Westküste im immer sonnigen Kalifornien geblieben. Und ich hatte keine Bekanntschaften, schon gar keine romantischen.
Und das alles für einen langweiligen Bürojob, bei dem ich den ganzen Tag nichts anderes getan hatte, als ahnungslosen, unbedarften Menschen Versicherungen aufzudrängen, die sie nicht einmal brauchten – nichts, worauf ich wirklich stolz war, doch ein notwendiges Übel. Und nun setzten sie uns, ohne mit der Wimper zu zucken, vor die Tür, weil sie Insolvenz angemeldet hatten.
Seufzend ließ ich die beiden und die sich rasch leerende Lobby hinter mir und ging zum letzten Mal durch die vergoldete Drehtür, hinter der mich der kalte Atem des Winters rücksichtslos empfing.
Ich wollte flüchten, hinein in mein wohlig warmes Zuhause, weg aus dem Trubel der Stadt, dorthin, wo mich niemand sonst finden würde. Nicht, dass mich jemand suchen würde.
Mitleidige Blicke umgaben mich in der Bahn, denn jeder Mitreisende kannte die Bedeutung meines Kartons und meiner hängenden Mundwinkel. Er wäre mir fast aus den Händen gefallen, während ich versuchte, meinen Schal zu richten und den Kragen meiner Jacke in Vorbereitung auf den kalten Heimweg wieder aufzustellen.
Mein Wohnhaus ging in einer nicht enden wollenden Reihe gleich aussehender Bauten aus den Anfängen des Zwanzigsten Jahrhunderts unter – einst schön mit Torbögen und reichen Verzierungen an den Fassaden geschmückt. Leider hatte sich seit langem niemand mehr um die Häuser gekümmert.
Noch nie zuvor war mir meine unmittelbare Nachbarschaft so bewusst aufgefallen wie jetzt. Ein wenig erinnerte mich dieser trostlose Anblick an mich selbst. Alles war längst nicht mehr so strahlend, wie es zu Beginn einmal gewesen war.
Ich bemühte mich, nicht zu weinen. Dennoch verschleierten auf meinem Weg nach Hause immer mehr aufsteigende Tränen meine Sicht. Nicht einmal den Haustürschlüssel konnte ich in meiner Tasche erkennen. Alles war gänzlich verschwommen, und es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis ich es endlich geschafft hatte, diese hässliche Tür aufzuschließen.
Ich ließ meinen Karton auf den Stufen stehen und öffnete die Tür zum warmen Treppenhaus. Fast schon wehmütig beäugte ich die inzwischen irgendwie liebgewonnene Tapete, die sich an vielen Stellen bereits von den alten Wänden löste. Auch hier wäre schon seit meinem Einzug eine Renovierung angebracht gewesen, doch ich hatte mich längst an sie gewöhnt.
Der Gang roch wie meine Wohnung leicht modrig, als hätte sich beinahe unbemerkt ein Teppich aus Verfall über das gesamte Haus gelegt.
Ich stieg die knarrenden Stufen nach oben und begann die alltägliche Suche nach dem passenden Schlüssel, was mit den sich anbahnenden Tränen, die ich immer noch tapfer zurückkämpfte, nicht einfacher wurde. Gedankenverloren stocherte ich damit, nachdem ich ihn gefunden hatte, nach dem Schlüsselloch und bemerkte erst zu spät, dass ich dabei etwas durchbohrt hatte. Konnte es wirklich sein …
»Oh, scheiße«, flüsterte ich, als ich den unscheinbaren Aufkleber näher betrachtete. »Das kann doch nicht … Bitte, nein …« Ich hatte Probleme, zu lesen, was auf dem offiziell aussehenden Bescheid stand. Meine Tränen kannten nun kein Halten mehr. »Scheiße! Fuck! Nein!«
Ich trat mit aller Wut, die sich in mir angestaut hatte, gegen die Tür und heulte auf. Die Tür hielt unbeeindruckt stand.
Ich drehte den Schlüssel im Schloss. Nichts, keine Bewegung.
Sie hatten mich ausgesperrt, einfach so. Mr Blake wusste, dass ich meine Miete seit Monaten nicht zahlen konnte, ich hatte es ihm gesagt. Zunächst hatte er Mitgefühl gehabt – schließlich besaß er gleich mehrere Immobilien, die er allesamt vermietete. Doch selbst das größte Mitgefühl hatte ein Ende, wenn das Geld nicht kam.
Erst mein Job, dann meine Wohnung? Ich war verloren – allein in dieser Stadt, in der ich niemanden kannte. Hätte ich doch nur geahnt, dass dieses verlockende Jobangebot so ein Reinfall sein könnte …
Wie in Trance riss ich mich von der Tür los, rannte wieder nach unten und trat ins Freie. Panik überwältigte mich. Ich fröstelte und rieb meine eiskalten Hände aneinander. Kraftlos sackte ich unmittelbar vor dem Hauseingang in mich zusammen und vergrub mein Gesicht in den Händen. Der einzige Trost dabei war, dass zumindest alle meine relevanten Dokumente noch ihren Platz in meinem alten Zuhause hatten. Bis auf meinen Ausweis war ich also in diesen Belangen nackt.
Atme, denk nach!
Meine Hände verkrampften sich um meinen Kopf, als wollten sie ihn daran hindern, in tausend Teile zu explodieren. Wieso ich? Wieso ausgerechnet ich?
Womit hatte ich es bloß verdient, dass mir andauernd neue Steine in den Weg gelegt wurden? Immer dann, wenn ich allmählich das Gefühl bekam, angekommen zu sein und mein Leben auf die Reihe zu bekommen, passierte so etwas.
Und jetzt? Jetzt saß ich hier auf der nassen, kalten Stufe und hatte nichts. Ich griff nach der Hulapuppe in meinem Karton und musste beinahe lachen.
»Jetzt gibt es nur noch dich und mich«, flüsterte ich dem dicken Mann im Bastrock unter Tränen zu.
Vorsichtig tastete ich nach dem Medaillon an meinem Hals. Nicht viele meiner Erinnerungsstücke hatten den Umzug überlebt. Ich wollte vergessen, verdrängen. Aber das Medaillon hatte ich immer bei mir.
Ich konnte mir ausmalen, dass in wenigen Wochen der Gerichtsvollzieher den Großteil meines Hausrats in Besitz nehmen würde. Nicht dass in meiner Wohnung viel zu holen gewesen wäre. Sie war klein und billig gewesen und hatte bereits eine notdürftige Einrichtung vorzuweisen gehabt. Alte Schränke und Stühle, Reste von Hunderten Mahlzeiten in der Küche, ganz andere Reste im Bad. Aber das hatte mich nicht gestört. Hohe Ansprüche konnte ich mir sowieso nicht leisten.
Mein Bankkonto war leer, also hatte ich keine Möglichkeit, mich in ein Hotel einzubuchen. Und die Familie … Ich konnte nicht … Nein, ich wollte mich nicht bei ihnen melden. So oder so lebten sie am anderen Ende der USA, und ich hatte kein Geld für ein Busticket.
Sofort ließ ich das Medaillon wieder aus den Fingern gleiten und hob meinen Kopf, um mich umzusehen, auch wenn ich beim besten Willen nicht wusste, wonach ich eigentlich suchte.
Mittlerweile war es stockdunkel geworden, und es waren nur noch wenige Menschen auf den Straßen unterwegs. In den Fenstern der Häuser brannten vereinzelt Lichter. Dort saßen Familien beisammen am Tisch, lachten und aßen. Szenen, die ich selbst noch nie erlebt hatte.
Ich war obdachlos. Bittere Galle stieg in mir hoch, als ich daran dachte, dass ich ja unter einer Brücke unweit von hier übernachten könnte, wo ich schon sehr oft Menschen hatte schlafen sehen. Ich war ebenso verloren und hoffnungslos. Verdammt noch mal.
Und so machte ich mich auf. Wohin? Das wusste ich selbst noch nicht. Aber hierbleiben konnte ich nicht, das würde mich noch verrückt machen. Mir musste schnell etwas einfallen, ehe die Nacht noch kälter werden würde.
Ich ging über die wenig befahrene Straße und lief weiter geradeaus und an Häusern vorbei, die ich noch niemals zuvor gesehen hatte – durch kleine Nachbarschaften, in denen die Grundstücke immer mehr Fläche einnahmen und bunte Laubbäume den dreckigen Asphalt zurückdrängten.
Ich beneidete die Menschen, die dieses Viertel ihr Zuhause nennen konnten. Vielleicht könnte ich auch Unterschlupf im Dickicht der Bäume finden? Nein, so ganz allein im Dunkeln wollte ich nicht sein.
Die Straßenlaternen beleuchteten mir den Weg – weiter, immer weiter ins Ungewisse. Ich musste ewig gelaufen sein, denn plötzlich stand ich vor dem letzten Haus der Stadt. Letzter Stopp vor dem Nirgendwo. Abrupt blieb ich stehen und starrte weiter in Richtung der sich im Wald verlierenden Straße, ehe etwas rechts von mir meine Aufmerksamkeit auf sich zog.
Seit ich in Philadelphia lebte, war ich noch nie hier gewesen. Deshalb hatte ich auch noch nie diesen Mini-Bus entdeckt. Das Gefährt sah ähnlich heruntergekommen aus wie das Gebäude, hinter dem es zurückgelassen worden war.
Zögernd sah ich mich um, doch ich konnte weit und breit keine Menschenseele ausmachen. Alles vereinnahmende Finsternis.
Ob der Bus abgeschlossen war, und ob er jemandem gehörte? Ich könnte zumindest einmal nachsehen. Hoffentlich lag die Lösung meines Problems direkt vor mir. Unschlüssig wanderte mein Blick zurück zu den verschmutzten Fenstern und dem überquellenden Briefkasten des Hauses. Verlassen?
Ich lief durch den zugewucherten Garten und achtete auf jedes Knarzen, das ich aus dem Haus zu vernehmen glaubte. Doch ich war allein. Bis hierher schienen sich nicht viele Menschen zu verirren, denn weder an den Türen noch an den Fenstern konnte ich Spuren von Einbrüchen erkennen.
Ob diese Bruchbude doch noch jemand sein Zuhause nannte? Aber wer war ich schon, um zu urteilen. Meine aktuelle Lebenssituation sah nicht besser aus. So oder so wollte ich nicht zum Verbrecher werden, egal, wie hilflos ich gerade war. Nun doch der Mini-Bus.
Meine Knochen knackten, und meine Beine brannten vom weiten Weg. Ich wollte mich eigentlich nur noch hinlegen, weinen und schlafen, ehe mich am nächsten Morgen die Realität einholen würde.
Hier hinten gab es keine Straßenlaternen. Ich überlegte, mein Handy zu zücken, als ich mich daran erinnerte, dass ich keine Möglichkeit hatte, es heute noch mal aufzuladen. Nun hoffte ich doch sehr darauf, allein zu sein.
Im Dunkeln konnte ich schemenhaft die Umrisse des Busses ausmachen. Ich tastete mich vorsichtig an der rauen Außenwand entlang, während ich fieberhaft nach einem Einstieg suchte. Eines der kaputten Fenster war dick mit Klebeband verschlossen worden.
Durch die anderen Fenster konnte ich nur alten Polsterstoff sehen – keine übliche Ausstattung. Das Innenleben erinnerte eher an eine sehr spartanische Unterkunft. Jemand musste in diesem Bus gewohnt haben.
»Hallo?«, rief ich, ehe ich mich weiter um das Fahrzeug bewegte. »Ist hier jemand?«
Nein, du bist allein, hallte es in meinem Kopf.
Die Tür war geschlossen, doch ich ertastete einen kleinen Spalt in ihrer Mitte, der es mir ermöglichte, sie unter großen Anstrengungen und Ächzen gerade so weit zu öffnen, dass ich mich hindurchquetschen konnte.
Ich lugte vorsichtig in das Innere des Busses. Schließlich wollte ich keine bösen Überraschungen erleben. Ich ging leise hinein und öffnete die Vorhänge an den Fenstern. Ein Schwall von Staub brachte mich zum Husten. Meine Augen begannen zu brennen.
Ich entdeckte eine kleine Küchenzeile und die Gitter eines Gasherds. Aufgeräumt wie das gesamte Innere des Fahrzeugs, kein Müll, keine Scherben. Im hinteren Teil befand sich eine Holztür. Vermutlich führte sie zu einem Bad oder einer Abstellkammer. Meinen sehnlichsten Wunsch fand ich gegenüber der Küchenzeile erfüllt.
Ich machte ein kleines Bettgestell aus und konnte mein Glück kaum fassen, als ich darauf eine dicke Matratze erkannte. Auch hier: wenige Flecken, kein Dreck. Alt, aber augenscheinlich sauber. Ich strich über die Matratze und war positiv davon überrascht, wie weich und gemütlich sie zu sein schien. Einen besseren Schlafplatz konnte ich mir zumindest für heute Nacht nicht wünschen.
Ich setzte mich auf den Rand des Bettes und kramte in meiner Tasche nach dem Pfefferspray. Sicher war sicher, denn viel konnte ich in meinem Zustand nicht mehr ausrichten. Danach legte ich mich seufzend hin und ergab mich meiner Erschöpfung.
Eine Decke war mir leider nicht vergönnt, daher zog ich stöhnend die Beine an die Brust. Es war hier drinnen nicht viel wärmer als draußen, aber immer noch besser, als unter freiem Himmel zu übernachten. Ich schloss die Augen.
Schritte.
Ich war schlagartig wach und wurde von gleißendem Licht geblendet, welches mir in die Augen fiel. Wo war ich? Was …?
Dann brachen die Erinnerungen an all die Ereignisse wieder über mich herein. Meine Entlassung. Der Verlust meiner Wohnung. Der heruntergekommene Mini-Bus. Ich musste doch eingeschlafen sein.
Als sich meine Augen an das helle Licht gewöhnt hatten, blickte ich auf und machte vor Schreck einen Satz in die Luft. Vor mir stand ein vollbärtiger Mann mit dunkelblondem Haar, von welchem sich einzelne Strähnen in seine Stirn gekämpft hatten.
»Was tust du hier?«, presste er mit erhobener Stimme zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, und ich wich so weit vor ihm zurück, wie ich nur konnte.
Jeder Muskel in meinem Körper stand schlagartig unter Strom. Ich musste schnell hier weg!
Pennsylvania
»Bist du taub? Was machst du in meinem Van?«, fragte er wieder, dieses Mal deutlich lauter.
Sein Gesicht verdunkelte sich zusehends. Ein penetranter unverkennbarer Geruch stieg mir in die Nase – Alkohol. O Gott, der Kerl war betrunken! Vielleicht war er gewalttätig? Mein Herz sprang mir beinahe aus der Brust. Ich erinnerte mich an das Pfefferspray, das ich am Abend zuvor bereitgelegt hatte. Schnell! Zielen. Abdrücken.
»Fuck, spinnst du?« Der Kerl rieb sich umgehend mit den Händen über die Augen. »Verflucht, das brennt. Was sollte das?!«, fuhr er mich aufgebracht an, wandte sich jedoch von mir ab und torkelte blind durch den Bus.
Meine Chance war gekommen. Ich zerrte meine Handtasche hervor und wollte schnell abhauen, als ich bemerkte, wie der Fremde durch die Tür im hinteren Teil des Raumes verschwand, die sich tatsächlich zu einem kleinen Badezimmer öffnete.
Er drehte den Wasserhahn auf und versuchte, sich das brennende Spray aus den Augen zu reiben. Ich hörte ihn immer wieder fluchen.
Ich zögerte. Mein Blick huschte nach draußen. Es war immer noch stockfinster, es musste also nach wie vor mitten in der Nacht sein. Sollte ich mich aus dem Staub machen? War dieser Mann tatsächlich gefährlich?
»Scheiße, bringst du mir wenigstens ein Handtuch, wenn du mich schon so angreifst? Ich sehe rein gar nichts.«
Hätte er mir wirklich wehtun wollen oder sogar andere Gedanken gehabt, wäre er direkt auf mich losgegangen.
Ich suchte in der kleinen Küchenzeile nach einem Handtuch. Unter der Spüle wurde ich fündig. Ich warf es ihm aus sicherer Entfernung zu. Es landete auf seinem Hinterkopf, und er erschreckte sich ein wenig, schließlich hatte er meinen Wurf nicht kommen sehen.
Ich blieb stehen und beobachtete, wie der Mann immer mehr Wasser in sein Gesicht beförderte. Als er fertig war, trat er zu mir und lehnte sich an die Küchenzeile. Mein Herz machte einen noch kräftigeren Satz.
»Du bist ja immer noch hier«, stellte er nüchtern fest und rieb sich weiter über seine knallroten Augen.
»Ich … tut mir leid«, murmelte ich verunsichert, und das schlechte Gewissen kämpfte sich immer weiter an die Oberfläche.
»Jetzt weiß ich zumindest, wieso Frauen dieses Zeug immer mit sich herumtragen.« Er ließ sich auf der Matratze nieder, auf der ich bis vor wenigen Augenblicken noch geschlafen hatte. Mit seinem Fuß stieß er an den Karton, den ich dort ebenfalls gelagert hatte. »Du hast etwas vergessen«, bemerkte er und schob die Kiste, ohne hinzusehen, mit einem seiner Füße in meine Richtung. »Warum stehst du denn immer noch hier wie angewurzelt? Was willst du? Hau endlich ab!«
Doch ich blieb, wo ich war, und sah ihn ziemlich schuldbewusst an. So zugerichtet, wie er dort unten saß, sah er für mich plötzlich gar nicht mehr bedrohlich aus. Sein Haar war völlig durcheinander. Der lange drahtige Bart bedeckte einen Großteil seines Gesichtes und hatte schon seit Langem keinen Rasierer mehr gesehen.
Er konnte nicht viel älter als ich sein, auch wenn er durch seinen Bart um ein Vielfaches gesetzter wirkte. Ich erkannte, dass sein kariertes Hemd mit schwarzen öligen Flecken übersät war.
»Ich wollte das nicht, du hast mich nur ziemlich erschreckt. Ich habe nicht damit gerechnet, hier jemandem zu begegnen«, antwortete ich, nachdem ich mich geräuspert und meine Adrenalin-Achterbahnfahrt wieder etwas in den Griff bekommen hatte.
»Sagt die Person, die hier in meinem Bus steht.« Zum ersten Mal, seit er mich so erschreckt hatte, sah er mich direkt an. Sein Blick bohrte sich förmlich in meinen.
»Ich wusste nicht, dass das hier noch jemandem gehört«, verteidigte ich mich und gestikulierte vielsagend um mich herum. »Ich bin nicht eingebrochen. Die Tür war nicht abgeschlossen.«
Der breitschultrige Mann fluchte leise. »Diese beschissene Tür. Es wird Zeit, dass ich sie endlich repariere. Aber noch mal … Was tust du hier?« Er betrachtete mich mit einem skeptischen Blick, den ich nur schwer ernst nehmen konnte, weil der Mann immer noch Schwierigkeiten hatte, seine Augen vernünftig zu öffnen.
Ich seufzte. »Ich weiß nicht, wo ich diese Nacht schlafen soll.«
»Wieso gehst du nicht nach Hause?«
»Ich habe kein Zuhause mehr, bin sozusagen obdachlos«, gab ich zähneknirschend zu und sah dabei peinlich berührt und mit glühenden Wangen auf den Karton, der nun zwischen mir und dem Fremden stand.
Diese Erklärung war genug. Ich griff nach der Kiste und wollte mich schnell davonmachen, doch plötzlich brannten meine Augen, und Tränen drohten sich an die Oberfläche zu kämpfen. Ich hielt sie mit aller Macht zurück.
»Hm, na gut«, brummte er rau.
Ich drehte mich nochmals zu ihm um, ehe er weitersprach. Er hatte sich mit seiner vollen Körpergröße vor mir aufgebaut, was durchaus etwas einschüchternd auf mich wirkte. Dennoch legte ich den Kopf leicht in den Nacken, um ihn besser ansehen zu können.
»Es ist sehr kalt heute Nacht«, meinte er und ließ die Schultern hängen. »Du kannst hierbleiben, aber morgen früh bist du weg, okay?«
Ich war unschlüssig, was ich auf sein Angebot antworten sollte, kam aber zügig zu dem Schluss, dass mir keine andere Möglichkeit blieb. Ich war erschöpft und hätte auf der Stelle wieder einschlafen können.
»Das weiß ich wirklich zu schätzen, ehrlich.« Ich stellte meinen Karton hinter den Fahrersitz und legte meine Handtasche darauf ab. Höflich streckte ich meinem Retter in der Not die Hand entgegen, die dieser zurückhaltend beäugte, schlussendlich aber dennoch ergriff. Seine Hand strahlte eine unglaubliche Wärme aus. »Ich bin Amber. Ich dachte, ich sollte mich wenigstens vorstellen.«
»Deacon«, erwiderte der Mann vor mir knapp, und unsere Hände lösten sich voneinander. Er kramte aus einem schmalen Schrank eine Decke hervor und warf sie mir zu. »Hier. Du kannst da vorn schlafen.« Er deutete auf die Matratze. »Ich werde mich heute auf der Sitzbank ausruhen.«
»Danke«, murmelte ich und zog stumm meine Schuhe aus.
Als ich mich in der Decke eingerollt und erleichtert festgestellt hatte, dass diese nicht muffig roch, kam Deacon gerade aus dem kleinen Badezimmer – halb nackt.
Umgehend zog ich mir die Decke noch weiter über die Schultern und starrte verlegen auf den Boden. Kurz darauf hörte ich es rascheln, und es wurde dunkel im Mini-Bus.
Als ich mich in den Van geschlichen hatte, war mir weder Licht noch ein entsprechender Schalter aufgefallen, aber ganz offensichtlich gab es beides hier drinnen – ebenso wie eine Heizung, denn seit Deacon hier war, war es wohlig warm im Innern geworden.
»Gute Nacht«, sagte ich leise und zog mir die Decke noch ein Stückchen weiter über die Schultern.
»Nacht«, brummte Deacon, und schließlich herrschte im Mini-Bus erneut Stille.
Ich musste irgendwann tatsächlich noch einmal eingeschlafen sein, denn als ich das nächste Mal träge meine Augen aufschlug, war es bereits hell. Durch die geöffneten Vorhänge schien für Oktober die Sonne ungewöhnlich hell ins Innere des Vans.
Schläfrig strich ich mir meine Haare aus dem Gesicht und richtete mich auf, zuckte jedoch umgehend zusammen, als sich ein stechender Schmerz in meinem Rücken ausbreitete. Stöhnend rieb ich mir über die Wirbelsäule und den Nacken. Die Nacht hatte ihre Spuren hinterlassen.
Ich spürte die feuchte Luft, die aus der offenen Tür des Badezimmers kam. Als wäre der gesamte Bus in leichten Nebel gehüllt.
Da ertönte die Stimme von Deacon: »Kaffee?« Er trug wieder das rot-schwarz karierte Holzfällerhemd und eine eng anliegende verwaschene Jeans.
Und schon strömte der sanfte Geruch der gemahlenen Bohnen in meine Nase. Ehe ich es mich versah, standen zwei heiße Tassen auf der Küchenzeile.
»Danke.« Ich nahm eine der Tassen, und Wärme durchströmte meine kalten Hände.
»Du kannst das Bad benutzen, bevor du gehst. Ich fahre in einer halben Stunde los, bis dahin bist du weg«, sagte Deacon, während er mit dem Kaffeebecher in seiner Hand nach vorn zum Fahrerplatz ging und eine zusammengefaltete Karte aus dem Handschuhfach zum Vorschein brachte.
»Klar, danke«, sagte ich kleinlaut, nippte an meinem Kaffee und beobachtete Deacon dabei, wie er verschiedene Punkte auf der ausgebreiteten Karte markierte. »Als ich deinen Van letzte Nacht gesehen habe, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das Teil überhaupt noch fahren kann.«
Nach drei großen Schlucken und mit einer verbrannten Zunge betrat ich das kleine Bad. »Ich bin dann mal eben …«, begann ich, doch Deacon schenkte mir bereits keinerlei Beachtung mehr.
In dem winzigen Raum gab es nichts außer einer Toilette und einem kleinen Waschbecken mit einem Spiegel darüber. Spartanisch, doch an diesem Morgen einfach wundervoll.
Als ich in den Spiegel sah, verzog ich entsetzt mein Gesicht. Ich blickte in ein Meer aus zerzausten Haaren, und in meinem Gesicht befanden sich Reste eines Make-ups, an denen jeder Clown seine helle Freude gehabt hätte.
Hastig wusch ich mir das Gesicht und versuchte, das Meer, so gut es ging, zu bezwingen. Ich sah eine einsame Bürste in dem ansonsten leeren Raum liegen, doch wagte ich es nicht, sie zu benutzen. Grenzen sollten gewahrt werden, und ich wollte vermeiden, dass er meinen Besuch doch noch bereuen würde. Als ich mich bereit für den Weg fühlte, trat ich heraus und zog meine Schuhe an.
»Danke noch mal, dass ich hier schlafen durfte. Das war wirklich … nicht selbstverständlich.« Ich schulterte meine Handtasche und schnappte mir meinen Karton. »Ich hoffe du hast eine gute Fahrt, wohin auch immer die führen mag.«
»Danke. Und du? Was hast du jetzt vor?«
Da war es wieder. Dieses stechende Gefühl in meiner Magengrube. Der Vortag, der weiter wie ein böser Schatten über mir lag.
»Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht.« Ich hatte größte Mühe, meine Verzweiflung zu verbergen.
»Gibt es niemanden, bei dem du eine Weile unterkommen kannst?«
»Nein, nicht hier. Und wenn ich recht darüber nachdenke … eigentlich nirgendwo.«
Deacon nickte beinahe unmerklich, wandte sich von mir ab und faltete seine bis gerade eben noch großflächig ausgebreitete Karte wieder zusammen.
Mein Zeichen. Bei dem Gedanken, nun wieder in die eisige Welt entlassen zu werden, völlig allein und schutzlos, wurde mir schlagartig schlecht. Wir waren zwar Fremde, aber dennoch war ich ihm so dankbar. Ich räusperte mich und trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen.
»Also dann«, sagte ich. »Mach’s gut, Deacon.«
Mit diesen Worten öffnete ich die Beifahrertür und trat hinaus. Deacon setzte sich ans Steuer des Busses und startete den Motor.
Der beißende Wind schmerzte auf meiner Haut. Obwohl ich mir einbildete, seinen Blick noch immer spüren zu können, drehte ich mich nicht noch einmal um.
Zurück in die Stadt, zurück in die Ungewissheit. Als ich schon von weitem die Fenster meines Apartments sehen konnte, stiegen mir erneut die Tränen in die Augen, doch ich zwang mich dazu, nicht stehen zu bleiben. Den Gedanken daran, womöglich doch die Brücke zu meinem Schlafplatz zu machen, konnte ich nicht ertragen.
Wo sollte ich aber ansonsten auch hin? Die Obdachlosenheime waren zu dieser Jahreszeit bereits heillos überfüllt. Und dazu … ich, als Frau, in den gemischten Heimen der Stadt?
Der Wind brachte ein Bombardement aus eisigen Regentropfen mit sich, die nun beinahe waagrecht fielen und mich bis auf die Knochen durchnässten.
Ich könnte versuchen, mir irgendwo ein billiges Zimmer in einer Absteige am Rand der Stadt zu besorgen. Aber mit welchem Geld? Vielleicht brauchte jemand eine Aushilfe für den Tag. Schnellen Verdienst, den brauchte ich jetzt.
Ich hatte zwar nicht mehr viel Bargeld, aber für ein U-Bahn-Ticket, um in die Stadt zu kommen, würde es noch reichen. Vielleicht konnte ich mich auch einfach durch das Drehkreuz drücken, wenn niemand hinsah. So war vielleicht auch noch etwas Essbares drin.
Langsam wurde der Verkehr dichter. Ich hatte die U-Bahn-Haltestelle am äußersten Rand der Stadt fast erreicht und wollte gerade über die viel befahrene Straße gehen, als auf einmal ein langes, laut ratterndes Gefährt neben mir fuhr und das Tempo deutlich drosselte. Irritiert sah ich nach rechts und erkannte sofort, dass es Deacons rostige Kiste war. Er beugte sich durch das geöffnete Fenster nach draußen.
»Du stellst keine Fragen oder gehst mir anderweitig auf die Nerven. Du kommst mir nicht in die Quere oder redest mir rein, kapiert?«, rief er in meine Richtung, um gegen den Straßenlärm und den immer stärker werdenden Regen anzukommen. »Wenn du damit einverstanden bist, kannst du einsteigen.«
Meinte er das ernst? Meine Anwesenheit schien ihn letzte Nacht zwar auch nicht sonderlich gestört zu haben, aber er war sehr deutlich in seiner Ansage gewesen, dass dies die einzige Nacht wäre, die ich in seinem Bus verbringen würde. Warum hatte er seine Meinung geändert?
Und außerdem: Ich kannte ihn doch überhaupt nicht. Es gab jedoch nichts mehr, was mich noch mit diesem Ort verband. Ich könnte einfach einsteigen. Egal, wohin er mich brachte … Ich könnte einen Neuanfang wagen.
»Also?«, fragte Deacon ungeduldig, während bereits die ersten Fahrer hinter ihm wütend auf ihre Hupen drückten. »Wie sieht’s aus?«
»Okay«, murmelte ich. »Ich komme mit, auch wenn wir uns genau genommen eigentlich noch gar nicht kennen«, rief ich dann etwas lauter, lächelte dabei aber zurückhaltend. »Du könntest sonst wer sein. Woher weiß ich, dass du kein Serienmörder bist?«
»Würde ich dir das denn sagen, wenn es so wäre?«, antwortete er trocken mit perfekt aufgesetztem Pokerface.
Ich musste lachen. »Allein diese Antwort zeigt schon, dass du es nicht bist.«
Ich hatte meine Entscheidung längst getroffen. Entschlossen löste ich mich aus meiner Starre und ging zu dem brummenden Wagen. Als ich die Beifahrertür öffnete, zog mir eine wohlig warme Wolke entgegen, die mir jetzt noch viel wertvoller vorkam als heute Morgen. Deacon reichte mir ein Handtuch und bedeutete mir, mich abzutrocknen, weil ich seinen Van volltropfte.
»Danke.«
Er nickte stumm, wandte sich dann wieder der Straße zu und fuhr los.
Ich wusste nicht, wohin er wollte. Ich wusste nicht, was seine Geschichte war, aber es war mir egal. Ich hatte ein Dach über dem Kopf und konnte hoffentlich in den nächsten Tagen meinen Kopf frei bekommen. Dafür war ich ihm unendlich dankbar.
Virginia
In das Handtuch eingewickelt, saß ich nun auf seinem Beifahrersitz. Ich zitterte wie Espenlaub.
Meine Schuhe hatte ich bereits ausgezogen, sodass ich meine Beine eng an die Brust ziehen konnte, um mir noch mehr Wärme zu spenden. Seit ich zu ihm eingestiegen war, hatte ich es nicht gewagt, ihn anzusprechen.
Deacons Augen waren unverändert auf den wachsenden Strom von nassen Fahrzeugen gerichtet, auf deren Lack sich die Silhouetten der hohen Gebäude um uns spiegelten.
Unser Weg führte uns durch Häuserschluchten, über große Kreuzungen bis zur Interstate, die uns von hier wegbringen würde. Wohin wusste ich immer noch nicht. Hauptsache weg.
»Ich kann dein Zittern ja schon von hier aus spüren«, sagte Deacon plötzlich in die Stille hinein. »Nimm dir von hinten etwas Trockenes zum Anziehen, das kann man ja nicht mit ansehen.« Dabei deutete er auf die Kommode neben seinem Bett, während der Van unter der Beschleunigung laut protestierte.
Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was er mir gerade angeboten hatte, doch schließlich riss ich mich aus meiner Trance, schnallte mich ab und ging auf wackeligen Beinen nach hinten.
Auch wenn es so vieles gäbe, was ich ihn hätte fragen können, hatte ich es genossen mich eine Weile in meinen Gedanken zu verlieren. Es war alles andere als einfach, zu begreifen, dass ich erst mal nicht nach Philadelphia zurückkehren würde.
Jedes Schlagloch, über das wir fuhren, ließ mich zusammen mit der halben Einrichtung des Innenraums in die Höhe fahren.
Ohne größere Blessuren bekommen zu haben, war ich endlich an der Kommode angelangt, aus der er mir letzte Nacht die Decke gegeben hatte. Mir war es unangenehm, in den persönlichen Dingen eines Fremden zu wühlen, deshalb schnappte ich mir ein weißes Sweatshirt und eine graue Jogginghose, die vor der Matratze auf dem Boden lagen.
Ich zog ich mich in das kleine Bad zurück. Zu meiner großen Erleichterung waren die Klamotten sauberer als das, was Deacon gerade selbst trug. Der Duft von frisch gewaschener Wäsche stieg mir in die Nase, als ich mir das Sweatshirt überzog.
»Besser?«, fragte er, als ich mich wieder neben ihm niedergelassen hatte.
»Viel besser. Danke. Du hast mich gerettet, ich hoffe dessen bist du dir bewusst.« Ich studierte die Züge seines Gesichtes von der Seite.
Er warf mir einen kurzen Blick zu.
Ich biss mir auf die Zunge. Es war nicht schwer, zu erkennen, dass er nicht zu der Sorte Mann gehörte, die es liebte, sich ausgiebig zu unterhalten. Außerdem hatte ich ja versprochen, ihm nicht auf die Nerven zu gehen. Ich respektierte das und versuchte, meine angeborene Neugier zu unterdrücken. Stattdessen sah ich genauer hin.
Seine Finger umklammerten das Lenkrad so fest, dass die Knöchel bereits weiß hervortraten. Ich fragte mich, was seine Geschichte war. Wieso er mit einem rostigen alten Mini-Bus durch die Gegend fuhr. Was das Ziel seiner Reise war.
»Was schaust du denn so? Habe ich etwas im Gesicht?«, fragte er unerwartet, während ich hastig meinen Blick wieder auf die rasende Auto-Herde vor uns richtete.
»Nein, ich bin nur neugierig, wohin du uns überhaupt bringst«, gab ich zurück.
»Shenandoah.«
»Der National Park?« Ich erntete dafür jedoch erneut nur einen kritischen Seitenblick. »Was?«
»Keine nervigen Fragen.«
»Ich wollte nur wissen, wohin du fährst und nicht wie deine Sozialversicherungsnummer lautet.« Ich blickte verlegen in die Ferne.
Er blieb stumm.
Obwohl ich bisher noch nie an diesem Ort gewesen war, schien er mir doch aus dem Fernsehen bereits vertraut. Wenn mich nicht alles täuschte, lag das große Tal nicht weit weg von Philadelphia, nicht mehr als drei oder vier Autostunden. Ich hatte nicht darauf geachtet, wie lange wir schon fuhren, aber die Sonne hatte ihren Zenit bereits überschritten.
»Und danach?«
»Danach?«
»Wohin fahren wir, wenn wir dort waren?«
»Wenn du so weitermachst, fahren wir nirgendwo mehr hin«, brummte Deacon genervt.
»Sorry, ich weiß schon. Keine Fragen und nicht nerven. Ich wollte nur wissen, warum du durchs Land fährst. Besuchst du alle National Parks?«
»Frag dich das ruhig weiter.«
Ich schluckte. Ich wollte ihm nicht auf den Geist gehen, aber die Stille im Bus machte mich wahnsinnig. Ich hätte mich gern mit ihm unterhalten, auch wenn ihm das zu widerstreben schien. Ich versuchte, meine Klappe zu halten, und sah mich weiter im Fahrerraum um.
Deacon fand sich wohl ohne die Hilfe der Karte von heute Morgen zurecht, denn sie war irgendwo zwischen dem quer über das Armaturenbrett verstreuten Krimskrams untergetaucht. Vielleicht konnte ich mich ja bei Gelegenheit für seine Gastfreundschaft bedanken, indem ich hier klar Schiff machte. Durch das Fenster sah ich die Bäume stetig dichter und die Hügel langsam zu Bergen werden.
Ich nahm die Fahrerkabine weiter in Augenschein. Vor allem Deacons Platz war übersäht mit einer Schar Bonbonpapieren – Erdbeere, was mich sehr an meine Kindheit erinnerte –, und es gab kaum noch eine freie Stelle. Zwischen zwei Plastikverpackungen war ein zusammengefaltetes Foto gerutscht.
Ich beugte mich nach vorn, damit ich es besser begutachten konnte, und staunte nicht schlecht, als ich darauf einen lachenden Deacon ausmachen konnte. Mit kurzen Haaren hätte ich ihn fast nicht erkannt, und auch sein heutiger langer Bart ähnelte auf dem Foto noch eher Flaum. Er war ziemlich herausgeputzt und trug einen Anzug sowie eine Krawatte. Ein besonderer Anlass?
Meine Augen huschten weiter zu dem Jungen, der dicht neben ihm stand und um den er liebevoll einen Arm gelegt hatte. Schätzungsweise nicht älter als vier oder fünf Jahre, grinsend wie ein Honigkuchenpferd, seinen bewundernden Blick in Richtung Deacon gerichtet. Wie alt war er auf diesem Foto? Er sah darauf so viel jünger aus. Wie viel Zeit war seit der Aufnahme vergangen?
»Her damit!«
Mit einer schnellen Bewegung beugte Deacon sich zu mir herüber, riss mir, ohne den Blick von der Straße abzuwenden, das Foto aus der Hand und verstaute es in seiner Hosentasche. Ein paarmal holte er tief Luft und umfasste dann mit beiden Händen wieder angestrengt das Lenkrad.
»Hör zu, Amber«, presste er aufgebracht hervor, auch wenn er allem Anschein nach versuchte, ruhig zu bleiben. »Meine Regeln sind ganz einfach und simpel. Misch dich nicht in Dinge ein, die dich nicht im Geringsten etwas angehen, und wir haben keine Probleme. Sorge nicht dafür, dass ich es bereue, dich mitgenommen zu haben.«
»Es tut mir leid … Wird nicht wieder vorkommen.«
»Gut.«
»Ich muss dir aber sagen, dass du mit kürzeren Haaren und weniger Bart eindeutig attraktiver bist«, murmelte ich schulterzuckend und lächelte vorsichtig, woraufhin er jedoch lediglich seufzte und den Kopf schüttelte.
In der folgenden Stunde war außer dem Rattern des Motors nichts zu hören. Je weiter wir fuhren, desto leerer wurden die Straßen, und die Farbenpracht der Wälder wechselte zu einem kräftigen Rot.
Sobald ich das gemeißelte Schild erblickte, welches uns darauf hinwies, dass wir nun im Bundesstaat Virginia angekommen waren, atmete ich erleichtert aus. Ich freute mich darauf, mir ein wenig die Beine zu vertreten und mich frisch zu machen, das war immerhin unsere erste Pause heute.
Ich hatte Deacon nicht noch mehr aufregen wollen, indem ich ihn nach einer Pause fragte oder ob es okay war, wenn ich während der Fahrt die Toilette benutzte. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal so viel darüber nachgedacht, was jemand über mich denken könnte? Eigentlich hatte ich längst mit solchen Gedanken abgeschlossen.
Wir hatten eine Mautstelle passiert, und ich war der Ansicht, dass es nun nicht mehr lange bis zum Park dauern konnte, doch die Straßen zogen sich immer weiter. Mein Rücken knackte bei jeder Bewegung, was vermutlich auch mit der vergangenen Nacht zusammenhing.
»In einer halben Stunde sind wir da. Vorher muss ich aber noch zu einem Baumarkt«, erklärte er und setzte dann auch schon den Blinker, um bei der nächsten Ausfahrt abzufahren.
Ich hatte das Ortsschild nicht gesehen, doch die wunderschön geschmückten Fenster der kleinen Läden an der Straße vermittelten einen idyllischen Eindruck. Einen großen Baumarkt würde Deacon hier nicht finden.
Er quetschte sich mit diesem Ungetüm auf einen Parkplatz unmittelbar vor einem überschaubaren General Store. Nachdem er ohne ein Wort ausgestiegen war, ging ich davon aus, dass er es bevorzugen würde, wenn ich hier wartete. Es dauerte keine halbe Stunde, bis er mit zwei großen braunen Papiertüten zurückkam, sie hinten im Bus verstaute und dann wieder vorn bei mir einstieg, um den Motor anzulassen.
»Ich hoffe, du isst Fleisch«, sagte Deacon, sobald er ausgeparkt hatte und wieder aus dem Ort fuhr.
»Ich bin keine Vegetarierin.«
»Sobald wir da sind, schließe ich den Van an Strom und Abwasser an, repariere das Schloss, und dann mal sehen, wie spät es ist. Vielleicht schaffe ich noch andere Verbesserungen. Danach koche ich für uns.« Während er das sagte, steuerte er den Wagen zurück auf die Schnellstraße, wo auch schon auf einem großen Schild darauf hingewiesen wurde, dass der Haupteingang vom Shenandoah National Park nur noch dreißig Meilen entfernt war.
»Ich könnte doch kochen«, schlug ich vor und drehte mich zu ihm, damit ich ihn besser ansehen konnte. »Du hast genug zu tun, und ich möchte mich revanchieren.«
Deacon musterte mich skeptisch.
»Was? Ich kann kochen. Bisher ist noch niemand daran gestorben.«
»Also gut«, erwiderte er. »Du kümmerst dich um das Essen, und ich erledige den Rest.«
Die letzten Meilen bis zu unserem Ziel waren absolut traumhaft, und ich konnte meinen Blick für keine Sekunde von der atemberaubenden Landschaft abwenden. Sie stellte so einen starken Kontrast zu dem grauen Philadelphia dar, dass ich bei der unbeschreiblichen natürlichen Schönheit instinktiv lächeln musste.
Hohe Berge, tiefe Täler, und in der Ferne sah ich sogar einen Wasserfall. So weit das Auge reichte, bedeckte die Berge ein dichter Wald, dessen Laubbäume in verschiedene Rot- und Gelbtöne getaucht waren. Ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals etwas Schöneres gesehen zu haben.
Die Fahrt zum Park verging wie im Flug. Am Eingang grüßte Deacon den Ranger und reichte ihm ein paar Scheine, um die Campinggebühren zu bezahlen. Der Ranger zeigte ihm auf einem kleinen Plan unseren Parkplatz, die Community-Duschen und wie er den Wagen an Strom und Wasser anzuschließen hatte.
Als Deacon uns wieder in Bewegung brachte, packte mich das schlechte Gewissen. Ich hatte noch überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, wie ich mich an den anfallenden Kosten beteiligen sollte. Allein das Benzin hatte schon ein halbes Vermögen gekostet. Auch wenn ich immer noch nicht genau wusste, wohin er eigentlich wollte, wurde ich das Gefühl nicht los, dass seine Reise noch sehr viel weiter führen würde als von Pennsylvania nach Virginia.
»Deacon?«
»Hm?«
»Ich … habe leider wirklich überhaupt kein Geld, was ich dazutun könnte«, murmelte ich leise und starrte dabei nervös auf meine Hände. »Und ich weiß auch nicht, wann ich wieder in der Lage sein werde, das zu tun.«
Es dauerte eine ganze Weile, bis er antwortete, auch wenn ich seinen forschenden Blick auf mir spüren konnte. Erst als er den beschriebenen Platz für seinen Mini-Bus erreicht hatte und den Motor ausschaltete, wandte er sich vollends mir zu.
»Ich weiß, dass du blank bist. Ich erwarte von dir aber auch nicht, dass du dich beteiligst.«
»Das kann ich nicht annehmen«, erwiderte ich kopfschüttelnd, doch er war bereits von seinem Platz aufgestanden und betrat den von Laub übersäten Waldboden.
»Deacon.«
»Was?«
»Ich will dir etwas zurückgeben, wenn ich es irgendwie kann.«
»Nein. Ich fahre meine Route. Mit dir oder ohne dich hätte ich dabei Benzin, Maut und Essen finanzieren müssen. So wie du aussiehst, isst du nicht viel, also fällt das wohl kaum ins Gewicht.«
Ich biss mir zum wiederholten Male in seiner Gegenwart auf die Zunge. Es passte mir überhaupt nicht, dass ich mich bei ihm durchschnorrte. Mir war durchaus bewusst, dass Deacon recht hatte, aber ich fühlte mich damit alles andere als wohl.
»Von mir aus.« Ich willigte zähneknirschend ein. »Aber dann lass mich dir anderweitig zur Hand gehen.«
Er war gerade dabei, eine Klappe an der Seite des Mini-Busses zu öffnen, hinter der sich wohl die benötigten Anschlussstellen befanden, doch als ich das sagte, sah er abrupt zu mir.
Prompt begannen meine Wangen, verräterisch zu glühen.
»Nicht was du wieder denkst! Männer …«, sagte ich stöhnend. »Wieso denkt ihr alle immer so … so …« Ich versuchte mit rudernden Armen die passenden Worte zu finden, doch mir wollte nichts einfallen.
»Zweideutig? Tja, ich fürchte, dass das in unserer Natur liegt. Du kannst mir gern zur Hand gehen … am Bus natürlich.« Er ging in die Hocke, um auf Augenhöhe mit den Anschlüssen zu sein. »Bei jedem Halt arbeite ich immer etwas an meinem Van, um ihn wohnlicher zu machen und auf Vordermann zu bringen. Bei manchen Angelegenheiten kann ich eine helfende Hand mit Sicherheit gut gebrauchen. So, jetzt haben wir wieder Strom. Die Lebensmittel sind in dem kleinen Kühlschrank links von der Spüle.«
»Ähm, gibt es hier irgendwo eine Dusche?«
»Diesen Weg entlang und dann links«, murmelte Deacon und deutete vage in die entsprechende Richtung, die ihm vorhin wohl der Ranger gezeigt hatte.
Die sanitären Anlagen waren sehr gepflegt und glänzten vor Sauberkeit. Ich hoffte innständig, dass das auch bei den anderen National Parks der Fall sein würde – sofern wir noch weitere besuchen würden.
Ich genoss das heiße Wasser auf meiner Haut.
Seit ich Deacon getroffen hatte, hatte ich kaum noch an die Ereignisse der letzten Tage gedacht. Warum auch? Zurück konnte ich sowieso nicht. Ich hatte mich auf ein Abenteuer eingelassen – mit einem Mann, von dem ich nicht viel mehr wusste als seinen Namen.
Casey hätte mich mit Sicherheit für verrückt erklärt, aber für mich fühlte es sich so an, als ob es die beste Entscheidung gewesen war. Genau das, was ich nach diesem ganzen Schlamassel gebrauchen konnte, und ich wurde das Gefühl nicht los, dass auch Deacon zumindest ein klein wenig froh darüber war, dass er nun Gesellschaft hatte. Auch wenn er das nur ungern zeigte.
Da meine eigenen Klamotten immer noch etwas feucht waren und ich sonst keine anderen besaß, schlüpfte ich nochmals in die von Deacon geliehene Kleidung und sah nun nicht nur beinahe aus wie ein Mann, sondern roch dank seines Duschgels und Shampoos auch wie ein waschechter Kerl. Das war zwar durchaus ungewohnt, aber nicht weiter tragisch.
Als ich zurück durch das Dickicht der Bäume ging, entdeckte ich Deacon, der an der Zentralverriegelung hantierte. Er saß unverändert in der Hocke und suchte einen Schraubenzieher aus seinem roten Werkzeugkasten heraus.
Als ich näher zu ihm kam, widmete er sich nochmals kurz dem Schloss, ehe er die ölverschmierten Hände an einem Lappen abwischte. Er hatte sehr muskulöse Unterarme, die unter den hochgekrempelten Ärmeln zum Vorschein kamen.
Deacon sah über die Schulter zu mir, sobald ich hinter ihm über den Kies lief und ins Innere des Mini-Busses verschwand, doch sagte nichts. Ich kannte seine ursprünglichen Pläne nicht, aber entschied mich dafür, aus dem gekauften Rindfleisch und Gemüse einen deftigen Eintopf zu machen. Es dauerte nicht lange, bis Deacon durch die Tür hereinlugte.
»Es riecht genießbar«, stellte er fest, trat neben mich und beäugte den Inhalt des Topfes. »Sieht auch gar nicht mal so übel aus.«
»Wenn du so weit bist, können wir essen.«
Er holte aus einem der Hängeschränke oberhalb der Spüle zwei tiefe Teller, wobei sich sein Hemd so weit nach oben schob, dass ich ein winziges bisschen seiner Haut sehen konnte. Eilig sah ich zurück zu dem gekochten Essen, welches er nun in die beiden Teller gab.
Während er so neben mir stand, wurde mir bewusst, dass er hier drinnen gerade noch so aufrecht stehen konnte, wohingegen ich damit überhaupt keine Probleme hatte. Ich nahm an, dass er das Dach aufgestockt hatte, zumindest wirkte es von außen bei einem genaueren Blick so.
»Als Nächstes muss hier eine Essnische rein«, meinte Deacon, während wir vorn saßen, die Teller auf unseren Oberschenkeln abstellten und aßen.
»Keine schlechte Idee.«
»Du hattest übrigens recht.«
»Womit?« Ich hielt einen Moment inne.
»Du kannst tatsächlich sehr gut kochen.«
Tennessee
Den Rest des Tages hatte Deacon damit zugebracht, weiter an seinem Bus herumzuschrauben. Das Schloss war nun zwar wieder repariert, aber offenbar hatte er währenddessen eine ganze Liste an Verbesserungen zusammengetragen, die er in nächster Zeit umsetzen wollte.
Ich war eine gute Köchin, aber definitiv keine gute Handwerkerin, also ließ ich Deacon sein Ding machen, solange er keine Hilfe brauchte, und beschloss, die nahe Umgebung zu erkunden.
Er nickte grimmig, als ich ihm mitteilte, dass ich in den angrenzenden Wäldern spazieren gehen würde, und machte keine Anstalten, mich zurückzuhalten oder mich zu begleiten.