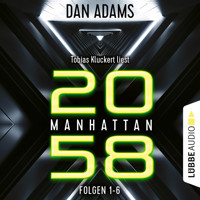4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Colorado, Winter 1879. Der junge Arzt Allan Kerrish ist auf der Flucht vor den Männern von Senator Cahill. Auf seinem Weg durch die verschneite Landschaft rettet er Catherine Archer das Leben. Ihr Mann wurde ermordet, und die Täter sind mit der Besitzurkunde für die Archer-Goldmine über alle Berge. Der Doktor und die Witwe landen in dem trostlosen Goldgräbernest Three Oaks - einem gesetzlosen Ort, in dem allein das Recht des Stärkeren zählt.
Perfekte Unterhaltung für echte Cowboys und Fans von "Yellowstone" und "Horizon"? Ein absolut spannender Western, fesselnd geschrieben, mit einer packenden Story und hervorragend recherchiert. "Wild-West-Feeling" für Cowboys und Cowgirls!
Dieses eBook enthält alle 6 Folgen der gleichnamigen eBook Western-Serie und entspricht mehr als 600 Buchseiten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 791
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Die Charaktere
Karte
Titel
Impressum
Teil 1 – Ritt durch die Weiße Hölle
Teil 2 – Der Grizzly
Teil 3 – Briefe eines toten Mannes
Teil 4 – Goldgräber und Flussratten
Teil 5 – Verfluchte Iren
Teil 6 – Cahills Männer
Über dieses Buch
Colorado, Winter 1879. Der junge Arzt Allan Kerrish ist auf der Flucht vor den Männern von Senator Cahill. Auf seinem Weg durch die verschneite Landschaft rettet er Catherine Archer das Leben. Ihr Mann wurde ermordet, und die Täter sind mit der Besitzurkunde für die Archer-Goldmine über alle Berge. Der Doktor und die Witwe landen in dem trostlosen Goldgräbernest Three Oaks – einem gesetzlosen Ort, in dem allein das Recht des Stärkeren zählt.
Ein modern geschriebener Western, spannende und fesselnde Story, dichte Atmosphäre, hervorragend recherchiert. »Wild-West-Feeling« garantiert!
Das eBook enthält alle 6 Folgen der gleichnamigen eBook-Serie und entspricht mehr als 600 Buchseiten!
Über den Autor
Dan Adams ist das Pseudonym von Jürgen Bärbig (ehemals Scheiven), geboren 1971. Er war Stipendiat der Bastei Lübbe Academy und nahm 2014 an der einjährigen Masterclass teil. In der Halloween-Anthologie Angel Island (Bastei Lübbe, 2014) erschien seine Kurzgeschichte »Die Mauern von Ronwick Abbey«. Er verfasste die spannende Western-Serie »Three Oaks« (2016). Mit dem actionreichen SF-Thriller »Manhattan 2058« (2018) entwirft er ein düsteres, packendes Szenario der nahen Zukunft.
Die Charaktere
Dr. Allan Kerrish besaß in Sante Fe seine eigene Praxis und war beliebt und angesehen. Doch dann zieht er die Wut von Senator Cahill auf sich und muss aus der Stadt fliehen – verfolgt von Cahills Männern. Als Kerrish nach Three Oaks kommt, hofft er, sich hier für eine Weile verstecken zu können.Kerrish ist kein Kämpfer, aber wenn er dazu gezwungen wird, greift er auch zur Waffe. Ein guter Schütze ist er allerdings nicht.
Catherine Archer wird nach dem Mord an ihrem Mann von Kerrish gerettet und nach Three Oaks gebracht. Catherine ist eine starke und gerechtigkeitsliebende Frau, die ihren rechtmäßigen Besitz zurückfordert und Rache an den Mördern ihres Mannes nehmen will.
John D. Twissle ist der Besitzer des Silver Coin Saloons in Three Oaks. Twissle hat sein gesamtes Geld in den Ort gesteckt und Land aufgekauft. Doch dann versiegten die Goldminen und die Stadt verödete. Twissle lässt sich dennoch nicht unterkriegen. Er verkauft weiter Schnaps und Huren, weil es das ist, was er am besten kann.
Victoria »Brandy« Winters kam gemeinsam mit ihrem Verlobten und der Hoffnung nach Three Oaks, dort Gold zu finden und ein neues, besseres Leben zu beginnen. Aber es sollte anders kommen. Die Minen waren versiegt und ihr Verlobter begann zu trinken und Brandy zu verprügeln. Zum Glück verschwand er eines Tages in den Bergen. Brandy strandete bei Twissle und arbeitet in seinem Saloon als Hure. Sie hasst dieses Leben.
Miss Coralina wird von allen Cora genannt und arbeitet als Hure im Saloon. Sie ist eine mexikanische Schönheit, aber auch durchtrieben und boshaft. Sie weiß ihre Reize einzusetzen, um Männer zu manipulieren und bekommt stets, was sie will.
Douglas Jordan wirkt auf den ersten Blick wie ein freundlicher Geschäftsmann, ist in Wirklichkeit aber ein gerissener und skrupelloser Gangster, der über Leichen geht und zu brutaler Gewalt neigt. Meist agiert er aus dem Hintergrund heraus. Er kommt nach Three Oaks, wo er sich als Bennett Archer, den Besitzer der Goldmine, ausgibt. In Wirklichkeit hat er ihn zuvor ermorden lassen, um an die Besitzurkunde zu gelangen. Um an das Gold der Archer-Mine zu kommen, würde er selbst einen Pakt mit dem Teufel eingehen.
Travis Jordan ist Douglas’ jüngerer Bruder. Travis ist ein gefährlicher und unberechenbarer Killer. Mit seiner Bande raubt er von Postkutschen bis Banken alles aus, was ihm Geld einbringt. Dabei ist er schnell mit dem Colt zur Hand. Große Pläne sind nicht seine Sache. Tote und Verletzte nimmt er bei seinen Überfällen schulterzuckend in Kauf.
Sweet Anny ist Travis’ Geliebte. Die Frau mit dem hübschen Gesicht kann reiten und schießen wie ein Mann. Sie gibt sich unnahbar und zeigt keine Schwäche. Daher wird sie von Travis’ Leuten respektiert. Doch Anny zweifelt, ob der Weg, den sie gewählt hat, wirklich der richtige ist.
Donan O`Greer hat in der Archer-Mine gearbeitet und ist der Anführer der meist irisch-stämmigen Minenarbeiter. Als die Archer-Mine einstürzt und siebzig Männer unter sich begräbt, ist darunter auch sein Sohn. Seitdem ist er verbittert und wütend auf alle Minenbesitzer, die sich einen Dreck um die Sicherheit in den Stollen kümmerten. Obwohl die Minen längst versiegt sind, bleibt er in Three Oaks, da er seinen toten Sohn nicht allein lassen will, der immer noch in der Mine begraben liegt.
Crazy Norman ist eine Flussratte. So werden die Männer genannt, die keinen Claim in den Bergen bekommen haben und das wenige Schwemmgold aus den Bächen und Flüssen fischen müssen. Wie alle Flussratten führt auch Crazy Norman ein erbärmliches Leben, von allen verachtet. Crazy Norman ist skrupellos, nur den anderen Flussratten gegenüber zeigt er sich loyal. Sein Hass auf die Goldgräber im Camp ist grenzenlos.
Caleb Jones ist ein Mann, der die Stille und die Einsamkeit der Berge liebt. Er nimmt alles mit Humor und einem Augenzwinkern, aus Streitigkeiten hält er sich gern raus. Für die Leute im Goldgräbercamp ist er sowas wie die gute Seele.
Jellycoe ist ein ehemaliger Sklave, der keinem Weißen traut – außer seinem Freund Caleb Jones, den er während des Bürgerkriegs kennengelernt hat. Die beiden sind wie Blutsbrüder. Sie bewohnen eine Hütte in den Bergen, wo sie als Trapper und Jäger leben. Jellycoe hat ein Mädchen in Three Oaks – Martha, die als Mädchen für alles im River Look Hotel arbeitet.
Joshua Sykes arbeitet als Goldgräber und stellt sich gegen deren Anführer Donan O`Greer. Eine Revolution will er aber nicht anzetteln, da jede Revolution Blut kostet. Doch dann lässt er sich doch vor den falschen Karren spannen.
DAN ADAMS
Stadt ohne Gesetz
Western
beBEYOND
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Jan Wielpütz
Lektorat/Projektmanagement: Stephan Trinius
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung eines Motivs von © ysbrandcosijn/iStock; Rpsycho/iStock; ysbrandcosijn/iStock; YaroslavGerzhedovich/thinkstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6296-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Teil 1 – Ritt durch die Weiße Hölle
Allan Kerrish war so müde, so unendlich erschöpft, dass er sich am liebsten in den Schnee gelegt hätte, um zu schlafen und nie wieder aufzuwachen. Doch noch war sein Lebensfunke nicht erloschen, und er wollte nicht kapitulieren, nicht vor der Natur und nicht vor den Männern, die ihn seit jenem unglücklichen Tag in Santa Fe verfolgten. Er war vor ihnen bis nach Colorado in die Rockys geflohen. Er hasste diese Kerle. Sie waren wie Bluthunde – nur, dass diese Bluthunde Winchester-Gewehre und Colts trugen. Zweimal war er ihnen nur knapp entkommen und ihretwegen war er nun gezwungen, durch diese verfluchte Kälte zu reiten, statt im warmen Santa Fe Bauchweh zu kurieren, Knochen zu schienen und Kindern auf die Welt zu helfen.
Mit der linken Hand umklammerte er die Zügel, mit der rechten hielt er die Decke fest, die er als notdürftigen Mantel benutzte. Außer der Stute, einem Anzug voller Löcher und Flecken und einem Colt Peacemaker, der nicht funktionierte, war ihm nichts geblieben. Er hatte nichts mehr zu essen. Wollte er trinken, nahm er Schnee in den Mund. Die Kälte stach ihm dann durch die Zähne direkt ins Gehirn. Für eine heiße Tasse Kaffee oder einen warmen Apfelkuchen, wie ihn seine Mutter immer gemacht hatte, hätte er töten können.
Sein Magen knurrte. Das Pferd schnaubte, während es sich schwer durch eine Schneewehe kämpfte, die sich zwischen den Tannen angehäuft hatte. Er hatte sich angewöhnt, in regelmäßigen Abständen über die Schulter zu blicken.
Von seinen Verfolgern hatte er aber seit einer Woche nichts mehr gesehen. War es ihm endlich gelungen, sie abzuhängen?
Ein hoffnungsvolles Lächeln stahl sich auf sein unrasiertes Gesicht, das gleich wieder erstarb. Denn im Grunde spielte es keine Rolle, ob er nun erschossen wurde oder hier erfror, am Ende wäre er so oder so tot.
Er stemmte sich in die Steigbügel und sah den Weg entlang, den er noch nehmen musste. Wald. Pinien und Tannen, so weit das Auge reichte. Rechts erhoben sich schneebedeckte Berge. Erstarrte Wasserfälle hingen zwischen den zerklüfteten Felsen, in denen er Gabelböcke herumspringen sah. Zu gerne hätte er auf einen angelegt, ihn aus der Wand geschossen, seine Zähne in das noch warme, rohe Fleisch geschlagen. Aber sie waren viel zu weit weg und viel zu hoch. Trotzdem zog er den nutzlosen Revolver. Wieder versuchte er den Hahn zu spannen, wie schon unzählige Male zuvor. Ohne Erfolg. Das Mistding klemmte. Ich könnte mich nicht einmal selbst erschießen, dachte er bitter.
Vor den Augen tanzten wilde, flirrende Punkte; trotz des Schals brannte sein Gesicht vor Kälte.
Er schob die Waffe zurück in das Holster, vergrub seinen Kopf unter der Decke und überließ es dem Pferd, den Weg zu finden.
Ihr beider Atem hing wie Eisnebel in der Luft.
Nach einer Weile fing es an zu schneien, und die Dämmerung setzte ein. Zum dritten Mal, seit er in diese verfluchte Gegend gekommen war, musste er ein Nachtlager finden.
Hier gab es Wölfe. Er hatte sie gehört, ihr Schnaufen und Hecheln, wie sie ihn im Schatten des Waldes verfolgten, und ihre gelben Augen in der Nacht gesehen, wie sie ihn beobachteten.
Sein Pferd kam inzwischen nur noch langsam voran, es wankte vor Erschöpfung durch den Schnee, bis es schließlich keinen Schritt mehr tat.
Kerrish stieg aus dem Sattel. Die Beine waren taub, in seinen Händen hatte er kaum noch Gefühl, und trotzdem ging er voran und zog das störrische Pferd hinter sich her. »Komm schon. Wir finden ein warmes Bett für mich und einen schönen großen Stall für dich.« Er grinste, als hätte er einen guten Witz gemacht. Tatsächlich hätte er lieber losgeheult wie ein kleines Kind und gewartet, bis der Tod ihn endlich holen würde.
Schritt für Schritt ging er voran, Gedanken gab es nicht mehr, Verzweiflung und Hunger machten jede Bewegung zur Qual.
Doch dann öffnete sich der Wald. Baumstümpfe ragten aus dem Schnee heraus. Da entdeckte er einen alten Karren neben dem Weg und hörte das Rauschen eines Flusses weit unter sich.
Aber da war noch etwas anderes. Etwas, das ihn mit neuer Kraft erfüllte. Wie ein Schloss in einem Traum stand sie plötzlich vor ihm. Eine Hütte aus dicken Stämmen, mit einem Dach aus Rinde und einem kleinen Stall.
Kerrish sah zu seiner Stute, die kaum noch in der Lage war, den Kopf zu heben. »Siehst du das? Verdammt! Siehst du das?« Er lachte hysterisch, seine Stimme überschlug sich und kehrte als Echo von den Berghängen zu ihm zurück. Siehst … du … das … du … das, hallte es.
»Ich hab dir nicht zu viel versprochen, nicht wahr?!«
Halb stolpernd, halb rennend, zog er sein Pferd hinter sich her. Immer die Hütte im Auge behalten, rasten seine Gedanken, bloß nicht blinzeln, damit sie nicht einfach wieder verschwindet. In dem Fall hätte der Tod einen letzten, grässlichen Scherz mit ihm getrieben, ehe er ihn endgültig fertigmachen würde.
Aber die Hütte war da, trotzte der Kälte und dem Schnee. Sie schien verlassen. Der Eingang war zugeweht, die Fenster mit hölzernen Läden verrammelt.
Mit bloßen Händen tauchte er in den Schnee, fegte ihn beiseite, keuchte, schwitzte. »Gleich, ich hab’s gleich!«, rief er seinem Pferd zu. »Da ist der Riegel!« Zitternd hob er ihn an und stemmte sich gegen die Tür. Sie hielt stand. Kerrish warf sich mit der Schulter dagegen. Nichts. Dann noch mal und noch mal. Plötzlich gab die Tür nach. So plötzlich, dass er das Gleichgewicht verlor, voran stolperte und der Länge nach in den Raum stürzte.
Einen Augenblick lang saß er mit offenem Mund staunend auf dem Boden, dann lachte er aus vollem Hals. »Wir haben es geschafft! Jaaa!« Kerrish kam auf die Füße und schüttelte die Faust gegen die offene Tür. »Du kriegst mich nicht. Hast du gehört, Tod?!«
Noch in der Bewegung erstarrte er. Sein Pferd lag ausgestreckt im Schnee.
»Nein, nein. Wir haben es doch geschafft! Du darfst jetzt nicht sterben.« Auf allen vieren stolperte er wieder in den Schnee hinaus, hin zu seinem Tier, das kaum noch atmete. Kleine Dampfwölkchen stiegen noch vor den Nüstern auf.
»Hoch mit dir. Steh auf.« Verzweifelt zerrte er an den Zügeln, aber sein Pferd reagierte nicht mehr. Ein letztes Zucken, ein letzter Atemzug, der den braunen Leib erbeben ließ, dann war es tot.
Kerrish blieb auf den Knien hocken, hielt den Kopf des Tieres auf dem Schoss. Vier Jahre war sie bei ihm gewesen, hatte ihn aus jeder Gefahr herausgebracht, und er hatte ihr noch nicht einmal einen Namen gegeben.
»Du Bastard!«, schrie er gegen den aufkommenden Sturm an, der mit eisigen Fäusten an ihm zerrte. Das Schneetreiben wurde dichter. Er musste zurück ins Haus, wollte er nicht auch erfrieren. Seine Fußspuren waren schon nicht mehr zu sehen, als er durch die Tür stolperte, die er hinter sich zuschlug.
Auch hier war es bitterkalt und dunkel, er brauchte unbedingt ein Feuer. Er stieß einen der Fensterläden auf, um das letzte Licht des Tages einzulassen, damit er die Hütte durchsuchen konnte.
Der Wind pfiff um das Haus, jaulte und kreischte, als würden die Diener des Teufels den Berg hinabsteigen.
Kerrish sah sich um. Es gab einen Tisch, einen Schaukelstuhl, eine Bank und ein Regal, auf dem vier von Spinnen eingewobene Töpfe standen. Ein grob gezimmertes Bett, auf dem ein paar Felle lagen, stand neben dem Kamin. Ein Stapel Holz lag aufgeschichtet daneben. Ein rostig gewordenes Beil steckte in einem der Scheite. Alles wirkte so, als wäre der Besitzer nur kurz vor die Tür gegangen, um gleich wieder zurückzukehren.
Eilig machte er sich daran, das Holz im Kamin aufzuschichten. Feuer, er brauchte ein Feuer. An nichts anderes konnte er mehr denken. Streichhölzer besaß er nicht, und hier fand er keine, also blieb ihm nur seine Waffe. Er nahm zwei Patronen aus der Kammer und brach sie auf. Das Schießpulver schichtete er auf ein Stück Rinde, das er mit zitternden Händen zwischen ein Bündel aus Reisig schob. Der Hahn klemmte noch immer, egal, wie sehr er sich auch bemühte ihn zu lösen. Daher nahm er auch die restlichen Patronen aus den Kammern, öffnete sie, befeuchtete das Beil mit seinem Speichel, wälzte die Klinge im Schießpulver und rieb sie am Lauf seiner Waffe entlang. Wieder und wieder, immer wieder. Plötzlich, ein Funkenschlag, der das Pulver traf, eine kurze Stichflamme, die das Reisig entzündete und eine winzige Flamme zurückließ. Kerrish war wie erstarrt. Die Flamme drohte zu erlöschen. Vorsichtig nahm er weiteres Reisig, das sich entzündete. Die Flamme wurde größer, berührte die Scheite, züngelte daran entlang, und Rauch wirbelte durch den Kamin.
Er hatte es geschafft. Schnell schloss er das Fenster, hockte sich vor das Feuer, wickelte sich in die Felle und wärmte sich auf. Immer wieder legte er Holz nach, die Flammen konnten gar nicht groß genug sein, um die fürchterliche Kälte aus seinem Körper zu vertreiben.
Nun, da er sich behaglich warm fühlte, meldete sich der Hunger, beißend und knurrend. Doch hier gab es nur eins, was er essen konnte. Sein Blick ging zur Tür. Er musste schlucken und gleichzeitig lief ihm das Wasser im Mund zusammen. So viel Fleisch. »Es macht ihr sicher nichts aus«, sagte er leise, während der Schein der Flammen tanzende Muster auf sein eingefallenes Gesicht malte. Schwerfällig stand er auf, nahm das Beil und trat an die Tür. Der Sturm hatte nicht nachgelassen. Im Gegenteil. Er wollte nicht hinausgehen, nicht sein warmes Paradies verlassen, aber sein leerer Magen zwang ihn dazu.
Kaum hatte er die Tür geöffnet, zerrte der Sturm an seiner Kleidung. Die Kälte durchbohrte seine Haut, sein Fleisch und schien bis zu den Knochen vorzustoßen. Von einem Moment auf den anderen war jedes behagliche Gefühl fort.
Dunkelheit und Schnee. Er konnte kaum einen Meter weit sehen, als er im geraden Weg von der Hütte fortstapfte.
Da waren Geräusche. Neben dem heulenden Wind hörte er Knurren, Bellen und Schmatzen.
Die Wölfe, sie holen sich mein Pferd, schoss es ihm durch den Kopf. »Verschwindet!« schrie er, stürzte voran, das Beil über dem Kopf erhoben. Ein Schemen tauchte vor ihm auf. Dann ein zweiter. Struppige Körper, die ihre Köpfe tief im Leib seines toten Tieres vergraben hatten und an den Eingeweiden zerrten. »Das ist meins!«, schrie er. »Verschwindet, ihr dreckigen Viecher!«
Eine Bewegung im Augenwinkel ließ ihn herumwirbeln. Ein Schatten jagte mit zwei Sprüngen durch den Schnee und warf sich auf ihn. Dolchartige Zähne, gelbe Augen. Er schlug zu, traf den Wolf mit dem Beil im Flug. Ein Jaulen, und der Körper prallte gegen ihn. Die Wucht riss Kerrish von den Beinen, das Beil entglitt ihm.
Das Tier war nicht tot, nur verletzt, es schnappte nach seinem Gesicht. Der nach Aas stinkende Atem stach Kerrish in die Nase. Er packte das Tier am Hals und versuchte es wegzustoßen. Das Tier war stärker. Wieder schoss der Kopf vor, knapp an seinem Ohr vorbei. Kerrish presste die Zähne zusammen, sein Atem kam stoßweise. Die andere Hand fuhr durch den Schnee, suchte das Beil. Er fand es, packte es und schlug zu. Diesmal trieb er die Schneide tief in den Schädel des Wolfes. Der Knochen splitterte. Heißes Blut spritzte Kerrish in die Augen. Das Tier sackte ohne einen Laut über ihm zusammen.
So schnell er konnte, kämpfte er sich unter dem Kadaver hervor, stellte sich breitbeinig hin und wartete darauf, dass sich auch die anderen auf ihn stürzen würden, aber die waren so mit ihrem Mahl beschäftigt, dass sie ihn gar nicht beachteten.
Sein Pferd blieb für Kerrish unerreichbar. Sich mit einem Rudel ausgehungerter Wölfe anzulegen, wäre Selbstmord gewesen. Also nahm er, was er kriegen konnte. Er packte den toten Wolf und zerrte ihn hinter sich her zurück in die Hütte. Für diese Nacht hatte er etwas zu essen und einen warmen Unterschlupf, und er erkannte, was für ein Glück er gehabt hatte.
Am nächsten Morgen erwachte Kerrish zusammengerollt unter einem halben Dutzend Fellen. Er lag auf einer Matratze, die lediglich aus Tannenzapfen bestand.
Er blinzelte zur Decke hinauf. Draußen war es still, der Sturm hatte sich gelegt. Durch die Ritzen der Fensterläden fielen Streifen aus Sonnenlicht ins Innere.
Er stand auf. Seine Bewegungen waren steif, seine Muskeln schmerzten. Das Feuer war erloschen, und die Überreste seines Abendessens lagen abgenagt auf einem Haufen neben dem Kamin. Die Eingeweide des Wolfs hatte er in einen der Töpfe geworfen, wo sie zu einer blutigen Masse gefroren waren.
Kaum dass er ein paar Schritte getan hatte, zitterte er schon wieder vor Kälte. Er trat ans Fenster, öffnete den Laden einen Spalt weit und spähte hinaus.
Die Berge strahlten silbern und golden im Licht der Sonne. Ein paar Schleierwolken hatten sich in den Bergspitzen verfangen.
Der Neuschnee hatte sich wie dicker Zuckerguss auf einem Kuchen über das Land gelegt. Sein Pferd war vollends darunter verschwunden. Nicht einmal Blut war zu sehen.
Ein kleiner Vogel hatte seine Abdrücke vor dem Fenster hinterlassen.
Seufzend nahm sich Kerrish eines der größeren Felle, wickelte sich darin ein und ging hinaus. Hier konnte er nicht bleiben.
Irgendwo musste es doch eine Siedlung geben. Diese Hütte war ja auch nicht einfach aus dem Boden gewachsen. Er packte ein, was vom Wolfsfleisch noch übriggeblieben war, und ging los. Dabei folgte er dem einmal eingeschlagenen Weg.
Von Wölfen keine Spur. Nur ein paar Adler zogen hoch über ihm ihre Kreise.
Er ging Meile um Meile, summte jedes Lied, das ihm in den Sinn kam, und kaute Streifen von gebratenem Wolfsfleisch, welches ihm zäh und faserig zwischen den Zähnen hing. Aber er wollte sich nicht beschweren. Es war allemal besser als gar nichts.
Gegen Mittag erreichte er eine Stelle, an der sich der Weg gabelte und ein weiterer Pass die Berge von Osten nach Westen durchschnitt. Er entschied sich für Westen. Tiefer in den Bergen würden ihn seine Verfolger vielleicht nicht vermuten, und er konnte sie endgültig abhängen.
Die Sonne stand nun hoch am Himmel, der Schnee glitzerte, wie ein dichter Teppich aus Diamanten.
Die Berge waren majestätisch, riesige steinerne Flanken stachen durch den Schnee. Rechts vom Weg fiel der Boden, zuerst sanft, dann steil in eine Schlucht ab. Er konnte nicht sehen, was an deren Grund lag, aber er konnte das wilde Rauschen eines Flusses hören, welches von den Felswänden widerhallte. Kerrish gönnte sich einen Moment, in dem er innehielt und die erhabene Schönheit der Landschaft genoss. Als er sich abwandte und den Weg fortsetzen wollte, fiel sein Blick auf Huf- und Wagenspuren. Zunächst waren sie noch undeutlich, halb verweht unter frisch gefallenem Schnee. Doch je weiter er ging, desto deutlicher wurden sie.
Im Schutz der Felswand hockten zwei Männer unter den Tannen, die so dicht standen, dass ihre Äste ein Dach bildeten.
Wes war groß und trug einen dichten schwarzen Bart. Seine Winchester lehnte neben ihm an einem Stamm. Er prüfte seinen Smith-&-Wesson-Revolver, indem er ihn ans Ohr hielt und die Trommel ganz langsam Kammer für Kammer klickend weiterdrehte.
Den Hut hatte er tief in die Stirn gezogen, während er sein Gesicht im Pelzkragen seiner Jacke versteckte.
»Verdammt Cal. Wo bleibt die nur?«, fragte er.
Cal war etwas kleiner, aber von kräftigerer Gestalt. Er trug einen am Saum ausgefransten Mantel, mit einem Kragen aus Wolfspelz, sowie Handschuhe und einen Schal, den er sich bis über das Kinn gezogen hatte. Er saß mit dem Rücken an einen Felsen gelehnt und rührte sich nicht. Damit schien er selbst ein Teil der erstarrten Landschaft geworden zu sein.
»Hey? Bist du taub?« Wes wurde mürrisch.
Endlich sah Cal ihn an. »Keine Ahnung. Wart’s einfach ab. Die kommen schon.«
»Verdammt, Cal. Ich frier mir den verdammten Arsch ab.«
»Hör auf zu jammern. Hier …« Er warf Wes eine Zigarette zu, die er gerade gedreht hatte. »Rauch eine.«
Wes stand auf und steckte den Revolver ins Holster. Seine Nervosität war fast mit den Händen greifbar. Die Zigarette glühte auf. »So weit sind wir doch gar nicht vorgeritten. Die müssten längst da sein.«
Cal hatte sich wieder von ihm abgewandt und würdigte ihn keiner Antwort.
»Wie kannst du nur so ruhig bleiben?«, fuhr ihn Wes an.
»Wieso nicht? Du quatschst doch für uns zwei.«
Kerrish stapfte durch den Schnee und folgte den Hufspuren, die nun deutlich zu erkennen waren. Vielleicht traf er auf jemanden, der ihm helfen konnte. Er beeilte sich. Schweiß klebte kalt in seinem Nacken.
Seine Hände waren ebenso kalt wie seine Zehen, die er in den Stiefeln zusammenkrampfte, nur um zu spüren, dass er sie noch bewegen konnte.
Bei jedem Schritt sank er bis zu den Waden im Schnee ein.
Plötzlich hörte er Pferde wiehern. Es musste irgendwo vor ihm sein, wie nah wusste er nicht. Die Felswände warfen das Wiehern als dutzendfaches Echo zurück, und außer Felsen und Tannen sah er nichts.
»Da kommen sie«, sagte Wes und deutete auf eine von vier Pferden gezogene Kutsche, die sich rutschend und schlingernd ihren Weg durch den Schnee kämpfte. Ein Mann saß auf dem Bock, das Gesicht hinter einem dicken Wollschal verborgen.
Wes und Cal verließen ungesehen ihren Beobachtungsposten und zogen sich die Tücher vor das Gesicht. Sie kletterten zu ihren Pferden hinunter, die sie hinter der nächsten Biegung versteckt hatten, und ritten los, der Kutsche entgegen.
Der Fahrer sah die beiden Reiter und zog erschrocken die Zügel an. Er wollte nach seiner Waffe greifen, als ein Schuss fiel. Die Kugel zerschmetterte ihm das Gesicht. Er war sofort tot. Der leblose Körper fiel auf dem Kutschbock nach hinten. Die toten Finger umklammerten immer noch die Zügel.
Wes hatte den Revolver gezogen und ritt nun neben die Kutsche. Das überraschte, fassungslose und entsetzte Gesicht eines Mannes tauchte im Fenster der Tür auf. Wes schoss sofort auf ihn. Der Mann zuckte und stöhnte schmerzerfüllt. Die Kugel hatte ihn in den Arm getroffen. Eine Frau im Inneren schrie. Schon war Wes aus dem Sattel gesprungen und riss die Tür auf. Die Frau beugte sich gerade über den Verletzten, als sich ihre Blicke begegneten. Wes schoss erneut ohne zu zögern, und sie stürzte in die Polster. Der Mann schrie vor Wut und Schmerz und versuchte mit dem verletzten rechten Arm nach der Waffe zu greifen, aber Wes ließ ihm keine Chance. Er spannte den Hahn, die Trommel drehte sich, und er drückte ab. Die Kugel traf den Mann in die Stirn. Eine Blutfontäne mit Knochensplittern und Gehirnmasse spritzte gegen die Kutschendecke. Der Tote stürzte neben seine Frau. Schon war Wes bei ihm und durchsuchte ihn, während Cal sein Pferd zügelte, absprang und auf die Kutsche kletterte. »Hast du’s?«, rief er.
»Gleich!«
»Beeil dich!« Ein Donnern war zu hören.
Die Pferde wieherten panisch.
»Mach schon!« Eine flache Geldkassette fiel neben der Kutsche in den Schnee, die ein massives Vorhängeschloss aus Metall besaß. Cal sprang hinterher, schnappte die Kiste an einem der Griffe und stieg wieder eilig in den Sattel. Er hatte Mühe, sein aufgeregtes Tier zu bändigen. »Mach schon!« Das Donnern wurde lauter.
»Hier. Ich hab’s!« Triumphierend hielt Wes ein mit Blut bespritztes Stück Papier in der Hand.
Doch als er aus der Kutsche kletterte und die Berge hinaufsah, wandelte sich seine Freude schlagartig in schieres Entsetzen. Eine weiße Wand stürzte auf sie zu. So schnell er konnte, warf sich Wes auf sein Pferd und galoppierte los, noch bevor er richtig im Sattel saß. Sein Pferd warf den Kopf nach hinten, rollte mit den Augen und hätte ihn fast abgeworfen, als die Lawine auf die Straße stürzte.
Kerrish war hinter ein paar Baumstämmen in Deckung gesprungen. Mit dem nutzlosen Peacemaker in der Hand, spähte er in die Landschaft. Niemand zu sehen. Die Schüsse waren weiter vorne gefallen und hatten nicht ihm gegolten. Das Donnern allerdings wurde immer bedrohlicher. Es wurde zum Stampfen, zum Grollen, wie bei einem Herbstgewitter.
Dann sah er es. Eine Lawine, eine riesige Wolke aus Eis und Schnee, die alles mit sich riss, raste die steilen Berghänge hinab. Bäume zersplitterten, stürzten um und verschwanden. Kerrishs Augen wurden riesengroß. Die Lawine war gigantisch und hielt geradewegs auf ihn zu. Er sprang auf, sah sich um. In wenigen Augenblicken würde sie ihn verschlingen.
Er starrte in Richtung der Felskante. Wie tief es dort wohl hinunterging? Schon lief er in diese Richtung. Eine andere Wahl hatte er nicht.
Polternder Lärm verfolgte ihn, Holzsplitter flogen an ihm vorbei und Eisstücke, groß genug, ihn zu enthaupten. Er zog den Kopf ein, stürmte an die Felskante, sah hinunter. Fünfzig Fuß tief unter ihm strömte der Fluss. Ein Blick zurück.
Die tödliche Schneewand hatte ihn fast erreicht. Seine Ohren dröhnten, sein Mund wurde trocken. Spring, schrie eine Stimme in seinem Kopf. Er ließ sich fallen. Im gleichen Moment rauschte die Lawine über ihn hinweg. Tonnen von Stein, Schnee und Eis polterten, zischten und krachten ins Flusstal hinunter. Baumstämme überschlugen sich, brachen wie Streichhölzer, Splitter flogen und stürzten in die Tiefe und plötzlich, mit einem Mal, war es vorbei. Über die Kante regneten noch ein paar kleinere Steine, und etwas Schnee schob nach.
Kerrish hing in der zerklüfteten Felswand. Ein krumm gewachsener Baum und ein paar vertrocknete Gebüsche hatten seinen Sturz in den Tod verhindert. Er konnte sein Glück kaum fassen. Mit einem Seufzer der Erleichterung sah er zum Rand der Felswand hinauf. Es war nicht weit. Bemüht, das Gleichgewicht zu halten, bekam er einen Vorsprung zu fassen, an dem er sich hochziehen konnte. Stück für Stück – und für ihn viel zu langsam – erreichte er den Rand und zog sich hoch.
Keuchend kam er auf die Füße. Den Revolver hatte er verloren. Unwichtig.
Der Weg war verschwunden, und er musste über Geröll klettern. Er kam nicht weit. Hinter der nächsten Biegung, zwischen den Tannen, die am Rand des Abgrunds standen, hatte sich eine Kutsche verfangen. Wie ein riesiges Insekt lag sie auf der Seite, halb unter Schnee begraben. Die Lawine hatte einen Teil des Daches fortgerissen. Gepäck lag verstreut herum. Koffer waren aufgeplatzt und hatten Hüte, Hemden und Kleider freigegeben.
Im Geschirr hing noch der zerfetzte Körper eines Pferdes. Der Kopf war abgerissen, die Flanke schien mit einem gigantischen Schlachtermesser aufgeschnitten worden zu sein. Der Schnee ringsherum war voller Blut.
Vorsichtig ging Kerrish näher. All seine Sinne waren auf die Kutsche und die Umgebung gerichtet. Alles blieb still. Die Kutsche lag vor ihm, die Tür war aufgesprungen. Der Wind spielte mit den Vorhängen aus rotem Stoff.
Kerrish trat auf etwas, das unter seinen Stiefeln knirschte. Ein Arm ragte aus dem Schnee heraus. Die Hand hing halb abgerissen nur noch an ein paar Sehnen. Kerrish zog den Fuß zurück, als ihn ein Stöhnen bis ins Mark erschreckte. Es kam aus der Kutsche.
»Zum Teufel«, keuchte er, sein Herz raste, während er seinen Blick auf die offene Tür richtete. Nach kurzem Zögern kletterte er auf die Kutsche und spähte ins Innere. Alles war voller Blut und Schnee. Die Blätter einer aufgeschlagenen Bibel raschelten leise und betonten damit sogar die völlige Stille.
In einer Ecke lag ein Mann bäuchlings auf einer Frau. Kerrish untersuchte ihn mit einem raschen Blick. Selbst wenn er kein Arzt gewesen wäre, so war klar, dass der Mann ohne Zweifel tot war. Aber die Frau regte sich noch. Obwohl sie die Lider geschlossen hatte, zuckten ihre Mundwinkel und Augenbrauen. Kerrish sah hilfesuchend zum Himmel. »Auch das noch, verflucht. Als hätte ich nicht schon genug Schwierigkeiten.« Für einen Moment war er versucht, dem Toten den Pelzmantel abzunehmen, die Kutsche zu durchsuchen und einfach zu verschwinden, aber da meldete sich sein Gewissen.
Vorsichtig ließ er sich in die Kutsche hinab, packte den Toten bei den Schultern und rollte ihn von der Frau herunter. Der Tote trug ein Holster, der Colt steckte noch. Wer immer ihn getötet hatte, er hatte ihm keine Chance gelassen.
Kerrish kniete neben der Frau nieder. Brust und Hals waren mit Blut besudelt. Sie hatte eine Schusswunde in der Schulter, und die linke Hälfte ihres Gesichtes war stark angeschwollen und blau und grün verfärbt. Sicher hatte sie sich den Kopf angeschlagen. »Hey, Lady. Können Sie mich hören?«
Sie rührte sich nicht.
Er fasste sie vorsichtig um die Hüften und zog sie an sich heran. Sie stöhnte, als er ihren Kopf gegen seine Schulter bettete und an ihrem Rücken herabsah. Auch hier, Blut. Die Kugel war glatt durchgegangen. Schnell riss er Streifen aus den Gardinen und legte ihr einen Verband an, der die Blutung stoppen sollte.
»Mehr kann ich erst Mal nicht für Sie tun, Lady«, sagte er, als er fertig war, und legte sie vorsichtig zurück. Anschließend durchsuchte er das zerstörte Innere der Kutsche. Dem Toten nahm er Pelzmantel und Holster samt Colt ab. In der Westentasche fand er zusammengerollte hundert Dollar und eine goldene Uhr. Trotz des gesprungenen Glases sah sie wertvoll aus. Beides steckte er ein. In einem Korb fand er einen Laib Brot, der den Whisky aus einer zerbrochenen Flasche aufgesogen hatte, und etwas Trockenfleisch und ein paar schrumpelige Äpfel. Er nahm alles, was er finden konnte. In der Flasche war noch ein kleiner Rest übriggeblieben, den er vorsichtig austrank, wobei er darauf achtete, keine Scherben zu schlucken. Der scharfe Schnaps ließ ihn husten, belebte ihn aber zugleich. Während er sich den Mund abwischte und in die kalten Hände blies, betrachtete er die Bewusstlose, die nun ruhiger zu atmen schien. Sie war jung und trotz der Schwellung im Gesicht äußerst hübsch. Der Blutverlust ließ ihre Haut wächsern und blass erscheinen. Das blonde Haar fiel in weichen Locken auf ihre Schultern.
Sie trug einen Ehering. Der Tote auch. »Verdammter Mist«, fluchte Kerrish leise. »Das wird ein böses Erwachen.«
Er legte sich die Frau über die Schulter und schob sie vorsichtig durch die Tür. Dann kletterte er hinterher, nahm sie wieder auf und trug sie in Richtung der Passstraße.
Schon zitterten seine Knie; die Anstrengungen der letzten Wochen hatten ihn so sehr geschwächt, dass selbst eine so zierliche Frau ihm wie ein Koloss erschien.
Nach einem letzten Blick auf die Kutsche ging er weiter und orientierte sich dabei am Fluss, der ihn nach Westen führte.
Immer wieder strauchelte er, fiel mit seiner Last in den Schnee. Trotz der Kälte begann er zu schwitzen. Jeder Atemzug brannte in den Lungen, jeder Muskel schmerzte und jeder Schritt wurde zu einer endlos erscheinenden Meile.
Der Weg wand sich langsam ins Tal hinab. Das Gelände wurde flacher und immer wieder gestattete es nun einen Blick auf das silbern dahinfließende Band des Flusses. Auch sah er nun die Hufabdrücke wieder. Er schätzte vier Reiter, die dem Weg erst kurz zuvor gefolgt sein mussten. Die Abdrücke der Hufeisen waren deutlich zu erkennen.
Was er dann roch, war eine starke Ausdünstung nach Alkohol, die in der eiskalten Luft hing. Der Geruch war so stark, dass er in der Nase prickelte und im Hals kratzte.
Kerrish blieb wankend stehen und sah sich um. Nun sah er auch Rauch, der zwischen den Tannen aufstieg und dort träge verwehte. Jemand schlug Holz, ein Pferd wieherte, und ein Hund bellte.
Die Geräusche kamen von abseits des Weges. Kerrish zögerte nicht lange und bog ab. Ein Pfad, von Hufen und Schlittenspuren in den Wald gezeichnet, führte ihn zu einer Hütte. Ein Mann mit schwarz-grauem Vollbart, in zerschlissener Winterjacke und mit einem fleckigen grauen Hut auf dem Kopf, stand davor und schlug Holz. Als er Kerrish bemerkte, ließ er die Axt fallen und griff sofort zu seiner Schrotflinte.
Beide Hähne klickten. »Wer zum Teufel bist du denn?«, fauchte er und spuckte in den Schnee, ohne den Eindringling dabei aus den Augen zu lassen.
»Allan Kerrish. Ich bin Arzt«, sagte er langsam. »Nicht schießen. Ich brauche Ihre Hilfe.« Mit einem Kopfnicken deutete er auf die Frau, die schwer in seinen Armen hing. »Sie … sie braucht Ihre Hilfe. Sie wurde angeschossen.«
»Lass erst mal die Knarre fall’n, Jüngelchen, dann red’n wir weiter.«
Kerrish hielt es für besser, zu tun, was der Mann verlangte. Umständlich gelang es ihm, die Frau mit einem Arm zu umklammern, während er mit der freien Hand den Gürtel löste.
Das Holster fiel ihm auf die Füße.
»Jetzt komm mal drei Schritt vor.«
Kerrish gehorchte. Die freie Hand hatte er als Zeichen seiner Friedfertigkeit erhoben.
Sein Gegenüber kniff die Augen zusammen. »Schon besser«, sagte der Mann und spie erneut einen gelben Schleimklumpen in den Schnee. Dann sicherte er seine Schrotflinte und deutete auf die Hütte. »Komm rein. Ich hab Kaffee auf dem Feuer. Siehst aus, als ob du einen vertragen könntest.«
Kerrish lächelte erleichtert. »Ich hab seit Wochen keinen anständigen Kaffee mehr getrunken. Danke.« Er zeigte auf seine neu gewonnene Waffe, aber der andere schüttelte nur den Kopf. »Fass sie nur an, wenn ich dir doch noch eins auf ʹn Pelz brennen soll.«
Damit ging der Mann zu seiner Hütte und ließ Kerrish eintreten. »Du kannst die Lady da vorne ins Bett legen, Jüngelchen.«
»Danke, Sir. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich Allan nennen würden. Ich bin kein Junge mehr. Ich bin fünfunddreißig.«
Der Mann grinste und zuckte die Schultern. »Wir habʹn aber ’n dünnes Fell, was? Aber wie du willst.«
Er drehte sich um und nahm zwei Becher von einem wackeligen Regal.
Der ganze Raum roch stark nach Alkohol, der Kerrish schwer zu Kopf stieg. Zwischen den Bodenbrettern waberten Dampfwölkchen. Von den Deckenbalken hingen Kaninchen- und Biberfelle. Im Kamin prasselte ein Feuer, über dem ein kleiner Topf hing. Sein Gastgeber füllte die Becher und stellte sie auf den Tisch. Dann setzte er sich, trank einen Schluck und streckte Kerrish seine runzelige Hand entgegen. »Ich bin Ashton, aber nenn mich ruhig Ash.«
Kerrish nahm die Hand und schüttelte sie. Dann erst wandte er sich seiner Patientin zu, löste den Verband an ihrer Schulter und begutachtete die Schusswunde. »Haben Sie Nadel und Faden hier? Ich muss die Wunde unbedingt nähen.«
»Sicher. Die Kiste unter dem Bett.«
»Ich brauche auch sauberes Wasser und Alkohol.«
Ash grinste. »Du meinst Whisky? Kannst jede Menge davon haben.«
»Nicht zum Trinken. Ich muss damit die Wunde säubern und die Nadel sterilisieren.«
»Sterili… was?« Ash winkte ab, stand auf und brachte ihm, was er verlangt hatte.
»Mach mir aber keine Blutflecken. Hab erst letztʹn Monat ’n neues Laken aufgezogen.«
»Ich geb mir Mühe.« Während Kerrish arbeitete, sah ihm sein Gastgeber interessiert über die Schulter. Dabei hielt er jedes Mal die Luft an, wenn Kerrish die Nadel in die Haut stach und den Faden durchzog.
»Bist ja wirklich ’n richtiger Arzt«, sagte Ash und schnalzte mit der Zunge.
»Was dachten Sie denn?«
»Na irgendso ein Quacksalber, der einem irgendso ein Zeug aus Kaktussaft und Elchpisse verkaufʹn will.«
Kerrish grinste. »Nein, so einer bin ich nicht.«
»Mhh. Wer ist die Kleine? Sieht süß aus.«
»Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie in einer Kutsche gefunden. Man hat auf sie und ihren Mann geschossen. Er hat nicht so viel Glück gehabt.« Kerrish hielt inne und strich ihr eine Strähne aus dem Gesicht. »Oben auf dem Weg habe ich Pferdespuren gesehen. Sind hier Reiter vorbeigekommen?«
Ash zuckte die Schultern und trank seinen Kaffee. »Kann schon sein. Achte ich nicht drauf. Is mir auch scheißegal. Sollen mich in Ruhe lassʹn.«
»Gibt es hier eine Stadt in der Nähe?«
»Ja. Three Oaks.«
»Three Oaks?«
»Warst wohl noch nie hier in der Gegend, was?«
»Nein. Zum ersten Mal.«
»Und dann noch im Winter. Musst ganz schön verrückt sein.« Ash zog sich einen Schemel heran. »Hier wurde Gold gefunden. Ist schon Jahre her. Hier brummte es wie in ʹnem verdammten Bienenstock. Die Berge sind voll mit Stollen. Gibt kaum ein Fleckchen Land, an dem sich nicht ein Digger die Zähne ausgebissen hat. Wenn einer also was werd`n wollte, kam er hierher.«
Während Ash erzählte, legte Kerrish einen neuen Verband an. »Und Sie kamen auch wegen des Goldes?«
»Darauf kannst du verdammt einen lassen. Jeder kam deswegen. Ich hatte sogar meinen eigenen Claim, nur … hatte ich kein Glück. Also mach ich das hier«, sagte Ash und breitete die Arme aus.
Er atmete tief ein und grinste zufrieden, als gelte es, ein Wunder an Geschäftssinn zu präsentieren.
Kerrish holte sich seinen Kaffee. Der Alkoholgeruch, der jeden Winkel der Hütte erfüllte, machte deutlich, was sein Gastgeber meinte. »Sie brennen Whisky.«
»Genau. Den besten der gesamten verdammten Gegend. Das Zeug hat mich über manch kalten Winter gebracht. Und in Three Oaks haben sie’s wie die Löcher gesoffen. Und im Sommer kommen immer noch Siedler mit ihren Planwagen über den Dead Horse Pass. Verkaufe das Zeug dann direkt vor der Tür. Bringt ziemlich was ein. Im Winter ist es da eher ruhig.«
»Das glaube ich gern. Sagen Sie. Ist es noch weit bis in die Stadt?«
Ash kratzte sich den kahl werdenden Schädel. »Ist noch ein Stück. Aber es wird bald dunkel.« Er sah auf die bewusstlose junge Frau, dann seufzte er und kniff die Lippen zusammen. »Ich bring euch morgen früh hin.«
»Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Ich würde auch dafür zahlen.«
»Will ich nicht. Keiner soll Ash Williams nachsagen können, er wäre nicht gottgefällig und hilfsbereit.« Ash zeigte in Richtung Feuerstelle. »Kannʹs die Nacht da schlafen.« Dann stand er auf und holte Brot, ein tiefgelbes Stück Käse und ein großes Stück Trockenfleisch, das er auftischte. »Hast sicher Hunger.«
»Oh ja. Wie ein Bär.«
»Dann lass es dir schmecken … Jüngelchen.« Ash grinste, erhob sich schwerfällig und zeigte auf die Tür. »Wenn was ist – findest mich draußen. Ruh dich aus, aber lass deine Finger von meinem Zeug, klar?«
»Klar.«
Ash ging nach draußen, kurz darauf waren wieder gleichmäßige Axtschläge zu hören.
Nachdem er gegessen hatte, zog sich Kerrish einen Stuhl ans Bett und setzte sich zu seiner Patientin. Obwohl er es nicht wollte, wurden ihm die Augen schwer. Er richtete sich gerade auf, wischte sich über das Gesicht und versuchte wachzubleiben. Ein hoffnungsloser Kampf. Die Tage in der Wildnis hatten ihn ausgelaugt und bis an die Grenzen seiner Kraft erschöpft. Es gelang ihm gerade noch, den Kaffeebecher neben sich zu stellen, bevor er einschlief.
Als er aufwachte war es bereits dunkel geworden. Ash stand über ihm und grinste ihn an.
»Oh Gott«, murmelte Kerrish, »habe ich lange geschlafen?«
»Paar Stunden bestimmt. Komm, es gibt Abendessen.«
Kerrishs besorgter Blick fiel auf seine Patientin. Sie lag still, nur ihr Brustkorb hob und senkte sich in gleichmäßigem Rhythmus. Der Verband war nicht durchgeblutet, was ihn ein wenig beruhigte.
»Na, komm schon. Die läuft dir nicht weg.«
Ash setzte sich an den Tisch und bot Kerrish mit einer Handbewegung an, es ihm nachzutun. Dampfende Suppe, in der fettige Fleischstücke schwammen, stand auf dem Tisch.
»Sie leben ganz gut hier«, sagte Kerrish, nachdem er sich gesetzt hatte.
»Man kann es aushalten. Keiner stört mich … normalerweise … und keiner quatscht mir rein. So mag ich’s. Aber jetzt iss, bevor’s kalt wird.« Damit beugte sich Ash über die hölzerne Schale und schaufelte sich den Löffel schmatzend in den Mund. Suppe troff ihm aus den Mundwinkeln in den Bart. Dann rülpste er, trank einen Schluck Whisky, riss ein Stück hartes Brot ab und aß weiter.
»Sag mal, was treibt dich in diese gottverlassene Gegend hier?«, nuschelte er und spuckte feuchte Brotkrumen über den Tisch.
Kerrish lächelte gequält und vermied es, seinen Gastgeber anzusehen. »Ich will in den Westen.«
»Was denn? Im Winter? Durch die Berge? Hast du sie noch alle?«
»Ich hielt es für eine gute Idee.«
»ʹne Schnapsidee war das. Wo ist denn überhaupt dein Pferd? Oder dachtest du, ein Spaziergang könnt dir guttun?«
»Wölfe haben es gefressen.«
»Dann hast du verfluchtes Glück gehabt, Jüngelchen. Die Viecher sind ganz verrückt im Winter. Aber jetzt mal ehrlich. Was machst du wirklich hier?«
Kerrish streckte sich. »Ich lege mich wieder hin. Ich bin völlig fertig. Ich erzähle es Ihnen morgen, okay?«
Abwehrend hob Ash die Hände. »Geht mich ja eigentlich auch nix an. Behalt dein Geheimnis ruhig.«
»Gute Nacht, Ash und … vielen Dank noch mal für alles.«
Kaum hatte er sich vor dem Feuer ausgestreckt und die schmutzige Decke über die Schultern gezogen, begannen die Wölfe in den Bergen mit ihrem schaurigen Geheul.
»Hörst du’s?« Ash grinste. »Sie sind sauer, dass sie dich nicht zwischen die Zähne bekommen haben.«
Kerrish hob nur die Hand und nickte schwach, dann war er auch schon wieder eingeschlafen.
Die Nacht hatte sich über den Bergen ausgebreitet.
Vier Reiter erreichten die ersten Häuser von Three Oaks. Cal und Wes ritten mit ihnen. Sie waren der Lawine im letzten Moment entkommen, fast hätte es Wes noch erwischt. Der Schreck saß ihm noch immer in den Knochen. Ein Felskamm, der wie eine Barriere gewirkt hatte, hatte ihnen das Leben gerettet.
Ihr Anführer hörte auf den Namen Douglas Jordan. Ein ordentlich gekleideter Mann, mit einem warmen Mantel aus Büffelfell. Seine Stiefel waren teuer, ebenso wie der Hut und die Handschuhe aus Hirschleder.
Hinter ihm ritt ein schlaksiger, hagerer Kerl namens McWaitt, der seine Umgebung mit einem widerlichen Grinsen musterte.
Aus ein paar Fenstern strahlte goldenes Licht, aber auf der Straße war niemand unterwegs.
»Was ist denn das für ein verfluchtes Kaff?«, fragte Wes. »Hier gibt’s doch nichts zu holen.«
»Nicht so ungeduldig, Wes.« Sein Boss verzog keine Miene. »Jetzt suchen wir uns erst mal eine Unterkunft.«
»Wie Sie meinen, Mr Jordan.«
»Da vorne ist ein Saloon«, sagte McWaitt.
»Geh und frag nach einem Hotel oder so was. Beeil dich.«
»Ja, Sir.«
Die vier Reiter zügelten ihre Tiere vor dem Saloon, und McWaitt kletterte aus dem Sattel, verschwand im Gebäude, um kurz darauf wieder hinauszukommen. »Hier die Straße rauf, zum Fluss, da gibt’s ein Hotel, hat der Barkeeper gesagt.«
»Sehr gut.« Jordan nahm die Zügel auf, drückte seinem Pferd die Ferse in die Flanke und lenkte das Tier nach Norden.
Zerfallene Häuser lagen links und rechts des Weges. Rostige Ketten klirrten leise im Wind. Zerrissene Vorhänge wehten durch gesplitterte Fensterscheiben.
Wes wollte etwas sagen, bemerkte aber den adlergleichen Blick, mit dem sein Boss ihn bedachte, und schwieg.
Stattdessen kratzte er sich den schwarzen Bart und hoffte darauf, dass er wenigstens was zu vögeln und einen anständigen Whisky bekommen würde.
Das Hotel lag direkt am Fluss, neben einer Brücke. River Look Hotel stand mit blauer Schrift auf einem weißen Schild. Das Haus besaß drei Etagen und war damit das Größte im gesamten Ort. Dicke Eiszapfen hingen vom Rand des Daches und glitzerten im Licht einer einzelnen Laterne, die über dem Eingang hing. An das Hotel schloss sich ein Stall an.
Jordan stieg aus dem Sattel und winkte Wes zu sich. »Du kommst mit mir. Cal, McWaitt, ihr kümmert euch um die Pferde.«
Die beiden Männer betraten das Hotel. Die Tür quietschte ein wenig. Der Dielenboden knarrte bei jedem Schritt. Sie sahen sich um, doch außer ihnen war niemand da. Jordan trat an die Rezeption und hieb mit der Hand auf die Klingel, die neben einem in Leder eingeschlagenen Buch lag.
Wes blieb stehen und sah sich um. Direkt vor ihm führte eine Treppe nach oben. Daneben stand ein Sofa aus rotem Samt, das allerdings fadenscheinig und fleckig war. Von der Lampe an der Decke hingen Spinnweben. Links, getrennt durch eine Doppeltür, die offen stand, befand sich das Speisezimmer. Rot-weiß karierte Decken lagen auf den Tischen.
Eine Tür öffnete sich und lenkte Wes’ Aufmerksamkeit auf einen älteren Mann mit schütterem braunem Haar und Flaum im Gesicht, den Wes nur mit Wohlwollen als Bart bezeichnen konnte.
Der Mann gähnte. »Guten Abend, Gentlemen«, sagte er dann mit heiserer Stimme. »Ich bin Mr Fargus. Willkommen im River Look Hotel.«
»Sind Sie der Besitzer?«, fragte Jordan, und Fargus nickte diensteifrig.
»Wir brauchen Zimmer, wenn das möglich ist?«
»Aber natürlich. Sie können sich die Zimmer aussuchen. Um diese Jahreszeit haben wir nur sehr selten Gäste.«
»Zu anderen Zeiten wird es wohl auch nicht besser sein«, bemerkte Wes grinsend und erntete dafür von Jordan einen stechenden Blick, der ihm das Grinsen gleich wieder vertrieb.
»Wir sind zu viert.«
Die Augen des Hotelbesitzers leuchteten. »Aber ja, Sir. Kein Problem. Sehr gerne. Wie lange gedenken Sie zu bleiben?«
»Das weiß ich noch nicht genau. Aber erst mal eine Woche.«
»Gern. Haben Sie Gepäck?«
Jordan winkte ab. »Nichts, worum wir uns nicht selbst kümmern könnten. Aber wir waren lange unterwegs. Kann man hier was essen?«
»Martha!«, rief Fargus. »Martha, komm mal her!«
Eine Schwarze, wesentlich jünger als Fargus, mit lockigem Haar, das sie hochgesteckt trug, erschien in der Tür.
»Die Gentlemen haben Hunger. Mach Rühreier und Bohnen mit Speck. Und back etwas Brot auf. Für vier Leute. Beeil dich.«
Schon hielt er ein paar Schlüssel in der Hand. »Hier, Sir. Zimmer vierzehn … unser bestes. Ihre Begleiter sind auf derselben Etage untergebracht.«
»Sehr gut.« Jordan nahm Fargus’ Hand und drückte sie, dass es knackte. »Haben Sie vielen Dank. Kann ich vielleicht ein wenig ihrer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen? Ich hätte da ein paar Fragen.«
»Aber selbstverständlich, Sir. Es ist mir eine Freude.«
»Wunderbar. Wes! Bringt euer Zeug auf die Zimmer, danach kommt zu mir. Wir haben was zu besprechen.«
»Ja, Boss.«
Jordan und der Hotelbesitzer verschwanden die Treppe hinauf. Wes steckte die anderen Schlüssel in die Westentasche, bevor er in den Stall zu Cal und McWaitt ging. Die waren gerade damit beschäftigt die Pferde abzusatteln und mit Heu und Wasser zu versorgen.
Wes lehnte sich gegen einen der hölzernen Stützpfeiler, schob sich den Hut in den Nacken, ehe er die Arme verschränkte. »Habt ihr ʹnen Schimmer, was der Boss hier will? Er hat gerade Zimmer für eine Woche genommen.«
»Er hat sicher ʹnen guten Grund, ganz sicher«, antwortete McWaitt. »Das hat bestimmt mit dem Kerl zu tun, den du umgelegt hast.«
»Hey, du Idiot. Brüll hier nicht so rum. Muss ja nicht jeder mitkriegen.«
»Ja … okay. Was war das eigentlich für ’n Wisch, den du ihm abgenommen hast?«
»Weiß ich nicht. Irgend ʹne Urkunde, oder so. Ich hab’s mir nicht so genau angesehen.«
»Du kannst eh nicht lesen«, bemerkte McWaitt grinsend.
»Du denn, Großmaul?«
»Du kannst eine aufs Maul kriegen.«
»Schluss damit.« Cal sprach generell nicht viel, aber das wenige, was er sagte, klang fast immer wie ein Pistolenschuss.
»Der Boss wird es uns schon sagen.« Damit schwang Cal den Sattel über einen Balken, warf sich die Satteltaschen über die Schulter und nahm sein Gewehr. »Gib mir meinen Schlüssel.«
»Hier.«
Cal nahm ihn, ohne hinzusehen, und ging ins Hotel.
Kurz darauf folgten auch Wes und McWaitt.
Eine halbe Stunde später fanden sie sich in Jordans Zimmer ein. Es war geräumig, mit einem weichen Bett und einer Sitzgruppe vor einem Kamin, in dem ein Feuer prasselte.
Ein schwerer Schrank stand neben einer weiteren Tür, die hinaus auf den Balkon führte. Durch die geschlossenen Fenster konnte man das Gluckern und Rauschen des Flusses hören.
Cal stellte die Geldkassette auf den Tisch. Aus dem Stall hatte er ein Brecheisen und eine Eisensäge besorgt. Auf Jordans Befehl hin machte er sich an dem Vorhängeschloss zu schaffen. Es dauerte eine Weile, bis es ihm gelang das Schloss zu knacken und den Deckel zu öffnen.
Wes ließ einen lauten Pfiff hören.
»Donnerwetter«, sagte McWaitt. »Wir sind reich.«
Cal sagte, wie üblich, nichts.
In der Kiste lagen Bündel mit verschnürten Geldscheinen. Tausendfünfhundert Dollar zählte Jordan und warf das letzte Bündel zurück in die Kiste. »Hört zu«, sagte er und zündete sich eine Zigarette an. »Das Geld rührt keiner an. Wir benutzen es, um noch mehr rauszuholen, denn ich bin davon überzeugt, dass in dieser Stadt mehr steckt, als es den Anschein hat.« Er zog ein Schriftstück aus der Jacke. An den Rändern klebte Blut. »Das hier ist eine Besitzurkunde für die Archer-Mine. Eine Goldmine. Gold, Männer. Und wir werden es uns holen. Setzt euch und hört zu. Ich habe schon einen Plan.«
Es war ein erschöpfter Schlaf, der keine Träume gestattete, aber schon früh am nächsten Morgen rüde unterbrochen wurde. Draußen war es noch dunkel. »Was ist denn los?«, fragte Kerrish. Er blinzelte, geblendet vom Licht der Laterne, das ihm in die Augen stach. »Wie spät ist es?«
»Keine Ahnung. Steh auf. Ich will los.« Das war Ash, zumindest glaubte Kerrishs träger Geist, ihn erkannt zu haben.
»Was denn? Jetzt schon?« Er richtete sich mühsam auf, um sich dann gleich wieder auf den Rücken fallen zu lassen und die Arme von sich zu strecken.
»Ich bin noch so verflucht müde.«
»Nun mach schon. Hoch mit dir, Jüngelchen.« Die Laterne wurde angehoben. Im Weggehen tippte er gegen Kerrishs Füße. »Da steht Kaffee. Bedien dich und dann los. Ich hab schon angespannt.«
Eine halbe Stunde später hatten sie die junge Frau in den Planwagen geladen und sie mit Decken und Fellen warm eingepackt. Sie war immer noch nicht bei Bewusstsein, doch sie murmelte leise Worte, stöhnte und wimmerte.
»Ist das normal?«, fragte Ash.
Kerrish zog unzufrieden die Mundwinkel nach unten. »Die Schusswunde bereitet mir weniger Kummer, aber sie hat sich schwer den Kopf angeschlagen. Hoffen wir, dass es nur eine Gehirnerschütterung ist und nichts Schlimmeres.«
»Das wird schon wieder. Der Herr wacht über die Unschuldigen, oder nicht?« Ash winkte ab. »Ist auch egal. Lass uns los.«
Ash zurrte die letzten Leinen um zehn kleine Whiskyfässer, bevor er auf den Kutschbock kletterte.
Zwei zottelige, gedrungene Pferde waren eingespannt. Sie stampften mit den Hufen, schüttelten die Mähnen und wirbelten mit den langen Schweifen.
Ein schwarzer Mischlingshund sprang zwischen die beiden Männer auf den Kutschbock. »Wo kommst du denn her? Warste wieder im Stall? Rumtreiber. Darf ich vorstellen, dass ist Alamo. Ach … bevor ich’s vergesse. Ich hab was für dich, Jüngelchen.« Er gab ihm den Revolver wieder. »Ich glaub, du bist ganz in Ordnung. Wär zu schade so ʹne schöne Knarre im Schnee verrosten zu lassen.«
»Danke.«
»Dann woll’n wir mal!« Die Peitsche knallte durch die eiskalte Luft, und die Pferde setzten sich in Bewegung. Der Planwagen quietschte und rumpelte, die Räder ächzten.
»Wie lange waren Sie nicht mehr in der Stadt?«, fragte Kerrish.
»Ich zähl die Tage nicht. ʹne Woche, zwei. Keine Ahnung.« Ash deutete mit dem Daumen nach hinten. »Was willst denn jetzt mit der Kleinen machen?«
So weit hatte Kerrish noch gar nicht gedacht. Er hatte ohnehin an überhaupt nichts mehr gedacht. Aber jetzt, wo er sich wieder der Zivilisation näherte, musste er sich etwas einfallen lassen. Vielleicht würde er die Frau beim Doktor abgeben, sich von dem gefundenen Geld ein Pferd und Proviant kaufen und sich davonmachen, ehe ihn seine Verfolger aufspüren konnten.
»Gibt es einen Arzt in der Stadt?«, fragte Kerrish.
»Ja, den gibtʹs. Hast wohl schon die Schnauze voll von ihr?«
»Nein, aber ich habe meine eigenen Sorgen. Da kann ich keine neuen gebrauchen.«
Ash grinste und schnalzte mit der Zunge. »Aha! Willst doch nicht einfach nur so in den Westen. Rennst wohl vor ʹner Frau weg, was?«
»So ähnlich.«
»Weißt du, was mein alter Herr immer gesagt hat?«
»Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich verraten.«
»Jetzt werd mal nicht frech, Jüngelchen. Also, mein Alter hat immer gesagt: ›Du kannst vor nichts weglaufen, eine Kugel ist immer schneller als du. Also ist es besser stehen zu bleiben und sich der Sache zu stellen, das schont wenigstens die Sohlen deiner Stiefel.‹«
Kerrish musste lachen. »Ihr Vater war ein weiser Mann.«
»Mein Vater war ’n beschissener Schläger und Saufbold. Der war immer so besoffen, das er gar nicht weglaufen konnte.«
»Was ist aus ihm geworden?«
»ʹne Kugel hat ihn erwischt. Hat sein Maul einmal zu oft aufgerissen, da hat ihn jemand über den Haufen geschossen. Hat mich nicht überrascht.«
»Das tut mir leid.«
»Muss es nicht. Ich konnte den Dreckssack ohnehin nicht leiden.« Ash sah seinen Reisebegleiter an, als wäre er gerade aus dem Nichts aufgetaucht. »Warum erzähl ich dir das eigentlich alles, verflucht noch mal? Ich kenn dich doch fasst gar nicht.«
»Sie haben doch von Ihrem Vater angefangen.«
»Ah ja. Richtig.« Ashs Atem roch nach Whisky. »So, aber jetzt mal ehrlich. Ich hab dir was von mir erzählt und jetzt erzähl mir was von dir, aber nicht wieder die Geschichte, dass du dir mal den Westen ansehen willst. Die glaub ich dir nämlich nicht.«
Kerrish sah ihn finster an. Ash bemerkte es. »Du rennst doch vor irgendwem davon, oder?«
Seit seiner Flucht aus Santa Fe hatte Kerrish mit niemandem über das Ereignis gesprochen, das sein bisheriges so friedliches Leben zerstört hatte. Bis jetzt hatte ihn auch noch niemand danach gefragt. Verflucht, und auch jetzt wollte er nicht darüber reden. »Da gibt es nichts.«
»Willst es mir wohl nicht sagen, hmm?«
Kerrish presste die Lippen zusammen.
»Hast jemanden umgelegt?«
Ash würde keine Ruhe geben, bis er eine Erklärung bekam, die ihn zufriedenstellen würde. »Also gut. Ich habe Ärger. Ein paar Kerle sind hinter mir her. Ich habe keine Ahnung, was sie mit mir anstellen werden, sollten sie mich in die Finger kriegen. Und ehrlich gesagt, will ich es auch nicht herausfinden.«
»Was hast du denn ausgefressen?«
»Nichts. Nur beim Pokern gewonnen.«
»Das musst du mir erklären.«
Kerrish zuckte die Schultern. »Da gibt’s nicht viel zu erklären. Einer meiner Gegner war ein schlechter Verlierer. Ich habe dreitausend Dollar von ihm gewonnen. Er meint, ich hätte betrogen. Das stimmt nicht, und er konnte es auch nicht beweisen.«
»Was war denn das für ’n Kerl?«
»Schon mal den Namen James Cahill gehört? Senator Cahill?«
Ash schüttelte den Kopf.
»Der ist keiner, der gerne verliert, egal wobei … und dreitausend Dollar sind eine Menge Geld. Er hat mir seine Leute auf den Hals gehetzt, und ich habe gemacht, dass ich wegkam. Ich hatte eine Praxis in Santa Fe, Patienten, die mich mochten … das war mein Leben.«
»Wieso hast du’s ihm nicht zurückgegeben?«
»Das Geld?«
»Ja.«
»Das interessierte ihn doch gar nicht mehr.«
»Und wo isses jetzt?« Ashs Augen bekamen einen gierigen Glanz.
»Habe ich zurücklassen müssen. Bin überhaupt froh, mit heiler Haut aus der Stadt gekommen zu sein.«
»Dieser Cahill is ja ’n ganz schöner Scheißkerl, was? Und? Was glaubst du? Hast du seine Leute abgehängt?«
Kerrish sah über die Schulter, als müsste er sich vergewissern, dass sie nicht gleich da wären, um sich auf ihn zu stürzen. »Sieht so aus«, antwortete er vorsichtig, »aber sicher bin ich mir nicht.« Er ließ die Schultern sinken. »Ich habe immer Pech, wenn es gerade gut läuft.«
Ash ließ die Peitsche knallen und trieb die Pferde in Richtung Fluss.
Der Wagen rumpelte durch das Flussbett, Wasser spritzte bis zum Kutschbock hoch. »Und? Was hast du jetzt vor?«
»Keine Ahnung. Weiter weglaufen, vermutlich. Ich werde bestimmt nicht stehen bleiben und mich von denen erschießen lassen. Ich hänge nämlich an meinem Leben.«
»Wär kein Leben für mich«, bemerkte Ash, schien aber mit der Erklärung zufrieden zu sein, denn er zog eine Flasche unter dem Sitz hervor, entkorkte sie mit den Zähnen und reichte sie weiter. »Daff löft zwar nich deine Probleme, aba es hilft fie für eine Feit fu vergeffen«, brabbelte er mit dem Korken im Mund und hielt Kerrish die Flasche hin.
Kerrish nahm sie, warf einen Blick auf die goldgelbe Flüssigkeit und setzte die Flasche an. Er hatte nie viel getrunken, nun zuckte er mit den Schultern. Vielleicht wurde es wirklich Zeit, damit anzufangen. Er trank, bis sein Mundraum mit Whisky gefüllt war, der sofort ein höllisches Feuer entfachte.
Alles in ihm schien zu kochen.
»Du musst ihn schon runterschlucken, Jüngelchen«, sagte Ash grinsend. »Sonst wirkt er nicht.«
Kerrish spuckte aus. Dann japste er nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. »Das brennt ja furchtbar.«
Ash schien das als Kompliment aufzufassen, und er warf sich in die Brust. »Jaha. Mutter hat keinen Schwächling großgezogen. Das Zeug hab ich aus Tannenzapfen gebraut. Gut, was?« Schelmisch lachend lupfte er die Augenbrauen. »Gib mal her. Ich zeig dir, wie man das trinkt.«
Schon hatte er die Flasche wieder an sich genommen, setzte sie an und trank fünf tiefe Schlucke, ohne die Flasche auch nur kurz abzusetzen. Mit einem lang gezogenen »Ahhhhh!« wischte er sich über den Mund und gab sie zurück. »Nix im Leben kann so beschissen sein, dass ’n anständiger Whisky es nicht lösen könnte, oder?«
Kerrish blieb skeptisch, nahm aber dann einen vorsichtigen Schluck.
Ash legte ihm kameradschaftlich die Hand auf die Schulter und drückte sie. »Nimms nich so schwer. Du hast Pech gehabt, Jüngelchen. Na und? Was soll’s. Das haben wir doch alle schon mal gehabt. Wichtig ist, was du dagegen tun willst.«
»Was meinen Sie?«
»Na, willst du dein Leben lang Angst haben und weglaufen, oder willst du was gegen diese Kerle unternehmen?«
»Was soll ich denn tun?«
»Na, die wollen dich doch wohl umlegen, oder sonst was Unschönes mit dir anstellen, oder nicht? Was zum Teufel sollte dich daran hindern, dir ’n Gewehr zu kaufen und ihnen zuvorzukommen.«
Kerrish erschrak, dann sagte er bitter: »Ich hasse Waffen. Sie bringen nur Unheil.«
»Trägst aber wohl eine mit dir rum. Kannst du denn überhaupt damit umgehen?«
»Na ja.«
»Dann lernʹs. Mann, Jüngelchen, sei doch nicht blöd. Willst du immer mit einem offenen Auge schlafen müssen und ständig über die Schulter gucken?«
»Aber die sind zu siebt. Das sind Killer.«
Ash winkte ab, als wäre diese Tatsache nur eine lästige Anekdote. »Wenn du an deinem Leben hängst, wird dir was einfallen. Aber, wie gesagt, weglaufen nützt nix. Irgendwann finden sie dich und dann wär’s gut, wenn du bereit bist. Wie ja schon mein Vater sagte …«
»Ja, ich weiß«, fiel ihm Kerrish ins Wort. »›Du kannst weglaufen, aber eine Kugel ist immer schneller.‹« Er machte ein mürrisches Gesicht. »Sie haben gut reden.«
Ash grinste nur betrunken.
Der Planwagen folgte nun einem breiten Weg. Auf den Hügeln, die sich links und rechts davon erhoben, wuchsen Tannen, Pinien und Zedern. Ein schwarzes Eichhörnchen raschelte im Geäst auf der Suche nach Futter. In den Hügeln, denen sich die schroffen Berge anschlossen, konnte Kerrish zerfallene Häuser ausmachen, deren Dächer eingestürzt und deren hölzerne Wände verfault waren. Darüber, am Fuß der Berge, lagen unzählige dunkle Eingänge, die durch schmale Pfade oder gar breitere Wege miteinander verbunden waren.
»Was du da siehst, sind die Goldminen, von denen ich dir erzählt hab«, erklärte Ash. »Aber das ist längst alles weg. Vor fünf Jahren hat die letzte Mine dichtgemacht.«
Links der Straße kam die Kirche von Three Oaks in Sicht, oder das, was davon noch übrig war. Ihre Rückseite und ein Großteil des Friedhofs lagen unter einer gewaltigen Gerölllawine verschüttet. Der Kirchturm stand noch, ebenso der vordere Teil des Gebäudes. Kerrish fühlte sich an ein Schiff erinnert, das in zwei Hälften zerbrochen war.
Die Morgensonne ließ den Schnee glitzern und tauchte alles in ein überraschend freundliches Licht.