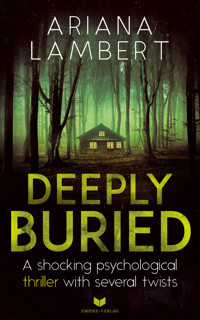7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Empire-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Grab. Eine Ermittlerin. Ein zwölf Jahre alter Fall.
Auf der irischen Halbinsel Beara legt der Regen die Leiche eines Mannes frei. Was seine Bergung offenbart, ist an Grausamkeit nicht zu überbieten: Zahlreiche Säuglinge wurden dort vor Jahren verscharrt. Die irische Polizei steht vor einem Rätsel.
Die Familie des Toten hüllt sich in geheimnisvolles Schweigen. Nur gegenüber der Berliner Anwältin Anna Schwarz wollen sie aussagen. Doch Anna hat sich geschworen, nie wieder einen Fuß auf die grüne Insel zu setzen.
Kann Anna bei der Lösung des Rätsels um den Toten helfen?
Und kann sie sich den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit stellen, die die grüne Insel für sie bereithält?
Bei "Tief unterm Grab" handelt es sich um eine Neuauflage von "Die Kinder von Beara".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tief unterm Grab
Ariana Lambert
Über die Autorin:
Ariana Lambert hängte ihre Robe nach zwölf Jahren als Strafverteidigerin an den Nagel. Dennoch bleibt sie dem Verbrechen treu und schreibt heute Krimis und Thriller. Sie lebt in ihrer Lieblingsstadt Dublin und im Sommer in ihrer Heimat im Spreewald.
Über das Buch:
Uralte Steinkreise verbergen eine uralte Wahrheit
Auf der irischen Halbinsel Beara, innerhalb uralter keltischer Steinkreise, legt der Regen die Leiche eines Mannes frei. Was seine Bergung offenbart, ist an Grausamkeit nicht zu überbieten:
Zahlreiche Säuglinge wurden dort vor Jahren verscharrt.
Die irische Polizei steht vor einem Rätsel. Gibt es eine Verbindung zu den Kindern von Tuam, dem schrecklichsten Kapitel der irischen Kriminalgeschichte?
Die Familie des Toten hüllt sich in geheimnisvolles Schweigen. Nur gegenüber der Berliner Anwältin Anna Schwarz wollen sie aussagen. Doch Anna hat sich geschworen, nie wieder einen Fuß auf die grüne Insel zu setzen.
Kann Anna bei der Lösung des Rätsels um den Toten helfen?
Und kann sie sich den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit stellen, die die grüne Insel für sie bereithält?
Tief unterm Grab
Ariana Lambert
Thriller
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Februar 2023 Empire-Verlag
Empire-Verlag OG, Lofer 416, 5090 Lofer
Lektorat: Marion Mergen – www.korrekt-getippt.de
Korrektorat: Jasmin Schulte – https://zeilenstark.de/
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –
nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Cover: Chris Gilcher
http://buchcoverdesign.de/
Illustrationen: Adobe Stock ID 443480882, Adobe Stock ID 549102946, Adobe Stock ID 140465072 und freepik.com
Dieses Buch widme ich allen Kindern dieser Welt, denen jede Chance auf Leben genommen wurde.
1
Gegen den seit Tagen andauernden Regen hatten sie eine Plane über das Areal gespannt. Dennoch mussten sie sich beeilen, die sterblichen Überreste zu sichern. In stetig ansteigenden Bächlein breitete sich das ohne Unterlass vom Himmel herabfallende Wasser um die Gräber aus.
Mit hinter dem Rücken verschränkten Armen betrachtete Jon Johnson das Gewusel der zahlreichen Helfer, die wie Ameisen in ihrem Staat geschäftig und emsig umhereilten und keinerlei Notiz von ihm nahmen.
Er konnte sie nicht auseinanderhalten; ein jeder von ihnen steckte in einem malertypischen weißen Plastikanzug, um keine eigenen Spuren am Tatort zu hinterlassen.
In dieser Position spannten die Verschlüsse der Regenjacke über seinem beachtlichen Bauchumfang und einige der Knöpfe drohten, der Spannung nachgeben zu wollen. Er beachtete es nicht. Die Jacke hatte ohnehin schon lange den Kampf gegen die Wassermassen aufgegeben. Er spürte, wie kleine Rinnsale seinen Rücken hinabliefen. In regelmäßigen Abständen wischte er über seine Brillengläser, um das Geschehen vor sich nicht nur verschwommen wahrzunehmen. Überraschenderweise steckten seine Füße nach wie vor in trockenen Schuhen. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis der Regen sich auch dorthin vorarbeiten würde.
Er musste hier weg.
Er wollte weg.
Zurück in sein Büro. Ins Trockene.
Zurück nach Dublin.
Wieso hatten sie den schrecklichen Fund auch gerade jetzt machen müssen? Er wollte nur an der Verhandlung am Circuit Court in Tralee teilnehmen. Danach sollte es gleich wieder nach Dublin gehen.
Doch durchkreuzte der Leichenfund gestern Abend seine Pläne, denn man war froh, einen Staatsanwalt vor Ort zu haben, der die Bergung überwachen und die ersten Ermittlungen mit nach Dublin nehmen konnte.
Anfangs war es nur ein Toter gewesen. Ein gewöhnlicher Leichenfund. In den Wäldern auf der Halbinsel Beara, ganz weit im Westen und unendlich weit entfernt von Dublin. Nachlässig vergraben und von einem Spaziergänger entdeckt. Ein Klassiker.
Einzig die in der Nähe stehenden Monolithen verliehen dem Geschehen etwas Unheimliches. Alte, jahrtausendealte Felssteine der Kelten. Ordentlich in einem Kreis aufgestellt, von Moos bedeckt und teilweise eingewachsen. Doch gab es solche und ähnliche Steinkreise hier viele.
Die Frage war, ob die Wahl des Grabes zufällig war oder eine tiefere Bedeutung hatte.
Dafür müssten sie erst herausfinden, wer der Tote war.
Männlich, zwischen fünfzig und sechzig Jahre alt, Todesursache nicht natürlich. Es fanden sich zahlreiche Hämatome an den Hand- und Fußgelenken, die den Rückschluss zuließen, dass er gefesselt worden war und sich nicht wenig gewehrt hatte. Am auffälligsten jedoch waren die Strangulationsmale am Hals, die ganz sicher zum Tod geführt hatten.
Nicht schön, aber nichts, was Johnson den Schlaf geraubt hätte.
Dachte er.
Es kam leider anders.
Kaum hatten sie gestern Abend die Leiche freigelegt und geborgen, fand einer der Gardaì, der nur noch zum Aufräumen abgestellt war, weitere menschliche Überreste. Überreste, die ganz sicher nicht zu dem Toten gehörten. Dieser lag nach Aussage der Rechtsmedizinerin noch nicht lange dort, allenfalls ein paar Tage. Was sie dort jedoch fanden, war älter. Viel älter. Sie hatten Knochen gefunden.
Menschliche Knochen.
Kleine Knochen.
Knochen von Kindern.
Von Babys.
Viele Knochen.
Viele Babys.
Da standen sie nun bis heute. Legten ein Skelett nach dem anderen frei. Über ihnen das riesige weiße Zelt.
Johnson hatte einmal ein solches Zelt in seinem Garten aufgebaut. Zur Kommunionfeier seiner ältesten Tochter, um die zahlreichen Gäste unterbringen zu können. Lange war das her. Seine Töchter waren schon seit Jahren aus dem Haus, lebten ihr eigenes Leben, feierten ihre eigenen Feste. Das Häuschen von damals war verkauft, er wollte sich heute besseres leisten, konnte sich besseres leisten. Er wohnte nun in einem schmucken, für Dublin typischen, viktorianischen Reihenhaus. Mitten in der City, in der Leeson Street. Allein der Kauf hatte ihn einige Jahresgehälter gekostet, die aufwendigen Renovierungsarbeiten ein weiteres. Doch es hatte sich gelohnt. Er liebte sein großes Wohnzimmer mit dem dunkelgrünen Chesterfield-Sofa, die hohen Bücherregale aus dunkelbraunem Rosenholz und den an einen Wintergarten erinnernden Anbau, in dem sich die geräumige Küche befand. Nach langen Arbeitstagen genoss er den Garten, der mit den akkurat angelegten Beeten und in Form geschnittenen Buxbäumchen auch zu einem edlen Hotel gehören könnte. Selbst die auffällige hellrote Eingangstür mit dem übergroßen Löwenkopf als Türklopfer wurde nicht selten zum Motiv der fleißig knipsenden Touristen in der Dubliner City. Er konnte stolz sein. Sein Haus war ein echter Hingucker.
Er hatte es zu was gebracht, wenn man so wollte. Dank seiner Ambitionen und seines Fleißes war er die Karriereleiter aufgestiegen. Es fehlte nur noch ein Sprung bis zum Chief Prosecution Solicitor bei der Staatsanwaltschaft Dublin. Und den würde er auch noch schaffen.
Leidige Angelegenheiten, wie die Überwachung eines brisanten Leichenfundes, gehörten manchmal einfach dazu. Es war immer Teil seiner Karrieretaktik gewesen, sich nicht zu beschweren, sondern einfach loszulegen. Noch nie hatte er sich davor gescheut, sich die Hände schmutzig zu machen. Gleiches erwartete er auch von seinen Mitarbeitern und Mitmenschen. Nicht jeder Begleiter in seinem Leben hatte damit Schritt halten können. Seine Frau war schon lange fort, und seine Sekretärin bibberte förmlich vor Angst, sobald er ihr Büro betrat.
Áine Nic Aodha, die Rechtsmedizinerin, kam auf ihn zu und unterbrach seine Gedanken. Sie steckte ebenfalls in einem der Maleranzüge, der nur ihr Gesicht freigab. Dieses war trotz der Plane wie seines nass vom nicht enden wollenden Regen.
»Ich denke, wir haben alle. Es sieht nach fünf Leichen aus. Fünf Kinderleichen. Klein. Sehr klein. Säuglinge. Dem Stand der Verwesung nach zu urteilen, liegen sie seit etwa zehn Jahren hier. Vielleicht auch länger. Näheres wird die Untersuchung zeigen.«
»Kinder? Kinderleichen? Sie glauben doch nicht etwa …?« Sämtliche Farbe wich aus Johnsons Gesicht.
»Was? Was soll ich glauben?«
»Na ja, Sie wissen schon …« Ein unbeschreibliches Grauen beschlich ihn.
»Ach was. Wir sind nicht in Tuam, Johnson.« Mit einer wedelnden Geste und rollenden Augen drehte sie sich um, ging zu einem Campingtisch, der am Rande des Zeltes stand, und fing an, allerlei metallene Gegenstände in einen Koffer zu räumen. Mit einem schnipsenden Geräusch zog sie die Handschuhe aus und warf auch die achtlos hinein. Johnson ging ihr nach.
»Nein, das sind wir nicht. Doch Sie haben sicher mitbekommen, dass es nicht bei Tuam geblieben ist. Wir suchen weiter.«
Jetzt hielt die Frau in ihrer Geschäftigkeit inne und schaute Johnson an. »Wir?«
»Ja. Wir. Die Staatsanwaltschaft ist in der staatlichen Kommission ebenfalls vertreten.«
»Sie auch?«
»Nein, ich nicht persönlich. Aber einige meiner Kollegen.«
»Aha.« Es klang überheblich und abschätzend. Sie wandte sich ab und fuhr mit dem Aufräumen fort.
Das störte ihn im Grunde nicht. Johnson war es gewohnt, nicht die beliebteste Person im Raum zu sein. Im Gegenteil. Für gewöhnlich war es an ihm, andere überheblich und bevormundend zu behandeln. Es gefiel ihm, diese Rolle zu übernehmen. Er konnte es sich erlauben, andere von oben herab zu behandeln. Und er wollte es auch. Nicht oft wurde es ihm mit gleicher Münze zurückgezahlt. Es gab wenig Menschen, die ihm intellektuell gewachsen waren.
Diese Frau jedoch ließ sich von ihm nicht beeindrucken. Er musste sich noch darüber klar werden, ob es ihm gefiel oder ob es ihm zuwider war.
»Aha? Was meinen Sie?« War er etwa unsicher? Er? Unsicher? Vor einer Frau?
Jetzt schaute sie ihn wieder an. »Nichts. War nur so dahergesagt.«
»Seit mehreren Jahren werden weitere Einrichtungen untersucht, Ausgrabungen vorgenommen, und sind wir mal ehrlich: Es wird nicht bei den bisherigen Funden bleiben. Es wird mehr geben.« Johnson hatte das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen.
»Das mag sein. Aber jetzt malen wir nicht gleich den Teufel an die Wand, Johnson.«
Die Rechtsmedizinerin wusste, wovon er sprach: Insgesamt wurden derzeit vierzehn Mutter-Kind-Heime in ganz Irland, auch in Nordirland, auf illegale Massengräber untersucht. Mehr als achthundert Skelette von Säuglingen und Kindern hatte man bislang gefunden, nachlässig verscharrt oder in Schuhkartons in stillgelegten Kläranlagen von verschiedenen Heimen und Einrichtungen abgelegt. Das Nonnenkloster in Tuam hatte vor sechs Jahren traurige Berühmtheit erlangt, als man dort in einem ausgedienten Abwassertank fast achthundert Kinderleichen entdeckt hatte.
Es hatte sich herausgestellt, dass bereits vor vierzig Jahren zwei Jungen beim Spielen Knochen gefunden und den Fund gemeldet hatten. Die Verfolgung dessen war jedoch im Sande verlaufen, da vonseiten des Ordens keinerlei Unterstützung gekommen war, und die Schwestern, die Auskunft hätten geben können, längst verstorben waren. Man hatte sich damals mit einer Segnung der Knochen durch einen Priester begnügt und die Untersuchungen eingestellt.
Erst eine Historikerin hatte zu Beginn der Zweitausenderjahre herausgefunden, dass über viele Jahrzehnte lang fast achthundert Eintragungen verstorbener Kinder im Sterberegister, jedoch nur eine einzige registrierte Bestattung vorgenommen worden waren. Die Untersuchungen waren wieder aufgenommen worden, und die ersten katastrophalen Funde wurden gemacht.
Eine staatliche Untersuchungskommission ermittelte nun zweifelhafte Vorgänge in diversen Heimen und den sogenannten Magdalen-Laundries. Heime und Einrichtungen, in denen vor Jahrzehnten im katholischen Irland unverheiratete, schwangere Frauen oder Prostituierte zur Besserung untergebracht waren. Oft waren die Zustände von mangelnder Hygiene, Ausbeutung der Frauen und einer hohen Sterblichkeitsrate der Babys und kleinen Kinder geprägt, und viele der Verstorbenen hatte man einfach verscharrt oder in der Kanalisation entsorgt.
Bis heute verlief die Aufklärung schleppend und Befragungen gestalteten sich schwierig, weil es um Vorfälle seit den Zwanzigerjahren ging, Zeitzeugen nur noch wenige vorhanden waren und ihnen viel Ignoranz entgegenschlug. Erst kürzlich erzählte ein Kollege Johnson von einer Nonne, die die Befragung mit dem Kommentar »Wenn da Knochen liegen, dann lasst sie doch da liegen« ablehnte. Im Übrigen, überlegte er, bewegte sich die Reaktion der Rechtsmedizinerin sehr nah an eben dieser Ignoranz.
Wie dem auch sei, galt sein einziger Gedanke den noch auf ihre Entdeckung wartenden Kinderleichen. Er hoffte inständig, dass er nicht auf eines dieser Gräber gestoßen sein könnte.
»Es kann schon sein, dass weitere Funde gemacht werden. Aber schauen Sie, wo wir hier sind.« Nic Aodha machte eine Geste mit beiden Händen und schloss die Umgebung mit ein. »Wir sind mitten in der Natur. Außer ein paar Cottages, alten Ruinen und einigen Ferienhäusern finden Sie hier im weiteren Umkreis nichts. Kein Mutter-Kind-Heim, kein Kloster, nichts. Also, ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass wir hier auf ein Tuam gestoßen sind.«
Hoffentlich, dachte Johnson. Er kramte seine gewohnte Überheblichkeit heraus, straffte die Schultern und gab klare Anweisungen. »Gut. Dennoch haben wir hier fünf Kinderleichen. Skelettierte Leichen. Mit dem Körper eines älteren Mannes darüber. So wie es ausschaut, sollten demjenigen, der ihn dort begraben oder verscharrt hat, die Schätze darunter bekannt gewesen sein. Er kann sie nicht übersehen haben. Das ist kein Zufall. Dann sehen Sie mal zu, dass wir so schnell wie möglich an die Ergebnisse kommen und aufklären können, womit wir es hier zu tun haben.«
2
Das Haus war viel zu groß für sie allein. Dennoch wollte sie sich nicht davon trennen.
Als Anna und Chris sich vor mehr als zehn Jahren für die stattliche Villa im Berliner Grunewald entschieden hatten, waren sie noch voller Zukunftspläne gewesen, hatten von Kindern geträumt, von Gartenpartys und einem Pool im Garten. Bis heute fielen der Stress und die Abgründe ihres Alltags von ihr ab, sobald sie in die von alten Eichen und Pappeln gesäumte Straße einbog, an deren Ende sie das kompakt wirkende Gebäude aus den Dreißigerjahren erwartete. Spätestens auf den vier Stufen, die auf ihre Veranda führten, die von runden Säulen getragen wurde, hüllte sie die Ruhe und Geborgenheit ihres Zuhauses ein. Lediglich der Blick auf die beiden großen Terrakotta-Kübel mit den Hortensien weckten ein schlechtes Gewissen in ihr. Denn sie kümmerte sich zu selten um den Garten und die Blumen. Im Herbst wehte erst der Wind das herabfallende Laub von den Stufen, wenn nicht ihr Vater rechtzeitig kam und sich ihres Gartens annahm.
Vor dem schrecklichen Unfall hatte der Garten zu ihren Lieblingshobbys gehört. Sie hatte frische Blumen gepflanzt, die Terrasse dekoriert, den Rasen gemäht. Doch für derlei Dinge fehlte ihr heute die Motivation. Es gab keinen Pool, keine Kinder und keinen Chris.
Nur Anna.
Anna und das große Haus mit den drei Schlafzimmern, von denen sie das eine, das als Kinderzimmer vorgesehen war, bis heute nicht ohne Bauchschmerzen betreten konnte.
Ein Busfahrer und der Moment, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, hatten alles in ihrem Leben zerstört, und mit einem Mal war nichts mehr gewesen wie vorher. Der Busfahrer hatte sie übersehen. Ihr kleiner Mini war auf die Gegenfahrbahn gedrängt worden. Der entgegenkommende SUV hatte nicht mehr ausweichen können; ebenso wie Chris keine Chance hatte, die schweren Kopfverletzungen zu überleben. Sie hatte ihn sterben sehen. Sie hatte ihr ungeborenes Baby verloren. Sie hatte alles verloren.
Keine Zukunftspläne mehr. Keine Träume.
Bis heute.
Heute Morgen hatte die Sonne in ihr Schlafzimmer geschienen. Sie hatte gut geschlafen.
Sie fühlte sich gut.
Sie hatte von Benjamin Black geträumt.
Benjamin.
Der gut aussehende Garda aus Dublin, den sie im vergangenen Jahr auf der Suche nach dem vermissten Eóin unterstützt hatte. Der Mann, dem es erstmalig seit Chris’ Tod gelungen war, einen Weg in ihr Herz und in ihr Bett zu finden. Der Mann, der sie veranlasst hatte, ihre Lebenslethargie zu überdenken und wieder so etwas wie Pläne und Träume zu haben. Der Mann, der sie schließlich zugunsten einer anderen, völlig verrückten Frau verraten und fast umgebracht und sie dann gerettet hatte.
Über ein Jahr war es her. Und trotzdem dachte sie manchmal an ihn. Und träumte von ihm.
Heute Morgen jedenfalls war etwas anders. Sie spürte eine Motivation, wie schon lange nicht mehr. Sie wollte etwas unternehmen. Sie musste etwas unternehmen.
Immer noch im Schlafanzug und barfuß ging Anna hinunter und griff nach ihrem Telefon. Es lag auf der Arbeitsfläche, die die Küche von dem angrenzenden Esszimmer optisch trennte. Sie kletterte etwas umständlich auf einen der Barhocker und wählte die Nummer ihrer Kanzlei.
»Guten Morgen, Helen«, begrüßte sie ihre Sekretärin, die nach nur einmaligem Klingeln am anderen Ende ihren Begrüßungssatz aufgesagt hatte.
»Guten Morgen, Frau Schwarz.«
»Helen, ich arbeite heute im Homeoffice. Ich habe keine Termine, wie ich das sehe. Ich werde die Akte Langner durcharbeiten und bin telefonisch den ganzen Tag erreichbar.«
»In Ordnung. Ich weiß Bescheid. Es ist ohnehin ruhig gerade. Man spürt die Ferienzeit deutlich.« Sollte Helen überrascht sein, denn Anna arbeitete gewöhnlich nie von zu Hause, ließ sie es sich zumindest nicht anmerken. Im Übrigen hatte sie recht. Es waren Sommerferien in Berlin und Brandenburg. Gerichtstermine fanden nur sporadisch statt.
Der Wetterbericht prophezeite einen weiteren Tag, an dem die Temperaturen an der Dreißig-Grad-Grenze kratzen würden. Ein perfekter Tag, um sich im Haus um einige Dinge zu kümmern.
»Ich danke Ihnen, Helen. Wir sprechen uns bestimmt noch. Bis später.« Ohne eine weitere Erwiderung abzuwarten, legte Anna auf und ging zu ihrer Kaffeemaschine. Unter lautem Krächzen und Rattern bereitete sie einen Cappuccino zu, den sie auf der Terrasse zu trinken gedachte.
Durch die bodentiefen Fenster fiel das besondere Licht eines Morgens, der einen herrlichen Sommertag versprach. Sie öffnete die Türen und trat auf die Terrasse. Augenblicklich schlug ihr ein Duft entgegen, der mit einer Mischung aus warmen Sonnenstrahlen auf nassem Gras und feuchter Kühle der gerade vertriebenen Nacht Schwung für den Tag zu geben vermochte.
Sie setzte sich auf einen der Gartenstühle, die stets in Erwartung einiger Gäste ordentlich um den großen Tisch standen, doch fast nie von solchen benutzt wurden. Anna lehnte sich ein wenig zurück, schlug die Beine übereinander und genoss den Blick in den Garten.
Die großzügige Grünfläche war umrahmt von dichten Sträuchern und Bäumen und machte das Areal von außen nicht einsehbar. Zu ihrer Rechten wilderte eine dichte Haselnusshecke, und sie dachte bei ihrem Anblick nicht zum ersten Mal an das Buch aus ihren Kindertagen Das alte Haus. Der alte Nussknacker lebte dort in einer Nusshecke, und die beiden Kinder erlebten mit ihm und den drei Tieren aus dem Haus ihrer Großmutter jede Menge Abenteuer. In der Geschichte gab es auch einen alten Besen, der den Hof und den Garten immer schön sauber hielt.
Einen solchen könnte sie auch gebrauchen.
Denn der Anblick könnte schöner sein, wenn sich jemand ausgiebig um den Garten kümmern würde. Wenn ihr Vater nicht zwei oder drei Mal im Jahr käme, um den Rasen zu mähen oder das Laub zusammenzuharken, würde alles verwildern. Jedenfalls hielt er ihr das immer vor. Insgeheim freute sie sich über den Besuch ihres Vaters, den sie sonst nur selten sah. Im Augenblick dankte sie ihm für seinen unermüdlichen Einsatz, die Büsche und Sträucher daran zu hindern, alles zu überwuchern und die Verwilderung etwas aufzuhalten.
Anna nahm einen Schluck aus der Tasse. Der Kaffee war heiß und schmeckte bitter. So wie sie es mochte. Dann zündete sie sich eine Zigarette an. Sie liebte die allererste Zigarette am Morgen, die ihr einen gewissen Schwindel verursachte. Chris hatte es gehasst und unermüdlich versucht, ihr das Rauchen abzugewöhnen. Doch Chris war nicht mehr da, und Anna rauchte gern.
Nach der Zigarette und dem Kaffee fühlte sie sich überzeugt von ihren Plänen und voller Motivation, es anzupacken. Immer noch barfuß ging sie nach oben. Ihre nackten Füße machten patschende Geräusche auf dem glänzend lackierten Parkettfußboden. Einen kurzen Moment hielt sie inne, atmete tief durch und drückte die Türklinke nach unten.
Zunächst konnte sie nicht viel sehen. Die hölzernen Fensterläden waren geschlossen und das dämmrige Licht verhinderte ein umfassendes Erkennen. Nach einem kurzen Augenblick gewöhnten sich Annas Augen an das Halbdunkel, und sie tat einen Schritt über die Türschwelle. Es fühlte sich an wie das erstmalige Betreten eines fremden Planeten. Sie durchquerte den Raum mit wenigen großen Schritten und vermied es, an die linke Wand zu schauen.
Sie war nicht sicher, ob sie den Anblick des Kinderbettes, das dort stand, ertragen würde. Also hielt sie den Blick starr geradeaus und öffnete die Fenster. Das klare Sonnenlicht des strahlenden Morgens sollte die Geister und Schatten des Raumes vertreiben können.
Unter knarrenden Geräuschen ließen sich die Fensterläden nach außen aufschieben, und Licht fiel in das Zimmer. Anna ließ das Fenster offen. Warme, aber noch frische Luft strömte herein und vertrieb den muffigen und abgestandenen Geruch.
Motiviert drehte sie sich und schaute sich in dem Zimmer um, als besichtigte sie es zum ersten Mal. Im Grunde war es ein sehr schönes Zimmer: hohe Decken, die ein schlichter, aber reizender Stuck zierte, der gleiche hellbraune Holzfußboden wie im ganzen Haus, jahrzehntealt, mehrfach abgeschliffen und anschließend lackiert, bis er glänzte. Neben der Tür standen einige Rollen Tapete, und ein zusammengeklappter Tapeziertisch lehnte an der Wand. Bestimmt hatte ihr Vater die Dinge hier abgestellt.
Zögerlich wandte sie den Blick nach rechts.
Da stand es.
Eine große weiße Decke oder ein Laken war darübergelegt worden. So war es nicht sofort erkennbar. Doch Anna wusste, dass darunter das hübsche Kinderbett stand.
Eine Weile verharrte sie davor und starrte auf das unregelmäßige Gebilde vor sich. Dann ging sie entschlossen darauf zu und zog mit einem Ruck das Laken herunter. Tausende von Staubwölkchen flogen durch den Raum und tanzten eine Weile in dem Schein des hereinfallenden Lichts.
Anna ließ das Laken achtlos zu Boden fallen und schaute auf das Bett. Zu ihrer größten Überraschung überkam sie weder ein Weinkrampf noch eine Welle von Traurigkeit. Es war auszuhalten. Das Bett gefiel ihr. Es war schlicht, aber hübsch. Die Matratze war in Plastik eingeschweißt und ein Gestell, das man als Baldachin darüber hängen könnte, lag auseinandergeschraubt darin. Und auch wenn sie natürlich traurig war, dass sie es nie würde benutzen können, nie ihr eigenes Baby darin schlafen würde, hielten sich die Emotionen gerade in Grenzen.
Na schön.
Elf Jahre waren offensichtlich lange genug, um selbst mit den schlimmsten Erinnerungen umgehen zu können.
Sie griff nach dem Telefon, das in ihrer Hosentasche steckte und wollte ein Foto von dem Bett machen. Sie würde es bei einer Online-Auktion verkaufen und einem anderen Kind die Möglichkeit geben, die ersten Träume seines Lebens darin zu erleben. Für sie war es der Abschluss von Vergangenem und die Möglichkeit, nach vorn zu schauen.
Fast hätte sie laut aufgeschrien und ihr Telefon weggeworfen, als es in der absoluten Stille plötzlich klingelte. Der altmodische Klingelton hörte sich an, als würden die Glocken eines Kirchturms direkt hier in dem Zimmer läuten.
Mit der Rechten fasste sie sich an die Brust und spürte deutlich den angeschwollenen Herzschlag. Den linken Daumen schob sie über das Display und nahm das Telefonat an.
»O Gott, Helen. Ich habe mich gerade erschreckt«, begann sie mit einem Lachen, um sich zu beruhigen.
»Entschuldigen Sie, Frau Schwarz. Es war nicht meine Absicht.«
»Das weiß ich doch. Ich hatte das Telefon in meiner Hand, und in diesem Moment klingelt es. Hui … Was kann ich für Sie tun?«
»Frau Schwarz, ich habe einen Anrufer auf der anderen Leitung, der schon mehrfach angerufen hat und darauf besteht, sofort mit Ihnen zu sprechen. Er sagt, Sie kennen sich aus … Dublin.«
Allein dieses Wort bescherte ihr augenblicklich eine Gänsehaut, die ihren Nacken hinaufkroch und ihre Kopfhaut umfasste.
Dublin?
Wer könnte es sein?
Benjamin?
Nein, das war ausgeschlossen. Er würde sie nicht anrufen.
Wer dann?
»Okay. Wie ist sein Name?«
»Jon Johnson. Er sei von der DPP in Dublin, was auch immer das heißt. Und er lässt sich nicht mehr abwimmeln, sagt er. Kennen Sie ihn?«
Jon Johnson. Natürlich kannte sie ihn. Er war der ermittelnde Staatsanwalt gewesen, als sie im letzten Jahr bei der Suche nach dem vermissten Eóin geholfen hatte. Ein aufgeblasener, ignoranter und arroganter Mann kam ihr in den Sinn, der mit seiner Abneigung gegenüber einer jeden Frau, die in seinem Territorium intervenierte, nicht hinter dem Berg gehalten hatte.
Anna wunderte sich über seinen Anruf und fragte sich, was er von ihr wollen könnte.
»Ja, ich kenne ihn. Die DPP ist die irische Staatsanwaltschaft. Stellen Sie einfach durch, Helen. Ich kümmere mich um ihn. Bis später.«
Ein Klacken in der Leitung ertönte und Anna begrüßte den Mann in akzentfreiem Englisch. »Mister Johnson. Was für eine Überraschung! Wie geht es Ihnen?«
»Miss Schwarz. Dass wir uns noch einmal sprechen würden, hätte ich nicht gedacht.« Mit dem Ertönen des Basses in seiner Stimme sah Anna den überdurchschnittlich großen und ebenso breiten, wuchtigen Mann vor sich, der um das verbleibende Haar auf seinem fast kahlköpfigen Haupt kämpfte und sie in regelmäßigen Abständen liebevoll streichelte.
»Ich auch nicht. Was kann ich für Sie tun?«
Anna vernahm ein angestrengtes Schnaufen und war gespannt darauf, was jetzt kommen mochte.
»Ich bin nicht sicher, wie ich anfangen soll. Es ist verzwickt.«
»Das ist es bestimmt.« Anna musste schmunzeln, weil der sonst so vorlaute Mann im Moment zauderte.
»Ich möchte Sie gern erneut nach Irland einladen«, sagte er etwas umständlich.
»Wie bitte?« Es gelang Anna nicht, das Erstaunen aus ihrer Stimme fernzuhalten.
»Ja. Wir brauchen hier dringend Ihre Hilfe. Sie könnten uns bei den Ermittlungen in einer Todessache behilflich sein.«
»Mister Johnson«, warf Anna dazwischen, bevor er weiterreden konnte. »Stopp! Sie müssen nicht mehr sagen. Ich kann nicht nach Irland kommen. Haben Sie vergessen, was bei meinem letzten Besuch in Dublin geschehen ist? Ganz zu schweigen von meinen Erlebnissen bei dem Besuch davor. Glauben Sie mir, ich habe absolut keinerlei Ambitionen, zu Ihnen zu kommen. Also besser, Sie erzählen mir nicht, warum Sie so dringend meine Hilfe brauchen.«
Vor einem guten Jahr hatte Katharina Bowen, eine ehemalige Mandantin, sie mit der Suche nach ihrem vermissten Sohn Eóin beauftragt und nach Dublin geholt. Erst nachdem Anna von Katharina niedergeschlagen worden war, hatte sie von dem Racheplan ihrer Mandantin erfahren. Katharina hatte das Verschwinden Eóins nur inszeniert, um sich an Anna für einen früheren, vermeintlichen Anwaltsfehler zu rächen. Bei ihrer anschließenden Entführung in ein abgelegenes Mausoleum an der Küste der Irish Sea war auch Benjamin involviert gewesen, weil er geglaubt hatte, der Mutter etwas schuldig zu sein und sie beschützen zu müssen. Glücklicherweise hatte er seinen Fehler entdeckt und Katharina davon abgehalten, Anna zu erschießen.
Während Katharina wegen einer schweren Psychose in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wurde, trug Benjamin die Verantwortung, wurde suspendiert und versetzt.
Johnsons Loyalität gegenüber Benjamin in dessen Strafverhandlung hatte Anna überrascht. Für seinen Verrat an ihr und ihrer Entführung hatte dieser sich vor dem Criminal Court verantworten müssen. Zu der Verhandlung war Anna vor einigen Monaten nach Dublin gereist und hatte so die Gelegenheit, Jon Johnsons Aussage zu verfolgen.
Sie selbst hatte sich in ihrer Aussage zurückgehalten mit den Schilderungen dessen, was passiert war. Ihre Empfindungen waren ebenso ambivalent wie das Verhalten des Garda, und sie kam nicht umhin, ihn auch ein wenig zu bedauern. Außerdem fragte sie sich, welchen Nutzen es ihr gebracht hätte, ihn im Gefängnis und sein Leben zerstört zu wissen.
Die Fürsprache des Staatsanwalts war mehr als nützlich gewesen. Bei aller Kritik, die er seinem Kollegen aussprach, überwogen doch die Bewunderung und Achtung für dessen übrige Professionalität bei den Ermittlungen. Wer sei er denn, den ersten Stein nach jemandem zu werfen, der in den Fängen einer Frau zu unkontrollierbaren und selbstzerstörerischen Taten gegriffen hätte. So oder so ähnlich hatte er sich ausgedrückt. Anna hatte das Bedauern des Staatsanwalts, einen integren Mitarbeiter zu verlieren, deutlich gespürt.
Ohne die nachsichtigen Worte des Staatsanwaltes hätte es für Benjamin viel schlimmer ausgehen können. Den Ausgang hatte sie zwar nicht mehr verfolgt, aber von einem Bekannten erfahren, dass er mit einer Bewährungsstrafe und einer Versetzung in ein irisches Kaff davongekommen war.
Doch Katharina war noch nicht mit ihr fertig gewesen und aus der geschlossenen Abteilung des Central Mental Hospital geflohen. Am Gericht hatte sie plötzlich erneut Anna gegenübergestanden.
»Ich muss Sie nicht daran erinnern, dass diese Verrückte aus der Psychiatrie hatte fliehen können und mir am Criminal Court an den Kragen wollte«, rief Anna dem Staatsanwalt die jüngsten Ereignisse in Erinnerung.
»Ich erinnere mich«, sagte dieser etwas kleinlaut.
»Und erinnern Sie sich auch noch daran, als sie auf mich zustürzte wie eine wild gewordene Furie und mir an die Gurgel ging?« Anna redete sich förmlich in Rage und merkte, wie ihre Hände anfingen zu zittern. Sie atmete einmal tief durch und rief sich selbst zur Mäßigung. »Nein, Mister Johnson, ich möchte wirklich nicht zurück nach Dublin kommen, so schön Ihre Stadt auch ist. Bitte verstehen Sie mich.«
»Natürlich verstehe ich das. Ich bedaure diese Vorfälle auch zutiefst. Das hätte alles nicht passieren dürfen. Dennoch«, er unterbrach sich und legte eine kurze Pause ein, vermutlich um die folgenden Worte sorgfältig zu wählen, »ist Miss Bowen mittlerweile gut untergebracht. Die Klinik hat aus den Fehlern gelernt. Es ist ja auch nichts passiert. Glücklicherweise konnte sie gleich festgenommen werden, bevor Sie ernsthaft Schaden nehmen konnten. Außerdem …« Anna unterbrach ihn mit einem verächtlichen Schnauben. Johnson ließ sich jedoch nicht beirren und redete einfach weiter: »Soweit ich es mitbekommen habe, hat dieses … Abenteuer … Ihrer Karriere absolut nicht geschadet.«
»Ha!« Anna lachte laut auf. »Sie sind nicht schlecht, Mister Johnson. Nicht schlecht.«
In der Tat hatten Annas Ermittlungsgeschick und ihre manchmal etwas unkonventionellen Methoden ihr dazu verholfen, eine gewisse Berühmtheit als Anwältin zu erlangen. In den vergangenen Monaten war sie mehrfach zu Tagungen und als Referentin bei Weiterbildungen in der ganzen Welt und sogar als Beraterin der Europäischen Kommission nach Brüssel gerufen worden. Johnson musste vor seinem Anruf recherchiert haben.
»Miss Schwarz, was soll ich sagen? Lassen Sie mich nicht betteln. Lassen Sie mich wenigstens erzählen, worum es geht.« Seine Stimme hatte einen hohen Ton angenommen. Er bemühte sich offenbar, höflich zu sein.
Mittlerweile war Anna nach unten gegangen und machte sich noch einen Kaffee. Das Telefon zwischen das Ohr und die Schulter geklemmt fischte sie sich eine Zigarette aus der Schachtel und ging zwischen den offen stehenden großen Flügeltüren erneut hinaus auf die Terrasse. Die Sonne stand höher und es wurde merklich wärmer. Die Terrasse jedoch war überdacht, und bis die Sonne am Nachmittag herumkommen würde, war es noch auszuhalten. Sie zündete die Zigarette an, setzte sich auf den Stuhl, legte die Beine hoch und nahm einen Schluck Kaffee.
»Na, dann erzählen Sie«, ermunterte Anna ihn. Sie wollte schließlich nicht unhöflich sein. Im Übrigen rüttelte der Staatsanwalt an ihrer Neugier. Sie wollte nun wissen, was den Mann bewegt haben mochte, um ihre Hilfe zu betteln.
»Gut. Vor ein paar Tagen fand ein Spaziergänger eine Leiche. In einem Wald an der Westküste. Ein Mann. Todeszeitpunkt war der erste oder zweite Juli, also etwa vor zwei Wochen. Er wurde erdrosselt. Er muss sich gewehrt haben, denn er war an Händen und Beinen gefesselt. Mittlerweile wissen wir auch, wer er war. Devlin. So nannte er sich. Sein gebürtiger Name war Victor Sartor, geboren in Lichtenfels. Das ist in der Nähe von München, sagt meine Mitarbeiterin, und aufgewachsen ist er …«
»In Berlin. Victor Sartor?«, unterbrach Anna ihn.
»Aha, der Name sagt Ihnen etwas?«
»Natürlich tut er das. Das wussten Sie genau.«
»Ich habe es gehofft.«
Es war der Name einer Strafsache, an der Anna vor vielen Jahren teilgenommen hatte. Sie erinnerte sich an einen kleinen, unansehnlichen Mann mit fettigem Haar und schmalen Lippen, der vor Selbstbewusstsein strotzte und eine Vorliebe für kleine, junge Mädchen hatte, die ihm irgendwann zum Verhängnis geworden war. »Und Sartor ist tot? Er wurde erdrosselt? In Irland?«
»Ja und ja. Er ist vor einigen Jahren nach Irland ausgewandert.«
Anna hörte gespannt zu. In ihrem Kopf ratterte es. Den Gedanken, dass es nicht schade war, dass dieser perverse Kerl tot war, konnte sie nicht unterdrücken. Ein Kinderschänder weniger auf dieser Erde. Gut so.
»Okay. Und deshalb brauchen Sie mich? Weil Ihr Toter ein Straftäter ist, an dessen Verhandlung ich vor – keine Ahnung – zehn Jahren teilgenommen habe? Im Übrigen war ich Vertreterin der Nebenklage, nicht seine Verteidigerin. Wie sollte ich da helfen können?«
»Vor zwölf Jahren. Aber nein, nein, nein. Das ist es nicht. Er ist nicht allein nach Irland ausgewandert.«
»Sondern?«
»Mit fünf Frauen.«
»Mit fünf Frauen?«
»Genau. Mit fünf Frauen. Ich müsste weiter ausholen, um Ihnen das im Einzelnen zu erläutern. Es würde den Rahmen sprengen. Ich denke, das können wir nachholen, wenn Sie herkommen.«
Anna schnaufte.
Johnson machte eine kurze Pause und fuhr dann fort: »Worauf ich hinauswill, ist Folgendes: Eine der Frauen heißt Kim Valentin. Dieser Name sollte Ihnen ebenfalls etwas sagen.«
Das tat er. »Ja, ich weiß, wer das ist. Das ist das Mädchen, das ich in dem Strafverfahren vertreten habe. Sie war zwölf, als er sich mit ihr … vergnügt hat. Das war unser Glück. Sonst hätten wir ihn nicht verurteilen können. Sie war total verliebt in ihn gewesen, sofern man bei einer Zwölfjährigen davon sprechen kann. Ich denke, es war eher eine Art Abhängigkeit. Wie auch immer. Für die Taten bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr konnten wir ihn verurteilen. Alles danach schlug leider fehl. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er nur eine Bewährungsstrafe bekommen.«
»Richtig. Mit Ablauf der Bewährungsfrist wanderte er nach Irland aus. Mit Kim und vier weiteren Frauen.«
Johnson hatte es tatsächlich geschafft, Annas Interesse zu wecken. »Und was sagen Kim und die anderen vier Frauen zu seinem Tod?«
»Das ist es. Sie schweigen.«
»Oh, das ist interessant. Und ich soll sie zum Reden bringen?«
Einen kurzen Moment herrschte Schweigen. Dann kam Johnson endlich zum Punkt: »Na ja. Ja. Die Sache ist die, dass Kim nach Ihnen verlangt hat.«
»Nach mir?« Anna war ehrlich überrascht. Sie hatte nicht gedacht, dass Kim sich noch an sie erinnerte. Das Verfahren war zwölf Jahre her. Kim war damals noch ein Kind.
»Nach Ihnen.«
»Ach, Mister Johnson. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Was erhoffen Sie sich denn von ihr? Was wird sie mir denn erzählen? Ein Geständnis ablegen? Sagen, wer ihn umgebracht hat?«
»Nun, das war leider noch nicht alles.«
»Nicht?«
»Nein. Wissen Sie, die Tötung Sartors wird mir nicht den Schlaf rauben. Wenn wir den Schuldigen nicht finden, dann finden wir ihn eben nicht.«
Anna war überrascht von diesem unkonventionellen Bekenntnis eines Staatsanwalts. Wenn sie als Anwältin einem Kinderschänder keine Träne nachweinen würde, war das eine Sache. Doch die meisten Staatsanwälte gingen anders an die Dinge heran. Die Aufklärung einer Tötung gehörte zu dem besonderen Berufsethos der Behörde. Johnsons Pragmatismus überraschte sie. Sie konnte nicht annähernd erahnen, worauf er hinauswollte.
»Aber?«
»Wir haben bei der Bergung des Toten unter ihm Knochen gefunden.«
»Knochen?«
»Knochen. Menschenknochen. Kleine Knochen. Von Säuglingen.«
Autsch. Dieser Fakt ließ den Fall in der Tat brisanter erscheinen. Auf jeden Fall geriet Annas Entschlossenheit, ihm eine Absage zu erteilen, erheblich ins Schwanken.
»Und Sie vermuten einen Zusammenhang mit Sartor?«
»In der Tat.«
»Und jetzt soll ich für Sie Kim zum Reden bringen? Rechnen Sie mit einem Geständnis von ihr?«
»Eine gute Frage. Mit einem Geständnis rechne ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie ist eine kleine, unscheinbare Frau. Zierlich, leise und sehr hübsch. Ich verstehe bei ihr überhaupt nicht, wie sie in diese Gemeinschaft geraten ist.«
»In welche Gemeinschaft?«
»Das kann ich Ihnen schlecht berichten. Sie sollten es sich anschauen. Womit wir wieder am Anfang unseres Gesprächs wären: Ich lade Sie ein, nach Dublin zu kommen.«
3
Ein Kleid, das aus mehr Pailletten bestand als aus Stoff. Viel zu hohe Absätze.
War es nicht erbärmlich, mit Anfang vierzig aufgetakelt wie ein Weihnachtsbaum in einem Club zu stehen, in dem viel zu laute Musik lief und Cocktails zu schlürfen, die viel zu bunt waren?
Gut, das mit den Cocktails schob Anna wieder beiseite. Cocktails waren toll. Dennoch ärgerte sie sich im Moment, dass sie sich von ihrer Freundin hatte überreden lassen, heute Abend auszugehen.
Lene schien sich zu amüsieren. Einen dieser aufwendig gestalteten Drinks in der Hand wiegte sie im Rhythmus der aus den Boxen über ihnen dröhnenden Bässe. Anna dagegen musste dem immer wieder aufkommenden Impuls widerstehen, sich die Ohren zuzuhalten.
»Da kommt Clara«, brüllte Lene ihr ins Ohr und zeigte mit dem großen Glas in der Hand in Richtung der Tür des Clubs. Anna nutzte die Gelegenheit, griff Lene am Arm und zog sie mit sich in Richtung der ankommenden Freundin.
Weiter vorn in dem großen Raum, der ohne die vielen Menschen und hohen Regale voller Flaschen und Gläser an eine große Fabrikhalle erinnern würde, war es nicht ganz so laut.
Sie kannte Lenes Kollegin und Freundin nicht gut, sie hatten erst ein paar Mal beruflich miteinander zu tun gehabt.
Lene winkte der Ankommenden zu, die sie sogleich erblickte und mit einem breiten Lachen auf sie zukam. In diesem Moment wurde ein Platz an der Bar frei und die Frauen versammelten sich um einen Barhocker.
»Entschuldigt die Verspätung. Ich habe kein Taxi bekommen. Was ist denn hier heute los?«
»Freitag«, kommentierte Lene ausdruckslos. »Schön, dass du da bist. Kennst du Anna?«
Clara nickte und die beiden Frauen gaben sich die Hand. »Wir hatten erst kürzlich am Amtsgericht KW eine Strafsache.«
»Und ihr kennt euch schon länger?«, fragte Anna.
Während Clara sich mit einem Nicken begnügte und dem herbeieilenden Barkeeper mit einem Fingerzeig auf sich aufmerksam machte, um etwas zu bestellen, erklärte Lene ihr ausführlicher: »Wir kennen uns schon länger. Sind uns schon oft im Büro über den Weg gelaufen. Aber seit … einigen Wochen arbeiten wir beide im gleichen Referat und Clara soll zum Ende des Jahres die Leitung übernehmen.«
Clara schaute zu Anna und nickte ihr mit einem breiten Grinsen zu.
Beide Frauen arbeiteten bei der Staatsanwaltschaft Berlin und bearbeiteten hauptsächlich Sexualstrafsachen. Daher würden sie sich bestimmt in Zukunft häufig über den Weg laufen, da sich auch Anna als Opferanwältin und Menschenrechtlerin oft in diesem Bereich tummelte.
»Und wir kommen gut miteinander aus … und haben niemanden, der zu Hause auf uns wartet. Also dachten wir, wir könnten mal zu dritt ausgehen«, erklärte Lene weiter.
Anna und ihre Freundin führten ein ähnliches Lebenskonzept, wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen. Während Anna ungewollt in ein Leben als Single und Workaholic geschubst worden war, lebte Lene aus Überzeugung dieses Konzept. Sie liebte ihren Job und den an erster Stelle. Ihre ständig wechselnden Partner und One-Night-Stands würde sie nie zugunsten einer steten und langweiligen Partnerschaft vorziehen. Anna hatte sie unlängst gefragt, ob sie keine Angst hätte, allein alt zu werden. Lene hatte nur gelacht und den Kopf geschüttelt. Das hatte Anna ihr ohne Zögern abgekauft; sie konnte sich Lene durchaus als alternde, aufgetakelte Oma vorstellen, die noch im Altersheim mit den Senioren flirtete oder mit einem bunten Hut und zu viel Make-up in viel zu teuren Restaurants saß und Martinis trank.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich große Chancen auf die Referatsleitung hätte, wenn ständig ein Mann – oder schlimmer noch ein paar Kinder – zu Hause auf mich warten würden. Wir müssen alle viel leisten und uns beweisen. Ich bin froh, dass ich keine Nachtschicht oder Wochenendarbeit vor einem Partner rechtfertigen muss«, mischte Clara sich in das Gespräch ein.
»Geht das eine nicht ohne das andere?«, fragte Anna. Sie bewunderte die Frau für ihr Engagement und ihren Ehrgeiz, überlegte jedoch gleichzeitig, ob das so richtig war.
»Ich glaube nicht. Zumindest kann man nicht beides mit vollem Einsatz erledigen.«
Stimmte das? War es nicht möglich, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen? Musste eines von beiden zurückstehen, wenn man das andere hundertprozentig erledigte? Gedanken, die Anna sich im Moment leider nicht machen musste.
Auf jeden Fall waren Reisen, wie die morgen anstehende, schwieriger zu gestalten, wenn zu Hause ein Mann und ein Kind auf sie warteten.
»Ein Staatsanwalt in Dublin hat mich nach Irland gebeten. Ich fliege morgen Mittag«, erzählte sie ohne Aufforderung. Sie hatte sich während des fast einstündigen Telefonats mit Johnson dazu überreden und überzeugen lassen.
»Du fliegst nach Irland? Wann wolltest du mir das erzählen?«, fragte Lene mit weit aufgerissenen Augen.
»Tu ich doch gerade.«
»Echt? Toll!«, kommentierte Clara. »Ich habe eine Freundin in Irland. Muss toll sein. Die Anwältin aus Berlin, die im vergangenen Jahr den Polizisten umgebracht hat. Habt ihr das mitbekommen?«
Anna erinnerte sich dunkel an eine Kollegin, die vor einem Jahr auf brutale Weise ihren Liebhaber, einen Polizisten, umgebracht hatte, sich aber dann nicht mehr an die Taten erinnern konnte. Es hatte sich herausgestellt, dass die Kumulation aus Schicksalsschlägen, Stress und Leistungsdruck ihre Psyche einfach außer Gefecht gesetzt hatte.
»Ja, das mit dem Polizisten lief eine Weile ständig im Fernsehen. War sie nicht in der Psychiatrie untergebracht?«
»Genau. Aber sie ist dann entlassen worden und ziemlich schnell nach Dublin zu ihren Schwiegereltern gezogen. Sie lebt dort jetzt und schreibt Bücher. Ihr ging es ziemlich schlecht. Ich glaube, sie ist bis heute nicht wirklich fit. Aber der Tapetenwechsel tut ihr gut.«
»Wie lange bist du weg?« Lene nahm den ursprünglichen Faden wieder auf.
»Ich weiß es noch nicht. Ein paar Tage. Ich habe bislang nur den Hinflug gebucht. Wird sich zeigen, wie lange ich brauche.«
»Du willst ernsthaft wieder nach Dublin? Nach dem, was dir die letzten Male passiert ist?« Ihre Freundin war sichtlich besorgt.
»Ich weiß, was du meinst. Ich wollte auch nicht, habe mir die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht.« In kurzen Sätzen fasste sie das gestrige Telefonat mit Johnson zusammen.
»An die Westküste? Du fährst an die Westküste? Warum fliegst du dann nach Dublin?«
»Ich treffe mich mit dem Staatsanwalt in Dublin und außerdem ginge ein Flug nach Cork erst am Mittwoch und ist unverhältnismäßig teurer.«
»Wo schläfst du an der Westküste?«, mischte sich Clara ein.
»Das weiß ich – ehrlich gesagt – noch nicht. Ich habe bislang eine Übernachtung in Dublin gebucht und dann muss ich weitersehen.«
»Ich frage nur, weil meine Freundin, von der ich erzählt habe, ein Ferienhaus an der Westküste hat. Ich kann sie mal anrufen.«
»Ja, gern. Aber das macht nur Sinn, wenn es in der Nähe ist. Wenn ich jeden Tag zwei Stunden fahren muss, suche ich mir lieber ein kleines B&B in Kenmare.«
»Klar. Verstehe ich. Weißt du was, ich schreibe ihr gleich mal eine Nachricht. In Dublin ist es eine Stunde früher. Sie ist bestimmt noch wach. Kenmare heißt das Nest?« Ohne eine Erwiderung Annas abzuwarten, nahm Clara ihr Telefon in die Hand und tippte mit schnellen Fingern eine Nachricht.
4
Das Leben wird nicht durch Wille oder Absicht gelenkt. Das Leben ist eine Frage der Nerven und Fasern und langsam aufgebauten Zellen, in denen sich das Denken versteckt und die Leidenschaft ihren Träumen nachhängt.
Mit einem Latte in der Hand, die Sonne gerade noch im Gesicht, bevor sie gleich hinter dem großen Baum verschwinden würde, stand Anna im Merrion Square vor dem Denkmal ihres Lieblingsschriftstellers und überlegte nicht zum ersten Mal, was Oscar Wilde damit hatte sagen wollen. Es war ein Zitat aus Das Bildnis des Dorian Grey, dem Buch Wildes, das ihm unter anderem während seines Prozesses wegen seiner offenen Homosexualität zum Verhängnis geworden war.
Sie bewunderte den aus dem Rahmen seiner Zeit gefallenen Schriftsteller und viele seiner Werke, und glaubte, dass er einfach oft falsch verstanden worden war. Schade, dass er ein so frühes und elendes Ende gefunden hatte. Sicher wäre von ihm mehr zu erwarten gewesen, wenn er mehr Zeit gehabt hätte.
Das Denkmal auf einem Stein im Merrion Square wurde ihm auf jeden Fall mehr als gerecht. In bunten Kleidern und lasziver Haltung räkelte er sich dort und war eines der beliebtesten Fotomotive Dublins. So auch eines der jungen Frau, die gerade aufwendige Verdrehungen ihres Körpers vollzog, um ein bestimmt ausgefallenes Foto des Denkmals aus einer aufwendigen Perspektive schießen zu können.
Amüsiert beobachtete Anna sie, als die wuchtige und nicht zu übersehende Statur Johnsons ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Ein senffarbener Pullover, der über dem massiven Bauch spannte und schlecht sitzende hellblaue Chinos sollten jedem Auge, das ein Mindestmaß an Ästhetik wahrnahm, auffallen. Er winkte ihr zu, und unter dem grauen Schnauzer, der dringend einer Rasur bedurfte, empfing sie ein herzliches Lachen. Es überraschte Anna, da sie den Staatsanwalt bei ihrem letzten Besuch nicht besonders freundlich in Erinnerung hatte. Ihre Hilfe schien dringend erforderlich, wenn der sonst humorlose Beamte sich freute, sie zu sehen.
Er streckte ihr die Hand entgegen, als sie die noch nicht erreichen konnte.
»Miss Schwarz. Ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie gekommen sind. Und sehen Sie, wie sehr Dublin Sie willkommen heißt. Lassen Sie uns ein paar Schritte gehen.« Mit einer ausholenden Handbewegung lenkte er ihre Aufmerksamkeit auf den strahlend blauen Himmel und lief auch schon los.
»Ja, ein wundervoller Tag. Hallo, Mister Johnson. Ob es an der Westküste auch so schön ist?«
Johnson verzog das Gesicht und strich sich mit der Linken über das spärliche Haar. »Bis vor wenigen Tagen hat es nur geregnet. Es hatte die Bergung der Leichen erheblich erschwert. Ich drücke Ihnen die Daumen.«
»Das heißt, Sie werden mich nicht nach Kenmare begleiten?«
»O nein, Miss Schwarz. Das kann ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Die Garda vor Ort hat alles im Griff. Man wartet dort auf Sie, damit Sie mit den Frauen reden.«
»Den Frauen? Sie sagten mir, ich sollte mit Kim Valentin sprechen. Was hat es mit den anderen Frauen auf sich?«
Sie schlenderten entlang der geschwungenen Wege durch den Park, und Anna bewunderte die symmetrisch angelegten Beete und den gepflegten Rasen. Der Merrion Square war nicht so groß wie der nur wenige hundert Meter entfernte St. Stephen’s Green, gefiel Anna gleichwohl um einiges besser, weil er nicht mit zu vielen Menschen überfüllt und beschaulicher war. Auf dem sehr gepflegten Grün erblickte sie einige Paare, die im Schatten der großen Bäume dösten, Kinder, die mit Bällen umherliefen; ein talentierter Artist balancierte auf einem Seil, das er zwischen zwei Bäumen gespannt hatte.
»Machen Sie sich ein Bild vor Ort, bitte. Wissen Sie, ich habe schon einige Berufsjahre hinter mir und viel gesehen und gehört. Aber ich lerne immer wieder Neues. Offenbar hielt sich Sartor oder Devlin, wie er sich nannte, für eine Art Messias, einen Auserwählten, der seinen … Anhängern, seinen Frauen im Grunde, den Weg in ein erfülltes und unabhängiges Leben zeigen wollte. Alles etwas unkonventionell. Er lebte mit den Frauen fernab in einem alten Cottage, das seit Jahrzehnten leer gestanden hatte, bevor er es … nun ja … besetzt hat; als Selbstversorger, mit Gemüse im Garten, ein paar Hühnern und so etwas. Schauen Sie es sich an. Er war immer mal wieder in Konflikt mit dem Gesetz. Kleinere Drogengeschichten, mal ein Diebstahl hier, Körperverletzungen. Nichts Dramatisches. Die Gegend ist sehr dünn besiedelt. Einige landwirtschaftliche Höfe, ein paar Ferienhäuser. Doch verirren sich nur selten Touristen dorthin. Der Ring of Kerry ist nicht weit entfernt. Dort tummelt sich das Leben. Auf die Beara Peninsula kommen nur wenige und wenn, dann nicht bis ans Ende der Halbinsel. Die touristischen points of interest sind mehr in Richtung Festland. Die schroffe Küste ist zwar schön, bietet jedoch nicht viel, weder zum Leben noch für die Urlauber. Wie dem auch sei. Bei den wenigen Nachbarn, die es gibt, war er nicht besonders beliebt. Er hat sich nicht nur Freunde gemacht. Im Gegenteil: Ein Motiv fände sich bei einigen. Ich denke, dass seine Frauen uns ganz sicher weiterhelfen könnten. Doch sehen Sie: Das Problem ist, dass er sie seit Jahren weitestgehend abgeschottet hat, von der Gesellschaft, von anderen Menschen. Sie lebten nur für sich. Die Frauen sind extrem scheu. Leben in ihrer eigenen Welt. Und nun ist ihr Gott gestorben. Sie sind hilflos und verunsichert. Wir kommen ganz schlecht voran. Und dann sagte diese Kim Valentin, sie würde mit ihrer Anwältin sprechen.«
»Mit mir«, sagte Anna mehr zu sich selbst.
»Mit Ihnen. Ich habe Ihnen die Akte mitgebracht. Sie können sich die bisherigen Befragungen ansehen. Alles andere besprechen Sie bitte mit den Gardaí vor Ort.«
»Mach ich.« Sie griff nach der Akte, die sie sich dicker vorgestellt hatte, und steckte sie in ihre Tasche.
Einen Moment gingen sie schweigend nebeneinander her und Johnson fuhr sich wieder mit der Hand über sein Haar.
»Wie kommen Sie nach Kenmare? Nehmen Sie den Zug?«
»Nein, ich habe mir ein Auto gemietet.«
Johnson nickte.
Sie waren am südlichen Eingang des Parks angekommen. Auf der anderen Straßenseite erhob sich eine Wand puritanischer, schmuckloser und dennoch eindrucksvoller Reihenhäuser mit den für Dublin typischen bunten Türen.
Johnson verabschiedete sich. »Ich muss nach rechts. Wenn Sie keine Fragen mehr haben …« Er wandte sich bereits ab. »Melden Sie sich bitte morgen, wenn Sie angekommen sind.«
»Ich muss nach links. Nein. Alles gut. Ich schaue mir die Akte an und melde mich, falls ich noch Fragen habe. Sonst melde ich mich morgen aus Kenmare.«
»Haben Sie schon eine Unterkunft?«
»Ich bin im Schoolhouse Hotel«, antwortete Anna und zeigte auf einen imaginären Punkt hinter sich in die Richtung, in der ihr Hotel lag.
»Oh! Gut. Aber das meinte ich nicht. Haben Sie schon was in Kenmare?«
»Ach. Ja, ich habe ein kleines Ferienhaus von einer Bekannten gemietet. In Tuosist. Das ist nicht weit von Kenmare.« Zu Annas größter Überraschung hatte sich die von Clara empfohlene Freundin als Glücksfall herausgestellt, deren Ferienhaus nur wenige Kilometer von Kenmare entfernt lag. Anna hatte es unkompliziert gemietet und freute sich auf entspannte Abende vor dem Kamin und den Ausblick über den Atlantik, den man nach Claras Aussage aus jedem der Zimmer, selbst aus dem Bad, genießen konnte.
Johnson zog anerkennend die Augenbrauen nach oben. »Gute Wahl. Viel Erfolg.«
»Danke.«
Einen Moment überlegte Anna, ob sie Johnson nach Benjamin fragen sollte, was aus ihm geworden war, und ob es ihm gut ging. Doch zuerst hielt sie es für vermessen, den Staatsanwalt dies zu fragen, und im nächsten Augenblick hatte der sich schon umgedreht und ging schwerfällig davon, sodass Anna es sich nicht anders überlegen konnte.
Den Merrion Square hatte Anna hinter sich gelassen. Mit einem gewissen Bedauern. Sie wusste nicht, wann sie wieder hierherkommen würde. Sie plante, sich morgen in aller Frühe auf den Weg nach Kenmare zu machen.
Unmittelbar vor ihrem Hotel, das tatsächlich vor vielen Jahren eine Schule gewesen war und heute ein gemütliches Hotel mit kleinen, aber individuellen Zimmern beherbergte, lud der Grand Canal sie ein, ein paar Meter zu gehen. Die Sonne schien noch. Das Spiel der durch die hohen Platanen hindurchscheinenden Strahlen mit den Reflexionen auf dem Wasser malte eine mystische Atmosphäre. Anna lief entlang des Kanals und bewunderte die schönen viktorianischen Häuser mit den auch hier vielfarbigen Haustüren. An einer Bank aus Bronze, auf der eine gleichfarbige Skulptur des irischen Poeten Patrick Kavanagh saß, blieb sie stehen. Entspannt und die Beine übereinandergeschlagen sollte die Skulptur ausweislich des Schildes an sein Gedicht Lines Written On A Seat On The Grand Canal erinnern. Anna setzte sich neben ihn, zog ihr Telefon aus der Tasche und machte ein Selfie. Das tat sie selten, doch inspirierte sie die entspannte Umgebung, das Plätschern des Kanals, die besondere Mystik in den Minuten, bevor die Sonne untergehen würde. Sie zündete sich eine Zigarette an und genoss die Ruhe. Nur wenige Spaziergänger liefen auf den schmalen Wegen beidseits des Kanals. Sie wusste nicht, was die nächsten Tage bringen würden.
Fünf Frauen.
Ein Messias.
Ein Toter.
Sie schloss kurz die Augen und gab sich dem Moment, der Ruhe vor dem Sturm, hin.
5
Eine Traube von Menschen quoll aus dem schmalen Eingang des Pubs. Ein Schwarm aus Vergnügen und Gelassenheit.
Samstagabend waren die Besucher in den meisten Pubs der Stadt in Feierlaune; oft spielte Live-Musik und viele Mitarbeiter großer Büros der näheren Umgebung feierten das Ende einer arbeitsreichen Woche. Anna wusste, dass viele internationale und europäische Unternehmen in der unmittelbaren Nähe ihre Büros unterhielten. Entsprechend voll waren die Räume des Restaurants und des Pubs auch im Schoolhouse.
Sie kämpfte sich durch das Gewusel, ignorierte plumpe Anmachsprüche ebenso wie den Geruch der verschwitzten Körper und stieg die Treppe nach oben zu ihrem Zimmer unter dem Dach hinauf. In der Minibar entdeckte sie eine kleine Flasche Whiskey und eine Cola-Dose. Die Cola schäumte, als sie sie auf den Whiskey goss, aber so schmeckte sie wunderbar. Die Beine auf dem kleinen Tisch vor dem Fenster abgelegt lehnte sie sich in den Sessel und studierte die Akte.
Trotz der grotesken Details darüber, was sie morgen an der irischen Westküste erwarten würde, schlief Anna gut und traumlos.
Sie stand auf, als es gerade anfing zu dämmern und machte sich in ihrem gemieteten Kleinwagen auf den Weg in Richtung Westen. Die Stadtautobahn war noch frei und sobald sie Dublin hinter sich gelassen hatte, zeigte sich das wahre Irland. Links und rechts der Autobahn erstreckten sich weite, dunkelgrüne Wiesen, leichte Hügel und immer wieder kleine und größere Herden mit Schafen oder Rindern. Die Sonne reflektierte in ihrem Rückspiegel und es versprach, ein schöner Tag zu werden. Anna schaltete ihre Playlist an und ließ das Fenster herunter.
Bis Cork ging es zügig und flüssig auf der Autobahn voran. Hinter der zweitgrößten Stadt Irlands verließ sie die Autobahn, und die Fahrt über enge Landstraßen und – zugegebenermaßen beschauliche – Dörfer verlief schleppender und nahm mehr Zeit in Anspruch. Dafür wurde es jetzt noch idyllischer, als es auf dem ganzen Weg zu erahnen war. Vereinzelte Häuser säumten die Straße, ebenso magische Wälder mit Bäumen, die über und über mit Moos bedeckt waren, dass Anna nicht verwundert gewesen wäre, einen irischen Kobold auf einem der Baumstümpfe zu entdecken. Die Straße war an einigen Stellen so schmal, dass sie bei Gegenverkehr bremsen musste.
Endlich in Kenmare angekommen, parkte Anna in einer der Hauptstraßen, stieg aus und drückte ihren schmerzenden Rücken durch. Sie hatte sich auf der nur gut drei Stunden dauernden Fahrt keine Pause gegönnt. Sie war überrascht, das kleine Städtchen voll von bunten Menschen zu entdecken. Sie hatte mit beschaulichen Gässchen und kleinen Pubs gerechnet. Doch hier erblickte sie Souvenir- und Schuhläden, Cafés sowie andere Shops, die Touristen gefallen könnten. In den schmalen Straßen drängten sich bunt gekleidete Menschen mit großen Rucksäcken, praktischen Cargohosen in Tarnfarben und atmungsaktiven Regenjacken. Überrascht von dem Gewusel entdeckte sie ein kleines, gemütlich wirkendes Café. Bevor sie die Garda Station betreten würde, wollte sie sich noch einen Kaffee und einen Scone gönnen. Letzteren verstaute sie in ihrer Tasche und rauchte lieber zu dem Kaffee, der besser schmeckte, als sie erwartet hätte, eine Zigarette.
Sie nutzte den kleinen Spaziergang entlang der geschäftigen Einkaufsstraße, der anzusehen war, dass sie vor wenigen Jahren noch romantisch angemutet haben mochte. Bevor wahre Massen an Touristen im Sommer hier einfielen wie Heuschrecken über ein reifes Kornfeld. An einem kleinen Bücherladen blieb sie stehen und bewunderte das liebevoll gestaltete Schaufenster. Zwei Eingänge weiter kaufte sie in einem Delikatessen-Shop ein paar Flaschen Bier, ein Baguette und ein paar Äpfel für den Abend. Sie würde es sich am Ferienhaus auf der Terrasse mit dem Blick auf einen Sonnenuntergang am Atlantik schmecken lassen.
Schließlich konnte sie ihren Auftritt in der Garda Station nicht länger hinauszögern und betrat das schöne, aus groben grauen Steinen gebaute Haus der Garda Síóchana. Im Eingangsbereich traf sie auf Stille und Geschäftslosigkeit. Keine Menschenseele war zu erblicken. Sie nahm die drei Stufen und betrat einen kleinen Flur, der nach dem Ozon des gigantischen Druckers, der unter dem Fenster stand, und dem Chlor der letzten Reinigung roch. Zwei große Fenster zu ihrer Rechten gewährten den Blick auf einen kleinen Innenhof, der sehr gepflegt und einladend wirkte. Bunte Sonnenblumen zierten ein kleines Beet und streckten die hübschen Köpfe nach oben in Richtung des hier nur spärlich einfallenden Sonnenlichts. Daneben stand eine schlichte weiße Bank, die dank der Gemütlichkeit des kleines Hofes beschaulich wirkte.
Anna lief weiter geradeaus. Die klackenden Geräusche ihrer Absätze auf dem Steinfußboden hallten von den Wänden wider. Immer noch entdeckte sie keine Menschenseele, doch konnte sie Stimmen hinter einer Tür hören. Sie lief ihnen entgegen, verharrte einen Moment, strich sich mit der linken Hand eine Strähne hinter das Ohr, klopfte an die Tür und trat ohne eine weitere Aufforderung ein.
Augenblicklich verstummte das Stimmengewirr und Anna sah sich vier erstaunten Gesichtern gegenüber. Vier Gardaí in dunkelblauen Uniformen saßen an einem kleinen Tisch vor dem Fenster in einem eher schmucklosen Raum. An der Decke erstrahlten zwei Neonröhren und gaben dem Raum die Nüchternheit eines Büros. Gegenüber der Tür, in der Anna einen Moment stehen blieb, stand ein wuchtiger grauer Schrank und daneben ein hüfthohes Regal, in dem zahlreiche Bücher und Zeitschriften wahllos und unordentlich gestapelt lagen. Auf dem Regal stand eine Kaffeemaschine, deren Kanne in der Mitte des Tisches vor dem Fenster stand und nur noch halbvoll war.
Anna schloss die Tür und lächelte die Anwesenden freundlich an.
»Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung.«
Ein älterer Garda mit einem lustigen Schnauzer, dessen Enden spitz nach oben gezwirbelt waren, und mit einer unscheinbaren Nickelbrille auf der Nase legte ein Stück Pizza in den Karton und erhob sich etwas schwerfällig. Er kam auf sie zu und fragte: »Was kann ich für Sie tun?«
Anna streckte ihm die Hand entgegen. »Mein Name ist Anna Schwarz. Ich bin die Anwältin aus Deutschland. Ich denke, ich werde erwartet, habe jedoch keinen Namen erhalten. Ich weiß nicht, wer die Ermittlungen leitet, und bei wem ich mich melden soll.« Johnson hatte ihr zu keinem Zeitpunkt Namen genannt, was ihr in diesem Moment auffiel.
Mit einem erkennenden Blick auf dem gemütlichen Gesicht streckte nun auch der Garda ihr die Hand entgegen. »Ah. Miss Schwarz. Ja, wir haben Sie schon erwartet. Guten Tag. Ich bin Neall O’Connor. Schön, Sie kennenzulernen.«
Die beiden schüttelten sich die Hand und Anna erwiderte: »Danke. Schön, Sie kennenzulernen, Neall O’Connor. Ich entschuldige mich, dass ich Sie in Ihrer Pause störe.«
»Kein Problem. Kommen Sie rein! Nehmen Sie Platz! Möchten Sie auch ein Stück Pizza?«
Anna schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, danke. Aber einen Kaffee nehme ich gern.«
»Oh, natürlich.«
An die einzige weitere Frau im Raum gewandt sagte O’Connor: »Cat. Holst du uns mal noch eine Tasse aus der Küche?«
Die junge Frau, die Anna keinesfalls älter als Mitte Zwanzig schätzte, erhob sich widerwillig und ging an Anna vorbei, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen.
»Das ist Cat Harte«, erklärte O’Connor, »unser Sonnenschein.«
Er zeigte mit der Hand auf den auf der anderen Seite des Tisches sitzenden Mann, der irischer nicht wirken konnte: Leuchtend rotes Haar, im Nacken kurz rasiert und auf dem Oberkopf wild und lockig, sollte schon sein ganzes Aussehen dominieren, wäre nicht das überaus hübsche Gesicht über und über mit zahlreichen Sommersprossen übersät. »Das ist Fergie O’hAnnluain«, erklärte O’Connor und sprach den komplizierten Namen aus, ohne sich die Zunge zu brechen.
Anna schätzte ihn auf Mitte Vierzig, vielleicht ein wenig älter als sie und gab auch ihm die Hand.
»Fer…gal. Fergal ist mein Name. Den Rest müssen Sie sich nicht merken.« Der Rothaarige erhob sich von seinem Stuhl und schüttelte Annas entgegengestreckte Hand.
»Gut. Ich merke mir Fergal. Freut mich sehr.«
Wieder hob O’Connor die Hand und zeigte auf den daneben sitzenden älteren Herren, dessen Gesicht zahlreiche tiefe Falten zierten, vor allem um die Mundwinkel und die Augen, was vermutlich auf eine natürliche Fröhlichkeit des Mannes hinwies. Anna mochte ihn schon, bevor er nur einen Ton gesagt hatte. Er schaute sie freundlich an, und in seinen blassblauen Augen erkannte sie unendliche Heiterkeit.
»Guten Tag, Mylady. Ich bin Darragh McGrath. Nennen Sie mich Darragh.« Er deutete einen kleinen Diener an und Anna fühlte sich in ihrem ersten Gefühl bestätigt.
Sie nahm Platz und den ihr von der immer noch schweigenden Harte gereichten Kaffee und trank dankbar einen Schluck.
O’Connor griff wieder nach seinem Stück der Pizza und erklärte: »Der Inspector ist noch unterwegs. Er müsste aber jeden Augenblick zurück sein.«
»Er ist gerade gekommen und gleich nach oben gegangen«, sagte Harte und nahm sich ein Stück der Pizza.
»Ach. Er steht ziemlich unter Druck. Wir kommen schlecht voran. Wissen Sie, es gibt zahlreiche Motive, wenig Alibis. Es kommen einige Verdächtige in Betracht, für Devlins Tod verantwortlich zu sein.«
»Sartor. Sie meinen Sartor?«, fragte Anna.
»Ja, natürlich. Aber hier kennen ihn alle nur als Devlin. Den Namen Sartor kennt hier niemand. Es kam erst jetzt heraus«, antwortete O’Connor nicht unhöflich.
»Das heißt, er war hier bekannt?«
»Ha«, bestätigte Harte mehr zu sich selbst, während sie einen großen Bissen Pizza nahm. Sie schwieg gleich wieder und nickte kauend.
O’Connor übernahm und sprach weiter: »Auf jeden Fall. Jeder kannte ihn. Er war so etwas wie eine Berühmtheit hier. Nicht nur positiv. Im Gegenteil: Sie werden wenige Leute finden, die gutes über Devlin … Sartor zu berichten haben. Mit den meisten Leuten hatte er Streit, und er hat sie ausgenutzt oder betrogen und noch viel schlimmere Sachen. Aber gekannt hat ihn eigentlich jeder.«
Anna nickte zustimmend. Den Akten, die sie gestern Abend im Hotel gelesen hatte, hatte sie entnehmen können, dass Sartor sehr bemüht gewesen war, auf jede erdenkliche Weise an Geld zu kommen. Es gab kleinere Raubgeschichten, manche erzählten von Einbrüchen, und ein Bauer hatte berichtet, dass er Sartor dabei erwischte, als dieser eine seiner Kühe stehlen wollte.
»Wieso hat ihn nie einer der Leute angezeigt? Warum ist keiner zur Polizei gegangen?«, fragte Anna in die Runde. In den Akten stand, dass es in den letzten fast zehn Jahren nur zwei Verfahren gegen Devlin gegeben hatte. Beide wegen Diebstahls geringen Werts, die nach Zahlung einer Geldbuße eingestellt worden waren.