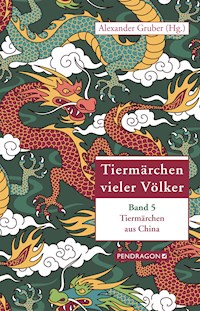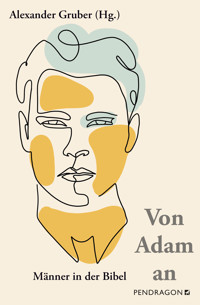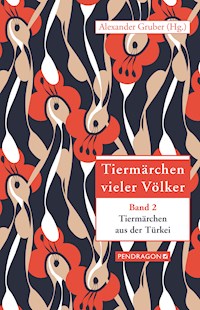Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Tiermärchen vieler Völker
- Sprache: Deutsch
»Der Fasan flog durch alle Räume des Palasts, der Affe kletterte aufs Dach, der Hund kroch unter die Dielen, um herauszufinden, wo die Schätze versteckt waren, was ihm auch alsbald gelang.« Schatzsucher sind nicht alle Tiere in den japanischen Märchen, die hier von Alexander Gruber neu erzählt werden. Aber immer können sie verblüffen und überraschen, hilfreich und mitleidig sein, ja, als zauberkundige Füchsin sich in die entfernte Ehefrau verwandeln. Was Wunder in einem Land, das aus sage und schreibe 6 852 Inseln besteht, und wo es seit dem Jahr 712 schriftliche Märchensammlungen gibt. Mit diesem 7. Band unserer Reihe »Tiermärchen vieler Völker« sind wir im Fernen Osten angekommen. Und mit dem »Storchenreiter« stehen wir am Rand des Ozeans und blicken auf die unendliche Fülle des Lebens von Tieren und Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tiermärchen vieler Völker
Band 7:Tiermärchen aus Japan
Herausgegeben, neu erzählt und mit einem Vor- und Nachwort versehen von Alexander Gruber
Inhalt
Vorwort
Affenpodex
Der Storchenreiter
Das Kriegsschwert des Fuchses
Ein treuer Kater
Was die Meeresbewohner sagten, die mit den breiten Flossen, und die mit den schmalen Flossen
Der weiße Hirsch
Die Qualle
Die rote Schale
Ein Fuchsschwanz und noch ein Fuchsschwanz
Die getreue Schildkrott
Die Ente
Vom neidischen Nachbarn und dem kleinen Hund
Die Sprache der Ameisen
Ein Friedfisch bedankt sich
Wo kommen die Fliegen her?
Vom Rattenkind
Vom Hasen, dem Alten und dem Marderhund
Bestrafter Verrat
Mamataro: Pfirsichsohn
Wie der Rabe schwarz wurde
Weiße Füchse im Moor
Glühwürmchen
Das Mädchen aus dem Bambus
Der dankbare Tanuki
Fugu
Schippeitaro
Was im Leben zählt, Fasan und Falke
Schmetterling und Hagestolz
Die Berghexe
Frau Füchsin und ihr Sohn
Der Hase von Inami
Von einem Wassergeist
Der Sperling ohne Zunge
Die Vampirkatze
Von der Hochzeit der weißen Füchse
Katzenliebe
Die Mäuse von Nagasaki
Nachwort
Vorwort
Tiermärchen – darunter versteht man üblicherweise Märchen, die von Ereignissen unter Tieren erzählen. Auch die Wissenschaft teilt so ein. Damit sind jedoch nicht Fabeln gemeint, worin Tiere nur Menschen oder deren personifizierte Eigenschaften vertreten, selbst wenn sie weit ausholen in die Menschenwelt wie etwa »Reinecke Fuchs«. Diese Einteilung lässt also, um beim Vertrauten zu bleiben, »Rotkäppchen« oder den »Gestiefelten Kater« im Gegensatz zum »Lumpengesindel« oder »Katz und Maus in Gesellschaft« nicht als ›Tiermärchen‹ gelten. Doch darüber setzt sich unsere Reihe »Tiermärchen vieler Völker« deshalb hinweg, weil im Anfang der Zeiten, will sagen, soweit die kulturelle Erinnerung zurückreicht, Mensch und Tier keineswegs getrennt sind. Die Stammmutter der Turkvölker etwa ist eine Wölfin, und im Garten Eden führt eine Schlange Eva in tödliche Versuchung – ganz zu schweigen von der Vielgestaltigkeit der antiken Götter: Zeus, in Gestalt eines weißen kretischen Stiers, entführt die phönizische Prinzessin Europa; seither heißt der Erdteil nach ihr. Mensch und Tier handeln zusammen, sind – wie es der Wirklichkeit entspricht – eine lebendige Einheit, eine Schicksalsgemeinschaft, bis wir Menschen sie aufkündigen, ja, sie aufgekündigt haben: unbegriffen und nicht verarbeitet bis heute.
Viele japanische Tiermärchen, die ich im vorliegenden Band der Reihe »Tiermärchen vieler Völker« erzähle, reichen weit zurück in die Anfänge aufgeschriebener Geschichte und Geschichten im ›Land der aufgehenden Sonne‹. Das macht sie spannend, denn wir erleben, dass, gleichgültig wo, Menschen kämpfen und kämpfen müssen um ihr Mensch-Sein, und dass Tiere ihnen helfen. Bleiben sie unter sich, halten sie uns ein Brennglas vor.
Affenpodex
Ein Mann von Adel lebte im Osten und besaß ein wohlgeordnetes und -bestelltes Haus. Ein anderer Adliger, im Westen mit seiner Frau lebend, alt und mit weißem Haar, war arm und besaß weder Kinder noch Geld. Einmal, am letzten Abend des Jahres, bat der alte weißhaarige Mann seine Frau, sie solle doch zum Haus des Edelmanns im Osten gehen und etwas Reis und Bohnenmus borgen, damit sie das Jahresende festlich begehen könnten. Seine Frau aber sagte: »Wenn wir dort etwas ausleihen wollten, das würde nur zu übler Nachrede führen. Lass uns lieber einen Hirsebrei bereiten und damit das Ende des Jahres feiern. Das Neue möge besser werden!« Es war aber die Zeit, da die Sonne herabstieg und in die Herzen der Menschen blickte. Sie nahm die Gestalt eines Wanderpredigers an, der von Haus zu Haus um sein Essen bettelte. So ging er nun zuerst zu dem Haus im Osten und sagte: »Ich habe nichts auf dieser Welt, worauf ich mein Haupt betten könnte; bitte, gewährt mir ein Obdach.« Aber da schalt ihn der Edelmann im Osten und sagte: »Dies ist der letzte Abend des Jahres, und Ihr Nichtsnutz jammert hier herum! Alle Knochen sollte man Euch brechen! Verschwindet! Aber schnell!« Der Bettelpriester ging nach Westen zum Haus der beiden Alten. »Ich bitte um ein Obdach«, sagte er, »denn ich habe nichts auf der Welt, worauf ich diese letzte Nacht des Jahres mein Haupt betten könnte.« – »Ach, Armer, komm herein! Wir haben zwar nur ein wenig Hirse in heißem Wasser, aber davon sollst du einen Napf voll haben, wie wir auch.«
Der Bettelpriester aber sagte: »Füllt einen Kessel mit Wasser, werft drei grüne getrocknete Blätter hinein und bringt’s zum Sieden.« Die alte Frau tat wie geheißen, und als das Wasser kochte, war der Kessel voller gesottener Fische. Darauf sagte der Priester: »Wascht den Kessel aus, füllt ihn mit Wasser und bringt’s abermals zum Sieden.« Die alte Frau tat wieder wie geheißen, und als das Wasser kochte, nahm er drei Reiskörner aus seinem Beutelchen und warf sie hinein. Und der Kessel füllte sich bis obenhin mit leckerem Reis. So feierten die Drei fröhlich das Ende des Jahres.
Als aber die köstliche Mahlzeit vorüber war, fragte der Priester die beiden Alten: »Was wünscht Ihr Euch? Wären Euch Reichtümer lieber, oder wolltet Ihr lieber wieder jung sein, du siebzehn, du achtzehn?« Die beiden Alten sahen sich an, dann sagten sie wie aus einem Mund: »Lieber wären wir wieder jung, wenn auch arm!« – »Dann macht heißes Wasser und gießt damit den Zuber voll!«, sagte der Priester, und als es so weit war, streute er ein schön gelbes Pulver ins Wasser und sagte: »Steigt nun beide ins Bad!« Das taten sie beide gleichzeitig und wurden von alten zu jungen Leuten, er achtzehn, sie siebzehn; unterdessen wurde es Morgen. »Jetzt steigt aus dem Zuber und löscht das Feuer und alle Glut!«, sagte der Priester. »Und du, junge Frau, gehst zu dem Adelshaus im Osten und erbittest dort neue Glut!« So geschah’s, und als die junge Frau zum Haus des Edelmanns im Osten kam, staunten dort alle Bewohner und fragten, was denn geschehen sei? Sie erzählte, wie der Bettelpriester gekommen sei, und sie mithilfe von Wasser und ein wenig Pulver verjüngt habe, da sie keine Reichtümer wollten; doch bitte sie um ein wenig Glut. Der Adelsherr im Osten ärgerte sich gewaltig. »Ich habe mich dumm angestellt!«, sagte er. »Hätte ich ihn hereingebeten, hätte er mich beschenkt. Bittet Ihr ihn doch, dass er zurückkommt in mein Haus im Osten, vielleicht erfüllt er Euch die Bitte.« – »Das will ich!«
Als die junge Frau ins Haus im Westen mit der Glut zurückkehrte, berichtete sie alles, und der Priester machte sich sofort auf den Weg zu dem Haus im Osten. – »Nun, Herr im Osten, da Ihr doch so reich seid, fehlt Euch denn noch was?« – »Gerade weil ich dies und das besitze«, sagte der Edelmann, »wünsche ich mir von allem noch mehr. Seid voll Güte und verschafft mir mehr!« – »Nun, Geld habt Ihr genug«, sagte der Priester, »so will ich euch alle jung machen! Richtet ein Bad für alle!« Das geschah, und als es im Badhaus dampfte, schüttete der Priester ein schön rotes Pulver in alle Zuber, Wannen und Schapfe. »Jetzt badet!«, sagte er, und das taten sie. Wie sie aber alle badeten, verwandelten sich der Hausherr und sein Weib zu Affen, die Kinder zu Hunden, die Diener zu Katzen, die Dienerinnen zu Mäusen, und aus einem Diener wurde gar ein Schaf.
Dem jungen Ehepaar aus dem Haus im Westen übergab der Priester das Haus im Osten mit allem Besitz und allem Land, jedoch am Abend tobten die beiden Affen unaufhörlich im Haus; es war unerträglich, sodass das junge Paar sagte, hier könnten sie nicht bleiben, und sie gingen zurück in den Westen. Dort suchte sie wieder der Priester auf, und sie sagten ihm, weshalb sie zurückgekehrt waren. »Geht zurück!«, sagte der Priester. »Im Garten liegen zwei schwarze Steine, die nehmt, macht sie heiß und legt sie da hin, wo die Affen sich tummeln.« Das taten sie. Die Affen kamen auch und tobten herum und setzten sich auf die Steine, verbrannten sich dabei die Ärsche und kamen nie wieder. Doch daher kommt’s, dass heute jeder Affenpodex rot ist. Das junge Paar aber lebte angenehm und vergnügt bis an ihr selig Ende.
Der Storchenreiter
Oft und oft hört man in Japan von den glückseligen Inseln erzählen. Aber wo liegen sie? Tja, das weiß keiner. Manche Leute, die am Strand des Ostmeers wohnen, berichten allerdings, dass sie öfters einen hohen Baum aus den Fluten hervorragen sahen, und das sei der Baum, der auf dem höchsten Gipfel des Berges Fusan wurzle. Der wiederum ist der größte Berg der glückseligen Inseln. Die paar Leute, die ihn gesehen haben, freuen sich ihr Leben lang, wenn sie dies Wahrzeichen des heiligen Landes erblicken, zu dem ganz Wenige den Weg finden. Horaisan heißt das ferne Inselreich. Nehmen sie aber die Krone des herrlichen Baumes zum Zielpunkt, worauf sie zusteuern wollen, versinkt er vor ihren Augen in der bewegten See und erscheint nie wieder an derselben Stelle. Selbst heutzutage gibt es Leute, die hoffen, dass der Weg zu den glückseligen Inseln doch noch gefunden wird, denn dort grünt und blüht das Land das ganze Jahr über, ein ewiger Frühling erhält die Luft lind, den Himmel blau, und die Zeit geht spurlos an Mensch und Tier vorüber. Der Tod findet dorthin keinen Weg und ist unbekannt auf den Inseln des ewigen Lebens. Dort gibt es keine Krankheit und keine Schmerzen. Die Vögel, die bei uns vor Einbruch des Winters wegziehen, sagt man, ziehen nach Horaisan. Das weiß man von den Schwalben, aber auch die Wildgänse, die den Winter nicht fürchten, suchen den Weg dorthin. Es heißt, sie sammelten Holz- und Rindenstückchen, auch Reisig, und nähmen das mit auf die Reise in ihren Schnäbeln; kämen sie aber an den Rand des bewohnten Landes, legten sie’s nieder als Gabe für die Götter, damit sie wohlbehalten über das Meer nach Horaisan kämen. Strandbewohner am Ostmeer finden solche Reiser oft, die die Gänse zurückgelassen haben.
Seefahrer, kühn genug, um das Land des ewigen Lebens zu suchen, sind vom Festland aus aufgebrochen, aber bei ihrer Suche nicht weiter als bis Japan gekommen, und so wurden oft beide Länder verwechselt, und der hohe Fudschijama für den herrlichen Berg Fusan gehalten. Ein Irrtum! Das Reich Horaisan ist von Japan viel, viel weiter entfernt als Japan von China. Eigentlich können nur übernatürliche Mächte einen Menschen dorthin führen.
Doch ein paar Mal ist es geschehen: ein Abgesandter des alten Mikado Suinin gelangte dorthin und kehrte auch wieder zurück! Er brachte die Orange von dort nach Japan mit. Dann auch der weise Japaner Wasobiowe, der als einziger wirklich Kunde von dem wunderbaren Land gegeben hat. Ansonsten aber hat keinen Sterblichen, den die Götter den Weg nach Horaisan haben finden lassen, die Lust angewandelt, sein glückliches Leben dort gegen sein früheres hier zurückzutauschen.
So ging’s auch vor langer Zeit dem Josuku, dem Leibarzt des Kaisers von China. Der ein böser Regent und grausamer Despot war. Josuku beschloss, sich dieser Tyrannei und der dauernden Gefahr, worin er selber schwebte, zu entziehen, und bat eines Tages den Herrscher: »Gib mir ein Schiff, Majestät, und eine Mannschaft dazu und lass mich ausziehen, um das Reich Horaisan zu finden. Dann kann ich dort auf dem Berg Fusan das Kraut der Unsterblichkeit pflücken. Das wächst da, und das bring ich dir, Großmächtiger, dann brauchst du nichts mehr zu fürchten, nicht einmal mehr die Zeit, und wirst Herr über die ganze Welt.« Oh, das war Musik in den Ohren des Tyrannen, und schon ließ er den Leibarzt Josuku samt tapferer Mannschaft und großem Gefolge ausrüsten. So konnte der sich dem Gewaltherrscher entziehen und nach Japan segeln und weiter und weiter, bis er die glückseligen Inseln erreichte, aber im Traum nicht daran dachte, nach China zurückzukehren oder gar dem Kaiser von China das Leben zu verlängern. Dem Wasobiowe aber erzählte er später seine Geschichte.
Dieser Japaner war ein älterer ehrbarer Mann, der sich von allen seinen Geschäften zurückgezogen hatte und in Ruhe und Beschaulichkeit nahe Nagasaki lebte. Ein Koch und ein Leibdiener wohnten mit ihm in seinem Haus. Fuhr er in seinem kleinen Boot aufs Meer hinaus, um zu angeln, mussten die beiden das Haus und den Garten hüten. Oft blieb er tagelang fort. Einmal, als die achte Vollmondnacht des Jahres bevorstand, die ja die schönste des Jahres ist, beschloss er, um den zahlreichen üblichen Besuchen zu entgehen, aufs Meer zu fahren, nahm seine Angelschnur, setzte sich, kundiger Schiffer, der er war, in sein Segelboot und segelte los. Ob Tag oder Nacht, das galt ihm gleich, er fuhr gelassen in Sichtweite des Landes und genoss den prachtvollen hellen Mondschein, der die Schönheiten des Ufers versilberte. Doch da zogen dunkle Wolken auf. Bald fing es heftig an zu regnen und regnete immer heftiger. Das Licht schwand völlig. Finsternis herrschte. Ein Sturm brach los und türmte die Wellen berghoch, auf denen sein Schiffchen tanzte als wär’s ein Ball aus Zelluloid. Der Mast brach, verschwand samt Segel im Wasser.
Aber den Mut, den ließ Wasobiowe nicht sinken, er ruderte, lenkte, ruderte und kämpfte um sein Leben. An Umkehr, an Heimkehr dachte er nicht. Daran war nicht zu denken. Der Sturm trieb das Boot vor sich her, und auch als grau der Tag dämmerte, ließ er nicht nach, nein, er verdoppelte seine Wut. Nur Gischt und Schaum schien das Meer, aus dem turmhoch die schwarzen Wasserwände der Wogen wuchsen. Drei Tage und drei Nächte ging es so. Drei Tage und drei Nächte kämpfte der Mann um sein Leben auch dann noch, als er die Hoffnung aufgab. Und da, mit einem Mal beinah, legte sich der Sturm. Das Heulen verstummte. Sterne erschienen am Himmel, und Wasobiowe, der ihren Lauf kannte, sah, dass er weit, weit weg von seiner Heimat, von Japan, entfernt war. Auch Land sah er nirgends, nirgends ein Ufer, nirgends einen Streifen Strand. So trieb er auf dem nun friedlichen Meer, hatte aber zum Glück noch seine Angelschnur. Die warf er aus und die Fische, die er fing, verzehrte er roh. So fristete er sein Leben, Tag für Tag, Woche für Woche. Drei Monate lang. Drei Monate trieb er dahin, dann aber unwiderstehlich in Richtung der Schlammsee, eines bösen Gewässers, von dem er einst hatte reden hören, und das ihn beinahe das Leben kostete, denn in diesem schlammigen Meer konnte kein Fisch leben, kein einziger. Schon sah er den Hungertod vor sich, doch trotzdem ruderte er, bis ihn vollends die Kräfte verließen. Da – war das nicht ein sanfter, leichter Wind, der ihn plötzlich umspielte? Der nach Erde, nach Land, nach Blüten und Leben duftete? Noch einmal griff er nach seinem Ruder und unter Aufbietung letzter Kräfte ruderte er mühselig und schwach dem Wind entgegen und landete nach zwölf weiteren Stunden völlig erschöpft am Strand von Horaisan. Wo er war, wusste er nicht, ließ sich über den Rand seines Bootes fallen, berührte Land, und da fiel alle Schwäche von ihm ab. Ein mächtiges Glücksgefühl schoss in ihm empor, die Strapazen und Gefahren seiner Reise waren wie ausgelöscht, wie nie gewesen. Er stand auf, stand freudig am Strand und sah sich aufatmend um.
Ein schön gekleideter, würdevoller Greis kam auf ihn zu und sprach ihn an. Er verstand ihn, denn er hatte vor langer Zeit chinesisch gelernt. Es war jener Josuku, den einstmals der Kaiser von China ausgeschickt hatte, das Kraut der Unsterblichkeit für ihn zu holen. Der begrüßte Wasobiowe nun freundlich, ja, liebevoll, und während sie zusammen ins Landesinnere gingen, erzählte er ihm seine Geschichte und sagte ihm auch, dass er nie mehr in seine Heimat zurückkehren werde; hier sei er glücklich mit seinen Lieben. Wasobiowe, erstaunt und entzückt, fiel auf die Knie und dankte den Göttern, dass sie sein Leben gerettet und ihm das Glück dieses Landes beschert hatten.
Ein paar hundert Jahre wohl lebte er hier in ungetrübter Freude, nichts von der Zeit merkend, denn wo sich alles gleichbleibt, nicht der Tod und keine Geburt sich ereignen, gibt es auch keine Zeit. Die Tage vergingen mit Musik und Tanz, in Gesprächen mit geistreichen Männern, im liebenswürdigen Umgang mit schönen und reizenden Damen. Schließlich jedoch beschlich Wasobiowe kaum merklich, kaum glaublich eine seltsame Müdigkeit, ein Sehnen nach einem Ende, ein Durst als ob nach dem Tod. Doch war der unstillbar. Hier gab es den Tod nicht. Hier konnte er nicht sterben. Auch seinem Leben gewaltsam ein Ende setzen, war hier unmöglich: es gab kein Gift, keine Waffen, keine Abgründe, in die er sich hätte stürzen können. Wollte er ins Wasser, trug es ihn wie einen Korken. Sein Wunsch zu sterben, war unerfüllbar.
Oft ging er alleine spazieren, wanderte über bergige Höhen, schritt durch Wälder und Wiesen, seerosenblühende Sümpfe, an schilf- und binsenbesetzten Seeufern, an Bächen und Flüssen entlang, die ihn an die Heimat erinnerten. Und da, eines Tages, blitzte ein Gedanke in ihm auf: Was, wenn ein Vogel ihn forttrüge?! Ein mächtiger Adler der Höhe? Ein anderer großer Vogel? Oh, das schien ihm, hin- und herüberlegt, machbar! Der Vogel musste stark sein. Und zähmen musste er ihn. Ein großer Storch fiel ihm auf, und auf ihn fiel seine Wahl. Mit Leckerbissen zähmte er ihn, bis er zutraulich wurde, gewöhnte ihn daran, ihm als Reittier zu dienen, dann auch, mit ihm zu fliegen. Und schließlich flog er auf seinem Rücken hinaus aufs offene Meer.
In viele merkwürdige Länder trug ihn der Storch, das merkwürdigste aber und am weitesten entlegene war das Land der Riesen. Die sind in jeder Hinsicht den Menschen weit überlegen, und wurde sonst Wasobiowe in den fremden Ländern ob seines Wissens und seiner philosophischen Weisheitslehren bewundert, lachten die Riesen hier gutmütig, gelassen und erklärten ihm, dies alles seien unvollkommene Notbehelfe der unvollkommenen Menschenkinder, derer sie nicht bedürften.
Alles sah Wasobiowe auf seiner Reise, alles was unter der Sonne und über der Erde ist. Alle Länder der Welt lernte er kennen, und als er endlich in seiner geliebten Heimat Japan auf dem Rücken des Storchs ankam, da brachte er seinen Landsleuten Nachricht über alles, was er gesehen, gehört und erfahren hatte, und sie lauschten seinen Erzählungen, merkten auf und erfreuten sich an seinen Beschreibungen, besonders aber an seinen Berichten über Horaisan. Dass er nichts erzählen konnte von dem, was über den Sternen und nichts davon, was unter dem Meer war, kümmerte sie nicht, denn vom Himmel hatte Buddha erzählt, vom Ozean Uschimataro, und das genügte.
Die Geschichten, die Wasobiowe von den glückseligen Inseln erzählte, die haben sich erhalten, und damit er nicht über den wundervollen Begebenheiten seines Lebens selbst vergessen wird, werden vielerlei Bilder von ihm gemalt, wie er auf dem Rücken des schönen großen Storchs durch die Luft reitet.
Das Kriegsschwert des Fuchses
Damals, als der Kaiser Itschijo über Japan herrschte, lebte ein sehr berühmter Waffenschmied in der Hauptstadt, der Munetschika hieß. Munetschika schmiedete die besten Schwerter, die es, soweit man auch gehen oder fahren wollte, gab. Weder Zeit noch Wissen sparte er; keiner Anstrengung wich er aus; keine Mühe ließ er sich verdrießen; jedes Schwert, das er schmiedete, sollte sein Meisterwerk werden. Und jedes wurde dazu, jedes übertraf – wäre das möglich gewesen – das vorige.
Während der Regierungszeit Kaiser Itschijos sah sich das Reich oft hart bedrängt. Viele mächtige Feinde bedrohten es, überzogen es mit Krieg. Sogar die Koreaner, die Japan vordem unterworfen hatte, wagten es und überfielen die Insel Kiushu. Jedoch inmitten aller dieser Wirren verstarb Kaiser Itschijo, Prinz Sanjo wurde sein Nachfolger. Kaiser Sanjo empörte der Mutwille der Koreaner; alle Kräfte mussten sich zusammenschließen, um diesem feindlichen Einfall ein Ende zu bereiten. Doch da verkündete ein Orakelspruch, dass nur ein neues Schwert, besser als jedes bislang in Japan vorhandene, den Sieg über die Koreaner bringen könne.
Wer sollte dieses neue Schwert schmieden? Nur Munetschika konnte das. Also schickte Kaiser Sanjo den Taschibana Mitschinari, der einer der tapfersten Krieger am Kaiserhof war, zu dem Waffenschmied mit dem Auftrag, sofort dieses vorzügliche Schwert zu schaffen, das alle bisherigen überträfe, und mit dessen Hilfe der Feind besiegt werden könne.
Munetschika fühlte sich geehrt von diesem Auftrag des Kaisers, doch er konnte nicht an die Arbeit gehen, so sehr die Zeit auch drängte, denn nichts war vorbereitet, und kein Gehilfe war zur Stelle, der die nötigen Handreichungen verstand und leisten konnte. Und doch war höchste Eile geboten! Während aber der kaiserliche Abgesandte und der Waffenschmied noch zusammenstanden und klagten, erschien mit eins ein weißer Fuchs in der Werkstatt – ein Bote der großen Göttin von Inari –, der befahl, dass Munetschika alles vorbereiten solle, um das Schwert zu schmieden. Der gehorchte und verrichtete alles genau nach der Regel. Der weiße Fuchs tat nun, als es so weit war, alle Handgriffe eines geübten Gehilfen, ohne die der Meister nicht hätte arbeiten können, und in kurzer Zeit war der Stahl geschmiedet, gekühlt, erneut geschmiedet, erneut gekühlt und wieder geschmiedet, dann aber geschliffen aufs Schärfste, dass ein im Wasser schwimmendes Haar, das gegen die Klinge trieb, durchschnitten wurde. Kein besseres Schwert hatte Munetschika als Meister geschmiedet, und kein besseres würde er schmieden so lange er lebte.
Freudig und stolz nahm der Waffenschmied das Schwert in die Hand, um es dem weißen Fuchs stolz nach allen Seiten zu zeigen, stolz auch auf seinen Namenszug weisend, der auf der Klinge wie bei jedem seiner Schwerter zu sehen war. Doch dieser stand nicht allein, denn neben dem Stempel mit seinem Namen eingeprägt stand »Der kleine Fuchs« zum Zeichen der göttlichen Hilfe.