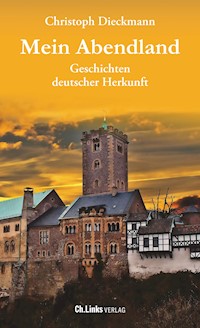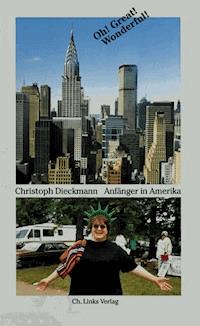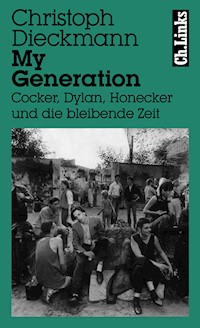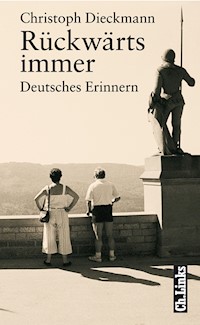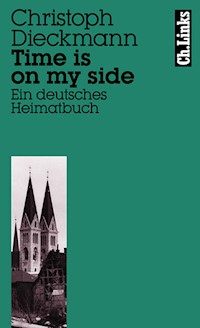
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Literarische Publizistik
- Sprache: Deutsch
1994 wurde ihm der Egon-Erwin-Kisch-Preis verliehen, doch ein "rasender Reporter" ist der ZEIT-Journalist Christoph Dieckmann nie gewesen. Wenn eilige Kollegen sich im Flug an spektakuläre Schauplätze begeben, ist er mit der Eisenbahn unterwegs und sucht die Mitte der Welt dort, wo andere sie am wenigsten vermuten: im großelterlichen Halberstadt, in Jena beim Fußballclub Carl Zeiss, bei den Kalikumpeln in Bischofferode, im Folk-trunkenen Rudolstadt, bei seinen alten Rock-Helden Rory Gallagher und J.J.Cale. Mit seinem vierten Buch, das mit einer Erinnerungsnovelle an die erste Liebe in der tiefsten "Bürokratischen Republik" beginnt, ist Dieckmann endgültig zum Erzähler geworden. Die Frage nach Heimat, nach verläßlicher, (mit)teilbarer Herkunft, verknüpft er mit der eigenen Identität. Die "kleinen Welten" der Menschen, von denen Dieckmann schreibt, fügen sich zu einem Heimatbuch fernab von neokonservativer Volkstümelei und nationalem Eifer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christoph Dieckmann
Time is on my side
Christoph Dieckmann
Time is on my side
Ein deutsches Heimatbuch
Meinen langsamen Lesern, und meinen ZEIT-Kollegen (vor allem Margrit Gerste) für einen Journalismus der Geduld.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, März 2017
entspricht der 1. Druckauflage vom September 1995
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Reihenentwurf: TriDesign, Berlin
Titelfoto: Halberstädter Dom (Privatarchiv Christoph Dieckmann)
eISBN: 978-3-86284-385-5
Inhaltsverzeichnis
Die Taten des treuen Heinrich
Eine Ermannung
Das alte Nest im Kopf
Wolf Biermann will seine Ostberliner Wohnung zurück – oder auch nicht
Eine Liebe im Osten
Der FC Carl Zeiss Jena unterwegs zum Glück
Das dreißigste Jahr
Jenas letzte Reise
Holetschek oder Die Kunst der Heimat
Jena besiegt den Tod
Der Bundesadler auf dem Broiler-Grill
Das zweite Länderspiel DDR–BRD
Der Schnee von gestern
Ostalgie
Weil der Trabi uns gehört
Ein Manifest der DDR-Identität
Das Salz der Erde und der Markt (I)
Der Tod von Bischofferode
Das Salz der Erde und der Markt (II)
Meines Kanzlers Land
Fünf Jahre Freiheit
Die Mühen am Harz
Halberstadt baut endlich auf
Dresden klagt nicht an
Zum 13. Februar 1995
Unsere liebe Stadt
Skins, Nazis und Vertriebene besuchen Rudolstadt
Die Welt im Heim
Rudolstadt erliegt dem Völkersturm
Ein Aufstand alter Männer
Der Garten Eden
Woodstock II: D-Day des Rock’n’Roll
Time is on my side
Quellenverzeichnis
Über den Autor
Die Taten des treuen Heinrich
Eine Ermannung
Frühe Jugend muß hoffen, wo käme sie sonst hin. Auch ist für jede Gegenwart die Zukunft offen; sie muß es sein. Ob sie es ist, philosophisch gesehen, hängt von den Launen des Philosophen ab und hat für das Handeln keine Bedeutung.
(Golo Mann)
1
Du aber warst nicht tot. Du lagst nicht am Grunde des Atlantik, die Lungen geflutet, Fischfraß, Muscheln in den Augen und Quallen im Hirn. So moderte in seinem Wrack Sir Francis, Englands Schwein zur See. Im Herzen unterm Rotrock rosteten zwei Spannen Stahl, um die der Degen seines Töters fortan kürzer war.
Zehntausend Fuß über Sir Francis’ Häupten segelte der Degen. Er stak an deiner Seite, wie du, die Hände auf dem Rücken, gefällig über Deck spaziertest. Die Brigg nahm gute Fahrt. Passatwinde hatten die Segel gebläht. Wir können’s heute noch schaffen, Kapitän! rief der Steuermann herüber. Du hobst die Hand zu Gruß und Dank. Gischt spülte die Stiefel, salzte die Haut und netzte dir den roten roten Kopfverband. DuBoise, der erste Offizier, nahm dich beim Arm: Robert, ich weiß, an wen du denkst. Du nicktest und wischtest dir verstohlen übers Aug’, daß niemand sähe, wie die Pupille Robert Surcoufs, Korsar Seiner Majestät des Königs von Frankreich, eine Träne gebar. Da schrie’s vom Ausguck: Land! Wahrhaftig, Cap Fréhel schimmerte im Abendlicht, die Bernsteinküste, Heimat, Marie-Catherine … Links glomm die Felsenburg des Kleinen Bé vorbei, vorn leuchteten die Mauern von Saint-Malo. Die Kathedrale ragte auf. Draußen aber, auf der Mole, tanzte alles Volk, jauchzte Willkommen und sang:
Freund, reih dich ein,
daß vom Hunger wir die Stadt befrein!
Über Gräben, die des Krieges Hader schuf
springt der Ruf:
Surcouf! Surcouf!
Und sie entluden den »Höllenhund von Saint-Malo«, verteilten die Säcke mit Korn und Mehl und speisten die darbende Stadt, die, seit England sie blockierte, nur von Luft und Liebe hatte leben müssen. In leichten Fesseln, mit gesenktem Haupt trotteten die Briten von Bord, geschmäht vom Mob, doch du sahst zu, daß den Gefangenen kein Leids geschah. Schon trug dich die Masse brausend durch die Stadt, an deinem Denkmal, deinem Grab vorbei. Da sahst du Marie-Catherine am Wege stehn. Du hobst den Arm: Die Menge stand und schwieg. Du sankst ins Knie, zogst den Degen, legtest ihn zu Füßen und sprachst: Verzeih mir, wenn du kannst. Verzeih, Marie-Catherine. – Verzeihen? Was, Robert? so frug sie sanft und strich dir übers blutumwundne Haupt. Du wußtest selber nicht, was zu verzeihen wäre, doch Vergebung wollen ist ein köstlich Ding und braucht, sehr groß zu werden, Sünde. So sagtest du (denn Frauen lieben keineswegs den ungesündigten Mann): Frag nicht, Marie-Catherine. Ich rede später, vielleicht, falls eines fernen Tags ein Herz den Kopf mir von der Seele wälzen kann. Da hob Marie-Catherine dich auf, sank ihrerseits dir an die Brust und wisperte: Ich will dein treues Weib sein, hörst du wohl? Und rüttelte dir sanft die Schulter.
Ja Mutti, sagte der Korsar, erwachte und mußte zur Schule. Es war auch besser so, da er für Marie-Catherine, offen gesagt, jenseits nautischer Sehnsucht kaum Verwendung wußte. Bis zur Vergebungsszene aber lief es wunderbar. Er träumte sie alle Nächte, vielfach variiert bis hinein ins Nibelungenhafte. Der Vorlagenspender hieß Gerard Barray und prägte in den sechziger Jahren den sogenannten Mantel-Degen-Film wie heute Michael Douglas Hollywood. Nichts Filmisches ist jemals wieder auch nur in die Nähe jener französisch-italienischen Schöpfungen gelangt, die damals das DDR-Landkino dominierten. Pirat und Musketier zu werden bedurfte es einer Barschaft von fünfzig Pfennigen – nicht immer vorhanden, aber selbst am Samstagnachmittag noch zu verdienen, falls in der Dorfkirche eine Hochzeit anstand. Der Bräutigam warf nach der Trauung Münzen. Die Jugend stürzte den Groschen und Pfennigen hinterher und balgte wie toll. In der Gosse liegend, kralltest du den Sechser, der zum Eintritt in das Kinoparadies noch fehlte. Der lange Endemann mit seinen Nagelschuhen trat dir auf die Hand. Du aber zerrtest die wunde Klaue samt Dreck und Sechser in die Tasche und hinktest eilends zum Dorfkrug, dessen Saal bereits verdunkelt war. Es gongte dumpf, der Projektor schnarrte an, Trompeten schmetterten, Shanty-Chöre männerten Ohé! Die Leinwand flammte auf: GERARD BARRAY in DER TIGER DER SIEBEN MEERE!
Ach, er hatte eine Neue im zweiten Teil (»Donner über dem Indischen Ozean«). Margret hieß sie und war englisch und brünett. Sie vor ihrem nichtswürdigen Gatten zu schützen, hieß es für Surcouf wieder eine Tötung vornehmen – vermutlich auch, um bei der Wiederkehr nach Saint-Malo Marie-Catherine endlich mit Vergebungsgründen zu erfreuen. Was aber tat jene? Saß sie daheim, weinte sich die Augen aus und trug, wozu ja Marien neigen, unter ihrem Herzen unschuldsvoll ein Kind? Roberts Kind? Nichts dergleichen ward bekannt. »Donner über dem Indischen Ozean« hatte Marie-Catherine vergessen.
Ähnlich trieb’s Gerard Barray als »Der Ritter von Pardaillan«, wo er den Surcouf zu Pferde gab. Im ersten Teil entriß er die blonde Violetta den Fährnissen der galanten Welt, in Teil II rupfte er einer braunen Metze am Mieder und lutschte ihr derart die Brüste, daß von Vergebung keinerlei Rede mehr sein konnte. Ging denn das nicht: ein Held und treu zu sein? Und jedwedes auffällige Verhalten erklärte der Ritter von Pardaillan mit mächtigem Gelächter, wobei er seinen Degen zog: Hoho, ich bin ein Gascogner, Sire! Ich durchbohre Sie!
Du warst kein Gascogner. Du warst der treue Heinrich.
2
Es war des treuen Heinrichs Lebensleistung (und gelang nicht vielen in der Bürokratischen Republik), bei größter Seßhaftigkeit ein noch größeres Heimweh auszuprägen. Hierzu nutzte Heinrich nicht nur die seltenen Entfernungen von daheim. Heimweh gelang ihm auch zu Hause, in dem kleinen Harzort, wo sein Vater das geistliche Amt versah. Kreismissionspfarrer durfte sich der Vater nennen und ermutigte in diesem Berufe die ansässige Bauernschaft zum Sammeln von Briefmarken und Stanniolpapier für die Weltmission. Es hieß, die Chinesen wären scharf auf Ulbrichtmarken.
Eines Abends kam die Weltmission zu Besuch. Auf der roten Couch, unter den wallebärtigen Aposteln Cranach des Älteren, saß Fräulein N’Dougoubougou, stammte aus Ghana oder Kamerun und war rabenschwarz, respektive perlweiß, da sie dauernd lachte. Sie nippte am Hordorfer Apfelsaft, ihr zu Ehren entkorkt (sonst gab es Hagebuttentee), strahlte und sprach: Iiiest ein biiießchen sauer! Heinrichs Mutter kochte eilends Hagebuttentee und bat Fräulein N’Dougoubougou, derweil Heinrichs Gute-Nacht-Zeremonie abzuhalten. Da saß sie ihm am Bett, lachte und duftete nach Zimt. Statt aber »O Haupt voll Blut und Wunden« anzustimmen oder »Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld« (denn es war Passionszeit), raunte sie mit kehligem Alt:
Awunikunikau awuni,
awunikunikau awuni.
Aiaiai iki aika imis,
aiaiai iki aika imis.
Awu.
Awu.
Awunikitschi.
Und ehe sich’s Heinrich versah, war Fräulein N’Dougoubougou über ihn gebeugt und drückte ihm auf die Stirne einen zimtenen Kuß. Ihre gelbe Batikbluse hing vor. Heinrichs Augen prallten auf ein paar Brüste, wie sie bislang ausschließlich dem Ritter von Pardaillan vorbehalten gewesen waren.
Anderntags beim Kochen fragte Mutter fast wie nebenbei: Wie fandest du sie denn? – Och, nett, sagte Heinrich, pilgerte auf den Trockenboden und sägte von zwei Wäschestützen die Spitzen ab. Die verdrahtete er zu einem Kreuz und nagelte es über Mutters Herd: Damit wir immer schön an den Herrn Jesus denken. – O du mein frommes Kind! rief Mutter und dachte: Meine schönen Stützen! Dann falteten sie die Hände und sangen, und der Kessel summte, und die Linsensuppe gluckste Heinrichs Lieblingslied:
Jesu, geh voran auf der Lebensbahn,
und wir wollen nicht verweilen,
dir getreulich nachzueilen,
führ uns an der Hand bis ins Vaterland.
Heimweh sagten wir dem treuen Heinrich nach und nannten dieses eine Lebensleistung. Er vollbrachte sie erstaunlich früh. Heimweh ist den Menschen aber allgemein und wird, je älter sie werden, immer allgemeiner. Denn sie können, was ihnen geschah, nicht ruhen lassen in seiner Einzigkeit. Sie müssen’s, fern vom Ursprung, wiederholen, größer machen, typisieren, müssen Motive sammeln in Alben und falsche Singulare in Atlanten, auf denen Heimat steht, Erinnerung, Ära, Generation und was der nachträglichen Verschmelzungen mehr sind. Sogar von Nation und dem Gefühl einer ganzen Epoche sprechen sie – war je einer Nation und hat die Epoche gefühlt? Patriot wünschen sie zu sein oder daß Deutschland verrecke; dabei ist Deutschland ein milliardisches Pluraletantum, und was der einzelne hofft und haßt, weiß kaum einmal sein Nächster. Und könnte wer Gedanken lesen, wie’s in der Bürokratischen Republik das Ministerium für Innereien sich unterfing, so würde er doch nichts begreifen. Das wirklich Einzelne hat nur sich selbst, so wußte Heinrich vor der Zeit. Es ist dem Vergleich entzogen; nur die Erinnerung verwandelt alles einander an und malt Geschichte und gründet unsere Partei. Einzeln bleiben und die Einzelheiten hüten, das war Heinrichs früher Beruf. In Gruppen fühlte und erfuhr er nichts. In seinem Heimweh wünschte er sich selbst zu finden als ein Zweites – was ein Paradoxon ist, aber Liebe würde es vollbringen. Er würde lieben und liebte bereits, denn Sehnsucht ist das Angeld der Liebe. Man muß es sparen, statt es zu verplempern in Gejammer.
Soll’s uns hart ergehn, laß uns feste stehn
und auch in den schwersten Tagen
niemals über Lasten klagen;
denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir.
Ja, er würde lieben. Würde nichts vergessen und verschmelzen, sondern als der Eine seiner Einzigen alle Einzelheiten schenken: Dann wären sie in summa, und er hätte sich erlöst. Diese Einzige dachte er sich nach dem Bilde Jesu, hoffentlich aber weiblich und leiblich und von ganzer Kraft begabt zu hören, wie Fräulein N’Dougoubougou mich berührte und ich den kranken Hasen an der Chaussee nach Anderbeck. Und auch du würdest mir erzählen, wie dich der Vater schlug, oder tröstete die Mutter? Du siegtest immer, oder quälten dich die Kameraden auf der Schulfahrt zur Steinernen Renne, so daß du Deine Kindheit anders Heimat nennen mußt als jene Überlegenen von damals und heute? Vorerst aber und solange man drinnen lebt, ist weder Heimat noch Kindheit, nur Stunde um Stunde. Die einen kommen, die andern kann keiner mehr nehmen.
Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz,
kümmert uns ein fremdes Leiden,
o so gib Geduld zu beiden;
richte unsern Sinn auf das Ende hin.
Seltsam, wie die Werdenden wünschen, Gewordene zu sein. Meist lebt der Mensch banal. Er schläft, er raschelt mit Papier, er kritzelt am Steuerbescheid, er wühlt im Supermarkt in den Konserven, er wartet auf den Bus. Doch woran er denken muß, wovon er schweigt, ist Liebe oder sonst ein fernes Licht. Darum befinden sich fast alle, die wir treffen, keineswegs am Bus oder im Supermarkt, sondern ganz woanders. Die Kinder träumen sich voraus, die Alten saufen sich zurück, hastdunichtgesehen über Stock und Stein, durch Wände und Wenden, durch tausend Nächte wie durch einen Rausch, der Epoche nicht kennt und keine Partei – zurück in das türkise Klassenzimmer mit Aquarium und Stummer Karte und der weißen Parole auf dem roten Fahnentuch, die keiner je geglaubt hat und Heinrich niemals vergessen, denn Samstag war es, und der Ofen glühte. Von links fiel Winterlicht durchs Fenster und vergoldete Angelikas Zöpfe. Was sang sie rein, sein Brautkind unter den Menschen, die heute alle sangen: Heinrichs Geburtstagslied.
Die Heimat hat sich schön gemacht,
und Tau blitzt ihr im Haar.
Die Wellen spiegeln ihre Pracht
wie frohe Augen klar.
Die Lerche singt, die Tanne rauscht,
sie tun geheimnisvoll.
Frisch das Geheimnis abgelauscht,
das uns beglücken soll.
3
Allen psychotisierenden Lebensdeutern zur Freude sei erzählt, wie der treue Heinrich Kenntnis davon erhielt, daß er der treue Heinrich wäre. Dreieinhalb war er und nachts immer noch nicht zuverlässig trocken, als die Mutter dringend einer Erholung bedurfte. Drei Geburten in vier Jahren hatten sie erschossen, zumal das Pfarrhaus achtundzwanzig Zimmer maß; die waren täglich zu bohnern. Heinrich wurde mitsamt seinem jüngeren Bruder nach Wernigerode verbracht, ins evangelische Kinderheim Heinrichstift. Diese Stätte protestantischer Gastlichkeit unterstand der Diakonisse Roswitha, welche einem Frauentypus zugehörte, für den auch im kirchlichen Bereich die Bezeichnung Dragoner zulässig ist.
Der Morgen graute, da ritt sie in den Schlafsaal ein, riß die Rollos hoch, kommandierte: Herrlicher Tag, Kinder! und trat an Heinrichs Bett. Nun? fragte sie süßlich unter ihrem Schnurrbart, nun, sind wir heute trocken, mein Kind? Heinrich dachte abwärts, schloß die Augen und schwieg. Die Dragonerfaust riß ihm das Bettdeck fort. Aha! schnob Roswitha, na was haben wir denn da! Kinder, kommt mal her! Stellt euch alle um Heinrichs Bett und lacht ihn kräftig aus. Und nun rufen wir gemeinsam: So ein großer Junge, pfui pfui pfui!
Diese Verwendung des Jesuswortes Lasset die Kindlein zu mir kommen mißhagte Heinrich so sehr, daß er Speis und Trank verweigerte und Galle erbrach, weswegen er am nächsten Morgen trocken war. Das prämierte Schwester Roswitha mit einem kakaogefüllten Lutscher der Marke »Lolliball«. Am folgenden Morgen wurde Heinrich befunden wie ehedem. Weil du wieder DAMIT angefangen hast, grimmte das Weib, darfst du bis auf weiteres dein Brüderchen nicht sehen! Heinrich weinte nach Mutti. Roswitha triumphierte: Mutti ist nicht da!
Als Mutti wiederkam – nach Wochen? oder Jahren? – und erfuhr, was vorgefallen war, versprach sie Heinrich auf dessen Begehr, fortan niemals wieder ohne ihn zu sein. Es scheint, daß du mein treuer Heinrich bist, so neckte sie und hielt ihn auf dem Schoß. Ach Mutterwort! Gar nicht lange, und Heinrich wurde den Großeltern in P. zugeführt. Selbdritt spazierten sie am Ufer der Stepenitz – Heinrich, Omi und der Teddy Petz. Omi lobte den Frühling: Sieh, Heinrich, die Forsythien! – Horch, Omi, die Kreissäge! – Ist es nicht wundervoll am Fluß? sprach Omi und sog schwärmerisch Mailuft. Heinrich schmiß den Teddy in die Strömung, um, wenn nicht gar mit Petz zu sterben, so doch zur Mutter heimgeschickt zu werden, moribunder Einfälle wegen. Omi zeigte das Geschehnis Großvater Hugo an, dem Superintendenten von P. Der donnerte: Wo ist der Bär? – Weg, greinte Heinrich, untergegangen. – Soso, aquis submersus, orgelte der Gewaltige, Storm-Liebhaber auch in pädagogischer Bewährung. Heinrichs Mutter hatte er vor dreißig Jahren den verschmähten Suppenteller in die pommersche Dorfschule hinterhergetragen, so daß die Tochter im Angesicht der kichernden Klasse schluchzend Graupen mampfen mußte. Heinrich hörte nun, auch er solle Mores! lernen, spürte die Haselrute und verschwand ungeatzt im Bett, wo er sofort ein entzündliches Fieber entwikkelte und ohne Unterlaß nach Mutti wimmerte. Sie lag im Kindbett, zweihundert Kilometer entfernt, aber Tante Inge kam und holte Heinrich nach Hause.
Es geschah hinter Stendal. Ein furchtbarer Schlag schmetterte von draußen ins Abteil. Das Fenster lag in Splittern und auf dem Boden ein mächtiges Stück rostigen Stahls, das hatte Heinrichs Schläfe gestreift. Tante Inge, starr: Junge, du hast einen Schutzengel! Heinrich nickte und sprach: Ich werde Mutti heiraten.
4
Von jeher hat der treue Heinrich darauf bestanden, seine Kindheit sei glücklich gewesen. Mit Eifer möchte der Mensch, dies zur Differenz hochbefähigte Wesen, seine Herkunft gröblich nach Glück oder Unglück scheiden und unterwirft sich somit dem Geschick. Gut läßt sich dies bemerken an den Memorierern der Bürokratischen Republik. Versuche doch mal ein Vermittler, im Sperrfeuer alternierender Ideologien sein unbehelmtes Haupt zu erheben! Dem Gewesenen und den Seinen kam das Mögliche abhanden: daß nämlich Zukunft wäre. Nur Deutung steht noch frei, umrungen von Untoten, die sich Grabinschriften dichten, weil sie das Dämmern und Erinnern mehr beheimelt als draußen der namenlos offene Tag. Aber das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben, lernte der treue Heinrich in der Schule aus einem kanonischen Buch der sozialistischen Literatur, und er muß es nutzen, daß ihn am Ende seiner Tage nicht sinnlos vertane Zeit schmerzlich gereue. Nikolai Ostrowski hatte dies geschrieben, ein jung gestorbner Rotarmist, den Totenvogel der Minerva schon im Zimmer. Heinrich las von großen roten Kämpfen gegen Weiß, von Liebesqual und beßrer Zeit, die ein gesetzmäßiger Ertrag der großen roten Kämpfe sei, und verdichtete sich all dies zum Abenteuer. Surcouf schwenkte den Degen, denn Ostrowskis beßre Zeit war jetzt, glückhaft und unwiderruflich entstanden durch Häufung einer komfortablen Summe von Jahren auf den letzten Krieg.
Noch Mutter mußte fliehen. Noch Vater war Soldat. Heinrich erschien Krieg als Torheit der Älteren. Nie wäre ihm eingefallen, seinesgleichen könnte später barmen, man habe selber in der falschen Zeit gelebt und also Menschenmögliches verpaßt. Heinrich wohnte in der besten aller Zeiten und in ihrer Fülle, dem rotweißen Glück der Seßhaftigkeit. Nichts trieb ihn fort. Das Leben war ein großes Haus am Wald, darin Heinrich noch für unendliche Kindheit zu bleiben gedachte. Die lebenden Alten standen als Schutzwall wider die flutende Zeit. Zwei Generationen hielten Wacht. Gerade erst hatte Großmutter Heinrichs Frage, ob alte Leute geschlachtet würden, engagiert verneint.
Wenn Heinrich eins besorgte, dann war’s die Lebensuhr des kleinen Muck, seines Katers, dessen Jahre mit siebenfachem Menschenmaß enteilten. Vordem hatte Heinrich das Huhn Braunhälschen geliebt, ein gleichmütiges Wesen vom Stamme Leghorn, das nie recht zu erkennen gab, ob das seltene Hühnerglück, an ein menschliches Herz gerührt zu haben, in seinem Bewußtsein eingetroffen war. Braunhälschen siechte, seit es sich eine rostige Reißzwecke in den rechten Huf getreten hatte. Eines frühen Morgens streifte Heinrichs Vater seinen grauen Kittel über, setzte die Baskenmütze auf, ging zum Hühnerstall, ergriff Braunhälschen, welches matt argumentierte, und führte es zum Richtblock. Am Verzehr des Geliebten nahm Heinrich nicht teil. Das Haupt wurde ihm zur Bestattung freigegeben. Halb waren die Lider geschlossen, die Pupillen trübe wie von Milch. Angstvoll berührte Heinrich den welken roten Kamm, umkränzte den Kopf mit Himmelschlüsselchen und begrub ihn unterm Haselstrauch in einem Schuhkarton der Weißenfelser Firma »Banner der Einheit«. Ein Backstein wurde aufgestellt und mit einem Kreuz beritzt, nebst den Jahreszahlen 1960–1963. Unter Tränen verfüllte Heinrich das Grab und sang:
Kleine Tropfen Wasser,
kleine Körner Sand
machen’s große Weltmeer
und das weite Land.
Am Abend setzte der Vater sich an Heinrichs Bett und verhieß, alle seufzende Kreatur, auch Tiere also, könnten in den Himmel kommen und würden dort ewiger Heimat teilhaftig. Daß Braunhälschen geseufzt hatte, war durchaus wahrscheinlich. Gott aber gibt einem jeglichen Samen seinen eigenen Leib, las Vater vor. Ein anderes Fleisch ist der Menschen, ein anderes des Viehs, ein anderes der Vögel, ein anderes der Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Dann sangen sie (denn es war wieder Passionszeit):
O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden
mit einer Dornenkron,
o Haupt, sonst schön gezieret
mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret:
gegrüßet seist du mir!
Heinrich dachte an das Haupt im Schuhkarton.
Dann wurde als Ersatzhuhn Muck, der Kater, angeschafft – per Zivilisationskonsens nicht zum Verzehr bestimmt, aber ein Streuner. Daß ihn Wollust außer Hauses trieb, erfuhr Heinrich spät. Er ahnte nicht, was in der sinnenfrommen Ehe seiner Eltern kaum zu fürchten war: daß erwachsener Friede umschlichen wird vom Partisanenkrieg der Geschlechter; daß in der Lust Heimat Verzicht bedeutet. Es balzt die Welt; nur Gott, ihr Aberbild, ist in sich selber treu, also daß ER sein Paradies verschließen mußte; und die Geschichte begann; und zeugte Kain, den Meuchler SEines Friedens, der unstet, flüchtig, heimatsüchtig draußen jagen soll und drinnen einen guten Gatten geben. Das also beichtete Heinrich Surcouf Marie-Catherine kniefällig unter der Mauer von Saint-Malo. Und hatte ein Wissen um Sünde, längst ehe er Geschlecht schien und Neil Youngs Lamento kannte: We all have to sin someday. Vorerst suchte er wieder mal den Kater. Fand ihn schließlich hinterm Regenbassin auf dem Rücken einer Kätzin. Rief: Mieze, Mieze! Rief aus Leibeskräften, wie er immer tat. Und der Kater, zitternd, gehorchte und stieg ab. Heinrich umfing ihn fremd. Der Kater kratzte, aber zart. Wahrlich, es ist nicht solche Liebe unter den Menschen, nur solche Eifersucht.
Auf dem Hofe wucherte Dickicht und verbarg ein altes Mauerwerk. Eines Tages gewahrte Heinrich Schurren und Schaben hinter einer tiefen Ziegelspalte. Er stakte seinen Stock hinein: panisches Getschiepe! Heinrich grauste. Er floh. Er kam am nächsten Tag, als ob er müßte, wieder zum Gemäuer. Stieß wieder den Stock hinein. Hörte die fiepende, flatternde Angst, die auch die seine war. Tat es wieder, und wieder, und wieder, und wollte ein Ende. Dann blieb es in der Mauer stumm. Heinrich war ein Mörder.
5
Es kam die Zeit, da er nicht länger im Hause der Eltern bleiben konnte. Die Schule war vorüber. Die Abschlußfeier hatte in ein Besäufnis gemündet, wobei Heinrich erstmals nennenswerte Mengen Bier verzehrte: zehn Gläser zu je einem Viertelliter. Nicht für die Schule habe man gelernt, sondern für das Leben, sprach eingangs der Feier der Direktor Rüdiger; fürderhin sei es an Ihnen, das erworbene Wissen tagtäglich in revolutionäre Praxis umzusetzen. Mächtig rockte die Band des Klassen-Hippies Horst, der einmal im Staatsbürgerkunde-Unterricht des Genossen Rüdiger geäußert hatte, Rauschgift kräftige die Erektion, doch eine Langspielplatte der amerikanischen Formation Creedence Clearwater Revival sei ihm lieber als jeder Orgasmus. Heinrichs Erschütterung entsprach der des Genossen Rüdiger. Was trieb Horst, und wie, und wo? Was geschah im Häuschen hinterm Kohlenhandel? Auch Heinrich war längstens behaart; auch er hatte vom Westradio etliche CCR-Songs aufgenommen. Lieber als die orgiastischen Grölgesänge des Tom Fogerty waren ihm jedoch die symphonischen Rockgespinste der Gruppen King Crimson und Yes, welche eher an den Morgenglanz der Ewigkeit gemahnten denn an Leiberei. Jeder Orgasmus! Sogar der Milchbart Heiko gab ja an, er sei schon mal bei einer Bergmannswitwe voll eingeritten, bei welchem Ausdruck er die Lippen leckte. Seit etlicher Zeit taxierten Heinrichs Kameraden sämtliche Weiber nur nach Arsch und Titten. Heinrich bemühte sich, auf den Charakter zu achten. Er galt als ritterlich. Das war ihm nicht ganz lieb.
Nach dem siebten Bier tanzte er mit Monika Wässrich, der Schärfsten der Klasse. Sie federte und flog, er hottete eckig durch das flackernde Getöse und fühlte sich verloren. Nichts, worin er führte – reden, denken, dichten –, ließ sich gebrauchen in dieser Hölle der Verrenkung. Horst brüllte »Hey tonight« ins Mikrophon, dann »I Put A Spell On You«; das war langsam. Monika packte Heinrich, drückte ihn an ihre Festigkeit, lachte, schwitzte köstlich, roch verworfen, und Heinrich wußte, was Horst ihm unlängst geflüstert hatte: Moni tut es jeden Tag.
Die Lichter verloschen. Die Band packte ein. Moni entwich. Auf dem Heimweg schwankte Heinrich in einem Pulk Bezechter. Plötzlich holte Elternbeirat Wässrich ein Messer aus der Tasche, schnäppte es auf, stach’s in Heinrichs jäh gestreckte Hand und brüllte: Du bist auch bloß ’n Ficker, du Ficker! Dann schluchzte Wässrich auf und rannte ins Dunkel. Es war nur ein Ritzer, aber Heinrich leckte Blut. Moni hätte er in dieser Nacht genommen als ein Krieger, statt kinderkeusch ins Knie zu sinken wie vor Marie-Catherine. Nicht länger träumte er Heimkehr. Er mußte hinaus.
Auch in diesem Sommer besuchten die Eltern das lutherische Erholungsheim in der Märkischen Schweiz. Heinrich machte dort die Bekanntschaft eines Frauenvertilgers. Dieser Steffen – sechzehn war er und aus Dresden – bekundete beim Bier, welches Heinrich immer noch sehr in Maßen genoß, Käthen seien nur zu einem gut: zum Uffbokken. Weder teilte Ritter Heinrich diese Ansicht, noch war er sattelfest im Gegenstand, weshalb er Steffen sportlich umzulenken suchte:
Gehst du in Dresden manchmal zu Dynamo?
Manchmal, sagte Steffen, eher selten. Höchstens zum Käthen abgreifen. ’s gibt bärische Käthen bei Dynamo. Da pimpern alle, sogar die Spieler. Der Boden hat die Schwester vom Schade geschwängert, da wollte der Schade von Dynamo gehen.
Sag mal, wenn du so viele Mädchen kennenlernst, das ist doch dann mehr flüchtig, stimmt’s?
Meinst’n das?
Na, da kann sich doch gar nichts Tieferes entwickeln.
Wieso, was’n Tieferes?
Na, die meisten Mädchen wollen ja doch, daß es einem Ernst ist.
Logisch mach ich Ernst. Volle Knolle.
Und wie lange bleibt ihr durchschnittlich zusammen?
Woche oder so.
Wenn du dich so schnell von den Mädchen wieder trennst – da ist doch wohl nichts zwischen euch?
Was soll sein? Krach oder was?
Na, stöhnte Heinrich, du schläfst doch bestimmt nicht mit den ganzen Mädchen?
Immer, sagte Steffen fassungslos.
Und was hast du von so flüchtigen Begegnungen?
’n bärischen Trieb, sagte Steffen. Du bist ’n Komiker, was? Nä, du bist Jungfrau.
Dies zu beheben, und zwar bei unbefleckter Ritterschaft, war künftig Heinrichs dringendes Ziel. Als Sofortmaßnahme legte er, bis dato Hochdeutscher, sich ein derart tierisches Sächsisch Dresdner Prägung zu, daß Heinrichs Mutter drohte, den familiären Verkehr zu unterbrechen, bis er der menschlichen Zunge wieder mächtig sei. Und dieser Steffen ist ein Bock, das kann ich riechen. Nimm dir an Vati ein Beispiel! Der war ein schüchterner Mann, unerpicht auf maskuline Insignien, was sich mit der leiblichen Entsagungsfreude seines Glaubens gut vertrug. Einst fragte ihn Heinrich nach seinem liebsten und seinem unliebsten Schauspieler. Er sagte: Heinz Rühmann und Hans Albers. Heinrich aber verwünschte, was von seines Vaters Scheu auf ihn gekommen war. Lange hielt er die Christenkeuschheit wie die sozialistische Moral für das Übliche der Welt und sich für ihren kommenden Überwinder. Nun lernte er, daß der gangster of love kein edler Einzelgänger ist, weil tatsächlich alle pimpern bei Dynamo. So ging die Welt, und statt sich für unerlöst zu halten, erklärte sie die Unzucht für den hundsnormalen Trieb zu bleiben, was man war, und nichts zu erstreben als die organisch formulierten Rechte der Kreatur. Selbstredend war die Bürokratische Republik normal im Sinne der Mehrheit, nur Heinrichs Vater unterhielt zu keinerlei Mehrheit Kontakt. Undenkbar, daß seine Kinder Massenorganisationen beitreten sollten, seit er unter Hitler deutsches Volk gewesen war.
Solismus, nicht Männlichkeit, hieß also Heinrichs Erbe. Niemals war sein Einzelgängertum in einer Masse aufgehoben – nicht bei den 160 000 im Springsteen-Konzert, nicht bei der staatsstürzlerischen Halbmillion am 4. November 1989 in Ostberlin; und als die Mauer platzte, versäumte er, sich bei den neuen Landsmannschaften zu sammeln, als gäbe es Heimat auf eigene Faust.
Jetzt aber war er sechzehn und ein Sommerfrischling im Lutherstift. Sie hieß Bettina, Arzttochter aus Gera, mit ihrer Mutter angereist. War sie hübsch oder schön? Beides, fand Heinrich nach zwei Tagen süßen Schauders und verstohlener Beschau. Dann paddelten sie auf dem Weißen See. Das Boot schabte an Schilf und schurrte glucksend über Wasserrosenblätter. Sie kamen heim bei Sonnenuntergang. Er hatte wild erzählt, aber ohne Aufschnitt; den mochte sie nicht. Sie zeigte ihm den Haubentaucher und ließ ihn siebenmal vergeblich raten, wo das submarine Huhn wohl wieder auftauchen mochte. Sie lachte viel und zwinkerte ihm zu.
Was sich neckt, das liebt sich, jubelte der innere Heinrich, zog das Boot aufs Land, sagte zu Bettina gute Nacht und stürmte, irgend jemand zu umarmen, die Stiege hoch zur Dachkammer des Lutherstifts, wo das Brüderchen schlief. Es rieb die Augen: Was is’n? – Liebe ist! jauchzte Heinrich, drückte den Kleinen, küßte ihn, deckte ihn wieder zu und wandelte nochmals schwärmerisch allein zum See. Morgen, morgen würde er sich offenbaren.
Sie wollte ihn nicht. Als guten Freund sehr gern, für mehr sei sie – zu jung. Sie saßen am Steg; es dämmerte wieder. Heinrich zog sämtliche Register juveniler Düsternis und sprach geläufig über Einsamkeit. Es gibt eine Hölle, redete er dumpf. Die Hölle – das sind die anderen. Bettina äußerte, zu jenen würde sie nun gern gehen, in den Gemeinschaftsraum, Canasta spielen. Bleib noch, sagte er und faßte – Wagnis! – ihre Hand. Sie entzog sich. Fünf Minuten, bat er. Warum magst du mich nicht?
Aber ich mag dich doch. Ich finde dich nett.
Warum willst du mich nicht?
Ja warum? dachte sie. Muß ich das sagen und ihn kränken? Soll er sich kennen, so dünn in diesem unmöglichen Hemd, mit der Hornbrille und den strähnigen Zotteln, auf die er so stolz ist? Vielleicht bin ich, was er ja für das Schlimmste hält: eine Spießerin. Ich liebe Ordnung, Sauberkeit und Maß. Ich mag nette, hübsche Jungs. Der hier ist maßlos ungestüm, vor allem aber ist er dünn, dünn, dünn.
Also sagte sie: Du weißt es doch. Ich bin zu jung.
Das ist es nicht.
(Schweigen.)
Also warum?
Laß es gut sein, Heinrich.
Warum? Warum? Warum? Warum?
Du bist zu dünn.
Heinrich war vernichtet. Er machte sich ein paar schöne Trauertage, wobei er Jochen Kleppers »Vater« las, dessen Motto, der Leitspruch Friedrich Wilhelm I., seiner Herzenslage würdig schien: Könige müssen mehr leiden können als andere Menschen.
Er las und las, siebenhundert Seiten Kleindruck. Fuhr mit dem Boot hinaus, suchte Winde, ließ sich treiben, las von des Preußenprinzen Flucht und Haft, von Kattes grausem Ende zu Küstrin, von Gundling und v. Creutz, von Fritzens Unzucht zu Dresden, von der seichten Seele der königlichen Mutter: Sind Briefe aus England? Über allem aber waltete der Vater und gebot dem Land, indem er den Trieben seines Volks entsagte. Aber dazu war er zu jung, um zu ermessen, wie verändert von Jahr zu Jahr König Friedrich Wilhelm zum Herbste seinen Einzug auf Schloß Wusterhausen hielt. Er kam nicht mehr als der Blühende, Leidenschaftliche, der kühn und kraftvoll Neues plante, wirkte, ordnete und flüchtige Ruhe bei den Seinen suchte: Frau, Kinder und Jagdkumpanen. Er kam als einer, der das längst Begonnene und zu vielen Malen schon Zerstörte immer wieder von neuem aufnahm: Das Heer. Den Staat. Die Kassen. Die Felder. Die Fabriken. Die Provinzen. Die Erziehung des Einen. Die Ehe.
An einem der Klepperschen Abende begleitete Heinrich die Eltern in die Kurlichtspiele. Bergmans »Berührung«: Die Arztfrau Karin – verläßlicher Gatte, zwei treffliche Teenie-Töchter – begegnet David, einem Archäologen, der nahe ihrer Kleinstadt gräbt. Eine hölzerne Madonna fördert er zutage, Jahrhunderte verborgen und geschwängert von Termitenlarven … Heinrich süchtelte neuerdings nach Symbolik. Er wohnte jetzt im doppelten Boden der Welt und schaute kundig zu, wie sie einbrach, die intakte Ehe. Ach, wie die Gatten milde miteinander scherzten; wie sie beim Frühstück die Dinge des bürgerlichen Tages planten und abends resümierten; wie sie herbstlich Äpfel lasen unterm bunten Baum. Und dann kommt Krieg, kommt David, bärtig und labil, und hat nichts zu bieten als den fremden Männerleib in einem alten Eisenbett in räudig kalter Kammer. Die Kammer wird Karin zur Welt. Erstmals, nach fünfzehn Jahren, betrügt sie ihren Mann, stöhnt, vögelt, liebt ja wirklich, dachte Heinrich schaudernd. Andreas, der Gatte, ahnt alles und hält stille, bis er irgendwann das Ultimatum stellt. Karin verläßt ihn, wie sie David verläßt, als der seinerseits die Dauer will. Da geht sie fort, schwanger, ihr egal von wem, über die kleine Brücke im Park, geleitet nur von einem Hirtenlied auf Flöte und Klavier, dessen wehe Skandinavik Heinrich nie vergißt.
Was sollte er werden? Ein Gatte und Ernährer wie sein Vater? Oder David: born to be wild, zu keiner Heimat bestimmt als der Freiheit des Augenblicks? Heinrich wollte Freiheit als seßhaftes Glück. Er wußte nicht, daß da keiner zu entscheiden hat. Es wird entschieden.
Sie gingen noch auf ein Bier. Ich fand diesen David unerhört, zürnte Vater, selten aufgeregt. Diese Karin sowieso. Was fehlte der Person? Die hatte doch alles. Und Andreas hat sich bewundernswert verhalten. – Mutter schwieg und sagte dann: Man steckt nicht drin in den Menschen. Manches sieht von außen eben anders aus. Der Vater: Trotzdem darf man niemals seine Schuldigkeit vergessen! Nachts stand der König lange vor der Schwelle, die ihn von der Gattin und einer Vergangenheit trennt, die ihm sehr weit schien. Der Regen rauschte nun doch so schwer und voll und ebenmäßig, als vermöchte er die verbrannte Erde noch einmal fruchtbar zu machen. Als dann der König vor die Gattin trat, den Leuchter über sie erhebend, gewährte ihm diese Nacht den letzten Irrtum seiner einstigen Liebe. Als hätte sie Monat um Monat auf diese Stunde gewartet, blickte Sophie Dorothea beseligt lächelnd zu ihm auf … Es war zuviel gewesen zwischen Herbst und Herbst.
Ein Neues wuchs in Heinrich auf: Größe. Freilich klappte sie zusammen, sowie sich Heinrich von den Vorlagen seines erhabenen Fühlens entfernte. Solch hohen Pump hatte er schon empfunden über der Lektüre von Heinrich Manns »Henri Quatre«, wobei er sich in den guten König Heinrich von Navarra schmolz und den Franzosen seine pax Henrici schenkte und sonntags ein Huhn in den Töpfen. Derlei Bürgerkönigtum demokratisch vervielfacht zu haben, war ja die Staatsdoktrin der Bürokratischen Republik. Heinrich aber, elitär bedarft, nicht egalitär, wünschte der Welt Audienzen zu gewähren. Er ließ Bettina nochmals vor sich treten und sprach, von Würde gepreßt:
Man muß ja wirklich nicht dauernd händchenhaltend rumrennen. Wichtig ist zu wissen, daß wir zusammengehören. Das zu gestehen (und Heinrich lachte gütig), fehlt dir ein bißchen der Mut, stimmt’s?
(Er fängt schon wieder damit an, dachte Bettina.)
Was allgemein für normal gilt beim miteinander Gehen und so, kann uns ja gar nicht kümmern. Das sind die Spießersitten von Gesinnungsbauern. Davon hab ich absolut nichts an mir; du weißt das. Ich denke über Grenzen hinweg. Weißt du, ich tu mich nicht damit dicke, aber ich bin leider wirklich der klügste Mensch, den ich kenne. Bloß all diese Klugheit ist tieftraurig in mir vergraben. Du könntest sie heben. Ich hätte keinerlei Geheimnis vor dir. Alles, alles würde ich dir sagen …
(Bloß nicht! dachte Bettina.)
Bettina sagte: Ich habe zu Hause in Gera eine gute Freundin, Sabine, mit der kann ich über vieles reden. Die anderen Sachen bespreche ich mit meiner Mutter oder mit meinem großen Bruder. Wir beide können Brieffreunde sein, das habe ich dir aber schon mehrmals gesagt. Wenn du mich wirklich gern hast, dann halte dich ein bißchen zurück. Die anderen Gäste gucken mich schon dauernd an, als ob ich schuld bin an deiner Leidensmiene. Das ist peinlich. Nimm’s einfach ein bißchen locker.
Locker! heulte Heinrich auf; es würgte im Hals. Versprich mir wenigstens, daß du nächsten Sommer keinen andern hast!
Das kann ich nicht versprechen, sagte Bettina freundlich.
Ich könnte das! rief Heinrich. Ich wäre treu!
Ja, viel zu sehr, sagte Bettina, sprang von der Schaukel und ging ins Haus. Zurück blieb der zerschmetterte Monarch. Besudelt lag das jüngst erlesne Throngefühl im Dreck. Die Ärzte standen über das Haupt des toten Königs gebeugt … Bis zu der Sektion, so hatte der Vater befohlen, sollte man ihn waschen, mit einem weißen Hemde bekleiden und auf einem hölzernen Tische aufbahren … Die Ärzte mußten lernen an ihm, der so unermeßlich litt und viele Tode starb.
Es war entschieden. Er sollte doch kein Vater sein. Das Schicksal hatte Heinrich zum Rock’n’Roller berufen. Er war David, nicht Andreas, und mußte tragisch leben, stolz und frei. In dieser hohen Mission reiste er nach Berlin. Die Hauptstadt der Bürokratischen Republik wurde gerade heimgesucht von jener weltoffenen Atmosphäre, die der Vorsteher des Landes schon seit längerem plante. Berlin, die Räuberin unter den Städten, tanzte, wimmelte und sang, denn Hunderttausende von internationalen Gästen, der progressive Nachwuchs sämtlicher verfügbaren Nationen, begingen die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten.
Selbst in diesem Tollhaus fiel Heinrich auf. Er hatte sich in seine Kutte geworfen, den Parka mit dem großen polnischen Black-Sabbath-Aufnäher. Lässig Gummi kauend hinterm Existentialistenblick, behaart mit der coolsten Matte der Stadt, so lungerte er am Fuße des Telespargels, im Volksmund auch Fernsehturm genannt. Bald war er weiblich umringt, grunzte Anglizismen und schrieb Autogramme. Where you want my writing? fragte er entzückte Blauhemd-Maiden in einem Amerikanisch, das seiner Harzer Abkunft durchaus inne war. Hier, hier, on arm! quietschten und drängelten die Dirnen, und Heinrich signierte mit Schwung: DANNY JOE BROWN, MANHATTAN!!! Auch Russinnen sowie Kämpferinnen von MPLA, FSLN, GST und dergleichen mehr spendete er unvergeßliche Impressionen vom Anderen Amerika.
Sodann betrat er das Kaufhaus »Centrum« am Alexanderplatz und daselbst die Damenkonfektion. Dort entblößte er sich weidlich und bestieg eine glitzernde Abendrobe, bis er den schrillen Ruf Gitti kucke mal, das giiiiibt’s doch nicht! vernahm und sich zum Verlassen der Abteilung aufgefordert fand. Er eilte ins Männerklo und schnürte sich den rechten Unterschenkel aufs Gesäß. Derart versehrt hüpfte er zur Herren-Schuhabteilung und verlangte einen Rinds-Boxcalf-Slipper der Größe zweiundvierzigeinhalb – den linken bitte! Die Verkäuferin stammelte, man gebe nur komplette Paare ab. Darauf schalt Heinrich die Bürokratische Republik einen Betrug am behinderten Menschen. Verhaftung unterblieb, wegen weltoffener Atmosphäre.
Das waren die ersten Taten des treuen Heinrich in der großen Welt. Er hatte bestanden. First we take Manhattan / than we take Berlin. Abends reiste er zurück. Kurz vor dem Lutherstift betrat er eine Kneipe, um die triumphale Heimkehr spirituell zu dehnen. Am Ecktisch saßen drei Kerle, die rochen nach Stall und redeten grob. Heinrich klopfte auf den Tisch und wurde eingeladen. Sie sahen auf seiner Kutte das Black-Sabbath-Emblem. »Paranoid«, sagte der eine, »Iron Man«, feine Dröhnung, aber Purple ist besser. Jethro Tull ist besser, sagte der zweite. Der dritte kippte Pfeffi, krampfte Grimassen und markierte wüste Soli. Geht klar, Ete, sagte der erste, du bist Hendrix. Sie soffen die Nacht herbei. Dann stolperten sie durch Felder und Wälder – Stunden, wie es Heinrich schien, bis hinter Bäumen gelbe Lichter blakten. Das war Bollersdorf, wo Ete eine Kate behauste. Hau dir hin, hörte Heinrich. Ick bin Ete, biste petete? Hier is beim Bauern. Heinrich krachte in eine speckige Couch und war weg. Gegen drei weckte ihn ein brüllendes Gebell. STILLSTANN! schrie Ete. AUGEN AUS! und hob langsam den rechten Arm zum Hitlergruß. WOODSTOCK HÖRT DIE HYMNE! Er schaltete am Tonband: Frijid Pink, »House Of The Rising Sun«.