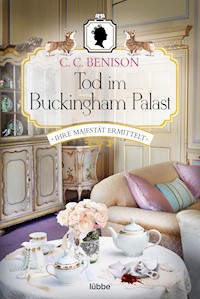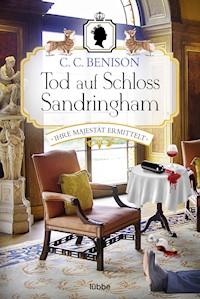
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ihre Majestät ermittelt
- Sprache: Deutsch
Kurz nach der Ankunft von Queen Elizabeth II. und ihrem Hofstaat auf Schloss Sandringham taucht in der Dorfhalle die Leiche einer Frau auf, die Ihrer Majestät zum Verwechseln ähnlich sieht und die sogar eine funkelnde Tiara trägt. Während die königliche Leibgarde ihre Sicherheitsvorkehrungen hochfährt und die Polizei bei den Ermittlungen vor allem eine Gruppe radikaler Tierschützer ins Visier nimmt, hat die Queen selbst einen anderen Plan. Auch diesen Mörder will sie mit Jane Bees Hilfe dingfest machen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungPrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22EpilogBemerkung des AutorsÜber dieses Buch
Band 2 der Reihe »Ihre Majestät ermittelt«
Kurz nach der Ankunft von Queen Elizabeth II. und ihrem Hofstaat auf Schloss Sandringham taucht in der Dorfhalle die Leiche einer Frau auf, die Ihrer Majestät zum Verwechseln ähnlich sieht und die sogar eine funkelnde Tiara trägt. Während die königliche Leibgarde ihre Sicherheitsvorkehrungen hochfährt und die Polizei bei den Ermittlungen vor allem eine Gruppe radikaler Tierschützer ins Visier nimmt, hat die Queen selbst einen anderen Plan. Auch diesen Mörder will sie mit Jane Bees Hilfe dingfest machen!
Über den Autor
C. C. Benison ist das Pseudonym des kanadischen Schriftstellers und Journalisten Doug Whiteway. Er wurde 1961 geboren und studierte an der University of Manitoba und der Carleton University in Ottawa. In den 1980er-Jahren arbeitete er als Reporter für die Winnipeg Tribune und die Winnipeg Free Press. Danach schrieb er als freier Journalist für diverse Magazine und Zeitungen und unterstützte Unternehmen als freier PR-Berater. Mit seinen Kriminalromanen gewann er zahlreiche Preise. Er lebt in Winnipeg/Kanada.
Kriminalroman
Aus dem kanadischen Englisch vonHeike Rosbach
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1997 by C. C. Benison, this translation published by arrangement with the Cooke Agency International, CookeMcDermid and Liepman AG.
Originally published in English by Bantam Books
Titel der englischen Originalausgabe:
»Death at Sandringham House. Her Majesty Investigates«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dorothee Cabras, Grevenbroich
Titelillustration: © Richard Jenkins Photography;
© Andreas von Einsiedel/gettyimages
VikaSuh; Afishka; Atlas Agency; Yeti studio/Shutterstock
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0970-5
luebbe.de
lesejury.de
In Erinnerung an Nancy Turriffund für Jeanne Allen,die sich bestimmt freuen wird
Prolog
Von den fünf Hauptresidenzen Ihrer Majestät – Buckingham Palast, Schloss Windsor, Holyroodhouse, Balmoral und Sandringham – mag ich Schloss Sandringham am wenigsten. Nicht, dass das Anwesen nicht beeindruckend wäre. Es ist wirklich ein großer, ziegelroter, auf schon witzige Weise hässlicher, weitläufiger englischer Landsitz, viel gemütlicher als der Buckingham Palast, der eher einem großen Hotel gleicht als einem Haus, das man gern sein »Zuhause« nennen würde. Die Personalunterkünfte in Sandringham House, wie es eigentlich heißt, sind ein wenig besser als die Kämmerchen im Dachgeschoss des Buckingham Palasts. Die Zimmer sehen tatsächlich aus, als wären sie in diesem Jahrhundert eingerichtet worden, was mir nur recht ist, denn ich, Jane Bee, Hausmädchen, muss in einem von ihnen wohnen.
Außerdem sind die Räumlichkeiten, die die Königin und ihre Familie auf Sandringham bewohnen, viel heimeliger. Man wird nicht schon von ihrer schieren Größe erschlagen, auch wenn es darin viel mehr englischen Landhaus-Krimskrams gibt, Nippes und Plunder wie Königin Alexandras Sammlung chinesischer Figuren im Großen Salon, die Leute wie ich abstauben müssen, ohne etwas zu zerbrechen.
König George V., der Großvater der Königin, schrieb einmal: »Das liebe alte Schloss Sandringham, der Ort, den ich mehr als alle anderen Orte auf der Welt liebe.« Der hatte gut reden. Seine Vorstellung von Spaß bestand darin, Briefmarken zu sammeln und in der Gegend herumzuballern. Ersteres war für mich schon immer das langweiligste Hobby der Welt. Und was das Letztere angeht – nun ja, Sie sollten mal die vielen Fasane sehen, die so eine feine Jagdgesellschaft nach Hause bringt. Da kommt einem durchaus das Wort »Gemetzel« in den Sinn, und das soll nichts sein im Vergleich zu den Tagen von George V. und seinem Vater, Edward VII., als Ihre Majestäten und ihre adligen Freunde mit ihren Flinten alles abknallten, was Flügel hatte.
Sie sehen schon, ich kann der Jagd nichts abgewinnen. Aber das ist es gar nicht, was mir an Schloss Sandringham missfällt. Es ist vor allem die Tatsache, dass das Anwesen so abgelegen ist. Es liegt rund einhundertzehn Meilen nordwestlich von London in Norfolk, mitten in diesem riesigen Grundbesitz von zwanzigtausend Morgen, die größtenteils aus Feldern und Wald bestehen. Im Frühjahr, Sommer und Herbst soll es sehr hübsch sein, hat man mir gesagt, aber ich habe es nie im Frühjahr, Sommer oder Herbst gesehen, wenn die Gärten in voller Blüte stehen und die Felder bestellt sind. Ich habe Sandringham immer nur im Winter erlebt, wenn die königliche Familie hier die Weihnachtstage und den Jahreswechsel verbringt.
Den Winter kann ich gut ertragen. Ich bin schließlich Kanadierin. »Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver«, haben wir voller Begeisterung im Französisch-Unterricht der Grundschule in meiner Heimatstadt Charlottetown auf Prince Edward Island gesungen. »Mein Land ist kein Land, es ist der Winter.« Aber der Winter in Norfolk ist anders als der im mit glitzerndem Schnee bedeckten Kanada. Er ist englisches Winterwetter in hoch konzentrierter Dosierung. Peitschende Winde wehen von Norwegen über die Nordsee herüber. Der Regen bohrt sich einem ins Gesicht. Die Kälte dringt einem bis in die Knochen. Wenn ich manchmal von einem Fenster des Schlosses zum Himmel hinaufschaue, scheint er sich vor Kälte und Nässe förmlich zu biegen.
Mein erster Winter in Sandringham war ein bisschen melancholisch. Ich war zu jener Zeit seit fast eineinhalb Jahren von zu Hause fort und stand knapp ein Jahr im Dienste Ihrer Majestät. Es war mein zweites Weihnachtsfest in Europa, während meine Familie sich im Haus meiner Großmutter in Charlottetown um den Baum scharte und sich den Truthahn schmecken ließ. Gut, meine schon etwas älteren Eltern, Steve und Ann Bee, standen damals vor der Scheidung, doch meine ältere Schwester Julie, die Frau eines Kartoffelbauern, hatte unmittelbar vor den Ferien das erste Enkelkind meiner Eltern zur Welt gebracht und damit eine Phase des Friedens und guten Willens eingeläutet – äußerst passend angesichts der Jahreszeit –, und ich sehnte mich danach, in Heathrow in einen Flieger zu steigen und bei dem unvergesslichen Foto-Moment der Familie dabei zu sein.
Leider gehörte ich im königlichen Haushalt nicht eben zu den Dienstältesten. Schlimmer noch, ich war dort eine der wenigen Nicht-Briten. Die meisten anderen Hausmädchen hatten Ausreden vorgebracht, warum sie die Feiertage im Schoße ihrer Familien in Barnstaple oder Wolverhampton oder Glasgow verleben müssten. Falls nötig, konnten sie ja auch innerhalb von ein oder zwei Tagen wieder ihren Dienst aufnehmen. Ich nicht. Eine Reise nach Nordamerika, vor allem an einen Ort wie Charlottetown, war eine große Sache.
Ich hatte gehofft, ich könnte den Weihnachtstag in dem Jahr bei meiner Großtante Grace in Long Marsham verbringen, einem Dorf am nordwestlichen Rande von London, doch auch daraus wurde nichts. Und so fuhr ich mit einigen anderen Hausmädchen in einem großen, alten Bus ein paar Tage vor der königlichen Familie nach Sandringham.
Das war mein erster Winter dort. Im nächsten Jahr bekam ich Heiligabend sowie den ersten Weihnachtstag frei und verbrachte ihn mit Tante Grace und – Überraschung! – meinem Vater. Der hatte nämlich beschlossen herauszufinden, warum ich in England herumlungerte, statt in Kanada zu sein, wo ich seiner Meinung nach hingehörte. Am zweiten Weihnachtstag musste ich mich allerdings wieder in Norfolk zur Arbeit zurückmelden. Ich freute mich nicht wirklich darauf.
Wie ich schon sagte, ist Schloss Sandringham so abgelegen. Es gibt nicht genug zu tun. Oh, arbeitsmäßig ist man schon ausgelastet, obwohl die Hausdame dort, unsere Chefin, keineswegs so eine Sklaventreiberin ist wie Mrs Harbottle, die Stellvertretende Hausdame im Buckingham Palast. Es ist die Zeit nach Feierabend, die einen kirre macht. Man kann im Aufenthaltsraum des Personals abhängen. Oder in seinem Zimmer sitzen und lesen. Aber wenn man ausgehen will, muss man eine halbe Meile durch Kälte und Dunkelheit zum Pub in Dersingham marschieren, der größten der sieben Ortschaften, die zum Landsitz gehören. Nach King’s Lynn, der nächstgelegenen größeren Stadt, sind es fünfzehn Meilen, und jemanden mit einem Auto aufzutreiben, der bereit ist, einen zum Chicago Rock Café oder zu einem der anderen Clubs zu fahren, ist nicht so einfach.
Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich nach Sonnenuntergang aus dem Fenster meines Adlerhorsts über die von den Außenscheinwerfern angestrahlten Flecken nassen Schnees hinweg auf die schwarzen Bäume und den dunklen Himmel starre und um eine Verfassungskrise bete, die die Königin zwingt, nach London zurückzukehren und uns alle mitzunehmen.
Der zweite Winter in Sandringham jedoch war nicht ansatzweise so langweilig, wie ich gedacht hatte. Wie sich zeigen sollte, gab es eine kleine Krise. Keine Verfassungskrise. Und auch keine, die uns gezwungen hätte, in die Hauptstadt zurückzukehren. Aber die Krise war interessant, wie Ihre Majestät in einem ihrer Momente unvergleichlichen Understatements sagen dürfte. Allerdings war sie auch tragisch.
Kapitel 1
Alles begann am Morgen nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Nachdem ich mehrere Stunden lang meinen üblichen Pflichten nachgegangen war – staubsaugen, abstauben, Betten machen und dergleichen –, erhielt ich plötzlich eine Aufgabe, die nicht zu meiner eigentlichen Jobbeschreibung passte. »Zur richtigen Zeit am richtigen Ort«, könnte man wohl sagen, obwohl der scheinbar glückliche Zufall durch einen wichtigen Faktor gefördert und begünstigt wurde – eine Grippe-Epidemie, die die Hälfte des Personals ans Bett fesselte. Genau wie die Pest im vierzehnten Jahrhundert den Feudalismus zu beenden half, so hatte die Grippe in jenem Winter am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts beunruhigende (wenn auch nicht dauerhafte) Folgen für die starre Palast-Hierarchie. Kurz, man sah sich plötzlich Dinge tun, die man normalerweise nicht tat.
Deshalb machte ich spät an jenem Morgen nicht die Betten im Schloss, sondern war im Gemeindesaal in Dersingham.
»Darum kümmerst du dich.« Ein Finger hatte auf mich gezeigt, als ich an den Küchen direkt neben dem Waffenzimmer vorbeiging, und obgleich Mrs Benefer, die hiesige Hausdame, zunächst Einwände erhoben hatte, gab sie doch bald nach, und ich düste in einem der Land Rover durch die Norwich-Tore auf die Straße nach Dersingham. Mitgegeben hatte man mir eine Tasche, in der sich ein Gefäß mit Pellkartoffeln und ein Karton mit Kristallgläsern befanden, die beim eigentlichen Konvoi zum Gemeindesaal vergessen worden waren, wo der Jagd-Lunch für die Mitglieder der königlichen Familie und deren Gäste stattfinden sollte.
»Warum wird der Lunch in Dersingham abgehalten?«, fragte ich meinen Fahrer Tony Annison, einen Beamten des Royalty & Diplomatic Protection Department. »Werden Mittagessen nicht normalerweise in der Jagdhütte abgehalten, die Ihre Majestät vor ein paar Jahren am Flitcham Hill hat bauen lassen? Dort fand der Lunch letztes Jahr statt, wenn ich mich recht erinnere.«
»Diese Antis haben sie sich vorgenommen«, sagte Annison.
»Die Aunties?« Mir kamen meine beiden Tanten mütterlicherseits in den Sinn.
»Ja, die Antis. Diese sogenannten ›Tierretter‹. Verdammte Terroristen sind das. Haben die Scheiben eingeschlagen. Unflätigkeiten hingesprayt. Das volle Programm.«
»Oh«, sagte ich leise, dachte aber still bei mir: Ups! Schon wieder war es jemandem gelungen, die Sicherheitsvorkehrungen auszuhebeln. Zwar befand sich die Jagdhütte der Königin einige Meilen südöstlich von Schloss Sandringham, jedoch war sie von einer Steinmauer umgeben und lag noch weit innerhalb des überwachten Areals des Landsitzes. »Haben sie einen erwischt?«
»Nein«, antwortete Tony grimmig.
Noch einmal ups. Einige der Tierschützer waren ganz schön clever, so viel stand fest. Ich fand sie in Wahrheit nicht völlig unsympathisch, aber sie ließen sich auch von einem ziemlich beängstigenden Eifer antreiben, der sie dazu verleitete, das eine zu retten und dafür etwas anderes zu zerstören. Während der Ferien gaben sich die Jagd-Gegner große Mühe, die traditionelle Fuchsjagd am ersten Weihnachtstag in Gloucestershire und anderswo mit Demonstrationen, Bombendrohungen und Ähnlichem zu stören. Das Abknallen von Fasanen und Schnepfen in Norfolk erregte gleichfalls ihren Zorn. Als mein Vater und ich am ersten Weihnachtstag von Long Marsham nach Sandringham fuhren, kamen wir an einer Horde Demonstranten vorbei, die mit Protestplakaten zu einem nahe gelegenen Feld marschierten und dabei einen Höllenlärm veranstalteten, um die Jagd zu stören.
»Warum wird das Mittagessen nach Dersingham verlegt? Warum nicht nach Anmer? Dort gibt es auch einen alten Gemeindesaal. Oder nach Wolferton?«, fragte ich, womit ich weitere Ortschaften meinte, die zum Landsitz gehörten.
»Ich wünschte, der Jagd-Lunch würde im Schloss stattfinden«, sagte Tony säuerlich, ohne auf meine Frage einzugehen. »Das wäre für uns alle einfacher. Ich weiß nicht, warum sie ihn überhaupt in so einem verdammten Gemeindesaal abhalten müssen.«
Ich wusste es. Wie Marie-Antoinette in ihrem idealisierten Bauernhäuschen in Versailles vorgab, ein Milchmädchen zu sein, so spielten die Königin und ihre Familie gern von Zeit zu Zeit, sie wären Normalsterbliche. Im Spätsommer warfen sie in Balmoral, ihrem Heim in den schottischen Highlands, ihre Steaks selbst auf den Grill. Im Winter ließen sie sich poulet au riz schmecken, während sie inmitten von Bekanntmachungen des Bezirksgesundheitsamtes und den Terminen des örtlichen Fotoklubs in einem Gemeindesaal auf Plastikstühlen saßen. Dass sie dabei von Lakaien bedient wurden und sich danach nicht selbst um den Abwasch kümmern mussten, schien ihnen nie aufzufallen.
Der Gemeindesaal in Dersingham erinnert mich an den in Long Marsham, in den ich meine Tante Grace schon oft begleitet habe. Diese Beobachtung lässt mich vermuten, dass englische Gemeindesäle von ihrer Architektur her ziemlich genormt sein müssen. Es sind eigentlich schlichte Zweckbauten; im Fall von Dersingham aus Backstein und dem für die Gegend typischen Carrstone, einem rostroten, eisenhaltigen Sandstein, und an den Stirnseiten der Giebel mit Fachwerk im Tudor-Stil. Der Gemeindesaal wurde einer Messingplatte in der Nähe des Eingangs zufolge 1911, dem Krönungsjahr von König George V., erbaut und sieht genauso kompakt und unscheinbar aus wie Seine verstorbene Majestät höchstselbst.
Das bedeutete nicht, dass es in den folgenden Jahren nicht einige Veränderungen im Innern gegeben hätte. Das entdeckte ich, nachdem ich mit meinen warmen, duftenden Kartoffeln über den Kiesparkplatz durch den eiskalten Nieselregen gelaufen war. Zu meiner Rechten bemerkte ich feine, saubere weiße Wände und frisch gestrichene blaue Türen, die zu den Toiletten für Damen und Herren führten. Zu meiner Linken befand sich die Saalküche, die so adrett und modern aussah wie die im Schloss, wenn sie natürlich auch wesentlich kleiner war.
Eric Twist, eine der Küchenhilfen, dem eine Zigarette an der Unterlippe klebte, nahm mir an der Tür wortlos die Tasche aus der Hand und fing an, rasch jede in Folie eingewickelte Kartoffel auf ein Backblech zu legen. Tony Annison zwängte sich an mir vorbei und stellte den Karton mit den zerbrechlichen Gläsern auf das Brett einer Durchreiche in den Saal, durch die ich einen Tisch sehen konnte, der gerade mit weißem Tischtuch, Servietten und Silberbesteck gedeckt wurde.
»Kann ich irgendwas tun?«, fragte ich, als Annison sich wieder an mir vorbeidrängte und mit dem Handy in der Hand hinaus in den Nieselregen und zum Land Rover ging.
»Du kannst aufhören, überall den verdammten Boden vollzutropfen, das kannst du machen«, sagte Eric ärgerlich, als er sich einen Wischmopp griff und die Pfütze aufwischte, die sich zu meinen Füßen gebildet hatte.
»Ach, komm schon. Meinst du, Ihre Majestät und ihre Begleiter werden nicht auch den Boden volltropfen? Und du bist von oben bis unten voll Zigarettenasche. Guck.« Ich zog die feuchte Jacke aus und schüttelte sie provozierend aus, als er seinen Zigarettenstummel in eine Kaffeetasse warf und sich vorn die Uniform abrieb.
»Hilf einfach diesen zwei Deppen beim Tischdecken«, schnauzte er mich an.
Ich legte meine Jacke auf einen Stuhl an der Tür, nahm den Karton mit den Gläsern vom Brett und ging zu einem Tisch, der gegenüber der Küche zwischen zwei Doppeltüren aufgestellt worden war, die anscheinend in kleinere Begegnungsräume oder Büros führten.
»Was ist mit Eric los? Er ist gereizter als sonst«, sagte ich leise zu Nigel Stokoe, dem Lakaien, der mir am nächsten stand und zweifelnd ein fleckiges Messer betrachtete.
»Kater, Schätzchen«, erwiderte Nigel und wischte das Küchenutensil am Ärmel seiner Weste ab.
Ich stellte den Karton auf den Tisch und begann, die Gläser vorsichtig aus den Tuchhüllen und Lagen von Blasenfolie zu befreien – Whiskygläser, wie ich feststellte. Man brauchte schon einen kräftigenden Schluck, wenn man den ganzen Tag in der Kälte herumgesprungen war, um Fasane zu ermorden.
Nigel und Davey Pye, zwei der Lakaien im Dienste Ihrer Majestät, gingen hintereinander rund um den Tisch und legten methodisch Messer und Gabeln auf. Da sie ihre üblichen schwarzen Schwalbenschwänze, schwarze Hosen, weiße Hemden und scharlachrote Gilets trugen und vielleicht weil sie beide ein wenig rundlich wurden, erinnerten sie mich an Tweedledee und Tweedledum aus Alice im Wunderland. Davey, der normalerweise gern quasselte, war jedoch ungewöhnlich still und legte abwesend und wie mechanisch das Besteck auf.
»Davey, du schwankst ja«, sagte ich schließlich, nachdem ich ihn ein paar Minuten lang beobachtet hatte. Er hatte plötzlich die Tischkante gepackt, die Augen geschlossen und zu wanken begonnen.
»Ich glaube, ich krieg auch diese Grippe«, murmelte er.
Nigel verdrehte übertrieben die Augen. »Kater«, formte er lautlos mit den Lippen.
»Ich habe gehört, wie sich deine Lippen bewegt haben, Nigel. Ich habe keinen Kater.«
»Du warst gestern Abend völlig hinüber, Davey«, gab Nigel fröhlich zurück. »Du warst voll. Scheintot. Konntest dich nicht mehr auf den Beinen …«
»Erspar mir das Geschwafel.«
»… hackedicht. Stockbesoffen. Sternhagelvoll. Du standest völlig neben dir, wie ich mich erinnere.«
»Pass auf, was du sagst!«, kam Erics gedämpfter Ruf aus der Küche. »Was ist, wenn Ihre Majestät in dieser Sekunde hereinkommt?«
Davey stöhnte. »Oje. Ich muss für Mutter heiter sein.« Wenn sie unter sich waren, nannte er Ihre Majestät die Königin gern »Mutter«.
»Was habt ihr Jungs diesmal getrieben?« Ich hielt ein Glas vor das Fenster. Es sah trüb aus, völlig ungespült. Ich stellte es beiseite.
»Wir haben gestern Abend versucht, bei der Talk-Sendung im Radio anzurufen. Das Thema war: ›Wen würden Sie am liebsten in den Weihnachtsferien flachlegen?‹«
»Hm, George Michael, so aus dem hohlen Bauch heraus gesprochen.«
»Stell dir vor! Das war auch Daveys Wahl. Nur …« Nigel fing an zu kichern. »Nur war Davey total dicht – du musst wissen, seine Mutter, seine echte Mutter, also Sylvia, hat ihm als Weihnachtsgeschenk eine Flasche Laphroaig geschickt. Er war so voll, dass er die Nummer nicht mehr wählen konnte. Ups.«
Eine Gabel fiel mit einem hellen Klirren aus seiner behandschuhten Hand auf den Parkettboden.
»So viel hab ich gar nicht getrunken, Nigel.« Davey wurde allmählich ärgerlich.
»Die Flasche ist leer, Alter.« Nigel erhob sich mit der Gabel und wischte sie an seinem Ärmel ab.
»Was! Ich habe sie nicht ausgetrunken. Sie war ein Geschenk …«
»Na ja, du hast ja auch die Hälfte der schönen Plätzchen gegessen, die meine Mutter mir geschickt hat!«
»Das hab ich nicht!«
»Hast du doch!«
»Ruhe jetzt!«, kam es aus der Küche.
»Oh, mein Kopf«, stöhnte Davey.
Von dem leichten Plattern des Regens an die Fensterscheibe und dem zarten Klingeling der kupfernen Heizungsrohre rund um den Saal abgesehen, die tapfer die Eiseskälte zu vertreiben versuchten, folgte darauf Stille.
Im Gegensatz zum Eingangsbereich und der Küche war der Saal ziemlich schlicht, ja sogar ein wenig deprimierend mit den Neonlampen, dem matten braunen Holz, mit dem die untere Hälfte der Wände verkleidet war, den uralten Schwarz-Weiß-Fotos von seit Langem verstorbenen Dorfhonoratioren, die an deren oberer Hälfte hingen, und den verblichenen Krönungsporträts der Königin und des Herzogs von Edinburgh an jeder Seite der Bühne am anderen Ende.
Der Saal sah aus wie in den Sechzigern in Eigenregie renoviert und erinnerte mich an die Kellerräume einiger Freunde meiner Eltern zu Hause auf Prince Edward Island. Eines sah allerdings funkelnagelneu aus – ein schwerer scharlachroter Vorhang, der die Bühne verdeckte.
»Haben sie hier ein Theaterstück oder so aufgeführt?«, fragte ich niemand Bestimmtes.
»Eine Pantomime, glaube ich.« Nigel richtete mit der einen Hand eine Gabel gerade aus und unterdrückte mit der anderen ein Gähnen.
»Wie toll!«, rief ich aus.
Da ich gehört hatte, dass Pantomimen, vor allem britische Aufführungen, etwas Neues waren, hatte ich es im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten geschafft, eine Cinderella-Vorstellung in einem Londoner Theater zu besuchen. Sie war zum Totlachen gewesen. Prince Charming war eine als Mann verkleidete Frau. Cinderella selbst war ein als Frau verkleideter Mann. Die hässlichen Stiefschwestern namens Anorexie und Bulimie waren ebenfalls Männer in Frauenkleidern, in diesem Fall den prächtigsten und ausgefallensten Kostümen. Die Kulissen waren wahre Wunderwerke der Fantasie. Als der Kürbis sich in eine Kutsche verwandelte, gab es ein spektakuläres Feuerwerk. Es war wirklich ein einziger großer Spaß.
Aber den gleichen Glamour konnte ich mir in einem eher engen Gemeindesaal nicht vorstellen. Und das sagte ich auch.
»Na ja, das ist London.« Davey erwachte aus seiner kurzen Erstarrung. »Wir sind hier in der Provinz. Jede Menge kleiner Ortschaften führen Pantomimen auf. Wir in Stratford hatten auch eine Theatergruppe, als ich klein war. Außerdem sind die Vorstellungen hier für einen guten Zweck, nicht, Nig?«
»Hmm. Irgend so ein Trust steht dahinter. Die Gruppe hat auch einen Regisseur von außerhalb. Kann nicht ganz so schrecklich sein.«
»Was für ein Stück ist es?« Ich war mit dem Auspacken der Gläser fertig und amüsierte mich damit, die Blasenfolie zu zerdrücken.
»Die Herzkönigin. Am Mitteilungsbrett im Vorraum hängt ein Plakat, gleich neben dem Schild, dass man im Saal keine Stilettos tragen darf. Deinen Bette-Midler-Act wirst du hier also nicht geben können, Davey, haha.«
»Die Herzkönigin? Die mit den Törtchen aus Alice im Wunderland?«, fragte ich.
»Genau die.«
»Ich wünschte, du würdest nicht von Essen reden!« Davey hob eine behandschuhte Hand an den Mund und stieß geräuschlos auf.
»Ist die Erwähnung schlimmer als der Duft?« Die angenehmen Aromen von schottischer Brühe und heißen Hackfleischpasteten, die es aus der Küche bis zu uns geschafft hatten, ließen sich wohl kaum umgehen. Das war bestimmt besser als der schwache Geruch nach Mäusen und Schimmel, der im englischen Winter so gern in alten Gebäuden hängt.
»Meine Nase muss verstopft sein. Oje, ich glaube, ich sterbe.« Daveys Hand war in einer dramatischen Geste von seinem Mund zu seiner Stirn gewandert.
»Ach, hör auf zu knatschen«, sagte Eric gereizt, als er mit einer silbernen Platte mit heißem Essen unter einer Wärmehaube durch den Saal kam. »Und du hör auf, die Blasenfolie kaputt zu machen. Davon krieg ich Kopfschmerzen.«
»Wie redest du denn?«, schimpfte ich. »Was, wenn jetzt Ihre Majestät hereinkäme?«
»Ach, geh doch nach Hause.«
In Wahrheit stimmte ich ihm zu: Davey sah wirklich ein bisschen kränklich aus. Sein normalerweise pummeliges rosiges Gesicht hatte den hellgelben Schimmer der Elefantenstoßzähne, die auf Schloss Sandringham in der Halle vor dem Speisesalon standen.
»Überhaupt, jetzt, da ich so drüber nachdenke …« Nigel blickte mich fragend an. »Warum bist du eigentlich hier?«
»Ist das eine dieser existenziellen Fragen?«
»Hä?«
»Egal. Ich bin hier, weil alle anderen im Schloss entweder beschäftigt oder krank sind.«
»Du warst über das Weihnachtswochenende nicht da. Ich dachte, du wärst vielleicht auch grippekrank.«
»Ich hatte zwei Tage frei. Ich war bei meiner Großtante in Long Marsham. Mein Vater ist herübergekommen, was irgendwie schön ist«, fügte ich hinzu und wunderte mich, warum ich »irgendwie« sagte.
»Aus den Kolonien?«, warf Davey ein.
»Ja.« Ich seufzte. Es gibt Tage, da würde ich diesen britischen Imperialisten gern einen Tritt verpassen. »Er kam mit vielen Biberfellen. Zum Glück ist die Barke in den Stürmen auf dem Nordatlantik nicht gesunken, obwohl ihnen der Skorbut ordentlich zugesetzt hat. Es war eine schrecklich harte Überfahrt.«
»Trägt heutzutage irgendwer noch Biber?« Davey hielt über einer Salatplatte inne, ohne meinen Sarkasmus zu merken. »Vielleicht wenn Vivienne Westwood ihn orange färbt …«
»… würde sie immer noch feststellen, dass die Aktivisten jeden, der so einen Pelz trägt, mit Schweineblut bespritzen würden«, beendete Nigel den Gedanken.
Davey schloss die Augen und stöhnte. »Schweineblut! Musst du das sagen?«
»Du taumelst wieder, Davey«, bemerkte ich.
»Würde dann bitte jemand das Thema wechseln.«
Es folgte ein kurzes Schweigen, während wir nach einem anderen Gesprächsthema suchten. Eric, der aufgehört hatte, an der Anrichte an einer heißen Platte herumzufummeln, starrte uns alle an, griff nach seinen Zigaretten und ging langsam zurück zur Küche.
»Also schön«, sagte ich, als er verschwunden war. »Wie waren SIE denn dieses Jahr Weihnachten?«
Davey und Nigel schauten sich über den Tisch hinweg an.
»Sehe ich da in der Mitte deiner Frage Großbuchstaben herumschwirren?«
»Tust du …«
»Na ja, SIE waren klasse.«
»Ach, schrecklich waren SIE«, widersprach Nigel.
»Klasse.«
»Schrecklich. Di war gezwungen, am ersten Weihnachtstag nach London zu fliehen. Fergie wurde nach Wood Farm verbannt, drei Meilen weit weg. Sie hat sich nicht mal in der Kirche blicken lassen.«
»Deshalb war es klasse, Nig. Das Leben ist stets besser, wenn diese nervigen Schwiegertöchter, die immer nur Stress machen, sich verziehen.«
»Die arme Diana.« Nigel rümpfte die Nase. »Wieder an einem Weihnachtstag allein vor einem kalorienreduzierten Tiefkühlgericht!«
»Quatsch. Sie hätte hierbleiben können. Es war ihre eigene Entscheidung.«
»Und den Tag bei ihrer angeheirateten Verwandtschaft damit verbringen, Wenn-Blicke-töten-Können zu spielen.«
Es langweilte mich inzwischen, Daveys und Nigels Meinungsverschiedenheiten über die königliche Familie zu lauschen. »Entschuldigt, ihr beide … Was war mit der Königin?«
»Ihre Majestät war wie üblich gelassen.«
»Ich erlaube mir, anderer Meinung zu sein, Nigel. Mutter ist in der Abwesenheit der Prinzessin von Wales noch gelassener geworden. Ich muss es wissen.«
Davey war kürzlich im Rang aufgestiegen und einer der beiden persönlichen Lakaien der Königin geworden, die den Pages of the Backstairs halfen, Mitgliedern des Personals, die im unmittelbaren Dienst Ihrer Majestät standen und ihre Privaträume aufräumten, Mahlzeiten servierten und dergleichen – Haushaltstätigkeiten auf hohem Niveau, wenn man es genau betrachtet.
Die Ernennung war ein wenig überraschend gekommen: Davey war nicht der verantwortungsbewussteste Angestellte. Aber wie es scheint, hatte Ihre Majestät festgestellt, dass er gut mit den Corgis konnte. Sie schnappten nicht nach seinen Knöcheln, wie sie es bei anderen Lakaien taten, die für Corgis offenbar das sind, was Briefträger für andere Rassen in den Vorgärten weniger palastartiger britischer Heime sind. Die Corgis – Fable, Myth, Kelpie, Pharos, Spark, Joan, Diamond und Phoenix – mochten ihn tatsächlich.
»Ich weiß nicht, warum!«, hatte er mir vorgejammert, als er von seiner Beförderung erfahren hatte. »Ich mag sie nicht.«
Ich hatte damals still bei mir gedacht, dass er zu nachdrücklich protestierte. Der Weg ins Herz der Königin führt über ihre Hunde, und der Weg zum Herzen der Hunde führt natürlich durch ihre Mägen.
»Bist du sicher, dass du nicht mit einem Lammkotelett in der Tasche herumgelaufen bist?«
An diesem Punkt war Davey leicht errötet. »Natürlich nicht. Das würde die Silhouette meiner Uniform zerstören.«
Aber er freute sich über die Ernennung, selbst wenn das hieß, dass er mit den Corgis Gassi gehen musste, so Ihre Majestät anderweitig beschäftigt war, was oft genug vorkam.
Da mir das wieder einfiel, gelang es mir nicht, dem, was Davey nun sagte, meine volle Aufmerksamkeit zu schenken:
»… und ich bin sicher, nicht mal die Thringys werden den Frieden dieser Weihnachtswoche stören.«
»Oh, nein!«, konnte ich mich nicht beherrschen auszurufen. »Nicht schon wieder die Thringys!«
»Und dieses Mal bleiben sie im Schloss sogar länger als die üblichen drei Tage«, erklärte Nigel voller Schadenfreude, als er meine Bestürzung bemerkte.
Die Thringys – oder richtiger: die Thrings – waren liebe alte Freunde der Königin. An sich ist das nicht ganz richtig. Alfred, der Marquess of Thring, war ein lieber alter Freund der Königin. Er war in Norfolk ein Nachbar, dessen Ländereien an die von Schloss Sandringham grenzten, und er liebte Hunde und das Schießen und die ganze traditionelle Routine des Landlebens, die Ihre Majestät so toll fand. Alfreds Frau Pamela, die Marchioness – seine zweite Frau genau genommen, Pamela II. genannt, weil zufällig die erste Ehefrau des Marquess auch eine Pamela gewesen war –, war ihr vielleicht nicht ganz so lieb.
Ich konnte nicht sagen, welche Gefühle Ihre Majestät gegenüber der Marchioness hegte, denn natürlich lässt sie das nur ganz wenige wissen. Allerdings hatte ich von einigen Bediensteten gehört, dass andere Mitglieder der königlichen Familie das Gesicht verzogen, sobald der Name der Marchioness fiel.
Ich war im letzten Januar während des dreitägigen Aufenthalts der Thrings auf Schloss Sandringham Lady Thring nur einmal ganz kurz begegnet. Sie erinnerte mich an gewisse unentspannte und fordernde amerikanische Touristen, die Marilla’s Pizza besuchten, das Restaurant auf Prince Edward Island, in dem ich mal als Kellnerin gearbeitet hatte. Nicht sonderlich überraschend, denn sie war tatsächlich Amerikanerin.
Aber es war nicht die Anwesenheit der Marchioness, die mich beunruhigte. Es war vielmehr die ihres Sohnes Buchanan, des Sprosses einer früheren Ehe oder Liaison, der sich gern an einem von uns Hausmädchen rieb, wenn er eines über den Staubsauger gebeugt in einem Korridor vorfand. Er hatte keine Ahnung, wie er sich gegenüber dem Personal benehmen sollte, und weiß der Himmel, wie er sich gegenüber Ihrer Majestät und ihrer Familie benahm! Ich vermute, er hielt sich für unwiderstehlich, aber er war in Wahrheit ein Flegel. Buchanan – oder Bucky, wie er genannt wurde – war jung, knapp neunzehn oder zwanzig, nicht viel jünger als ich.
Mrs Benefer, die hiesige Hausdame, hatte bereits mehrere Beschwerden über ihn erhalten – darunter eine von mir –, doch ihr Vorschlag für uns Mädchen lautete, ihm für die Zeit seines Besuchs aus dem Weg zu gehen – mit anderen Worten: zu lächeln und es über sich ergehen zu lassen.
»Warum«, fragte ich die beiden Lakaien betrübt, »bleiben die Thrings diesmal länger? Und warum in der Weihnachtswoche? Ich dachte, die wäre allein der Familie vorbehalten. Gäste treffen gewöhnlich nach Neujahr ein, oder nicht?«
»Ich denke, es ist das, was die Amerikaner eine ›günstige Gelegenheit‹ nennen«, sagte Nigel hochnäsig. Und vielleicht auch provozierend, denn er weiß verdammt genau, dass ich keine Amerikanerin bin. »Wie ich höre, werden die Thringys gleich nach Neujahr für längere Zeit in Amerika sein. Ich glaube, Seine Lordschaft hat einige Termine als Juror bei diesen Hunde-Ausstellungen. Und dann sind sie irgendwo in der Karibik. Das stimmt doch, Davey? Davey?«
Der Angesprochene musste aufstoßen und nickte, wobei er entschuldigend den Mund bedeckte.
»Warum können die Thrings dann nicht einfach in Barsham Hall wohnen und … und pendeln«, stöhnte ich bei dem Gedanken an Bucky.
»In die Karibik?«
»Nein, du Schwachkopf. Nach Schloss Sandringham. Barsham ist nur ungefähr zwanzig Meilen von hier entfernt.«
Nigel zog einen Schmollmund. »Ich kann mir vorstellen, dass Barsham für den Winter fast komplett eingemottet worden ist, da die Thrings weg sind. Ich denke, sie haben den ersten Weihnachtstag in London verbracht. Und die Renovierung von Barsham ist sowieso noch nicht abgeschlossen.«
»Was? Das geht jetzt schon über ein Jahr. Davey und ich haben uns Bilder von den verschiedenen Räumen im Tatler oder Architectural Digest oder in der Hello! angesehen.«
»Diese Fotos waren nur ein Vorgeschmack, Jane. Lady Thring hat mit ihrer gewaltigen Aufgabe noch kaum angefangen. Oje!« Davey rülpste erneut. »Entschuldigung …«
»Grippe, sagst du?«, meinte Nigel verschmitzt.
Obwohl der Marquess im Alter der Königin war, war er erst vor rund fünfzehn Monaten ein Marquess geworden. Alfreds Vater, eine Art Einsiedler mit Titel, war nicht scharf darauf gewesen, die Gänseblümchen von unten zu sehen und hatte ewig lange, bis in die neunzig, in Barsham Hall gelebt. Und als der Marquess of Thring dann endlich sein Leben aushauchte, begann die neue Marchioness umgehend – und ohne Rücksicht auf die Trauerzeit zu nehmen – mit der Umgestaltung des Innern von Barsham Hall vom Dachgeschoss bis in den Keller. Aus diesem Grund war das Gebäude in der Zwischenzeit praktisch nicht bewohnbar.
Ihr Haus in London, Thring House, lag in Mayfair, aber ihr Landsitz nach ihrer Heirat und vor Alfreds Aufstieg ins Marquessat war Anmer Hall gewesen, das der Herzog und die Herzogin von Kent 1990 freigemacht hatten.
Anmer Hall lag etwa drei Meilen östlich von Schloss Sandringham und war ein georgianisches Herrenhaus, das Edward VII. manchmal dazu benutzt hatte, bei seinen sagenhaften Festen auf Schloss Sandringham die überzähligen Gäste unterzubringen.
Die Thrings waren dort bald nach dem Tod des verstorbenen Lords ausgezogen. Wegen der Renovierungen von Barsham waren sie seit mehr als einem Jahr ohne einen Landsitz.
»Jedenfalls hat Ihre Majestät die Thrings eingeladen, bis Neujahr zu bleiben«, fuhr Nigel fort.
»Mutter ist zu nett«, warf Davey ein.
Das will ich meinen, dachte ich. Aber Ihre Majestät neigt dazu, gegenüber alten Freunden sehr loyal zu sein. »Sind die Thrings also heute Morgen bei der Jagd mit von der Partie?«
»Natürlich stoßen die Damen erst am späten Vormittag vor dem Mittagessen dazu«, erklärte Nigel in belehrendem Ton.
»Das weiß ich, Nigel.«
»Na gut, jedenfalls hörte ich, dass Ihre Ladyschaft das Mittagessen abgesagt hat. Migräne. Sehr glaubhaft. Ich nehme an, Bucky ist bei den Jägern. Seine Mutter ist so versessen darauf, dass er alles lernt, was einen richtigen englischen Gentleman ausmacht. Ha! Seine Chance, ein Aristokrat zu werden, ist größer, als ein Gentleman zu werden.«
»Natürlich ist Affie bei ihnen«, meinte Davey, womit er Lord Thring bei seinem Kosenamen nannte und meine Frage überging. »Ist er nicht der zweitbeste Schütze Englands?«
»Ich dachte, er ist der zweitlangweiligste Mann Englands?«
»Hat diese Krone an dich abgegeben, nicht wahr, Nig?« Davey lächelte.
Nigel schaute ihn von oben herab an und sagte gedehnt: »Ich dachte, du fühlst dich nicht wohl?«
Daveys Lächeln schwand. Er fasste sich mit einer Hand sanft an die Stirn. »Nur zu wahr. Ich fühle mich sogar sehr mies.«
Ein paar Minuten lang herrschte Stille, während Davey und Nigel ihre Arbeit kontrollierten, diesen oder jenen Teller hin und her schoben, als wollten sie sich selbst beruhigen. Weswegen, weiß ich nicht. Die Teller waren schlicht und weiß, ein einfaches Geschirr für ein einfaches Mahl. Sozusagen. Ich begann, die Gedecke abzuzählen.
»Wer kommt sonst noch zu dem Mittagessen?«, hakte ich nach.
»Ich bin mir nicht sicher«, antwortete Nigel. »Uns wurde gesagt, sechzehn Personen. Charles, denke ich. Wills und Harry. Oder zumindest Wills …«
»Vater«, schaltete Davey sich ein, wobei er den Kosenamen von Prinz Philip benutzte. »Edward, Andrew? Oder habe ich gehört, er liegt auch mit Grippe darnieder? Peter Phillips, der Sohn von Prinzessin Anne. Die Thrings natürlich. Ein oder zwei der hiesigen Adligen vielleicht …«
»Weniger als letztes Jahr, oder?«
»Die Grippe schmiegt sich vor großen Königen und dem Hochadel nicht«, erwiderte Davey und fuchtelte theatralisch mit einem silbernen Tablett herum.
»Zitierst du gerade Shakespeare?«
»Aber dann wohl ganz frei«, neckte Nigel ihn.
Daveys Stirn legte sich in Falten. »›… täglich Sehn an ihr nicht stumpfen die immerneue Reizung …‹«, murmelte er. »Nein, nein, das ist es nicht. Die großen Könige, was ist es? … Gewohnheiten … ›Strenge Gewohnheiten schmiegen sich vor großen Königen.‹ Das ist es! Heinrich V.«
Dass Davey in Stratford-upon-Avon geboren war, war ein Fluch. Wir waren nicht beeindruckt.
»Und die Frauen?«, wollte ich von Nigel wissen.
Er kontrollierte den Tisch und zählte an den Fingern ab. »Über die Damen weiß ich nicht Bescheid. Außer Ihrer Majestät … na ja, die Königinmutter ist dieser Tage viel zu gebrechlich. Die Marchioness hat sich sozusagen gedrückt. Prinzessin Anne natürlich. Zara Phillips wahrscheinlich. Vielleicht noch ein paar andere Ehefrauen …«
»Einen Fünfer darauf, dass Margo auftaucht«, unterbrach Davey ihn und benutzte damit den Namen, den nahestehende Mitglieder der königlichen Familie für Prinzessin Margaret haben und den wir Bediensteten verwenden, wenn wir unter uns sind.
»Niemals.« Nigel schüttelte den Kopf.
»Ich dachte, sie hasst blutige Sportarten«, sagte ich überrascht. »Von der Vorstellung, an einem nasskalten Wintertag durch die Gegend zu stapfen, gar nicht zu reden.«
»Ah, aber da hast du die Wirkung männlicher Schönheit auf Ihre Königliche Hoheit nicht einkalkuliert.« Davey drehte ein Bein geziert nach außen.
»Du musst krank sein.« Nigel starrte ihn an. »Du halluzinierst.«
»Ich meine doch nicht mich, du Blödmann! Ich meine Paul Jenkyns.«
»Ah«, murmelte ich. Inspector Paul Jenkyns war der neue Aufpasser Ihrer Majestät, ihr Personal Protection Officer oder Personenschützer, einer in einem Viererteam. Er war kürzlich nach einer Zeit bei den Kents in den Dienst Ihrer Majestät getreten. »Er ist ein ganz Süßer, so viel steht fest.«
»Ach, wirklich?« Nigel betrachtete sinnend die Decke. »Du machst dich lächerlich.«
»Wer? Ich?«
»Nein, Davey. Paul ist … na ja, ziemlich toll, aber …« Er schwieg und spitzte die Lippen. »Na gut, die Wette gilt, Schätzchen. Einen Fünfer drauf, Margo ist im Schloss. Genau in dieser Minute sitzt sie in einem violetten Morgenmantel aufrecht im Bett, trinkt eine Tasse Lapsang Souchong und liest einen Schundroman.«
Über Daveys rundliches Gesicht kroch ein kleines Lächeln. Und dann erstarrte er. Er packte mit der einen Hand die Tischkante und massierte sich mit der anderen sanft den Bauch. »Ooooh«, stöhnte er. Sein Lächeln fiel in sich zusammen. »Gerade habe ich gespürt, wie eine Welle von irgendwas durch mich hindurchgeschwappt ist.«
»Ist wahrscheinlich der Single Malt Scotch, der noch durch deine Adern schwappt.«
»Oh, halt den Mund, Nigel.« Davey zog eine Grimasse. »Oje, ach du meine Güte, ich muss mich einen Augenblick hinlegen.« Er schaute sich erfolglos um. An den Wänden standen Stühle, aber in großen orangefarbenen Stapeln, die auf die nächste Vorstellung warteten. Die Türen zu den kleineren Räumen entpuppten sich als zugesperrt, als ich an ihnen rüttelte.
»Hinter der Bühne gibt es vermutlich etwas zum Hinlegen«, behauptete ich, wobei ich an die Kutsche in der Cinderella-Pantomime dachte, die ich gesehen hatte.
Das Grollen eines Land Rovers, der draußen über den Kies näher kam, drang zu uns herein und machte uns darauf aufmerksam, dass gleich einige Jagdteilnehmer erscheinen würden, doch Davey strebte bereits zu einer der zwei Türen zu beiden Seiten der Bühne.
Mit einem Mal bekam ich wegen meiner Anwesenheit Bedenken. Ich wurde beim Servieren des Lunchs nicht benötigt – das gehörte nicht zu meinem Aufgabenbereich, obgleich ich nichts dagegen gehabt hätte –, und ich trug meine langweilige weiße Hausmädchen-Uniform. Ich wirkte völlig fehl am Platz. Im Buckingham Palast flüchten sich einige Hausmädchen immer noch in leere Räume, wenn sie das Scharren der Corgi-Füßchen hören, damit sie Ihrer Majestät nicht begegnen müssen. Ich weiß nicht, warum. So ist es mir noch nie gegangen. Andererseits wirkte ein Hausmädchen bei einer Jagd so wenig willkommen wie eine Nonne bei einer Hochzeit.
Nigel schlug vor, ich solle mich auf die Toilette zurückziehen.
Doch auf dem Weg dorthin wurde ich durch eine plötzliche und seltsame Abfolge von Ereignissen aufgehalten. Hinter dem Vorhang konnten wir Davey murmeln hören. »Ach, wo ist bloß der verdammte Lichtschalter?«, und dann sagte er leise und erschrocken: »Euer Majestät?« Wir drehten uns um und starrten auf den Vorhang, und da fragte Davey ein bisschen lauter: »Ma’am?«
Das war höchst merkwürdig, denn genau in diesem Augenblick betrat am anderen Ende des Saals Ihre Majestät den Raum. Sie zog mit der einen Hand an ihrem Hermès-Kopftuch, während die andere zum Reißverschluss an ihrer Barbour-Jacke griff. Hinter ihr waren Prinzessin Margaret in einer blauen Steppjacke und einem Tweed-Rock sowie Paul Jenkyns, der Detective Ihrer Majestät, in einem schwarzen Mantel, der einen schönen Kontrast zu seinen silberfarbenen Locken bildete.
Aber genau als wir herumfuhren, um Ihre Majestät und ihre Begleiter anzuschauen, wandten wir uns gleich wieder um, da hinter dem Vorhang ein fürchterlicher Schrei ertönte, der förmlich die Luft durchschnitt. Dem folgten ein furchterregendes rasselndes Luftholen und dann die unglaublichen Worte:
»DIEKÖNIGINISTTOT!«
Die Königin, die lächelnd und augenscheinlich gestärkt von ihrem Morgen in der freien Natur den Saal betreten hatte, lächelte weiter, als wäre sie entschlossen, sich durch nichts den Tag verderben zu lassen. »Mir ist es in meinem ganzen Leben nie besser gegangen, herzlichen Dank«, sagte sie fröhlich und schüttelte die Feuchtigkeit aus ihrem Kopftuch.
Ich kann nur mutmaßen, dass Ihre Majestät das wieder für einen der Scherze und Streiche hielt, die sie sich während der Feiertage gegenseitig im Schloss spielten. Falls nicht, war es ein hervorragendes Beispiel für ihre bemerkenswerte Fähigkeit, in jeder Situation gelassen zu bleiben.
Unglücklicherweise waren wir anderen von Daveys entsetztem Schrei völlig geschockt. Er mochte von Zeit zu Zeit gern einen Schabernack treiben, aber Daveys Verehrung für »Mutter«, wie er sie liebevoll nennt, war unerschütterlich. Sein seltsames Verhalten entbehrte jeder Vernunft, und so bewegten wir uns wie ferngesteuert unaufhaltsam auf die Bühne zu, ohne den Gepflogenheiten des Protokolls die geringste Beachtung zu schenken. Nigel, Eric, der aus der Küche gekommen war, um Ihre Majestät zu begrüßen, und ich auf der linken Seite der Bühne, Margaret und Inspector Jenkyns auf der rechten Seite.
»Lilibet! Kommst du mal?«, rief Ihre Königliche Hoheit ungeduldig, als die Königin ungerührt weiter den Reißverschluss ihrer Jacke aufzog.
Hinter dem Vorhang war wirklich sehr wenig Platz. Der Raum war vollgestellt mit mehreren gemalten Kulissen, von denen die eine, die am besten zu sehen war, eine Szene zeigte, die vage an den Ballsaal im Buckingham Palast erinnerte. Aber in der Mitte der Bühne stand, beide Hände auf den Mund gepresst und mit weit aufgerissenen Augen starrend, Davey, der im Spotlicht bleich wie ein Albinofrosch aussah. Und das, worauf er wie gebannt starrte, war wirklich ungewöhnlich. Tatsächlich so ungewöhnlich, dass wir alle vergaßen, Davey nach seiner Verfassung zu fragen, denn in einem Lichtermeer auf einer reich vergoldeten Trage lag eine anscheinend schlafende Frau, die Ihrer Majestät der Königin bis aufs Haar glich.
Die Gestalt war allerdings nicht in ein Ballkleid mit Schärpe oder Krone und Mantel gekleidet oder auch nur in eines dieser knallbunten Outfits, die Ihre Majestät trug, damit sie bei öffentlichen Auftritten in der Menge gut zu sehen war – Kleider, die mit der Königin auf Anhieb zu assoziieren waren. Die Frau hatte vielmehr ein Kostüm an, das dem Aufzug der Monarchin am heutigen Tag in bemerkenswerter Weise ähnelte – Gummistiefel, grüne Überhose, eine gewachste Barbour-Jacke und ein Kopftuch mit Pferdemotiven darauf. Und ebendiese Monarchin hörten wir gerade die Treppe hochkommen.
»Ach du liebe Zeit!«, rief Prinzessin Margaret mit ihrer leisen Stimme aus. »Lilibet, komm her und sieh dir das an«, fügte sie aufgeregt hinzu, als die Königin von hinten herankam und wir anderen eine Gasse bildeten, um ihr Platz zu machen. »Sehr ungewöhnlich.«
»Das ist nicht Jeannette Charles, oder?«, flüsterte Eric, dem seine übliche Verdrießlichkeit in diesem Augenblick offenbar abhandengekommen war.
Ihre Majestät blickte stirnrunzelnd auf die Gestalt. »Nein. Nein, ich habe Mrs Charles schon gesehen.« Sie flüsterte nicht. Ihre Augen wanderten von den Gummistiefeln zu der eulenartigen Brille, und dann entdeckte Ihre Majestät im gleichen Moment wie wir anderen das einzige unpassende Detail am Kostüm der reglosen Gestalt: Oben auf ihrem Kopftuch ruhte ein Diadem. Das Stirnrunzeln Ihrer Majestät wurde stärker.
Zwar empfand ich bereits Schock, Überraschung, Besorgnis und Neugier, doch nun kam noch ein weiteres Gefühl hinzu: Verlegenheit. Das Diadem war ein Detail, das allzu sehr an Spitting Image erinnerte, die britische TV-Comedy-Serie mit Puppen, in der die Reichen, Berühmten und Mächtigen hemmungslos durch den Kakao gezogen wurden. Solange die Serie ausgestrahlt worden war, war Ihre Majestät stets mit einem hausfrauenartigen Kopftuch und einem großen Diadem obendrauf gezeigt worden.
»Wie gemein!« Prinzessin Margaret war außer sich vor Zorn. »Sie schläft, nicht wahr? Jemand soll sie aufwecken!«
Man konnte durchaus meinen, dass sie schlief. Ich erkannte an der unbedeckten Haut, dass die Gestalt auf der Trage eine viel jüngere Frau war als die echte Königin vor uns. Doch sie war fachmännisch geschminkt, sodass das Gesicht nicht nur altersmäßig ähnlich war, sondern auch dieses gesunde rosige und pudrige Aussehen der Königin bei ihren eher offiziellen Auftritten hatte. Die Lider waren geschlossen, und die Hände, die einer jüngeren Frau, waren wie die einer Chorsängerin in Höhe der Taille locker gefaltet.
Auf Prinzessin Annes Frage hin stieß Davey hinter seinen Händen ein Wimmern aus und schüttelte den Kopf.
Die Gesichter wurden lang. Mit einem Gefühl der Vorahnung wie auch dem eines Déjà-vus streckte ich die Hand aus, um den Hals der Frau zu berühren und nach dem Puls zu suchen. Ein Jahr zuvor hatte ich schon einmal die Gelegenheit gehabt, das Gleiche zu tun, als ein Lakai direkt vor den Privaträumen Ihrer Majestät tot aufgefunden worden war.
»Nicht!«, befahl Paul Jenkyns. Doch es war zu spät.
Meine Hand berührte bereits ihre Haut. Das Make-up, das sich bis auf einen Schmierer an ihrer linken Wange gleichmäßig bis zur Brust verteilte, fühlte sich seltsam klebrig an, aber da war kein Puls und überhaupt keine Wärme. Die Frau war mausetot.
Ich brauchte es den anderen nicht zu sagen. Ein Schauer des Entsetzens durchlief uns.
»Weiß irgendjemand, wer das sein könnte?« Die Königin sah sich um, erhielt jedoch von ihrem improvisierten Hofstaat keine Antwort.
Ich schwieg. Die Tote hatte ein bisschen was Vertrautes an sich, wenn man die optische Ähnlichkeit mal außer Acht ließ, aber ich dachte, das würde ich mir nur einbilden.
Alle anderen schüttelten verneinend den Kopf.
»Ma’am, ich denke, wir sollten besser …«, begann Paul Jenkyns in geduldigem, befehlsgewohntem Tonfall, doch er wurde von zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Ereignissen unterbrochen.
Davey, dessen Gesichtsfarbe von pergamentartig zu Erbsensuppe gewechselt hatte, schoss zur Rückseite der Bühne, wobei er einen Requisitentisch umriss und unter anderem ein Nudelholz, Törtchenformen und ein Tablett mit Gipstörtchen klappernd und scheppernd zu Boden schickte. Wir hörten, wie er ein paar Stufen hinunterstapfte und wie dann eine Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Direkt danach stürzte ein großer schwarzer Hund springend und winselnd wie ein Wesen aus dem Totenreich in den Raum, der alle zwang, aus dem Weg zu gehen.
Um Davey besorgt und ohne jeden Gedanken ans Protokoll eilte ich davon und lief hinter die Bühne, um zu schauen, ob ich etwas für ihn tun konnte, denn es gab offensichtlich nichts, was ich noch für die Tote tun konnte. Zurück ließ ich ein kleineres Chaos: Eric versuchte unbeholfen, den Hund zurückzuhalten, Jenkyns riet zum Rückzug, Ihre Majestät stimmte zu, der Jagdhund bellte, und am anderen Ende des Saales waren viele neue, überwiegend männliche Stimmen zu vernehmen.
Ich ging einige Stufen hinunter, drückte gegen eine feuchte, kalte Windböe die Tür auf und spähte nach draußen.
Davey lehnte an der Carrstone-Mauer und rang nach Luft.
»Geht’s dir gut? Musst du dich übergeben?«
»Ich fühle mich gleich wieder besser, Schätzchen.« Er legte eine behandschuhte Hand auf die Brust. »Oh, aber wie soll ich das nur Mutter erklären? Das ist mir so was von peinlich.«
»Sei nicht albern. Dieser Fehler könnte jedem unterlaufen.« Ich sagte das, glaubte es aber nicht. Dass die Königin hinter der Bühne im Gemeindesaal von Dersingham ein Nickerchen hielt, war schlichtweg undenkbar. Doch ich nehme an, an Daveys Stelle …
»Du bist sicher, dass es dir gleich wieder gut geht? Du hast keinen Mantel an.«
»Mir geht’s prima, wirklich.« Er wedelte mich mit seiner Hand weg. »Lass mich einfach einen Augenblick allein. Ich brauche frische Luft.«
»Wenn du dir sicher bist … Übrigens, hast du den Hund hereingelassen?«
»Er schoss direkt an mir vorbei.«
Ich schloss die Tür und lief die paar Stufen hinauf. Ich konnte hören, dass die anderen wieder hinunter in den Saal gingen.
»Komm, Margo«, sagte die Königin gerade. Hinter einem Baum aus Pappe hervor konnte ich sehen, wie der Rücken Ihrer Majestät außer Sicht verschwand, während Nigel und Eric ihr folgten und Jenkyns die Nachhut bildete, wobei er den ungestümen Hund am Halsband festhielt.
Ich wollte gerade in den Halbschatten des Lichts hinaustreten, doch etwas an Prinzessin Margaret hielt mich zurück. Sie schien zu zögern, und dann, gerade als Jenkyns ihr vollständig den Rücken zugekehrt hatte, tat sie zu meiner Verblüffung etwas, was ich nie erwartet hätte und was meine Kinnlade nach unten klappen ließ: Mit einer geschickten Bewegung riss Ihre Königliche Hoheit das Diadem vom Kopf der toten Frau und steckte es unter ihre Jacke.
Kapitel 2
Mein Vater und ich hatten verabredet, dass wir an jenem Abend im Feathers Hotel in Dersingham zu Abend essen würden, in dem er sich für die Dauer seines Aufenthalts ein Zimmer genommen hatte.
Seit dem Morgen war der Regen, falls überhaupt möglich, noch schlimmer geworden, und die Sonne war um halb fünf endgültig untergegangen und hatte die Landschaft jenseits der Umfassungsmauer rund um das private Gelände von Schloss Sandringham in völliger Schwärze versinken lassen. Angesichts des Wetters und der Tageszeit versprach der eine halbe Meile weite Weg vom Schloss zum Hotel nicht angenehm zu werden. Aber das war er nur selten.
Ziemlich häufig kämpften sich einige von uns abends die Straße und den Hang hinunter zum Feathers, während der Wind unsere Jacken aufblähte, der Regen uns ins Gesicht schlug und einer mit einer Taschenlampe uns die erste Hälfte der Strecke führte, bis die schwach leuchtenden Straßenlaternen an der Hauptstraße den Weg in den kleinen Ort wiesen.
Man musste sich vorher gut überlegen, was man anzog, und das tat ich auch an diesem Abend. In einer dicken Daunenjacke über einem Fleece-Shirt und mit meinen Doc Martens an den Füßen konnte ich ohne großes Unbehagen durch die Gegend stapfen. Tatsächlich kam es hin und wieder vor, dass ich dachte, ich könnte mich glatt daran gewöhnen.
Außerdem war der Marsch eine Gelegenheit zum Nachdenken. Dass ich Zeugin geworden war, wie Prinzessin Margaret der toten Frau dieses Diadem vom Kopf gerissen hatte, hatte mich einigermaßen verwirrt. Ihre Tat war nicht ganz so verwerflich, wie wenn man in den Taschen eines toten Mannes nach dessen Geldbörse sucht. Immerhin war das Diadem nur Modeschmuck, und es hatte durchaus in Reichweite gelegen, sodass die Tat kaum einen schweren Raub darstellte. Aber das Diadem überhaupt an sich zu nehmen schien nicht zu Margos Wesen zu passen.
Ich suchte nach einer vernünftigen Erklärung dafür: Ihre Königliche Hoheit kannte möglicherweise den Kostümverleiher, der den Schmuck zur Verfügung gestellt hatte. (Weit hergeholt.) Oder das Diadem gehörte in Wahrheit ihr und war die Kopie eines echten Schmuckstücks. (Das erschien mir ein wenig einleuchtender, wenn man die Identität der Toten bedachte.) Oder und wahrscheinlicher – und das war der Grund, warum ich mich für diese Möglichkeit entschied: Ihre Königliche Hoheit die Prinzessin war so verärgert über diese Verhöhnung ihrer Schwester gewesen, dass sie sich den Stein des Anstoßes kurzerhand geschnappt hatte.
Als wir, die den Leichnam hinter dem Vorhang gefunden hatten, von der Polizei kurz vernommen worden waren, hatte ich befürchtet, nach dem Diadem gefragt zu werden. Ich wollte nicht sagen müssen: »Oh, Prinzessin Margaret hat es genommen.« Zum Glück war dann das Diadem bei der Befragung gar kein Thema, wenngleich mir das später auch reichlich seltsam vorkommen sollte.
Der Grund, warum ich sage, es hatte ein Körnchen Logik, dass das Diadem Prinzessin Margaret gehörte, lag in der Verbindung zwischen der Toten und dem Personal von Schloss Sandringham. Wie sich herausstellte, war die Frau, die wir so friedlich auf der vergoldeten Trage liegend auf der Bühne im Gemeindesaal von Dersingham gefunden hatten, Jackie Scaife, die jüngere Schwester von Aileen Benefer, der Hausdame. Deshalb war mir das Gesicht der Toten selbst unter dem Make-up und mit dem königlichen Brimborium wohl so bekannt vorgekommen.
Es bestand eine gewisse Familienähnlichkeit: Beide Schwestern hatten ein breites, herzförmiges Gesicht. Jackies Züge waren allerdings feiner. Sie war die Hübschere … gewesen. Das konnte selbst die royale Aufmachung nicht verbergen.
Das war, gelinde gesagt, ein kleiner Schock, und mir tat Mrs Benefer schrecklich leid, unter der zu arbeiten meistens angenehm ist, wenn sie auch ein bisschen überängstlich und verhärmt ist. Da Mrs B. mitgenommen worden war, um ihre Schwester zu identifizieren und die anderen unvermeidlichen Aufgaben in die Wege zu leiten, die mit einem Todesfall in der Familie verbunden sind, hatte sich mir noch keine Gelegenheit geboten, ihr mein Beileid auszudrücken.
Aber natürlich wurde nach dieser Tragödie unter den Bediensteten wie üblich getratscht. Jackie Scaife, so hieß es, sei schon vor langer Zeit nach Amerika gegangen, und es sei doch komisch, dass sie nach all den Jahren zurückgekommen sei und von der albernen Pantomime abgesehen nicht viel mehr gemacht habe, als bei Aileen und deren Ehemann Tom in einem der Wildhüter-Cottages auf den Ländereien von Schloss Sandringham zu wohnen, wo angeblich auch nicht alles eitel Sonnenschein gewesen sei.
Von schrecklichen Streitereien in letzter Zeit war sogar die Rede … Jemand wollte sie bei Sainsbury’s in Lynn gesehen haben, wo sie in einem auffälligen Pelzmantel wie ein Hollywoodsternchen herumstolziert sei. Und jemand anders hat mir erzählt, er habe sie im Feathers Pub sitzen gesehen, wo sie bei allen anderen Gästen Drinks geschnorrt habe. Aber so sei sie schon als Teenager gewesen, ein Mädchen, das unbedingt etwas erleben wollte, nicht immer auf schickliche Weise … Man kennt dieses Gerede ja.
Doch je weiter ich das Schloss hinter mir ließ und je näher ich Dersingham kam, desto mehr wandten sich meine Gedanken meinem Vater zu. Es war nicht so, dass ich nicht froh war, ihn zu sehen. Das war ich durchaus. Ich hatte seit ewiger Zeit niemanden von meiner Familie zu Gesicht bekommen, und Weihnachten mit ihm bei Tante Grace war wirklich sehr schön gewesen, im Großen und Ganzen jedenfalls. Da er Grace nicht mehr gesehen hatte, seit er und meine Mutter vor fast dreißig Jahren ihre Hochzeitsreise nach England unternommen hatten und da er mich zum ersten Mal nach mehr als zwei Jahren wiedersah, schien die Unterhaltung wie der Strom zwischen zwei Polen hin- und herzuspringen, dem Davor und dem Danach. Ereignisse, die dazwischenlagen, wurden hingegen nur am Rande erwähnt.
Nach dem Truthahn und bevor Grace den Plumpudding flambierte, schilderte ich meinem Vater mein Abenteuer, als ich den Mord an einem Lakaien im Buckingham Palast im Jahr zuvor zu lösen geholfen hatte. Da Dad bei der Royal Canadian Mounted Police war, würde er die Details für sich behalten, das wusste ich. Leider glaubte er mir nicht, vor allem, als ich ihm erzählte, dass die Königin ebenfalls an der Aufklärung des Falles beteiligt gewesen war.
»Du hast schon immer viel Fantasie gehabt, Spatz«, sagte er und ließ sich den Pudding schmecken. Obwohl Tante Grace mir den Rücken stärkte, meinte mein Vater nur lachend: »Ja, ja, und ich habe Elvis bei Burger King gesehen.«
Ich nehme an, an diesem Abend baute sich eine gewisse Spannung zwischen uns auf, die nun noch zunehmen sollte. Bei Grace waren am Weihnachtswochenende noch andere Leute anwesend gewesen – einige entfernter verwandte Mitglieder der erweiterten Bee-Familie, Freunde und Nachbarn –, doch sobald wir uns in Long Marsham in Dads Mietwagen gezwängt hatten, auf der M25 unterwegs nach Sandringham und allein waren, schlichen sich unweigerlich bestimmte Themen in die Unterhaltung.
Thema A, nicht in Form einer Frage: »Warum bist du nicht wieder zu Hause in Kanada und besuchst die Uni?« Es war meinem Vater nur schwer klarzumachen, dass die Welt, wie er sie kannte, die Welt der Jobs auf Lebenszeit, Geschichte war. Ich konnte mich in den heiligen Hallen der höheren Ausbildung zu Tode rackern und am Ende eine Urkunde in der einen Hand halten, ja, aber genauso wahrscheinlich ein Staubtuch in der anderen. Ich schloss für mich ein Universitätsstudium nicht gänzlich aus, doch ich wusste nicht, was ich tun oder sein wollte, und ich konnte nicht erkennen, dass es sich lohnte, einen Abschluss in Kunst zu machen, dafür jedoch mit fünfundzwanzigtausend Dollar Schulden dazustehen. Und ich wollte nicht zurück nach Prince Edward Island, eine Insel mit weniger Einwohnern als ein durchschnittlicher Londoner Stadtteil.
Ich mochte mein Leben in der großen Stadt, argumentierte ich. Ich hatte gute Freunde im Palast: Der Buckingham Palast war mit seinen Gesellschaftsklubs und Sportmannschaften wie ein kleines Dorf. Und ich hatte auch außerhalb des Palastes gute Freunde. Also was machte es schon, wenn ich nur ein Hausmädchen war? Ich würde nicht für immer und ewig die Bettwäsche Ihrer Majestät wechseln und ihr Porzellan abstauben, Herrgott noch mal. An diesem Punkt unserer Unterhaltung war ich schon sehr laut geworden.
Das Wetter war das ganze Wochenende über ungewöhnlich trocken gewesen, der Verkehr am zweiten Weihnachtstag auf den acht Spuren der M25 nicht sonderlich stark, und mein Vater, der sich zunehmend wohler damit fühlte, auf der falschen (linken) Straßenseite zu fahren, drückte aufs Gas, als er auf die M11 zuhielt, die Hauptstrecke nach Cambridge und in den Nordosten. Der Wind pfiff an den Autoscheiben vorbei, und die Reifen verursachten auf dem Asphalt ein dumpfes Dröhnen, sodass sich jegliches Gespräch verbot.
Mein Vater blieb eine Zeit lang stumm, wie er das so gern macht. Er schreit nicht. Er ist immer vernünftig; manchmal geht einem das auf die Nerven. Ich dachte über das nach, was ich ihm wirklich nicht erklären konnte, ihm, dessen beruflicher und privater Werdegang so schnurgerade verlaufen war. Er war nach der Schule direkt auf die Polizeischule in Regina, Saskatchewan, gegangen, hatte danach mehrere vorgezeichnete Posten bei der RCMP innegehabt und war methodisch in der Polizei-Hierarchie aufgestiegen.
Ich konnte ihm nicht sagen, dass das, was ich an London so genoss, das Versprechen und das Unvorhersehbare waren – die Rolle, die das Glück im Leben spielen konnte, die unzähligen Umstellungen und Kombinationen, die sich ergaben, wenn man unter acht Millionen Menschen in einer kosmopolitischen, multikulturellen und vielsprachigen Stadt lebte, die Möglichkeit, dass einem aus heiterem Himmel etwas Seltsames und Wundervolles widerfuhr.
Ja, ich brachte einen großen Teil des Tages mit Putzen zu, doch die Arbeit war nicht schwer; es gab genug freie Zeit, und ich hatte stets das Gefühl, gleich hinter der nächsten Ecke würde etwas Aufregendes auf mich warten.
Als wir schließlich hinter Cambridge auf die langsamere A10 kamen, die nach Ely führt, brach mein Vater sein Schweigen. »Jedenfalls«, sagte er und bemühte sich, gut gelaunt zu klingen, »hoffe ich, du bleibst nicht wegen der Sache weg, die zwischen deiner Mutter und mir passiert ist.«
Ah, Thema B, dachte ich. Nein, sagte ich mir, damit hat es nichts zu tun; außerdem »bleibe ich nicht weg«.
»Nein«, sagte ich laut zu meinem Vater. Ich muss ein wenig defensiv geklungen haben, denn er wandte kurz die Aufmerksamkeit von der Straße ab – wir hingen hinter einem Umzugslastwagen fest – und schenkte mir einen seiner kühlen, vernünftigen Polizistenblicke. »Bist du sicher?«
»Natürlich bin ich sicher.« In Wahrheit empfand ich eine sonderbare Anwandlung von schlechtem Gewissen. Ich wusste, die Trennung meiner Eltern war nicht meine Schuld. Und doch konnte ich nicht anders, als der Abfolge der Ereignisse – mein Weggang nach Europa und ihre Trennung – Bedeutung beizumessen.
Ich war die Letzte, die das Nest verlassen hatte. Jennifer, meine älteste Schwester, war schon Jahre zuvor gegangen, um in Halifax, Nova Scotia, Naturwissenschaften zu studieren und anschließend Medizin. Julie, Tochter Nummer zwei, heiratete »Mr Kartoffelkopf« und zog zu ihm auf seinen Hof auf der Insel. War mein Weggang mit einer schlechten Phase zusammengefallen, die meine schon etwas älteren Eltern Steve und Ann durchliefen? Wären sie zusammengeblieben, wenn ich geblieben wäre?
Die Wahrheit ist: Ich hatte ihnen in meinem letzten Jahr zu Hause nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich hatte die Uni besucht, war nebenher verschiedenen Teilzeitjobs nachgegangen und hatte mich mit meinen Freunden getroffen, sodass das Zuhause eher ein Zwischenstopp war, ein Ort, um Schlaf nachzuholen und Wäsche zu waschen. Aber ich nehme an, dass sich meine Eltern in den vergangenen Jahren auseinandergelebt hatten. Zu diesem Schluss kam ich, wenn ich darüber nachdachte – und ich hatte darüber nachgedacht, seit sie ihre Trennung verkündet hatten, nicht lange, nachdem ich meine Europa-Reise angetreten hatte, die mich letztlich in den Buckingham Palast geführt hatte.
Natürlich kann man bei den Eltern nie ganz verstehen, worin ursprünglich die Anziehungskraft bestanden hat; man kann sie sich schwer im eigenen Alter vorstellen. Aber wenn ich zum Beispiel an ihre Jobs denke – an den meines Vaters bei der kanadischen Polizei und an den meiner Mutter beim Guardian in Charlottetown – und in der Zeit zurückgehe, kann ich sehen, wo der Keim des Niedergangs gelegt worden sein könnte. Ein Polizist und eine Journalistin sehen die Welt nicht mit den gleichen Augen.
Ich erinnere mich an bestimmte Meinungsverschiedenheiten beim Abendessen, die mich damals nur ein wenig wunderten, von denen ich aber heute denke, dass die beiden in Wirklichkeit über etwas anderes stritten.
Ich sagte zu meinem Vater: »Vielleicht sollte ich dich mehr oder weniger das Gleiche fragen: War mein Weggang von zu Hause der – wie nennt man das? – Katalysator?«
»Spatz, wir waren eh schon auf dem Weg dahin. Die Antwort ist Nein.«
»Aber hättet ihr euch getrennt … oder hättet ihr euch trennen können, als ich dreizehn oder vierzehn war? Wolltet ihr das, seid jedoch wegen uns Kindern zusammengeblieben? Das glaubt jedenfalls Julie. Wenn sie mir nicht ein Referat über meinen Neffen hält, erzählt sie mir bis ins kleinste Detail von Mom und dir.«
»Brendan ist ein tolles Kind. Du solltest nach Hause fahren und ihn kennenlernen.«
»Ich bekomme mit jedem Brief ein Foto von ihm. Du hast meine Frage nicht beantwortet.«
»Es ging uns nicht schlecht. Das ist keine bittere Trennung. Wir haben uns einfach … auseinandergelebt.«
»Komisch, dass du im Haus geblieben bist.«
»Wieso ›komisch‹?«
»Na ja, ich weiß nicht, meistens ziehen die Väter aus. Das war zumindest bei all meinen Freunden so, deren Eltern sich getrennt haben.«
»Deine Mutter wollte die Veränderung.«
»Sie hat aber keinen jüngeren Lover, oder?« Allein schon den Gedanken fand ich erschreckend.
»Nein.« Er lachte.
»Und du, Dad? Hast du eine andere?«
»… Nein.«
Ich hatte ein leichtes Zögern bemerkt, oder war ich übersensibel? Ach, zum Teufel!, dachte ich, es ist ihr Leben. Ich bin hier. Sie sind dort. Wir sind alle erwachsen.