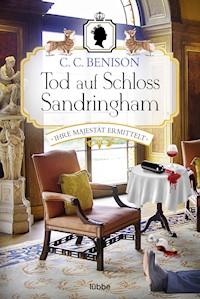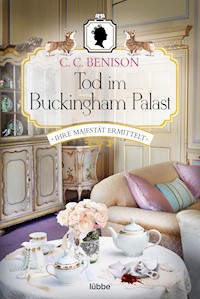
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ihre Majestät ermittelt
- Sprache: Deutsch
Die Queen ist "not amused", als sie eines Morgens über die Leiche eines ihrer Lakaien stolpert. Da das Opfer Robin Tukes als depressiv bekannt war, geht man von einem Suizid aus, und es werden keine weiteren Ermittlungen angestellt. Doch weder die Queen noch das Hausmädchen Jane Bee, eine gute Freundin von Robin, glauben an diese Theorie. Sie vermuten: Mord! Und für die Queen ist sofort klar, dass die beiden gemeinsam den Täter zur Strecke bringen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungProlog123456789101112131415161718EpilogBemerkung des AutorsÜber dieses Buch
Die Queen ist »not amused«, als sie eines Morgens über die Leiche eines ihrer Lakaien stolpert. Da das Opfer Robin Tukes als depressiv bekannt war, geht man von einem Suizid aus, und es werden keine weiteren Ermittlungen angestellt. Doch weder die Queen noch das Hausmädchen Jane Bee, eine gute Freundin von Robin, glauben an diese Theorie. Sie vermuten: Mord! Und für die Queen ist sofort klar, dass die beiden gemeinsam den Täter zur Strecke bringen werden.
Über den Autor
C. C. Benison ist das Pseudonym des kanadischen Schriftstellers und Journalisten Doug Whiteway. Er wurde 1961 geboren und studierte an der University of Manitoba und der Carleton University in Ottawa. In den 1980er-Jahren arbeitete er als Reporter für die Winnipeg Tribune und die Winnipeg Free Press. Danach schrieb er als freier Journalist für diverse Magazine und Zeitungen und unterstützte Unternehmen als freier PR-Berater. Mit seinen Kriminalromanen gewann er zahlreiche Preise. Er lebt in Winnipeg/Kanada.
Kriminalroman
Aus dem kanadischen Englisch vonHeike Rosbach
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1997 by C. C. Benison, this translation published by arrangement with the Cooke Agency International, CookeMcDermid and Liepman AG.
Originally published in English by Bantam Books
Titel der englischen Originalausgabe:
»Death at Buckingham Palace. Her Majesty Investigates«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dorothee Cabras, Grevenbroich
Titelillustration: © Richard Jenkins Photography;
© Judy Davidson/gettyimages; © Fusionstudio; MestoSveta; Kmannn;
VikaSuh; Afishka; Atlas Agency; Yeti studio/Shutterstock
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0366-6
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Nan, du hättest schallend gelacht.
Prolog
Das bin ich:
Vielleicht sollte ich aber besser mit »Das ist man:« anfangen. So spricht nämlich die Königin. »Man denkt gern, dass man seine Pflicht getan hat.« Etwa so würde sie sich ausdrücken.
Das ist man: Man heißt Jane Bee. Man ist zwanzig Jahre alt und Hausmädchen im Buckingham Palast.
Ach, es reicht mit diesem »man«!
Ich hatte ursprünglich nicht die Absicht, Hausmädchen im Buckingham Palast oder sonst wo zu werden. Es ist einfach irgendwie passiert.
Ich bin in Kanada geboren und aufgewachsen, in Charlottetown auf Prince Edward Island. Mein Vater ist Staff Sergeant bei der Royal Canadian Mounted Police, und meine Mutter ist die Herausgeberin des Guardian in Charlottetown, der Morgenzeitung auf der Insel. Sie lernten sich in den Sechzigern kennen, nachdem mein Vater seine Polizistenausbildung beendet hatte und meine Mutter die erste Frau geworden war, die von dieser Zeitung je als Reporter eingestellt wurde.
Sie bekamen drei Töchter. Ich bin die jüngste. Meine älteste Schwester Jennifer ist Assistenzärztin und macht ihr praktisches Jahr im Grace Maternity Hospital in Halifax. Julie, die mittlere, heiratete einen Kartoffelfarmer auf der Insel und erwartet gerade ihr erstes Kind – das erste Enkelkind meiner Eltern. Meine Schwestern sind beide sehr gesetzt und vernünftig.
Ich bin’s nicht. Nach der Highschool ging ich ein Jahr fünf verschiedenen Aushilfsjobs nach – Verkäuferin, Kellnerin, solche Sachen –, und danach verbrachte ich ein weiteres Jahr an der Universität und studierte Kunst. Wieder die Schulbank zu drücken war in Ordnung, aber ich hatte Leute mit einem Masterabschluss getroffen, die als Verkäuferin und Kellnerin arbeiteten. So sieht es heutzutage beruflich für Leute in meinem Alter aus. Deshalb entschied ich, dass es keinen Sinn hatte, mich mit dem Studium zu beeilen, nicht, wenn es danach keinen anständigen Job für mich gab. Ich hatte nicht Jennifers Begabung für Wissenschaft. Was Technisches war auch nichts für mich. Und einen Kartoffelfarmer zu heiraten und mir einen Stall voll Kinder ans Bein zu binden, konnte ich mir auch nicht vorstellen, jedenfalls jetzt noch nicht.
Ich beschloss, stattdessen ein Jahr lang quer durch Europa zu reisen. Ich hatte noch Geld von meinem »Jahr der fünf Jobs« übrig und hatte während meiner Zeit an der Uni zu Hause gewohnt und nebenher ein bisschen gearbeitet.
Natürlich waren Steve und Ann – unsere betagten Eltern – von meinem Plan nicht wirklich begeistert. Vor allem Steve nicht. Er hielt mir einen Vortrag, in dem er mir die Welt aus der Sicht eines Polizisten schilderte: Europa wäre voller Mörder, Vergewaltiger, Terroristen, Hochstapler und Männer, »die nur das eine wollen« (mein Vater ist wirklich altmodisch). Meine Mutter bewies wie bei allem, was uns Kinder betraf, ihre übliche Solidarität mit ihrem Mann, doch insgeheim war sie nicht vollkommen gegen meine Pläne. Immerhin hatten wir den Feminismus mit der Muttermilch eingesogen. Bevor ich ging, steckte mir Mum etwas Geld zu.
Also flog ich im September nach Europa. Vier Monate später war ich pleite. Wer hätte auch gedacht, dass das Leben in Europa so teuer wäre? Aber ich hatte eine tolle Zeit gehabt, und ich wollte nicht wieder nach Hause zurückkehren. Es war außerdem Januar. Der Januar in Kanada ist kein Vergnügen. Griechenland im Januar ist ein einziger Spaß – da ist Partyzeit –, doch ich konnte mir nicht mal das leisten, und dabei ist das Leben in Griechenland wirklich günstig! Vergleichsweise jedenfalls.
Ich besaß gerade noch genug Geld, um nach England zu meiner Großtante Grace zu fahren, die angeboten hatte, mich aufzunehmen. Oder »es mit mir aufzunehmen«, wie mein Vater es ausdrückte, als ich ihn aus Athen anrief.
Tante Grace ist die jüngste Schwester des Vaters meines Vaters, eine Bee genau wie ich. Sie lebt in dem Dorf Long Marsham in Buckinghamshire, nordwestlich von London, in einem Cottage, das im September gemütlich, im Januar jedoch dank Tante Grace’ großer Vorliebe für frische Luft ziemlich eisig ist.
Sie war es auch, die mich dazu brachte, im Buckingham Palast zu arbeiten. Eines Tages, als ich über den Mangel an Geld stöhnte und darüber, dass ich zurück nach Hause fahren müsse, schlug meine Tante vor, ich solle mir einen Job suchen. Ich gebe zu, die Idee war mir auch schon gekommen, aber ich war viel zu schön in meine Decken auf dem großen, dick gepolsterten Sessel im Wohnzimmer eingekuschelt, um tatsächlich aufzustehen und in der Sache aktiv zu werden.
Tante Grace schaute die diversen Londoner Zeitungen durch und las die freien Stellen laut vor. Ich war für die meisten unterqualifiziert. Diejenigen, für die ich qualifiziert war, waren – na, raten Sie mal – Verkäuferin und Kellnerin. Aber die Bezahlung bei diesen Jobs war so niedrig und die Miete in London so hoch, dass sich das kaum lohnte, wenn man sich nicht einen Mitbewohner suchte, und ich kannte in London niemanden. Die Idee wiederum, von Long Marsham aus zu pendeln, erschien für solch einen Job geradezu lächerlich – Long Marsham lag außerhalb der Reichweite der Metropolitan Line der U-Bahn; ich hätte mir also jeden Tag Bahnfahrkarten kaufen müssen, vom Zeitaufwand ganz zu schweigen.
Wir antworteten auf ein paar Chiffre-Anzeigen, die eine Stelle im Haushalt – ich vermutete, dass ich das schaffen konnte – und Kost und Logis versprachen, und das erste Antwortschreiben trug zu meinem Erstaunen das Siegel des Lord Chamberlain’s Office im Buckingham Palast.
»Vielleicht bekommst du einen Verdienstorden«, sagte ich zu Tante Grace, da mich das cremefarbene Briefpapier zunächst verwirrte. Wie ich schon sagte, ist Grace die jüngste Schwester meines Großvaters. Für ihre Generation bedeutete das, zu Hause zu bleiben, sich um die älter werdenden Eltern zu kümmern und nie zu heiraten. Falls sie das jemals bereute, so hat sie es doch nie gesagt. Sie ist eine flotte Frau mit gesundem Menschenverstand, viel Humor und großem Interesse an allem in ihrer Umgebung. Ich hatte sie sehr gern. Da ihr Leben offenbar auf die eine oder andere Weise im fortwährenden Dienst an der Gemeinschaft bestand, sei es das Organisieren von Essen auf Rädern oder die ehrenamtliche Arbeit in einem Hospiz, schien es nur natürlich zu sein, dass sie eine königliche Auszeichnung erhielt.
Sie aber winkte lachend ab. »Sehr unwahrscheinlich, Jane. Die Neujahrs-Ehrungsliste kam vor zwei Wochen raus. Ich hätte es bestimmt von irgendwem gehört, wenn ich darauf stünde. Außerdem, ist der Brief nicht an dich adressiert?«
Das war er tatsächlich. Jane Bee c/o Grace Bee. Man stelle sich mein noch größeres Erstaunen vor, als ich den Brief öffnete und las, dass man mich zu einem Bewerbungsgespräch um die Stelle als Hausmädchen im Buckingham Palast einige Tage später einlud.
Das Vorstellungsgespräch war einfach. Der Beamte schien halb zu schlafen und stellte nur die üblichen Fragen. Meine Staatsbürgerschaft war auch kein Problem. Mein Großvater war geborener Brite, und das gestattete es mir, ohne jede Einschränkung im Vereinigten Königreich zu arbeiten. Das Gehalt war fürchterlich gering, aber das war mir gleichgültig. Es war eine Stelle mit Verpflegung und Unterkunft. Ich würde mitten im Herzen Londons wohnen, einer Stadt, die ich zu lieben gelernt hatte, als ich im Spätsommer dort gewesen war. Und es war ein Spaß. Ich dachte mir, im Buckingham Palast zu leben und zu arbeiten wäre etwas, von dem ich noch meinen Enkelkindern erzählen könnte.
Der Palastbeamte deutete während unseres Gesprächs an, dass in diesen Jobs sowieso nur die wenigsten länger blieben. Ich bin sicher, er ging auch nicht davon aus, dass ich lange bleiben würde, und es war ihm egal, dass ich eigentlich studierte, mein Studium nur für eine Weile unterbrochen hatte und somit eine unwahrscheinliche Kandidatin für eine langfristige Anstellung war. Doch im September war ich immer noch im Palast und hatte ein weiteres Semester geschmissen, von meinem abgelaufenen Rückflugticket nach Kanada ganz zu schweigen.
Meine Eltern waren schier außer sich. Allerdings hatten sie in dem Sommer beschlossen, sich zu trennen – ich hatte gewusst, dass das kommen würde –, und so waren sie mehr als nur ein bisschen reizbar und verunsichert. Zum Glück waren sie auch mehr als sechstausend Meilen entfernt in Charlottetown auf Prince Edward Island.
Und so befand man sich also im Buckingham Palast.
1
Alles begann an einem Freitag Ende Oktober. Die Königin war ein paar Wochen zuvor aus ihrem Sommerurlaub auf Balmoral in Schottland zurückgekehrt. Und der Buckingham Palast hatte wieder zu seinem alten Selbst gefunden, das eher einem großen Hotel mit einem sehr anspruchsvollen Gast samt Ehegatten glich.
Es war gegen acht Uhr morgens, und ich staubsaugte allein im beeindruckend eleganten Grünen Salon vor mich hin, der auf den viereckigen zentralen Innenhof des Palastes hinausgeht. Normalerweise arbeiten wir in Zweierteams, aber meine Kollegin hatte sich freigenommen, um sich um ihre Mutter zu kümmern, die sich von einem Unfall erholte. Für die erste Hälfte des Axminsterteppichs, der so groß wie ein Fußballfeld war, hatte ich eine Ewigkeit gebraucht, und ich stieß gerade mit der Zehenspitze gegen einen verkrusteten Brocken, der für alle Welt wie vertrockneter Kaugummi aussah, als Nikki Claypole durch die Haupttür von der Gemäldegalerie hereingestürmt kam und meinen Staubsauger ausschaltete, bevor ich noch Zeit hatte, verdutzt zu sein.
Nikki wohnt direkt neben mir im Quartier der Hausmädchen im Dachgeschoss des Palastes, und manchmal frühstücken wir zusammen, doch an jenem Morgen hatte ich sie in der Servants’ Hall, dem Personalspeisesaal, vermisst. Nachdem sie am Vorabend heftig Party gemacht hatte, war Nikki bis zur allerletzten Minute im Bett geblieben, während ich meinen Kaffee allein getrunken und zu arbeiten begonnen hatte, bevor sie noch aufgestanden war. Ich weiß, das hört sich schrecklich brav und langweilig an, doch seit Kurzem schien ich meine alte Gewohnheit, bis in die Puppen zu schlafen, langsam abzulegen. Ich denke, das lag daran, dass ich zwanzig wurde.
»Hast du eine Ahnung, wie man Kaugummi aus einem Teppich bekommt?«, fragte ich über das ersterbende Jaulen des Staubsaugers hinweg.
»Verfluchte Touristen«, sagte sie und meinte damit die Horden, die im Sommer hier durchgetrampelt waren.
»Es können keine Touristen gewesen sein. Das ist der Originalteppich. Sie haben ihn extra für den Staatsbesuch wieder hingelegt.«
Nikki wedelte wegwerfend mit ihrem Staubtuch. Sie war mit ihren Gedanken eindeutig bei etwas anderem. Das konnte ich an dem schelmischen Leuchten auf ihrem sommersprossigen Gesicht erkennen, also ignorierte ich den Kaugummi und wartete darauf, dass sie mich aufklärte.
Wie es schien, war Ihre Majestät am Vorabend, dem Donnerstagabend, spät von einem Empfang oder so irgendwo in London in den Palast zurückgekehrt und im ersten Stock aus ihrem privaten Aufzug zu ihrem Schlafzimmer geschritten. I. M. war gerade in Höhe des Pagenvestibüls angelangt, als Robin Tukes, einer der Lakaien, aus der Tür der Länge nach auf die Nase fiel. Zu spät, denn plötzlich lag die Königin ausgestreckt auf ihm.
An diesem Punkt der Geschichte bekam Nikki einen Kicheranfall, und ihre Fröhlichkeit war so ansteckend, dass auch ich zu lachen anfing. Ich weiß, das hört sich gemein an – Ihre Majestät ist immerhin eine ältere Dame –, aber allein schon die Vorstellung, dass keine Geringere als die Königin von England über jemanden stolperte, war, na ja, urkomisch. Nikki ist nicht erbaut von der Verehrung, die alle Mitglieder und Beamten des königlichen Haushalts (die zwei obersten Stufen der Palasthierarchie) und die meisten Angehörigen des Personals (die unteren Chargen) der königlichen Familie entgegenbringen, und sie tut das gelegentlich kund, indem sie Ihre Majestät auf witzige Weise imitiert. Zwischen Prusten und Luftholen spielt sie beispielsweise nach, wie I. M. sich an ihre Handtasche klammert, auf diese berühmte altbackene Art die Stirn krauszieht und ihre Stimme dabei vor Verärgerung kiekst.
»Stehen Sie auf, Mr Tukes. Stehen Sie auf, sage ich, ich bin die Königin von England!« Nikki ließ sich auf einen der mit grünem Brokat bezogenen Stühle fallen und wischte sich mit dem Staubtuch die Tränen ab, als ein scharfer Befehl die Luft durchschnitt.
»Nikki Claypole, runter von dem Stuhl!«, schnappte eine vertraute Gestalt mit einem ebenso vertrauten Klemmbrett in der Hand. »Sie sind diesem Raum nicht zugeteilt. Und Jane, zurück an die Arbeit.«
Nikkis Gesichtszüge rangen um Fassung, als sie sich betont langsam von dem Stuhl erhob. Doch sobald Mrs Harbottle, die Stellvertretende Hausdame, ihr den Rücken kehrte und sich wieder zum Gehen wandte, streckte meine Freundin ihr die Zunge heraus. »Die alte Schachtel«, sagte sie leise. »Wir haben heute Morgen die Große Halle am Hals. All diese verfluchten Stühle! Also«, fügte sie hinzu, und ihr Gesicht hellte sich auf, »kannst du das glauben? Robin und Ihre Majestät in einem Knäuel auf dem Boden?«
»Aber was ist Robin zugestoßen?«, fragte ich, als sie auf die Tür zur von der Sonne erleuchteten Gemäldegalerie zuging, die eher ein mit Kunst überladener Korridor ist, der viele der Staatsgemächer verbindet. »Was hat er denn zu ihr gesagt?«
»Ach, nichts«, antwortete Nikki und hielt an, um vor der verspiegelten Tür mit ihrem ingwerfarbenen Haarzopf zu spielen. »Zumindest nicht, soviel ich weiß. Robin war völlig von der Rolle. Sternhagelvoll. Na ja, gestern Abend war ja seine Geburtstagsparty, nicht? Entschuldige, ganz vergessen. Du warst ja nicht da.«
Nein, ich war nicht dort gewesen. Ich hatte angefangen, mit einem jungen Mann aus der Filmcrew auszugehen, die sich im Augenblick viel im Buck House aufhielt, da sie eine Doku über die innere Organisation des Buckingham Palasts drehte. Mir hatte es leidgetan, die Party zu Robins einundzwanzigstem Geburtstag zu verpassen, doch dieser Filmtyp hatte Potenzial.
»Nebenbei« – Nikki verschwand bereits in die Gemäldegalerie –, »auf der Party gestern Abend ist noch was wirklich Interessantes passiert.«
»Was denn?«
Ihre Stimme wehte zu mir herüber. »Tut mir leid, die Große Halle ruft. Du wirst es noch früh genug erfahren.«
Tratsch und Klatsch ist das Schmiermittel des Buck House, keine Frage. Aber ich fragte mich, wie diese Geschichte, dass die Königin über Robin gestürzt war, so schnell hatte herumgehen können. Robin war zu dem Zeitpunkt offensichtlich volltrunken gewesen. Und es war nicht wahrscheinlich, dass I. M. etwas ausplauderte, das ihrer Würde so starken Abbruch tat wie der Sturz über einen Lakaien. Hatte also ihr Leibwächter geplaudert? Nicht, wenn er nicht in Brixton auf Streife gehen wollte. Wer dann?
Es mag seltsam erscheinen. Im Buckingham Palast wimmelt es von Hausangestellten, und es konnte jeder von ihnen gewesen sein. Aber jene bei den Privatgemächern der Königin spätabends sind nur eine kleine Elitetruppe. Und sie sind für ihren Dienst dort fest eingeteilt. Sie sollen dort sein. Sie sind diskret. Robin gehörte nicht zu ihnen. Er wankte im Vollrausch im Pagenvestibül herum, knapp dreißig Meter vom Schlafzimmer Ihrer Majestät entfernt. Warum hat ihn keiner aus dem Weg geschafft? Wo waren die Angestellten alle gewesen?
Den Rest des Vormittags verbrachte ich damit, den karminrot-goldenen Axminster mit seinem Tudorrosen-Muster abzusaugen und mit dem Tuch den Konzertflügel, die Schränkchen aus dem achtzehnten Jahrhundert und den riesigen vergoldeten Kerzenständer mit den drei kitschigen Göttinnenfiguren abzustauben. Und ich schaffte es, das Potpourri-Gefäß, das einst Madame Pompadour gehört hatte, nicht zu zerdeppern, obwohl es die Form eines Schiffs hatte und so aussah, als sollte es schleunigst auf irgendeinen Dachboden davonsegeln.
Wir erledigten alle gerade das doppelte Pensum des üblichen Programms. In der folgenden Woche war ein Staatsbankett für den RamaLamaDingDong angesetzt, den König von irgendeinem südostasiatischen Land, dessen Namen keiner aussprechen konnte. Das Bankett sollte das Kernstück des Dokumentarfilms werden, und die Extra-Putzaktion in den Staatsgemächern hatte schon lange vor dem Ereignis begonnen. Die meiste Zeit waren wir Hausmädchen mit niederen Arbeiten – Wischen, Abstauben, Bettenmachen – in den entlegenen Ecken des Palastes beschäftigt, die selbst die Königin nie zu Gesicht bekommt (das Buck House, wie wir traditionell den Palast nannten, hat vermutlich weit über siebenhundert Räume und mehrere Meilen Korridore).
Doch das anstehende Bankett hatte zu einer interessanteren Veränderung unserer Routine geführt. Wir verbrachten mehr Zeit in den großartigen Staatsgemächern inmitten all dieses teuren Krempels. Und wir erlebten den fragwürdigen Kick, gelegentlich in eine Scheinwerfergruppe und das Tonequipment zu laufen, wenn Cyril Wentworth-Desborough, der überaus aufbrausende Filmregisseur, mit seinem Gehstock herumfuchtelte und Befehle erteilte.
So dauerte es eine Weile, bis mir auf dem Weg hinunter in den Keller zur Wäschekammer Freddie, einer der Unterbutler, etwas mitteilte, das die Frage, wer den königlichen Sturz mitbekommen hatte, sofort aus meinem Kopf verbannte: Robin Tukes war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Man hatte ihn ins Devonshire Hospital gebracht, und dort sollte er noch mindestens ein oder zwei Tage bleiben.
»Sie haben ihm den Magen ausgepumpt«, verkündete Freddie, dem die Vorstellung zu gefallen schien. »Er muss wirklich hackedicht gewesen sein.«
Bis zum Mittag, als ich mich im Personalspeisesaal zu Nikki und David Pye, einem der anderen Lakaien, gesellte, war die Geschichte noch merkwürdiger geworden. Jetzt war nicht mehr nur von Alkohol die Rede. Jetzt sprach man von Pillen. Es ging das Gerücht, Robin hätte am Vorabend versucht, sich das Leben zu nehmen.
»Aber das ist verrückt«, sagte ich, während ich die ekligen Nierenstückchen in dem Steak-Nieren-Pie herausklaubte und zu einem separaten Häufchen auftürmte. »Zunächst einmal, wenn jemand sich umbringen will, warum sollte er das ausgerechnet im Pagenvestibül versuchen?«
»Nun ja, Robin hat unbestreitbar einen Hang zum Theatralischen, nicht wahr?«, erwiderte Davey. »Vielleicht hat er das mit Absicht gemacht, damit Ihre Majestät ihn findet.« Er setzte sich in Pose. »Kannst du dir das nicht vorstellen? Mutter beugt sich über ihn, ihre Perlen klimpern, sein bleiches Gesicht zuckt leicht, seine Augen gehen flatternd auf. ›Oh, Euer Majestät, Sie lieben mich, Sie lieben mich wirklich.‹ Dass unerwiderte Liebe einen Mann schrecklich mitnehmen kann, ist bekannt.«
»Ha, du musst es ja wissen«, warf Nikki ein.
»Du verletzt mich.«
»Kommt schon, ihr zwei, hört auf«, sagte ich. »Das klingt ernst.«
»Na ja, ich weiß nicht«, gab Davey zurück. »Wenn es stimmt, dann ist doch das Pagenvestibül ein ziemlich abwegiger Ort, um … na ja, du weißt schon.«
»Um sich umzubringen?«
»Genau. Obwohl Robin sich in letzter Zeit ein bisschen sonderbar verhalten hat. Findest du nicht? Ich meine, ich habe immer gedacht, dass er irgendwie manisch ist. Du weißt schon: überschäumende Energie, dann skandalöses Verhalten, danach plötzlich tiefe Depression. Er hat sich mit keinem von uns in diesem Sommer oben in Balmoral viel abgegeben. Er war nicht amüsant, und Balmoral kann so ein Spaß sein, wenn man es darauf anlegt! Und dann gestern Abend, als er verkündete –«
»Aber ich würde ihn nicht als selbstmordgefährdet beschreiben!«, unterbrach ich ihn. Ich konnte es einfach nicht glauben. Seit seiner Rückkehr aus Schottland war Robin eindeutig bedrückt gewesen. Mir war der Unterschied besonders stark aufgefallen, da ich in der Hierarchie ganz unten stand und nicht das Privileg genossen hatte, mit einigen anderen vom Personal nach Balmoral zu gehen, dem Sommersitz der königlichen Familie. Doch ein Selbstmordversuch, das war einfach zu viel.
»Ach, ich weiß nicht«, sagte Nikki. »Was erwartest du? Er ist schwul, er ist mit sich uneins …«
Davey verdrehte übertrieben die Augen. »›Mit sich uneins?‹ Wie du die Sprache verbiegst. Das liegt an dem Mist, den du in den Frauenzeitschriften liest.«
»Du kannst mich mal! Ich lese keine Frauenzeitschriften.« Nikki blitzte ihn an, während Davey eine Gabel Trifle an seine Lippen führte. »Du weißt, wovon ich rede.«
»Nur du weißt nicht, wovon du redest«, nuschelte er mit vollem Mund. »Um Himmels willen, ich bin schwul. Viele Lakaien sind schwul. Und was die höheren Mitglieder des Personals angeht – da gibt es mehr als eine Königin im Bienenkorb, wie du sehr wohl weißt. Nur weil man schwul ist, ist man noch lange nicht selbstmordgefährdet.«
Nikki zog eine Grimasse und trank einen Schluck von ihrem Tee. »Als ob ich das nicht wüsste, du Idiot. Du hast mich nicht ausreden lassen. Ich meine, Robin ist schwul, und jetzt ist er verlobt und will diese blöde Kuh Angela Cheatle heiraten. Das meine ich mit ›mit sich uneins sein‹.«
Sie stellte ihre Teetasse geräuschvoll zurück auf den Unterteller und verschränkte triumphierend die Arme vor der Brust. Davey gab sich geschlagen; er schürzte die Lippen, und über seine pummeligen rosigen Wangen zogen sich Falten.
Mir war die Kinnlade heruntergefallen. »Verlobt? Robin ist verlobt?«
»Das hast du nicht gewusst?« Davey warf Nikki einen Blick zu. »Welch untypische Zurückhaltung deinerseits, meine Liebe … Ja, Robin hat es gestern Abend auf seiner Party verkündet. Oh, mir gefällt deine Reaktion, Jane. Du siehst genauso aus wie wir gestern: wie die Tierchen, die auf die Autoscheinwerfer klatschen. Als er fertig war, hättest du die sprichwörtliche Nadel fallen hören können. Zuerst dachten wir, das wäre nur ein Scherz, aber Robin sah schrecklich entschlossen aus – und Angie auch –, deshalb spielten wir alle mit, nicht, Nikki? Dann hat er sich betrunken und ist von dannen gezogen, und das Nächste, was wir hörten, war, dass er im Krankenhaus ist.«
»Verlobt und will heiraten?«
»Das hat dich offenbar umgehauen.«
»Na ja … ja. Ich meine …« In Wahrheit war ich etwas beleidigt. Ich hatte selbst für Robin geschwärmt, als ich ihn kennengelernt hatte.
»Vielleicht war er also die ganze Zeit über bi«, sinnierte Davey, während er seinen Tee mit dem Finger umrührte. »Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht ganz sicher, dass es so was wie Bisexualität überhaupt gibt. Mir ist so etwas jedenfalls noch nie passiert.«
»Und wird es wahrscheinlich auch nie«, fügte Nikki hinzu.
Davey zog ihr ein Gesicht, bevor er den Finger in den Mund steckte.
Mir schwirrte noch der Kopf von der Neuigkeit. »Ich wusste nicht mal, dass sie viel miteinander zu tun hatten«, sagte ich. »Ich meine … Robin. Und Angie? Verlobt? Wollen heiraten?«
»Ja, schon merkwürdig, nicht?« Davey schob den Dessertteller zur Seite und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Ich denke, das einzige Mal, dass ich sie tatsächlich zusammen gesehen habe, war auf Balmoral, am Abend des Gillies’ Ball. Ich … ja, Jane? Du runzelst die Stirn?«
»Wessen Ball?«
»Der Gillies. Ach, so ein altes gälisches Wort für uns Dienstboten. Gewöhnlich steht ein Gillie hinter einem Gutsherrn, der zu seinem Vergnügen ein armes kleines Tier abknallt. Jedenfalls«, fuhr er fort, »ist der Ball für die Arbeiter und Nachbarn des Landsitzes und natürlich für uns. Zu schade, dass du nicht dabei warst, Jane. Du hättest vielleicht mit dem Prince of Wales tanzen können und –«
»Aber was war denn mit Robin und Angie?«, unterbrach Nikki ihn.
»Ach ja. Die Turteltäubchen. Wie ich schon sagte, am Abend des Gillies’ Ball ging ich irgendwann wegen irgendwas zurück ins Personalquartier, und da waren sie, beide durchnässt bis auf die Haut, und sie sahen ziemlich witzig aus …«
»Wahrscheinlich weil einer von euch Fieslingen sie gerade in den Dee geworfen hatte.«
»Stimmt nicht, Nikki. Alle waren brav gewesen. Wir hatten an dem Tag schon den obersten Berater des Premierministers hineingeschmissen, und Mutter war gar nicht erfreut darüber. Sie hat nichts dagegen, wenn wir ihre leitenden Berater in den Fluss werfen, aber sehr wohl etwas dagegen, wenn es die von anderen sind. Außerdem halten wir uns an die Tradition und ziehen sie davor nackt aus.«
»Also denkst du, Robin und Angie waren romantisch im Mondschein eine Runde schwimmen?«
»Ich sagte: ›durchnässt bis auf die Haut‹, Nikki. Sie hatten ihre Kleider an. Angie behauptete, sie hätten am Ufer herumgealbert und wären hineingefallen. Könnte wahr sein, denk ich mal …«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass Angie ›herumalbert‹«, widersprach ich.
»Ich auch nicht.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen, da Nikki und Davey ihre Mahlzeit verdauten und ich die Neuigkeiten verdauen musste.
»Na gut«, meinte ich schließlich und seufzte über meinen nicht aufgegessenen und gerinnenden Steak-und-Nieren-Pie, »ich vermute, es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass Angie schwanger ist.«
Angela war wortkarg gewesen, doch Gerüchte über morgendliche Übelkeit und eine leichte, aber merkliche Gewichtszunahme sagten uns Mädchen genug über ihren Zustand.
»Überhaupt kein Geheimnis«, stimmte Davey bei. »Sie haben es bekannt gegeben, als sie ihre Verlobung verkündeten. Sie bekommen sogar einen Sohn.«
»Woher wissen sie das?«
»Durch einen dieser Tests, denke ich.«
»Wirklich? Igitt!« In meinem Kopf spukten Bilder von langen, unangenehm aussehenden Nadeln herum.
»Das muss aber doch nicht heißen, dass Robin der Vater ist.«
»Warum sollte er sie denn sonst heiraten?«
»Na ja, ich weiß, dass ich es nicht weiß.«
»Und warum sollte er, nachdem er etwas verkündet hat, das eine Freude sein sollte, weggehen und versuchen, sich umzubringen? – Was ich im Übrigen nicht eine Sekunde lang glaube.«
»Robin hat in letzter Zeit gar nicht gut ausgesehen, weißt du? Vielleicht war es, was man einen ›Hilfeschrei‹ nennt?«, sagte Davey. »Wenn er doch nur das Zitronenmesser von Lady Di gehabt hätte.«
»Oh, bitte …«
»Aber die Frage ist: Warum heiratet sie ihn, das möchte ich wissen.« Nikki hing eindeutig ihren eigenen Gedanken nach.
»Stimmt. Sie wird ihre sagenhafte Karriere aufgeben müssen. Eine verheiratete Frau kann im Buck House nicht Hausmädchen sein. Das besagen die Vorschriften.«
»Ich weiß …«
»… obwohl ich mich frage, ob man als ledige Mutter Hausmädchen sein könnte. Hm, na, das wäre mal ein Schritt ins zwanzigste Jahrhundert: Sie könnten einen Hort einrichten. Wir sehen hier nie irgendwelche Kinder, nicht seitdem die Mami dieser kleinen York-Prinzessinnen Reißaus nahm.«
»Was ich sagen will, Davey, wenn ich auch mal etwas zwischendurch einwerfen darf: Für so eine wie Angie Cheatle ist ein Lakai nicht gut genug. Angie hat es auf jemand Besseres abgesehen, das kann ich dir versichern.«
»Oh, also, dann immer raus damit«, meinte Davey. »Auf wen?«
»Na ja, das weiß ich nicht«, erklärte Nikki düster, »aber die Miene, die sie manchmal aufsetzt … Ich hab gesehen, wie sie nicht nur einem feinen Pinkel hier schöne Augen gemacht hat, wenn sie die Chance dazu hatte. Und sind dir einige der Sachen aufgefallen, die sie trägt? Wie kann sie sich die vom Gehalt eines Dienstmädchens leisten?«
»Nikki, Liebes, ich verwende nicht viel Zeit darauf, weibliche Schönheit zu begutachten. Obwohl, jetzt, da du es sagst: Angie hatte in letzter Zeit ein paar reizende Fummel an. Ich würde sie bitten, mir einen für den nächsten Alexis-versus-Krystle-Wettbewerb im Toodle’s zu leihen, aber leider hab ich nicht ihre Konfektionsgröße.«
»Vielleicht ist es die bevorstehende Mutterschaft.« Ich hatte das Bedürfnis, unser Gespräch von Daveys Interesse für Drag-Kleidung abzulenken. »Ihr Baby braucht einen Vater, und sie hat jemanden gefunden, der für die Rolle geeignet ist, ob er nun der biologische Vater ist oder nicht.«
Die beiden sahen mich bedrückt an.
»Warum sollte Robin das machen?«, fragte Nikki.
»Na ja, ich weiß es nicht.«
»Wenn schon jemand selbstmordgefährdet sein soll, dann ja wohl Karim«, sinnierte Davey. »Obwohl …«
»Was?«
»Hm, ich wollte sagen, dass Robins Verlobung mit Angie für Karim ein Schock gewesen sein muss, doch nun frage ich mich, ob er nicht schon längst davon wusste. Vielleicht haben Robin und Karim aus diesem Grund seit Wochen nicht miteinander geredet.«
»Vorher hätte man sie die meiste Zeit nicht mal mit der Brechstange auseinanderbekommen«, bemerkte Nikki.
»Ja, seltsam. Ich kann sehen, was Karim an Robin attraktiv fand. Aber andersherum?« Davey zuckte mit dem Schultern. »Karim ist so … ich weiß nicht. Was ist an Karim attraktiv? Er ist so mürrisch. Du kannst nichts sagen, ohne dass der Junge gleich verstimmt aussieht. Er steht nicht auf mich.«
»Na, wir wissen alle, auf wen du stehst, nicht?«, erwiderte Nikki lauernd.
Davey hob seine Teetasse und lächelte affektiert. »Er hat mir neulich zugezwinkert, wisst ihr? Da bin ich mir sicher.«
»Du spinnst doch.«
Es war ein Scherz unter einigen Leuten des Personals, dass Davey sich zu einer hochrangigen Person im Palast hingezogen fühlte, deren Namen ich besser unerwähnt lassen sollte, wie Tante Grace meint. Darüber muss ich noch nachdenken.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle mal mehr über Robin erzählen, denn er steht bei der Geschichte im Mittelpunkt. Robin Tukes ist wie ich Kanadier. Als ich meinen Dienst antrat, war er bereits seit rund sechs Monaten im Palast, und er hatte seine Stelle als Lakai auf dieselbe Art und Weise bekommen wie ich meine als Hausmädchen – auf eine Zeitungsanzeige hin. Wenn man das Palastleben in- und auswendig kannte, war leicht nachzuvollziehen, warum er als Footman eingestellt worden war: Robin war auf fast schon klassische Weise gut aussehend: groß, schlank, dunkelhaarig, wie gemeißelte Gesichtszüge – der Typ, wie man sie aus amerikanischen Seifenopern kennt.
Doch nach dieser Beschreibung könnte man vielleicht meinen, er wäre oberflächlich. Das war er beileibe nicht. Wenn wir beide dreizehn Jahre alt gewesen wären, hätte ich gesagt, Robin war »tiefschürfend«. Es ist die Art von Wort, mit dem man in dem Alter einen Jungen mit der schrecklich attraktiven Fähigkeit zu grübeln beschreibt. Aber der Unterschied zwischen einem Dreizehnjährigen und einem Einundzwanzigjährigen ist im Großen und Ganzen der, dass Letzterer wahrscheinlich einen Grund zum Grübeln hat.
Unsere Freundschaft kam durch etwas sehr Einfaches zustande – die beiderseitige Freude, noch einen Kanadier in einem Haufen Briten zu finden. Nicht lange danach konnte man Robin und mich im Bag O’Nails antreffen, dem Pub unten auf der Buckingham Palace Road, wo wir uns auf nette Art und Weise über das Englische lustig machten – zumindest ich.
Bei Robin besaß die Witzelei gelegentlich mehr Biss. Es stellte sich heraus, dass er eine hässliche Beziehung mit jemandem hinter sich hatte, der dem Ausdruck »Englisches Kaltblut« eine ganz neue Bedeutung verlieh. Die Affäre war der Höhepunkt in einem Leben, das gänzlich auf diese aussichtslosen Wochenendbeziehungen ausgerichtet war, von denen man in Romanen liest und die dort sehr romantisch klingen. In seinem Fall waren sie aber »ausschweifend« – ein Wort, das Tante Grace einmal in einer Diskussion über Robin verwendet hatte und das gut zu passen schien.
Robin war von seiner Familie nach England geschickt worden, um eine »anständige Ausbildung« zu erhalten. (Das erzählte er spöttisch mit in die Luft gereckter Nase.) Doch er nahm das Geld für das Studium, brach in Cambridge seine Zelte ab und ging nach London. Es war wie die Flucht aus einem Käfig. Ich kenne das. Als mein Flieger aus Kanada in London aufsetzte, überkam mich dieses unbändige Glücksgefühl. Doch wenn ich damals ganz langsam und vorsichtig in die neu gefundene Freiheit eintauchte, so sprang Robin mit Anlauf mitten hinein.
Ich kann es nur dem wenigen gegenüberstellen, was er mir von seinem Leben zu Hause in London, Ontario, erzählte, einem Ort, wo es auf dem Friedhof noch am lebendigsten zugeht, wie Robin mir einmal sagte. Sein Vater war ein paar Jahre zuvor gestorben, seine Mutter durch den Tod ihres Ehemanns am Boden zerstört, und Herr im Haus war eine Art Feldwebel-Schwester, die fast fünfzehn Jahre älter als Robin war. Offensichtlich besaß die Familie Geld. Robin war auf die allerbesten Privatschulen geschickt worden, zuletzt ans Upper Canada College in Toronto. Aber er hatte es gehasst … Seine Jugend wirkte düster.
Doch in London (England) war gerade große Party. Robin zog es zum Theater. Ihm gefiel die Schauspielerei beziehungsweise die Vorstellung, Schauspieler zu sein, was bestimmt jeder Psychologe, der seine dreißig Pfund die Stunde wert ist, als typische Reaktion auf eine unterdrückte Kindheit deuten würde. Robin spielte bei mehreren kleinen Theatergruppen mit, doch die Theaterszene überschnitt sich mit der Schwulenszene, die sich wiederum mit der Drogenszene überschnitt, die sich mit dieser Szene und jener Szene überschnitt (hier bietet sich die Gelegenheit für einen Reiseführer: London: Die Stadt der Szenen), sodass Robin eines Morgens aufwachte und die Szenen alle durchhatte. Und Geld hatte er auch keins mehr.
So endete er im Buckingham Palast. Er brauchte Geld. Er brauchte einen Job. Er hatte den gleichen Einwanderungsstatus wie ich. Sein Großvater, ja seine beiden Großväter waren geborene Engländer.
Doch er brauchte etwas mehr – ein Versteck, einen Ort, um wieder zu sich zu finden, seine Wunden zu lecken und zu entscheiden, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen wollte. Und obwohl das Buck House so berühmt und so groß ist, ist es doch seltsamerweise der ideale Rückzugsort für diejenigen, die der Welt überdrüssig sind. Es ist wie ein kleines Dorf. Es gibt Freizeitklubs und Sportmannschaften, ein Postamt, eine Bank und eine Cafeteria und für jeden ein eigenes Zimmer. Man kann dort praktisch leben und sterben, ohne jemals einen Fuß vors Palasttor zu setzen. Sofern man das wollte.
Im Laufe des Frühjahrs und Frühsommers festigten Robin und ich unsere Freundschaft, indem wir gemeinsam die Sehenswürdigkeiten Londons besichtigten. Niemand sonst wollte das, nicht einmal Karim. Die anderen Palastbewohner stammten aus London und meinten, sie hätten noch ein Leben lang Zeit, sich den Tower of London anzusehen – genau wie viele New Yorker den letzten Atemzug tun, ohne jemals oben auf dem Empire State Building gewesen zu sein. Wann immer also Robin den Drang verspürte, der dörflichen Atmosphäre des Buck House zu entkommen, begleitete ich ihn. Ich gehe gern in die St. Paul’s Cathedral und das Britische Museum und die Westminster Abbey oder sogar die Themse hoch bis nach Hampton Court oder hinunter bis nach Greenwich.
Aber ich merkte bald, dass Robin gar nicht so an Geschichte und Kultur interessiert war, sondern vielmehr an Orten sein wollte – Touristenhochburgen sind ein super Beispiel dafür –, wo es unwahrscheinlich war, dass er einem seiner alten Kumpels aus der Zeit vor dem Buck House über den Weg laufen würde. Einmal hat er mich eiligst aus der Tate Gallery hinausgetrieben, weil er bei einem der kubistischen Gemälde jemanden erblickt hatte, dem er lieber nicht begegnen wollte. Obwohl er beiläufig über die Episode hinwegging, wie er es gern tat, hätte ich schwören können, dass er bestürzt war. Und ich fühlte mich schlecht, weil ich auf der Tate bestanden hatte, einem Ort, der Londoner ebenso anzieht wie Touristen.
Nach alldem hat es den Anschein, als wäre Robin ein gut aussehender Einsiedler. Und es stimmt, er war nicht sonderlich erpicht darauf, in Pubs, Bars oder Weinlokale zu gehen, von dem vertrauenswürdigen Bag O’Nails mal abgesehen. Aber im Innern des Buck House war das eine andere Sache. Wie Davey richtig festgestellt hatte, hatte Robin etwas Manisches an sich, einen Leichtsinn, der zu Ausbrüchen von skandalösem Verhalten führte.
Im Frühling sahen sich einige Lakaien auf dem Fernseher in ihrem Aufenthaltsraum die Oscar-Verleihung an. Die Übertragung verzögerte sich, und ein alter Clip aus den Siebzigern wurde eingeblendet, einem Jahrzehnt, das gerade wieder in Mode gekommen war. Der Videoclip zeigte einen nackten Mann, der hinter einem alten Schauspieler quer über die Bühne rannte. Irgendwer erinnerte sich, gelesen zu haben, dass man diese Leute damals »Flitzer« genannt hatte. Robin forderte die anderen heraus, das auch zu machen. Da sie eh schon alle beschwipst waren, zogen sie sich splitterfasernackt aus und flitzten im Palast herum, sogar in der Nähe der königlichen Privatgemächer.
Der Master of the Household, der weit oben in der Palasthierarchie steht, erfuhr davon und bekam einen Wutanfall. Anscheinend hatte I. M. den Tumult gehört, den Kopf aus ihrem Wohnzimmer gesteckt und einen unbedeckten Hintern erblickt. Sie war nicht erfreut, zumindest offiziell.
Wir schon, muss ich sagen. Inoffiziell.
Und ein anderes Mal gab es eine Party gleich nach dem Trooping the Colour, dem offiziellen Geburtstag der Königin im Juni, wenn die Leibgarde Ihrer Majestät, die Foot Guards, vor der Königin in der Horse Guard Parade bei Whitehall in ihren scharlachroten Jacken und Bärenfellmützen vorbeimarschieren. Wir aus den unteren Rängen hatten einen Heidenspaß, als auf einmal die Königin erschien. Nur war sie circa dreißig Zentimeter gewachsen. Es war Robin im Drag-Kostüm. Es war eine herrliche Vorstellung. Ein Kostümbildner, den Karim kannte, hatte Robin mit dem noblen Outfit ausgestattet, das I. M. bei der Parlamentseröffnung trägt – ein langes weißes Kleid mit einer blauen Schärpe und dem Hosenbandorden auf der Brust. Die Perücke war perfekt, das ergrauende Haar war toupiert und sah duftig aus; auf seinem Gesicht lag eine dicke Schicht Make-up, und er hatte alle erforderlichen Accessoires dabei – die Krone, die eulenartige Brille, die kleine Handtasche. Aber es war seine Darstellung, die den Vogel abschoss. Robin schaffte es so gut, im belanglosen Gespräch höflich inquisitiv zu sein und auf impertinente Bemerkungen völlig frostig zu reagieren, dass ihn bald alle »Ma’am« nannten, sich verbeugten oder knicksten. Am beeindruckendsten aber war, dass seine Darbietung fast schon ehrerbietig war. Er fiel kein einziges Mal aus der Rolle.
Es war eine tolle Nummer – Davey war grün vor Neid –, und sie brachte Robin in Schwierigkeiten. (Er stand dafür gerade und erhielt einen Rüffel vom Chef der Lakaien, dem Travelling Yeoman.) Bei dieser Aktion erhaschten wir jedoch einen kurzen Blick auf Robin, wie er in der Zeit vor dem Palast gewesen war – impulsiv, maßlos, forsch. Hatten diese Eigenschaften auch zu der seltsamen Sache mit der Verlobung geführt? War es eine spontane Aktion gewesen wie in seinen früheren Zeiten? Oder eine wohlkalkulierte, um die Ordnung wiederherzustellen, nach der er in seinem Leben suchte?
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich darauf keine Antwort.
Aber eines wusste ich genau: Der Robin, der im Oktober aus Schottland zurückgekehrt war, war nicht der Robin, der im August dorthin gefahren war. In den letzten Wochen schien er sich von allen zurückgezogen zu haben. Er sah so schrecklich ernst aus, als lastete alles Gewicht der Welt auf seinen Schultern. Ja, es war seine gedrückte Stimmung, die ursprünglich die Idee zu der Geburtstagsfeier hatte aufkommen lassen. Alle hatten gedacht, die Party könnte ihn aufmuntern.
Ich hatte vor, Robin im Krankenhaus zu besuchen, aber ich bekam keine Chance, mich davonzustehlen. Freitags fährt die Königin über das Wochenende nach Windsor, und sobald sie abreist, scheint der Arbeitseifer im Buckingham Palast schlagartig nachzulassen. Doch an diesem speziellen Freitag führte Mrs Harbottle sich auf wie ein Sklaventreiber. Ich freute mich darauf, einen Teil des Wochenendes in Long Marsham zu verbringen, und ich hatte Tante Grace versprochen, gegen Abend dort zu sein. An dem Tag blieb keine Zeit für einen Besuch im Krankenhaus.
Auf dem Weg aus dem Palast durch den Seiteneingang auf die Buckingham Palace Road traf ich Karim Agarwal in seinem schwarzen Schwalbenschwanz und dem weißen Hemd – der üblichen Alltagslivree der Footmen. Zuerst grüßte er mich nicht, und so rief ich ihm nach. Da wandte er sich um und sah mich ängstlich an.
»Ja?«, sagte er.
»Robin. Hast du ihn gesehen? Wie geht es ihm?«
Karim wandte den Blick ab.
»Es gibt diese unsinnige Geschichte von einem Selbstmordversuch«, plapperte ich weiter. Da er nicht antwortete, wurde mir unbehaglich zumute. »Da ist doch nichts dran, oder?«
Ich konnte seinen Blick nicht festhalten. Karim schien von der üblichen Szene vor ihm – dem Wachmann am Schilderhäuschen, den hohen Toren, dem Verkehr – fasziniert zu sein, während ich, um etwas zu tun zu haben, meinen Caban gegen die Feuchtigkeit des späten Oktober zuknöpfte.
»Tut mir leid, vielleicht hätte ich nicht fragen sollen …«
»Schau, ich weiß nicht, was passiert ist«, sagte Karim defensiv und wandte sich mir endlich zu. »Ich habe ihn nicht gesehen. Ich gehe vielleicht am Wochenende zu ihm.«
»Na gut, wenn du ihn besuchst, grüß ihn bitte von mir«, antwortete ich und zuckte die Schultern. »Sag Robin, ich komme am Sonntagnachmittag vorbei.«
Ich ließ ihn gehen. Sich mit Karim zu unterhalten war, wie Kaugummi von einem Teppich im Buck House zu pulen.
Genau wie Davey konnte ich nicht so recht nachvollziehen, worin die Anziehungskraft zwischen Karim Agarwal und Robin Tukes bestand, vom Reiz, die von Karims düsterer Ausstrahlung ausging, einmal abgesehen. Aber er passte nicht so recht zu den anderen Lakaien. Das lag zum Teil daran, dass er kein Engländer war – zumindest kein Angelsachse, obwohl er in England gelebt hatte, seit er ein Baby war. Seine Eltern waren in der Regierungszeit von Idi Amin aus Uganda vertrieben worden. Einige Kollegen machten hinter Karims Rücken die rüdesten Bemerkungen über ihn. Andere sagten sie ihm direkt ins Gesicht. Soviel ich wusste, war er der erste Lakai indischer Abstammung, den der Palast je eingestellt hat, und das kam in manchen Kreisen gar nicht gut an. Unglaublich, wie offen rassistisch die Engländer manchmal sein können.
Jedenfalls passte Karim auch nicht dazu, weil er nicht so ein Radaubruder wie die anderen Lakaien war; er machte nur selten bei den Streichen und Scherzen mit. Er war nicht einer der »Jungs«. Die Königin hat seinen kleinen nackten Hintern nie an den königlichen Privatgemächern vorbeiflitzen sehen. Ich vermute, die anderen hielten ihn ein bisschen für einen Waschlappen. Er ging seiner Arbeit mit einer Gewissenhaftigkeit nach, die seinen Kollegen völlig fremd war. Man konnte spüren, dass er andere Ambitionen hegte. Ehrgeizigen Menschen begegnete man im Buck House gemeinhin mit Misstrauen und Feindseligkeit. Aber Robin nahm ihn meist gegenüber den anderen in Schutz, selbst wenn er, Robin, oft der Drahtzieher des jeweiligen Streichs war oder zumindest sich daran beteiligte. Ich denke, für Robin war Karim so etwas wie ein Anker, jemand vergleichsweise Stabiles, während die anderen nur ein Haufen verrückter Engländer waren, die sich austobten.
An jenem Sonntag verließ ich Tante Grace am frühen Nachmittag, stieg am Bahnhof Marylebone aus dem Zug, wanderte die Baker Street hinauf, vorbei an Madame Tussauds wirklich langweiligem Wachsmuseum, und ging in Richtung Devonshire Hospital, das nur ein paar Straßen entfernt liegt. Um drei Uhr betrat ich die Station. Zu meiner Überraschung war auch Karim da. Als ich eintrat, konnte ich sehen, wie er sich in einem anscheinend intensiven, geflüsterten Gespräch auf einem Stuhl neben Robins Krankenbett nach vorne beugte. Die Unterhaltung brach abrupt ab, als ich näher kam.
Robins Blick war schwer zu beschreiben: irgendwie benommen, so kam es mir vor. Tatsächlich schien er einen Augenblick zu brauchen, bis er meine Anwesenheit wahrnahm. Als er es dann tat, lächelte er rasch, begrüßte mich und schaute danach Karim scharf an. Das war eine Art Zeichen. Ohne mich zu grüßen, griff Karim nach einer Plastiktüte von Selfridges, die er aufs Bett gelegt hatte, stellte ein Kürbisgesicht, das mit Bonbons geschmückt war, auf den Nachttisch – ich hatte vergessen, dass Halloween war – und hastete hinaus.
Ich war plötzlich verlegen, so als wäre ich Robin zum ersten Mal vorgestellt worden. Das lag vermutlich an dem ganzen Gerede über Selbstmord. Ein unangenehmes Thema. So gut man auch jemanden zu kennen glaubt (und ich dachte, ich würde Robin genauso gut wie alle anderen im Buck House kennen, ausgenommen vielleicht Karim), gibt es doch Momente, in denen einem die Person wie ein völlig Fremder vorkommt. Das war einer dieser Momente. Mir ging auf, dass ich Robin doch nicht so gut kannte. Obwohl sehr umgänglich, war er letztendlich schrecklich verschlossen. Er hatte jene charmante Art, mit einem strahlenden Lächeln oder einer humorvollen Frotzelei Fragen auszuweichen, die er nicht beantworten wollte. Nach unseren Ausflügen zu den Touristenattraktionen Londons fiel mir manchmal auf, dass ich über meine Hoffnungen, Träume und Probleme geredet, er jedoch kaum etwas von sich preisgegeben hatte.
Nun, da ich an seinem Bett stand, wurde mir klar, dass mir komplette Teile von Robins Charakter und Leben entgangen waren. Ich dachte an die Dinge, über die er nicht gern sprach (seine Familie) oder tatsächlich nicht sprach (seinen Kummer).
Plötzlich fiel mir wieder ein Mädchen aus der neunten Klasse ein, das sich das Leben genommen hatte. Sie hatte normal und fröhlich gewirkt. Und dann hatte ihre Mutter sie mit aufgeschnittenen Handgelenken im Badezimmer gefunden. Uns Neuntklässler hatte diese Tragödie damals intensiv beschäftigt. Aber wir waren den Motiven für ihren Freitod nie wirklich auf den Grund gegangen.
Jedenfalls dachte ich, für jemanden, dem kürzlich der Magen ausgepumpt worden war und der seit ein paar Tagen im Krankenhaus lag, sah Robin gar nicht schlecht aus. Im Gegenteil. Er sah sogar sehr gut aus. Er war ein wenig blass, aber das war wohl den dunklen Bartstoppeln zuzuschreiben. Dadurch und mit seinem schwarzen Haar und den dunklen Augen sah er aus wie ein verwegener Abenteurer. Es fehlte lediglich der Ohrring, den er normalerweise in seiner Freizeit trug.
Ich begann, eines der Bonbons von dem Kürbisgesicht auszuwickeln, und stellte die üblichen abgedroschenen Krankenhausfragen: Wie geht’s dir? Gut. Wann kommst du raus? Bald, hoffe ich. Was Süßes? Nein, danke. Ich fragte mich, ob Karim einfach nur mit ihm geflüstert hatte, da das Zehn-Bett-Zimmer keinerlei Privatsphäre bot. Doch Robin wirkte abgelenkt. Er war einsilbig. Schließlich versandete der Small Talk. Ich traf eine Entscheidung und kam direkt zur Sache.
»Es gibt da dieses Gerede über einen Selbstmordversuch …?«, sagte ich und grub meine Zähne in ein zweites klebriges Karamellbonbon.
»Ja, ich weiß«, antwortete er beiläufig.
»Ist da was dran?«
Er zuckte mit den Schultern und sah auf einen blauen Umschlag, den er zwischen Daumen und Zeigefinger hielt. »Ich hab mich in letzter Zeit ein bisschen down gefühlt«, gab er zurück, wobei er die Hand ausstreckte und das Kuvert neben den Kürbis stellte.
»Mir wurde gesagt, du warst am Donnerstagabend ein wenig high.«
Er schnaubte kurz. »Ach, was soll’s? Es war mein einundzwanzigster Geburtstag. Könnte ja mein letzter sein.«
»Robin! Sag das nicht.«
»Okay, ich sag es nicht.« Auf den gereizten Tonfall folgte sofort ein entschuldigender Blick. »Es tut mir leid«, meinte er dann. »Es ist nicht so einfach, hier nur untätig herumzuliegen. Und überhaupt, wo warst du am Donnerstagabend?«
Nun war es an mir, mich zu entschuldigen. Ich erzählte, dass ich mit Neil, dem Kameraassistenten der Filmcrew, ausgegangen war. »Ich dachte nicht, dass du mich vermissen würdest«, fügte ich hinzu. »Außerdem hatte ich nicht gerade viele Dates, seit ich im Buck House arbeite.«
»Netter Typ?«
»Ja, er ist okay. Ich habe dir schon von ihm erzählt.«
Aber Robins Aufmerksamkeit driftete ab. Mürrisch starrte er an die Decke.
»Robin, was ist los? Ist irgendwas los?«
Er gab keine Antwort.
»Ist es die Sache mit Angie? Nikki hat mir von deiner Verlobung erzählt. Du wirst Angie doch nicht wirklich heiraten, oder? Ich weiß, das hört sich irgendwie neugierig an, aber …«
Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel, und er sagte: »Jane, Liebling, Angie ist die Liebe meines Lebens.«
»Ach, lass das. Ist sie nicht.«
»Ist sie wohl.« Plötzlich grinste er in der altvertrauten Robin-Manier – viele weiße Zähne, umwerfend. Die Sonne ging auf. Das brachte mich aus dem Konzept. Ich seufzte innerlich. Schwul. Was für eine Verschwendung. Das heißt, wenn er denn überhaupt schwul war. Was mich wieder auf das Thema seiner bevorstehenden Heirat zurückbrachte.
»Was willst du mit Angie?«
»Kennst du diesen Song von Frank Sinatra? Liebe und Heirat. Passen zusammen wie Pferd und Kutsche. Hmm, hört sich fast wie ein Rap an. Was meinst du?« Er fing an, sich im Bett zu einer Rap-Melodie zu bewegen, die keiner von uns hörte.
»Krieg ich von dir auch mal eine direkte Antwort?«
»Eine direkte Antwort?«
»Hör mal, Robin«, insistierte ich, »hast du überhaupt mitbekommen, dass niemand anderes als die Königin von England über dich gestolpert und auf die Nase gefallen ist?«
»Ja, ich habe es gehört.«
»Die Frage ist: Was hast du in diesem Teil des Palasts um diese Zeit nachts zu suchen gehabt?«
»Wir haben auf der Party beschlossen, eine Schnitzeljagd zu veranstalten. Ich musste jemanden aus der königlichen Familie finden, ihn – oder sie – in einen Sack stecken und zurück zum Startpunkt bringen.«
»Aha! Also hast du nicht gewusst, dass sie an dem Abend ausgegangen war?«
»Oh, ich habe es gewusst. Ich hatte an jenem Tag in der Times die Hofnachrichten gelesen.«
»Mit anderen Worten, du hast es geplant. Du wolltest zu dem Zeitpunkt am Abend in jenem Teil des Palasts sein.«
»Kluges Mädchen.«
Langsam dämmerte mir etwas. »Lass mich schauen, ob ich das richtig verstanden habe. Du hast geplant, zu diesem Zeitpunkt an dem Abend in diesem Teil des Palasts zu sein, weil … weil, was? Weil du plötzlich den Drang verspürt hast, die Königin aus der Nähe zu sehen?«
Zu meiner Überraschung wurde Robins Gesichtsausdruck düster. Er schwieg lange, als müsste er eine Entscheidung fällen. »Ich wollte sie wegen einer gewissen Angelegenheit sehen«, räumte er ein. »Unter vier Augen.«
»Das meinst du nicht ernst?«
»Nie ernster als jetzt.«
»Du wolltest die Königin treffen? Die Königin von England höchstpersönlich? Allein? Spinnst du?«
Meine Stimme musste weit getragen haben, denn plötzlich drehte der Mann im Nachbarbett uns den Kopf zu. Sein Blick war eher erstaunt als tadelnd, deshalb nahm ich an, dass er mehr wegen der Lautstärke unseres Gesprächs denn wegen des Inhalts erschrocken war.
»Jane«, sagte Robin mit gesenkter Stimme und griff nach meinem Handgelenk. »Das ist ernst. Ich hätte es dir nicht einmal erzählen dürfen. Und ich möchte nicht, dass du es jemandem sagst. Verstehst du mich? Niemandem.«
»Aber …«
»Ich musste sie einfach sehen. Das ist alles.«
Mit einem Mal fühlte ich mich seltsam verwirrt und verängstigt. Die Königin war für die meisten von uns in den unteren Rängen eine ferne Gestalt, jemand, den man ab und an mal von einem Fenster aus zu sehen bekam, wenn sie den Palast durch den Queen’s Entrance an der Nordseite verließ, oder von der Türschwelle aus, wenn sie auf dem Weg in eines der Staatsgemächer vorüberging. Einige Hausmädchen flohen sogar in ein Zimmer nebenan, um ihr auszuweichen, wenn sie das warnende Geräusch der kläffenden Corgis hörten. Was sollte also jemanden dazu treiben, um eine Privataudienz bei I. M. nachzusuchen? Und inwieweit war das für jemanden in unserer Stellung überhaupt möglich? Trotz der Sicherheitsmängel im Laufe der Jahre, die an die Öffentlichkeit gedrungen waren, und trotz jener, für die das nicht galt, war ein Gespräch mit der Königin ohne ihre engen Bediensteten mir immer äußerst schwierig erschienen.
»Muss man nicht zu jemandem gehen, um einen Termin zu bekommen?«, fragte ich.
»Zu ihrem Privatsekretär.«
»Dann eben zu ihm.«
»Das konnte ich nicht machen.«
»Warum nicht?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Na schön«, murmelte ich frustriert, »über was in aller Welt wolltest du mit ihr reden?
»Ich wollte wissen, was sie in ihrer Handtasche hat.«
»Robin!« Ich entzog ihm meine Hand.
»Schau, Jane, ich kann dir nicht mehr erzählen. Und bitte behalte das alles für dich. Ich meine es ernst.«
»Warum hast du mir dann überhaupt etwas gesagt?«
»Weil ich möchte, dass jemand weiß, dass ich nicht den Clown gespielt habe.«
»Dann war es also kein Selbstmordversuch, nicht wahr?«
Sein Mund wurde zu einem grimmigen Strich. Er erwiderte: »Anscheinend verlor ich das Bewusstsein, wurde in dieses Krankenhaus gebracht, und man hat mir den Magen ausgepumpt.«
Es klang, als verlese er ein Aufnahmeformular fürs Krankenhaus. Doch meine Frage beantwortete er nicht.