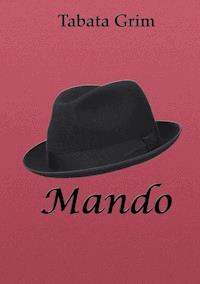Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Seit Tausenden von Jahren übt Adrien bereits seinen Dienst als Todesbote aus. Seine Aufgabe ist es, die Menschen in den Tod zu schicken und ins Jenseits zu führen. Er ist der Tod. Die Worte Mitgefühl und Erbarmen sind ihm fremd. Das ändert sich, als er der jungen Rettungssanitäterin Emily begegnet. Für Sterbliche sind Todesboten unsichtbar, doch Emily kann ihn sehen, wie Adrien überrascht feststellen muss. Emily weckt in ihm eine Welt der Gefühle, die ihm bis dahin fremd war. Auch Emily muss erkennen, dass sie sich rettungslos in den schönen Fremden verliebt hat, der ihr so manches Rätsel aufgibt. Als sie plötzlich auf Adriens Todesliste steht, gerät er in einen Konflikt, der nicht nur ihn vor die Herausforderung seines Lebens stellt....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist all denjenigen gewidmet, die verletzt wurden, obwohl sie liebten.
Denen, die zu träumen gewagt haben und enttäuscht wurden.
Und all denjenigen, die sich gerade in einer aussichtslosen Situation befinden.
Es gibt immer einen Ausweg.
Es ist Unsinn Sagt die Vernunft Es ist was es ist Sagt die Liebe
Es ist Unglück Sagt die Berechnung Es ist nichts als Schmerz Sagt die Angst Es ist aussichtslos Sagt die Einsicht Es ist was es ist Sagt die Liebe
Es ist lächerlich Sagt der Stolz Es ist leichtsinnig Sagt die Vorsicht Es ist unmöglich Sagt die Erfahrung
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1 – ATEMLOS
KAPITEL 2 – TOTENHAUCH
KAPITEL 3 – FREUNDINNEN
KAPITEL 4 – SCHICKSALE
KAPITEL 5 – VERSCHLUNGENE PFADE
KAPITEL 6 – RETTUNG
KAPITEL 7 – UNGEREIMTHEITEN
KAPITEL 8 – FAST EIN DATE
KAPITEL 9 – LEBEN UND TOD
KAPITEL 10 - ERKENNTNISSE
KAPITEL 11 – TODESENGEL
KAPITEL 12 – DUNKLE GABE
KAPITEL 13 – SCHMERZ
KAPITEL 14 – ANGST
KAPITEL 15 – NICHOLAS
KAPITEL 16 – GEFÄHRLICHE NÄHE
KAPITEL 17 – GEFÄHRTEN
KAPITEL 18 – ES IST, WAS ES IST
KAPITEL 19 – SEHNSÜCHTE
KAPITEL 20 – GLENGARRIFF
KAPITEL 21 – HERZ AN HERZ
KAPITEL 22 – EIN RICHTIGES DATE
KAPITEL 23 – PAKT
KAPITEL 24 – DAS VERSPRECHEN
KAPITEL 25 – EIN NEUES LEBEN
KAPITEL 26 – NUR EIN VERSUCH
KAPITEL 27 – BITTE
KAPITEL 28 - TOT
KAPITEL 29 – OKASIS
KAPITEL 30 – ABGRUND
KAPITEL 31 – ANGEKOMMEN
Danksagung
KAPITEL 1 – ATEMLOS
Ihre Augen waren weit aufgerissen, ihre Hände feucht und verklebt vom Schweiß. Auch von ihrer Stirn kullerten langsam kleine Schweißperlen die Schläfen und Wangen hinunter bis zum Kinn. Ihr Herz schlug bis zum Hals und die Angst, die sie fühlte, wurde noch viel größer, als sie immer noch keinen Puls spürte. Über den leblosen Körper des Mannes gebeugt, der zu sterben schien, massierte sie sein Herz zum wiederholten Male. Wieder und wieder.
»Eins, zwei, drei, vier – eins, zwei, drei, vier. Komm schon! EINS, ZWEI, DREI, VIER, LOS! Bitte!«, flehte Emily. Die Panik nahm mehr und mehr Platz in ihr ein. Ihre Handballen waren fest auf seinem Brustkorb fixiert. Ihre Arme schmerzten sie schon vom vielen Drücken, doch sie durfte noch nicht aufgeben. Ihr Kollege hatte längst die Elektroden von der Brust des Mannes genommen und den Defibrillator ausgeschaltet, da er wusste, dass alles Kämpfen nichts mehr nützen würde. Der Mann war bereits tot. Doch Emily wollte sich mit dieser Tatsache nicht abfinden. Wie wild hämmerte sie auf seinen Brustkorb ein. Noch einen Versuch, beschloss sie.
»Lass es gut sein, Emily. Er ist tot«, sagte Marvin, nahm ihre Hand und zog sie weg von der Leiche. Ihre Hartnäckigkeit war ihm vertraut. Nur schwer konnte sie es akzeptieren, wenn ihr jemand unter der Hand wegstarb. Krampfhaft zog sich ihr Magen zusammen. Der verstorbene Thomas Wales hatte einen Herzinfarkt erlitten und war von einen Passanten auf dem Boden liegend in einer kleinen Fußgängerzone in der Trap Avenue gefunden worden. Daraufhin hatte dieser sofort einen Rettungswagen gerufen. So schnell wie nur irgend möglich waren die beiden Sanitäter dorthin gefahren. Obwohl sie alles in ihrer Macht Stehende getan hatte, quälte Emily immer noch die Frage »Was wäre gewesen, wenn…«
»Wir haben wirklich alles versucht. Seine Pumpe wollte einfach nicht mehr«, meinte ihr Kollege. Tröstend legte er einen Arm um ihre Schulter.
»Wenn wir nur zwei Minuten eher dagewesen wären…«, schnaubte sie und fuhr sich betroffen durchs Haar. Natürlich hatte sie in den letzten drei Jahren ihrer Arbeit, in denen sie nun schon als Rettungssanitäterin tätig war, sehr viele Sterbefälle miterleben müssen. Sie wusste auch, dass es schlecht für das Gemüt war, all diese tragischen Schicksale zu nahe an sich heranzulassen, doch Emily konnte oft nicht anders. Freud und Leid lagen in ihrer Berufung nun einmal nah beieinander, wobei das Leid einleuchtenderweise oft überwog. So war es nun einmal. Dafür war es aber auch ein unbeschreibliches Gefühl des Glücks einem Menschen das Leben zu retten, dafür zu sorgen, dass sein Herz weiterschlug, zu spüren, wie sich sein Atem wieder normalisierte, wie das Leben, das ihm vor Kurzem noch gedroht hatte zu entweichen, wieder zurück in seinen Körper floss. Es waren diese Momente, die ihr zum Lebensinhalt geworden waren. Sie nahm es als ihr Schicksal, ihre Bestimmung an. Noch vor etwa fünf Jahren hätte sie es nie für möglich gehalten einmal eine Sanitäter-Uniform zu tragen, in der Lage zu sein einen Menschen wiederzubeleben, geschweige denn einen Luftröhrenschnitt zu setzen…
Sie würde es dennoch nie schaffen die Schatten der Vergangenheit vollständig abzuschütteln. Zu tief und zu schmerzvoll waren diese Wunden. In vielen Nächten träumte sie noch von dem grausamen Erlebnis, bei dem sie ihre Mom und ihren Dad in einem Verkehrsunfall verloren hatte. Emily war erst 16 Jahre alt gewesen. Damals war die Familie Walsh nach Colorado gefahren, um dort Ferien zu machen. Im Auto war es stickig und heiß gewesen, da die Klimaanlage nicht funktioniert hatte. Im Radio hatten sie und ihre Eltern gerade »Manic Monday« von den Bangles gehört und fröhlich mitgeträllert. Plötzlich war ihr Auto von einem anderen Wagen von der Fahrbahn gedrängt worden, sie waren frontal durch eine Leitplanke geschossen und hatten sich dann mehrere Male überschlagen, bevor das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war. Ihre Eltern waren sofort tot gewesen. Wie durch ein Wunder hatte Emily überlebt und war mit einigen Schnittwunden, Prellungen und Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Nie könnte sie auch nur ein winziges Detail dieses schrecklichen Tages, des schrecklichsten ihres Lebens, vergessen. Sie trug immer ein Medaillon bei sich, in dem sich in jeder Herzhälfte ein Bild von Mary und George befand, den beiden wichtigsten und prägendsten Menschen, die es in ihrem Leben gegeben hatte. In jeder Erzählung erwachten sie aufs Neue zum Leben. Es war schmerzlich, doch es tat auch gut.
Emily war nach dem Vorfall zu ihrer Großmutter gezogen, der einzigen Verwandten der Walsh-Familie. Wenn es ihre Grandma nicht gegeben hätte, wäre Emily zweifelsohne in einem Heim gelandet. Sie war dankbar, dass ihr diese Erfahrung erspart geblieben war. Sie würde aber auch nie behaupten, dass der Rest ihrer Kindheit unbeschwert verlaufen sei. Wie wäre das bei dieser klaffenden Lücke, die ihre Großmutter oder ihre Freunde niemals hätten füllen können, auch möglich gewesen?
Trotz allem hatte Emily sich zu einer schönen und klugen jungen Frau entwickelt. Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 in ihrem Schulabschluss hatten ihr sämtliche Universitäten offen gestanden. Doch zum Erstaunen ihrer Großmutter war Emily nach Wearville gezogen, einer großen Nachbarstadt ihres Heimatortes Summingen, um dort Sanitäterin zu werden. Nach dem Tod ihrer Eltern war in ihr mehr und mehr das Bedürfnis herangewachsen, verunglückten Menschen helfen zu wollen, einer solchen Situation niemals wieder so schwach und hilflos gegenüberstehen zu müssen wie einst, sondern genau zu wissen, was zu tun war, wenn es darauf ankam. Ja, ein Leben zu retten war das Schönste, was sie sich vorstellen konnte. In diesen Augenblicken schien ihre ganze Welt im Gleichgewicht zu sein. Es war ein befriedigendes und beruhigendes Gefühl.
Die Leute aus ihrer Nachbarschaft schauten die kleine Walsh-Tochter immer nur mit mitleidigen Blicken an. Sie wurde von den Bekannten und Nachbarn in der Ortschaft, Leuten, die sie ihr ganzes Leben kannten, nach diesen Unfall nur noch wie ein rohes Ei behandelt. Das machte sie geradezu krank. Sogar in der Schule wurde sie von ihren Mitschülern anders wahrgenommen. Man mied sie, keiner wusste so genau, wie man mit Emily Walsh umgehen sollte. Ihre einzige Freundin war Becky. Beide gingen in dieselbe Klasse und kannten sich schon seit frühen Kindertagen. Emily verbrachte viel Zeit mit ihrer besten Freundin. Sie war in dieser schlimmen Phase für sie da. Oft war Becky die Einzige, die es schaffte, ein Lächeln auf Emilys Gesicht zu zaubern. Sie verstanden sich ganz einfach ohne Worte. Auf all die anderen legte sie nicht sonderlich viel Wert. Sie verübelte keinem ihrer Mitschüler das unsichere Verhalten. Sie wussten es einfach nicht besser. Mit der Zeit schienen sich die Dinge in der Schule auch wieder halbwegs zu normalisieren, doch sie wusste, was hinter ihrem Rücken in Summingen auch nach ihrem Schulabschluss über sie geredet wurde: »Die Walsh ist ja wie eine Masochistin. Noch vor ein paar Jahren hat sie ihre Eltern bei diesem grausigen Unfall verloren und jetzt will sie sich solchen Situationen tagtäglich aussetzen. Dieses Trauma kann sie unmöglich überwunden haben. Die Kleine ist ja verrückt!«
Dennoch war Grandma Elise stolz auf ihre Enkeltochter, sehr stolz sogar. Mit jedem Gespräch über ihre Enkelin gingen Bewunderung und Respekt einher. Jedes zweite Wochenende besuchte Emily sie, rief jeden zweiten Tag bei ihr an. Ihre Grandma war alles, was Emily an Familie geblieben war und diese verstand so gut, dass ihre Enkelin raus musste aus dieser für sie so trostlosen Kleinstadt, hinein in eine größere Stadt mit anderen Menschen, dorthin, wo nicht jeder zweite ihren Namen kannte. Eine Veränderung war das, was sie gebraucht hatte.
Aber so weit lag Wearville nun auch nicht von Summingen entfernt, gut eine dreiviertel Stunde Autofahrt. Sie liebte ihre Großmutter für ihre herzerfrischend ehrliche Art und ihren trockenen Humor. Wenn nur jede 84-Jährige so lässig und agil wäre, wie Elise es war….
»Ist alles ok bei dir?«, ertönte Marvins warme Stimme und riss Emily aus ihren Gedanken. Prüfend schaute er seine Kollegin an. Beide saßen wieder in ihrem Rettungswagen und fuhren die Ellestreet entlang. Er saß am Steuer und seine Kollegin auf dem Beifahrersitz.
»Ja, mir geht's gut«, antwortete Emily.
»Hey, hast du Lust nach Feierabend mit Claire, den Kindern und mir zu Abend zu essen? Claire macht heute Abend ihr berühmtes Roastbeef. Sie würde sich sicher freuen, dich zu sehen. Außerdem wollen Kiara und Jeremia mal wieder mit ihrer Tante Emily spielen. Du hast dich lange nicht mehr bei uns blicken lassen, Kleines«, sagte er keck und warf erneut einen schnellen Blick auf Emily, ehe er sich wieder auf die viel befahrene Straße konzentrierte. Eine Spur von Sarkasmus schwang in seinen Worten mit. Emily wusste genau, was er mit der Anspielung auf seine Kinder meinte. Ganz besonders Jeremia war ein sehr lebhaftes Kind. Sie hatte oft Mühe, seinen dynamischen Kissenschlachten standzuhalten, ganz zu schweigen von seinen Ball-Spielen, bei denen er stets neue Regeln erfand, die ihm, wie er selbst erklärte, Abwechslung verschafften. Nicht oft kam es dabei vor, dass der Ball auf ihrem Rücken oder auf ihrem Kopf landete. Er war ein sehr aufgewecktes Kind – für ihren Geschmack fast schon etwas zu aufgeweckt. Mit seinen acht Jahren war Jeremia den andern Kindern seines Alters an Wissen und Intelligenz weit überlegen. Sie hatte nicht schlecht gestaunt, als er ihr einmal eine Geschichte vorlas, die er für eine Hausaufgabe selbst verfassen musste. Er benutzte so viele Wörter, von denen Emily glaubte, dass kein Achtjähriger sie kennen konnte. Es war auch die Art, wie er sie benutzte, denn er kannte deren Bedeutung und wusste mit ihnen umzugehen.
Ganz anders und viel ruhiger war da seine jüngere Schwester Kiara. Emily mochte sie sehr. Sie war ein sehr liebes und einfühlsames Mädchen. Sie hatte beide Hayden-Kids ins Herz geschlossen, genau wie Marvins Frau Claire, die im Laufe der Jahre eine sehr gute und vertraute Freundin für sie geworden war.
»Heute nicht, Marvin. Ich werde heute Abend früh schlafen gehen, da ich letzte Nacht so gut wie kein Auge zugetan habe«, antwortete sie und schenkte ihrem Kollegen ein kleines Lächeln. »Trotzdem danke!«, warf sie schnell hinterher.
Sie war froh Marvin als Partner zu haben. Er hatte sie ausgebildet. Genau genommen war er auch ihr Vorgesetzter, machte das allerdings nie in irgendeiner Form zum Thema. Er war mehr als zufrieden mit ihrer Arbeit. Emily war eine gewissenhafte und verlässliche Kollegin mit viel Engagement und Herzblut und etwas anderes ließ ihr Beruf auch gar nicht zu. Beide vertrauten einander blind, sie waren seit Jahren ein eingespieltes Team. Marvin war im Laufe der Zeit ein sehr guter Freund für Emily geworden. Sie wusste, dass sie mit ihrem Kollegen über alles sprechen konnte. Er gab ihr nach einem langen und stressigen Tag Halt, er war ihr Rettungsanker in dunklen Stunden. Beide verband eine tiefe und aufrichtige Freundschaft. Im Gegensatz zu ihr konnte Marvin bereits auf eine fünfzehnjährige Berufserfahrung zurückblicken, wobei er optisch kaum älter wirkte als sie. Schon bei seinem Vater war es so gewesen. Außerdem war das der Vorteil seiner afrikanischen Wurzeln: »Wir altern nicht so schnell wie ihr Weißen«, hatte er oft kess zu einigen erstaunten Personen gesagt, die ihm seine 37 Jahre nicht abnehmen wollten.
»Schon in Ordnung, Kleines. Heute war wahrlich ein sehr anstrengender Tag«, sagte Marvin verständnisvoll.
Ja, das war er bestimmt, dachte Emily. Warum starben ihr in letzter Zeit mehr Menschen unter der Hand weg, als sie rettete? So machtlos hatte sie sich schon lange nicht gefühlt. Und diese Angst, die sie heute gespürt hatte… Warum war sie so stark, dass sie sie fast lähmte? Es wirkte geradezu unprofessionell. Als ob sie gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen hätte. Nur gut, dass dieser lange Tag bald enden würde.
In ihrer kleinen Dachgeschosswohnung angekommen, legte sie wie gewohnt als erstes ihren Haustürschlüssel auf die kleine Kommode, die sich rechts neben ihrer Wohnungstür befand. Ihre Jacke warf sie lässig an den Garderobenstock, wo sie an einem der Haken hängenblieb. Nun brauchte sie dringend eine Tasse Tee. Es war ein kalter Oktoberabend und sie fröstelte. Nachdem sie das Wasser für den Tee aufgesetzt hatte, sprang Emily schnell unter die Dusche. Sie ließ sich von den wohlig warmen Duschstrahlen verwöhnen und schäumte ihren Körper ausgiebig mit einem aromatischen Duschgel ein, das nach Minze und Jasmin roch. Sie genoss dieses belebende und erfrischende Gefühl für einen kleinen Augenblick und nachdem auch die letzte Schaumkrone aus ihrem Haar gewichen war, wickelte sie sich in ein Handtuch ein. In Gedanken ließ sie den heutigen Arbeitstag noch einmal revuepassieren, während sie ihr langes platinblondes Haar föhnte. Sie dachte an all die Menschen, die sie heute hatte retten können und an diejenigen, für die jede Hilfe zu spät gekommen war.
Besonders an den Mann, der seinem Herzinfarkt zum Opfer gefallen war, musste Emily immerzu denken. Thomas Wales hatte er geheißen. Etwas war heute anders gewesen. Sie konnte es sich selbst nicht erklären und sie wusste auch nicht genau, was es war. Doch zum ersten Mal hatte sie eine Macht gefühlt, etwas wahrgenommen, das stärker schien als sie und jeder Mensch. Es klang verrückt, aber das waren ihre Empfindungen gewesen, während sie krampfhaft versucht hatte diesen Mann wiederzubeleben. Dabei war sie ein vollkommen rational denkender Mensch, überzeugte Atheistin. Aberglaube und Schicksal waren in ihren Augen bloß Schnickschnack. Sie saß bereits in der Küche und trank eine Tasse angenehm duftenden Hagebuttentee. Dieser wärmte auch die letzte Faser ihres Körpers. Nachdem sie den Becher geleert und ihre Zähne geputzt hatte, war es an der Zeit schlafen zu gehen.
In letzter Zeit litt sie wieder unter Alpträumen. Diese Art von Träumen, in denen sie den Verkehrsunfall mit ihren Eltern noch einmal durchleben musste. Sehr oft träumte sie jedoch auch von Opfern, die sie nicht retten konnte. Emily wünschte sich einfach nur eine erholsame, alptraumfreie Nacht, denn sie hatte eine Portion gesunden und entspannenden Schlaf dringend nötig. Erschöpft ließ sie sich in ihr Bett sinken und hoffte, dass sie in dieser Nacht verschont bleiben würde.
KAPITEL 2 – TOTENHAUCH
»Wollen wir, Thomas?«, erklang eine tiefe, unheilvolle Stimme, die ihn zusammenzucken ließ. Erschrocken und verwirrt drehte Thomas Wales sich um. Ein Mann, in komplett schwarze Kleidung gehüllt, blickte ihn mit ernster Miene an. Er wusste nicht genau, was dieser von ihm wollte, woher er so plötzlich kam. Genauso wenig konnte er sich daran erinnern, was zuvor geschehen war. Wo genau befand er sich überhaupt?
Verunsichert schaute er sich um. Alles um ihn herum nahm er nur verschwommen wahr, als ob er in ein verschmiertes, milchiges Glas blicken würde, so getrübt war seine Sicht. Nicht einmal Konturen ließen sich erschließen. Das einzige, was er klar und deutlich vor sich sah, war dieser Mann. Stimmte vielleicht irgendetwas mit seinen Augen nicht? Warum erkannte er diesen Mann, aber alles andere nicht? Die Eiseskälte, die von den Augen des Fremden ausging, war beängstigend.
»Wer sind Sie und was wollen Sie von mir?«, brachte Thomas nun zaghaft heraus. Diese düstere Erscheinung wirkte mehr als einschüchternd auf ihn. Der Fremde trat einen Schritt näher an ihn heran. Die unverhohlene Leere in seinem Blick schien Thomas zu durchbohren. Hastig trat er einen Schritt zurück und fuhr sich nervös durchs Haar. Jetzt schloss er die Augen. Wenn er sie gleich wieder öffnen würde, würde er sicherlich feststellen, dass alles nur ein böser Traum gewesen war und diese bedrohliche Erscheinung würde verschwunden sein.
Zu seinem Bedauern musste er feststellen, dass es leider nicht funktionierte. Immer noch lagen die Blicke des Fremden auf ihm, so als erwarte er etwas Bestimmtes. Sein Gesichtsausdruck ließ allerdings nichts erahnen. Das machte Thomas noch nervöser.
Erneut trat der Fremde einen Schritt auf ihn zu. »Ich bin der Tod. Deine Zeit ist gekommen, Thomas«, entgegnete Adrien entschlossen auf die gestellte Frage.
Thomas packte die nackte Angst, während sich ein Schauer über seinen gesamten Körper legte. »Das kann nur ein schlechter Scherz sein. Ich bin nicht tot«, stammelte er.
Ungerührt sah Adrien zu, als Thomas begann seinen Körper akribisch abzutasten, so als suche er nach der Wahrheit seiner Worte. Ganz klar spürte er seinen Körper. Sein Brustkorb hob und senkte sich, selbst das Zwicken, als er sich in den Arm kniff, war eindeutig zu vernehmen.
»Ich bin nicht tot«, wiederholte er siegessicher und zwang sich dem Starren des Fremden standzuhalten, der ihm immer noch unsägliche Angst bereitete.
Adrien verdrehte teilnahmslos die Augen und fasste sich in sein haselnussbraunes Haar. Zur Genüge kannte er diesen Prozess. Hin und wieder kam es vor, dass Verstorbene sich mit ihrem Tod nicht abfinden wollten. Einige von ihnen meinten ihren Körper zu spüren, ihre menschliche Wärme zu fühlen. Die Seele einer verstorbenen Frau hatte Adrien gegenüber einmal behauptet, ihren Herzschlag gewiss noch wahrzunehmen. Das alles war nur Täuschung. Sie nahmen oft nur das wahr, was sie unbedingt wahrnehmen wollten – auch wenn viele uneinsichtigen Seelen, die die Wahrheit nicht akzeptieren konnten, schon versucht hatten vor Adrien zu flüchten, hatte er doch keine einzige entkommen lassen. Es war seine Aufgabe die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits zu führen, denen er zuvor, gemäß der Bestimmung, das Leben nehmen musste. Er war einer von vielen Todesboten. Sie hatten viele Namen, wurden als Sensenmann, schwarzer Mann oder einfach nur als der Tod bezeichnet.
Mit steinerner Miene betrachtete er Thomas einen Augenblick lang. Er würde es wie sonst auch machen, beschloss er. Andere hätten es wohl als Holzhammer-Methode bezeichnet. Der Todesbote hatte weder Zeit noch Lust auf lange Verzögerungen. Also hob er seine Hand und ließ sie über die Augen des Mannes gleiten. Mit einem Mal hob sich der Schleier, der Thomas zuvor noch die Sicht versperrt hatte. Mit gutem Grund war das so gewesen: Vor sich sah er seinen eigenen Leichnam auf eine Trage gebettet. Jemand deckte gerade eine schwarze Plane darüber. Bei diesem schockierenden Anblick geriet er ins Stocken und taumelte erschrocken zurück.
Das konnte doch alles nicht wahr sein! War sein Leben wirklich schon zu Ende? Sollte das wirklich schon alles gewesen sein? Er hatte doch noch so viel vor. So viele Dinge wollte er mit seiner Frau noch erleben, sobald er es endlich geschafft hatte in seinem Beruf kürzer zu treten. Nun war es zu spät.
»Nein! NEIN!«, schrie er. »Es ist noch zu früh für mich, ich kann noch nicht gehen. Bitte, hab Erbarmen! Ich kann noch nicht weg von hier!« Noch nicht einmal von seiner Frau konnte Thomas sich verabschieden. Ob sie wusste, wie sehr er sie liebte? »Bitte, lass mich zu meiner Frau. Ich muss sie noch ein letztes Mal sehen!«, flehte er. Eine ungeheure Angst kroch in ihm hoch und dieser Schmerz und diese Leere waren einfach nicht zu ertragen.
»Nein, das ist ausgeschlossen«, erwiderte Adrien gänzlich ungerührt.
»Warum?« Die Verzweiflung, die Thomas übermannte, zog sich wie eine Schlinge um seinen Hals.
»Wir müssen jetzt aufbrechen«, drängte der Todesbote. »Du hast mir schon viel zu viel Zeit gestohlen. Es gibt noch andere Seelen, die ich holen muss.« Es konnte doch wirklich nicht sein, dass er immer noch hier stand und sich von einer gefühlsduseligen Seele aufhalten ließ. Die Zeit drängte und er hatte gleich noch einen wichtigen Termin. Ohne einen Funken Mitgefühl im Leib, zog er den Mann mit sich.
»Halt! Warte! Wohin bringst du mich?«
Adrien gab ihm keine Antwort darauf.
»Ist es schön dort?«
Wieder sagte er nichts. Genug Zeit hatte diese ärmliche Seele ihn schon gekostet. Natürlich hätte er antworten können, dass er ihn ins Jenseits brachte, an einen Ort der ewigen Glückseligkeit, wo er all seine Lieben wiedersehen würde. Er selbst war noch nie dort gewesen. Er brachte die Seelen lediglich bis vor das Himmelstor, nicht weiter. Todesboten war der Eintritt ins Himmelreich strengstens untersagt, was Adrien auch nicht sonderlich störte. Genauso wenig scherten ihn die Angst und die Unsicherheit dieser menschlichen Seele. Es war ihm schlicht und ergreifend egal. Emotionen, wie die Menschen es nannten, kannte er nicht. Er wusste nicht einmal genau, was das war. Er war nun einmal ein kaltes Wesen.
Nachdem Adrien seinen Auftrag ausgeführt hatte, musste er sich beeilen. Nicholas, sein Boss, hatte ein Treffen einberufen. Jeder Todesbote musste seine neue Todesliste abholen, da die alten so gut wie abgearbeitet waren. Nicholas war das Oberhaupt der Todesboten und erstellte für jeden seiner Gefährten diese Listen, die ihm vom Rat des Schicksals auferlegt wurden. Er entschied über den Tod der Menschen, darüber, wie und auf welche Art sie sterben mussten. Er war sozusagen der schicksalhafte Tod. Er und seine Gefährten, wie er sie nannte, waren allesamt todbringende schwarze Engel, die weder Mitleid noch Verständnis kannten. Jeder von ihnen war bildschön – zweifellos. Doch auf ihren makellosen Gesichtern würde sich nie eine Regung abzeichnen. Ihre Mienen waren unergründlich, gleichgültig und ließen höchstens auf Kaltblütigkeit schließen. Ihre Augen schienen leer zu sein, ohne jeglichen Glanz. Keiner von ihnen war in der Lage Gefühle zu empfinden oder auszudrücken. Ihr ganzes Dasein, das sich seit Anbeginn der Menschheit über Jahrtausende erstreckte, galt einzig und allein dem Zweck, menschliches Leben auszulöschen.
Adrien sah Nessofin, wie auch Asalon und Ebrafit, im Korridor vor Nicholas' Räumlichkeiten stehen; sie warteten darauf die Liste abholen zu können. Sie alle waren Gefährten, die im selben Bezirk arbeiteten. In einem Stadtteil waren meist vier bis fünf Todesboten tätig, die allesamt von Nicholas eingeteilt worden waren. Alles hatte sein System und seine Ordnung. Der Ort, an dem sich ihr Boss aufhielt und wo die Gefährten sich einfinden konnten, war eine kleine Zwischendimension, in die nur Wesen ihresgleichen eintreten konnten. Schlicht und ergreifend wurde dieser dementsprechend Gefährtenturm genannt. Ein flüchtiger Blickaustausch zwischen Adrien und den andern entstand, ehe er sich an die kühle gesprenkelte Wand lehnte, die den Korridor begrenzte.
Es herrschte Stillschweigen. Keiner der Gefährten schenkte seinem Gegenüber besondere Aufmerksamkeit. Unterhaltungen fanden selten statt. Adrien konnte nicht verstehen, warum sein Boss keine festen Termine vergab. So wäre ihm wenigstens diese Warterei erspart geblieben. So eine Übergabe ging zwar relativ zügig vonstatten, dennoch konnte man solche Treffen gezielter abstimmen, fand er. Lässig verschränkte er die Arme hinter seinem Rücken und sah zu, wie sich Nicholas' Tür öffnete, Merodis heraustrat und Embrafit als nächstes hereingebeten wurde.
Irgendetwas war an diesem Tag anders gewesen. Sein letzter Auftrag ließ ihn nicht mehr los. Diese Sanitäterin, die krampfhaft versucht hatte, Thomas Wales vor dem Herzinfarkt zu retten, den er ihm zuvor verpasst hatte, hatte ihm direkt in die Augen gesehen. Zuerst war Adrien verwirrt gewesen. Noch nie hatte ein menschliches Wesen ihn so direkt angesehen. So etwas war in all den Tausenden von Jahren seines Daseins noch nie vorgekommen. Sie konnte ihn auch nicht wirklich gesehen haben. Kein Sterblicher war in der Lage einen Todesboten zu sehen. Oder etwa doch?
»Adrien, du bist als nächstes dran«, machte ihm Embrafit deutlich, der gerade aus der Tür trat. Rasch schüttelte er den Gedanken, der ihn gerade noch beschäftigt hatte, von sich und trat geradewegs ein.
Ein großer weiß getafelter Raum erstreckte sich vor ihm. Sein Chef saß vor einem großen marmorierten Tisch und erwartete ihn schon.
»Adrien«, sein Laut war nicht mehr als ein Flüstern. Mit seiner knochigen langen Hand strich er sich eine schwarze Haarsträhne aus dem Gesicht und überreichte dem Ankömmling seine Liste. Seine Macht und seine Überlegenheit waren in jeder Geste deutlich zu erkennen und duldeten keinen Widerspruch.
Adrien rollte das beschriebene Pergamentpapier zusammen und steckte es ein, nickte bestätigend in Nicholas' Richtung und ging wieder hinaus.
»Nessofin«, rief er Adrien zu. Der Gefährte wollte gerade in das Büro seines Chefs eintreten, als er unerwartet von einer Hand gestoppt wurde.
»Worum geht es?«, fragte er überrascht.
»Ich muss dich sprechen. Sei nach der Übergabe auf dem Parkhausdach des Mallcenters.«
Nessofin wusste genau, von welchem Parkhausdach Adrien sprach. Es befand sich in einem ihrer gemeinsamen Bezirke. Dieser Platz bot einen guten Ausblick auf die Menschen, die an diesem Ort hin- und hertingelten. Oft kamen Todesboten dorthin. Immer noch ein wenig überrascht willigte er ein.
Einige Minuten vergingen, ehe sie sich auf dem Parkhausdach trafen. Nessofins pechschwarzes, lockiges Haar wehte im Wind. Fragend wandte er sich Adrien zu. »Worum geht es, Gefährte?«
Nessofins dunkle Augen musterten Adrien prüfend. Adrien musste mit jemandem über dieses Erlebnis heute sprechen. Es würde ihm sonst keine Ruhe mehr lassen. Das kannte er von sich gar nicht. Da allein Nessofin sich noch in Reichweite befand, entschied er sich für ihn als Gesprächspartner.
»Mir ist heute etwas Eigenartiges passiert«, begann er. »Ich ließ einen Mann an einem Herzinfarkt sterben und dann war da diese Frau, eine Sanitäterin, die versucht hat ihn wiederzubeleben. Ich hätte schwören können, dass sie mir direkt in die Augen gesehen hat, so als ob sie mich sehen könnte.«
»Das ist unmöglich«, warf sein Gefährte ein, »kein Sterblicher ist je in der Lage unseresgleichen zu sehen”, erklärte Nessofin entschieden. »Einst holte ich die Seele eines Mädchens. Es war sehr lange krank. Ihr Vater hatte Tag und Nacht an ihrem Bett gewacht. Als ich sie dann holte, für einen Moment nur, sah es für mich so aus, als ob er mich hätte sehen können. Doch als ich genauer hinschaute, war mir klar, dass er nur durch mich hindurch, ins Leere, blickte. Es ist ausgeschlossen«, stellte er fest.
»Du hast wohl recht«, sah Adrien ein.
Langsam ging die Sonne unter und tauchte die Stadt in ein zauberhaftes Licht, das sich auf die Hochhäuser und Straßen legte.
»Ich muss mich um meinen nächsten Auftrag kümmern, Gefährte, und das solltest du auch tun.« Mit nur einem Blinzeln löste Nessofin sich in schwarzen Rauch auf, der sich langsam im Wind verteilte. Dann war auch Adrien fort.
KAPITEL 3 – FREUNDINNEN
Die restliche Arbeitswoche verging wie im Flug. Unfallopfer, Opfer von Schlägereien oder auch Suizid und übermäßiger Drogenkonsum standen auf der Tagesordnung. Die Sterbefälle während Emilys Schicht nahmen zusehends ab. So konnte es weitergehen. Gerade bog sie mit ihrem Ford in eine kleine Seitenstraße der Parker Street ein. Heute war ihr freier Sonntag, den sie bis eben bei ihrer Großmutter verbracht hatte. Wie üblich, wenn Emily zum Mittagessen kam, hatte Elise die Lieblingsspeise ihrer Enkelin zubereitet. Gut, dass sie immer mehr als nur zu viel kochte. So packte sie ihr noch eine Portion des leckeren Kartoffelgratins in eine Frischhaltebox. Auch von ihrem frisch gebackenen Erdbeerkuchen nahm sie ein Stück mit.
Es war bereits vier Uhr durch und sie musste sich nun beeilen, denn sie war mit ihrer besten Freundin verabredet und wollte nicht zu spät kommen. Sie hatte sowieso schon ein schlechtes Gewissen, denn es war schon vier Wochen her, seit sie Becky das letzte Mal gesehen hatte. Damals waren sie mit Claire und Marvin, die Emily in letzter Minute ins Boot geholt hatte, bowlen gegangen. Es war ein sehr lustiger Abend gewesen. Während die drei ein Team gebildet hatten, hatte Beckys Team aus ihrem Kumpel Jake und ihrem Bruder Simon bestanden. Der einzige Wermutstropfen an diesem Abend waren die ständigen Verkuppelungsversuche ihrer Freundin gewesen. Aus irgendeinem Grund hatte Becky es sich zur Aufgabe gemacht ihrem Glück ein wenig auf die Sprünge zu helfen – ebenso wie dem ihres Bruders. Nach ihrer letzten gescheiterten Beziehung vor einem Jahr hatte Emily kein einziges Date mehr gehabt, aber Simon war nun wirklich nicht ihr Typ. Auch wenn er schon seit ihrer Kindheit ein Auge auf sie geworfen hatte, fand sie ihn schon immer eine Spur zu flachsig und unreif. Obwohl Simon drei Jahre älter war als die beiden, lebte er nach wie vor bei seinen Eltern – in seinem kaum veränderten Jugendzimmer. Bei den Erinnerungen an diesen Anblick musste Emily innerlich schmunzeln. Das letzte Mal, vor drei Jahren, als sie einen Blick hineingeworfen hatte, war es mit unzähligen Star-Wars-Postern und ein oder zwei Pin-Up-Kalendern behangen gewesen. Nein, sie brauchte einen Mann, der mit beiden Beinen fest im Leben stand, keinen großen Jungen – auch wenn sein Herz noch so gut war.
Wo blieb sie denn nur? Gerade parkte sie ihren Wagen vor dem Eingangsbereich von Petes Pub. Dort waren die beiden verabredet. Es war seit ewigen Zeiten ihr Stammlokal. Schon sehr viele Abende hatten die beiden jungen Frauen hier verbracht und eine Unmenge amüsanter Erinnerungen waren mit diesem Pub verknüpft.
»Schon zehn nach… Dass sie auch nie pünktlich sein kann!«, dachte Emily. Sie stieg aus dem Auto und blickte sich noch einmal fragend um. Es war ein herrlicher Nachmittag im Oktober. Die Sonne schenkte dem gesamten Stadtviertel einen besonderen Glanz, indem sie alles in ihren goldenen Schein einhüllte und schimmern ließ. Die Luft roch frisch und mild. Auch ein blumiger Duft war zu vernehmen. All das erinnerte Emily an Frühling. Sie steckte ihren Autoschlüssel in ihre Handtasche, als eine ruckartige Bewegung sie zusammenzucken ließ. Zwei Hände legten sich auf ihre Schulter.
»Hallo«, flüsterte eine Stimme ihr ins Ohr. Es war Becky.
»Du meine Güte, hast du mich erschreckt«, prustete die Erschrockene heraus, während sie sich ihrer Freundin zuwandte.
Deutlich amüsiert musterte Becky sie. Wieder einmal trug Emily ihre beigefarbene Bluse, die für Beckys Geschmack einfach viel zu bieder war, und dazu eine alte Jeans. Ihre Freundin zog eine Augenbraue hoch. »Süße, was soll denn dieser, verzeih meine Ausdrucksweise, langweilige Aufzug? Ich dachte, wir gehen heute Abend auf die Piste und suchen dir einen netten Mann oder du flirtest wenigstens ein bisschen mit ein paar geeigneten Kandidaten!« Verständnislos schüttelte sie den Kopf. »Weißt du, so ein bisschen flirten ist sehr gut fürs Ego. Du musst langsam wieder damit anfangen«, fuhr sie fort.
Emily verdrehte die Augen. Sie würde einfach nicht aufgeben. Sie würde nicht eher Ruhe geben, bis sie ihr einen handfesten Beweis dafür erbringen würde, dass sie eine Verabredung hatte. Emily musterte nun Beckys Outfit und sie musste zugeben, dass das, was ihre Freundin da anhatte, alles andere als bieder wirkte, im Gegenteil: Sie trug ein hautenges Shirt, das ihre wohlgeformten Konturen zum Vorschein kommen ließ. Ihr Rock aus schwarzem Leder war für Emilys Geschmack eine Spur zu knapp. Ihre Wimpern waren üppig und schwungvoll getuscht, ihre Lippen verführerisch rot bemalt, ihre langen schwarzen Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden, den sie lässig über ihre Schulter gelegt trug. Sie sah wirklich wie der Inbegriff eines jeden Männertraumes aus. Auch ihre Wildlederstiefel sahen toll aus. Sie hatten an beiden Seiten ein geschnörkeltes Muster, das Emily irgendwie ansprach. Dagegen wirkten ihre einfachen Turnschuhe nichtssagend. Die Unterschiedlichkeit der beiden Frauen machte sich also bereits in ihrem Kleidungsstil bemerkbar; Becky wirkte manchmal wie ein Paradiesvogel, trug oft Neontöne, enge Leggins und Röcke, vorzugsweise tief ausgeschnittene Kleider, Emily hielt sich hingegen eher an lässige Blusen, sportliche Shirts und niemals würde sie ohne ihre geliebte Jeans aus dem Haus gehen. Makeup trug sie eher selten.
»Ich gehe nicht mit dir weg, um mir einen Kerl zu angeln, um es mal mit deinen Worten zu sagen.« Emilys Tonfall war verärgert. So lieb sie ihre Freundin auch hatte, wenn sie sich in etwas verbissen hatte, konnte sie wirklich nerven. »Wir beide wollten uns einen netten Abend bei Pete´s machen. Nur darum ging es!«, stellte sie in einem nun deutlich versöhnlicheren Ton klar. Emily wollte wirklich nicht streiten. Beckys ständige Kritik an ihrer Kleidung sowie ihre Verkupplungsversuche verdeutlichten ihr, dass ihre Freundin sich sorgte. Becky hatte nicht nur einmal zu bedenken gegeben, dass sie in Wearville nur ihre Arbeit kannte und kaum ein Privatleben hatte. Das stimmte allerdings nicht! Na gut, sie arbeitete wirklich oft mehr, als ihr gut tat, ihr Privatleben war sehr knapp bemessen, aber sie hatte dort Marvin und Claire. Die beiden waren neben Elise und Becky ein Stück Familie für sie geworden.
»Ja, tut mir leid, Liebes! Ich weiß, ich nerve. Ich meine es aber wirklich nicht böse. Ich will dich nicht damit ärgern oder dich gar umkrempeln. Du bist gut so, wie du bist, wirklich.«
»Na, da bin ich ja beruhigt«, gab Emily sarkastisch zurück.
»Ich weiß, wie du bist, Emily, aber es würde dir sicherlich auch nicht schaden, einmal ein Kleid oder einen Rock anzuziehen. Du hast eine tolle Figur und bist wunderschön und hast es nicht nötig dich zu verstecken. Aber das ist deine Sache. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich mich nicht mehr einmischen werde, versprochen!« Dann brachte sie noch ein kleinlautes »Tut mir leid!« heraus und begann übermäßig mit ihren Wimpern zu klimpern, wobei sie mehr als nur albern aussah – mit voller Absicht. »Bitte, bitte…«
»Ist ja schon gut«, entgegnete Emily und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Im Pub nahmen die beiden an ihrem gewohnten Tisch Platz. Es war ein eher kleiner Pub, überall an den Wänden hingen Neonleuchten in den unterschiedlichsten Farben mit den Worten Pete, Holliday oder Happy Hour, das Ambiente war leicht gehoben und trotzdem wirkte es zugleich sehr einfach, die Tische sowie der Tresen waren sehr rustikal, in Eichenholz, gehalten. Ab und an spielten hier regionale Bands. Alles in allem bekam man das Gefühl von Zuhause und Lockerheit vermittelt, was Emily schon immer sehr gefallen hatte. Es war noch nicht einmal fünf Uhr, von daher herrschte noch nicht allzu viel Betrieb. Gerade mal eine Hand voll Leute (alles Männer) saß am Tresen und an den vielen Tischen verteilt um ihr Sonntagabendbier zu genießen.
»Wer ist denn da? Hallo Becky!«, erklang eine Stimme. Pete, der Inhaber des Pubs, war gekommen um die Bestellung aufzunehmen. »Und hallo Emily! Schön dich hier mal wieder zu sehen!« Er wirkte erfreut. Emily hatte sich immer sehr gut mit ihm verstanden. Er war einer der Wenigen, die sie nicht ständig mit diesen mitleidigen Blick bedachten. Dafür war sie ihm mehr als dankbar. Sie plauderten ein wenig darüber, wie es ihr in der Zwischenzeit in Wearville ergangen war und was sie in ihrem alles andere als einfachen Job erlebte, bis er dann schließlich ihre Bestellung aufnahm. Becky orderte einen Tequila Sunrise und Emily bestellte sich einen alkoholfreien Bananacolada, da sie noch fahren musste.
Es war schön, seit Langem einmal wieder mit ihrer Freundin hier sitzen zu können. Becky erzählte von der Arbeit beim Juwelier Phoenix. Sie redete wie ein Wasserfall und Emily hörte ihr einfach nur interessiert zu.
»Irgendetwas bedrückt dich doch, Süße, das spüre ich«, äußerte ihre Freundin nach einer Zeit. Im Vergleich