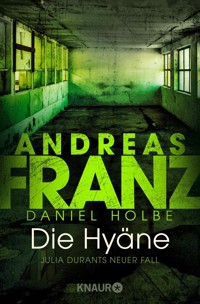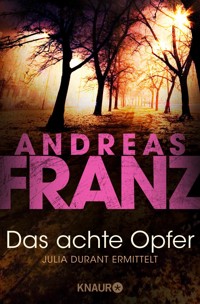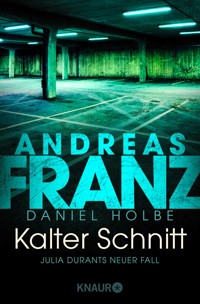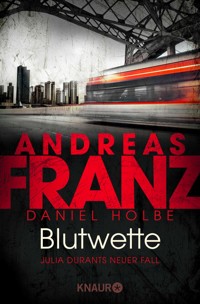Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Julia Durant ermittelt
- Sprache: Deutsch
Gleich der erste Fall nach ihrer Rückkehr in den aktiven Dienst verlangt Julia Durant, die immer noch unter dem Trauma ihrer Entführung leidet, wieder alles ab: In einem WG-Zimmer wird eine Studentin aufgefunden. Sie wurde grausam gequält und schließlich getötet, am Tatort läuft der Song "Stairway to Heaven". Verbissen ermittelt das K11 die mutmaßlichen Verdächtigen, und das Gericht verurteilt sie zu hohen Haftstrafen. Zwei Jahre lang wähnen sich alle in dem Glauben, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Doch dann taucht ein weiterer toter Student auf, und wieder spielt dasselbe Lied …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Franz / Daniel Holbe
Todesmelodie
Ein neuer Fall für Julia Durant
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Julia Durant leidet noch immer unter dem Trauma ihrer Entführung, und gleich der erste Fall nach ihrer Rückkehr in den aktiven Dienst verlangt ihr wieder alles ab:In einem WG-Zimmer wird eine Studentin aufgefunden. Sie wurde grausam gequält und schließlich getötet, am Tatort läuft der Song »Stairway to Heaven«.
Verbissen ermittelt das K11 die mutmaßlichen Verdächtigen, und das Gericht verurteilt sie zu hohen Haftstrafen.
Zwei Jahre lang wähnen sich alle in dem Glauben, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Doch dann taucht ein weiterer toter Student auf, und wieder spielt dasselbe Lied …
Inhaltsübersicht
Zitat
Prolog
Samstag
Samstag, 6. September 2008, 6.25 Uhr
Samstag, 7.50 Uhr
Samstag, 11.05 Uhr
Samstag, 12.24 Uhr
Samstag, 14.28 Uhr
Montag
Montag, 13.54 Uhr
Montag, 17.35 Uhr
Montag, 19.24 Uhr
Dienstag
Dienstag, 9.35 Uhr
Dienstag, 9.58 Uhr
Zwei Jahre später
Montag
Montag, 19. Juli 2010, 8.37 Uhr
Montag, 9.33 Uhr
Montag, 11.13 Uhr
Montag, 11.58 Uhr
Montag, 19.20 Uhr
Dienstag
Dienstag, 10.03 Uhr
Dienstag, 11.55 Uhr
Dienstag, 11.25 Uhr
Dienstag, 13.10 Uhr
Dienstag, 18.10 Uhr
Dienstag, 19.52 Uhr
Mittwoch
Mittwoch, 9.55 Uhr
Mittwoch, 11.18 Uhr
Mittwoch, 13.25 Uhr
Mittwoch, 15.47 Uhr
Mittwoch, 22.04 Uhr
Donnerstag
Donnerstag, 7.15 Uhr
Donnerstag, 7.42 Uhr
Donnerstag, 9.25 Uhr
Donnerstag, 11.40 Uhr
Donnerstag, 17.13 Uhr
Freitag
Freitag, 8.10 Uhr
Freitag, 11.21 Uhr
Freitag, 13.50 Uhr
Freitag, 15.00 Uhr
Freitag, 18.06 Uhr
Freitag, 18.55 Uhr
Freitag, 22.18 Uhr
Samstag
Samstag, 5.52 Uhr
Samstag, 7.10 Uhr
Samstag, 8.23 Uhr
Samstag, 8.42 Uhr
Samstag, 9.13 Uhr
Samstag, 9.27 Uhr
Montag
Montag, 15.20 Uhr
Montag, 21.00 Uhr
Epilog
In eigener Sache
Es gibt zwei Wege, denen du folgen kannst.
Noch ist Zeit, die Richtung zu wechseln.
(frei nach Led Zeppelin)
Jennifer Mason lag nackt auf ihrem Bett. Es war ein gewöhnlicher Futon, eins vierzig breit, weißes Laken. Die hell bezogene Sommerdecke war zerwühlt und hing zu zwei Dritteln auf das nussfarbene Parkett hinunter. Links vom Bett stand eine kleine Kommode, daneben ein Kleiderschrank aus einfach verarbeitetem Birkenholz. Rechts befand sich ein Holzregal, darin eine Stereoanlage und einige CDs, ansonsten glich der schmucklose Raum eher einem Büro als einem Wohnbereich. Weiße IKEA-Regale voll mit Büchern und ein verhältnismäßig großer Schreibtisch, darauf ein halbwegs moderner Laptop und Schreibutensilien. Die vier Halogen-Spots an der Decke vermochten jeden Winkel der zwanzig Quadratmeter grell mit Licht zu durchfluten.
Keinerlei Romantik im Raum, wie ihre Mitbewohnerin stets zu bemängeln wusste. Adriana Riva, eine hochgewachsene und ausgesprochen attraktive Italienerin, teilte sich die kleine Studenten-WG mit Jennifer und einer weiteren Studentin. Was sie nicht teilten, war die Auffassung vom Studieren. Adriana entstammte einer einfachen Arbeiterfamilie, die schon allein damit zu beeindrucken war, dass ihre Tochter überhaupt eine Hochschule besuchte. Sie finanzierte das Studium mit einem lukrativen Nebenjob bei einer Eventagentur und kannte die Rhein-Main-Partyszene in- und auswendig. Für Jennifer hingegen, die einen älteren Bruder mit steiler Laufbahn in der Armee und einen hochgebildeten Vater hatte, war es keine Selbstverständlichkeit, ein Auslandsjahr in Frankfurt verbringen zu dürfen. Ihre Noten hatten perfekt zu sein, sie musste jeden Leistungsnachweis nach Hause schicken. Die einundzwanzigjährige Kanadierin ließ sich daher nur selten zu Discobesuchen oder ausschweifenden Semesterpartys überreden, sondern konzentrierte sich voll und ganz auf das Studium. Umso mühsamer war es für Adriana gewesen, sie davon zu überzeugen, wenigstens zu Semesterbeginn eine kleine Feier zu veranstalten.
»Aber wirklich nur ein paar Leute!«, waren Jennifers warnende Worte gewesen.
»Versprochen«, hatte Adriana gesagt.
»Keine Kiffer!«
»Nein, keine Kiffer.«
»Und nicht diese Komasäufer und deren Kumpane!«
Die dumpfen Bassschläge der Stereoanlage waren längst verklungen, umso intensiver nahm Jennifer nun die grellen, psychedelischen Farben wahr, die sich wie schnell drehende Spiralen in ihre weit aufgerissenen Augen bohrten. Sie fühlte das weiche, schweißnasse Bettlaken im Rücken, doch sie war nicht in der Lage, Arme und Beine zu bewegen. Sie vermochte nicht einmal die Position ihrer Extremitäten mit Gewissheit zu bestimmen und spürte diese erst wieder, als sich zwei Fäuste fest um ihre Handgelenke schlossen. Irgendwann – sie hätte nicht zu sagen vermocht, wie viel Zeit dazwischen vergangen war – bemerkte sie den dumpfen Rhythmus ihres Unterleibs, der ohne ihr Zutun wild zu beben begonnen hatte. Es waren harte, gnadenlose Stöße, deren Inbrunst sie allerdings nicht wahrnahm. Sicher war nur, dass sie es nicht wollte: Sie wollte die stechenden Farben nicht mehr sehen und auch nicht die Fratzen, die sich immer wieder aus ihnen lösten, unangenehm dicht vor ihren Augen. Lüstern bleckten sie die Zähne oder drohten sie mit aufgerissenen Mäulern zu verschlingen. Und dann der brennend heiße Atem und das weit entfernte hysterische Lachen.
Jennifer war sich sicher, dass sie fliehen musste, doch sie wusste weder vor wem noch wohin. Ein weiterer Stoß durchfuhr ihren wehrlosen Körper, und ein Krampf schien ihren Bauch zu durchziehen. Plötzlich sehnte sie sich danach, ihrem Körper zu entschweben, einfach diese nutzlose Hülle zu verlassen, die sie quälte und nicht entkommen ließ. Wie gerne hätte sie sich den bunten Farben hingegeben, wäre ein Teil des Regenbogens geworden, fern von allem irdischen Leid. Doch das gepeinigte Gefängnis aus Fleisch und Knochen hielt ihre Seele fest umklammert und zwang ihr Stunde um Stunde weiterer schmerzhafter Demütigung auf.
Endlich aber, als die Farben längst verblasst waren und sich die Sehnsucht nach Wärme in ein Wimmern der Verzweiflung gewandelt hatte, ließ der Peiniger von ihr ab. Ein letztes Mal beugte er sich über sie. Der kalte Stahl am Hals erschreckte sie nicht, und Sekunden später spürte sie eine wohlige Wärme, die sie allen Schmerz vergessen ließ. Das Letzte, was Jennifer Mason wahrnahm, war der Geschmack von Eisen und eine angenehme Schwere.
Dankbar spürte sie, wie der geschundene Leib ihre Seele freiließ.
Samstag
Samstag, 6. September 2008, 6.25 Uhr
Müde stapfte Julia Durant die hölzernen Treppenstufen hinauf. Ihr freies Wochenende hatte sie sich weiß Gott anders vorgestellt, als morgens um halb sieben einen Tatort aufzusuchen. Andererseits hatte sie zu dieser Tageszeit keine Viertelstunde gebraucht, um Frankfurt von ihrer neuen Wohnung am Holzhausenpark in Richtung Fechenheim zu durchqueren. Die WG, zu der man sie gerufen hatte, lag in einem Altbau, der sich außen kaum von den anderen Häusern des Viertels unterschied: ein weiß getünchtes Backsteinhaus, zwei Etagen, mit einer klobigen Gaube, die aus dem schwarzen Ziegeldach hervorragte. Die Hausbesitzer gehörten zur oberen Mittelschicht und vermieteten, seit ihre Kinder ausgezogen waren, die obere Etage an Studenten. Am Ende der Treppe angekommen, verschnaufte Durant. »Jaja, die Raucherlunge«, hörte sie einen ihr unbekannten Kollegen sagen, der an ihr vorbeihuschte und nach unten verschwand. Idiot, dachte sie, ihr habt ja keine Ahnung.
Nach ihrer Entführung im vergangenen Juni hatte Julia Durant einen Zusammenbruch erlitten und vier Tage in den Main-Taunus-Kliniken Bad Soden verbracht. Auf Anraten der Ärzte sowie das Drängen ihres Vaters und ihrer besten Freundin Susanne hatte sie nach der Entlassung umgehend ihre lange geplante Reise nach Südfrankreich angetreten. Schon nach wenigen Tagen war jedoch klar gewesen, dass es mit einem einfachen Urlaub nicht getan war. Julia Durant war ausgebrannt.
»Ich würde sie gerne für ein paar Monate bei mir behalten«, hatte sie Susanne mit sorgenvoller Stimme zu ihrem Vater sagen hören.
»Ja, das wäre gut«, hatte dieser zugestimmt. »Sie braucht dringend eine Auszeit, sonst geht sie daran kaputt.«
Es kostete nur zwei Anrufe, einen bei der Krankenkasse und einen bei ihrem Vorgesetzten Berger, und alles war genehmigt: ein Jahr unbezahlte Freistellung, beginnend nach ihrem regulären Urlaub zuzüglich Überstunden und Resttagen, also alles in allem gut dreihundertneunzig Tage. Doch damit alleine war Durant noch nicht geholfen gewesen. Es hatte Wochen gebraucht, bis sie bereit war, sich auf eine Therapie einzulassen, und Monate, um dort das Geschehene zu verarbeiten. Ohne ihre Freundin Susanne hätte sie das alles niemals durchgestanden. Doch nun war Julia wieder zurück, seit vier Wochen im Dienst, und musste langsam wieder alleine klarkommen.
Raucherlunge, dachte sie verächtlich, wenn es doch nur das wäre. Sie war von einem Arzt zum nächsten gerannt, hatte EKG, UKG und EEG über sich ergehen lassen und so viele Blutproben gegeben, dass sie sich wie eine Kuh beim Melken vorgekommen war. Nichts. Keine organische Disposition.
»Tout est bien, Madame Durant«, hatte man ihr stets versichert, »Sie sind kerngesund.«
Warum fühle ich mich dann manchmal wie eine Achtzigjährige, verdammt? Es war zum Verzweifeln.
»Hallo, Julia«, erklang plötzlich die vertraute Stimme von Frank Hellmer und holte sie zurück aus ihren trüben Gedanken. »Ich wusste gar nicht, dass du schon wieder Bereitschaftsdienst machst.«
»Hallo, Frank.« Sie rang sich ein Lächeln ab. »Ist mein erster heute.«
»Und dann gleich in die Vollen, wie? Stehst du schon lange hier?«
»Gerade angekommen«, flunkerte sie. »Was liegt denn an?«
»Willst du das wirklich wissen?«, seufzte Hellmer. Durant begriff auf Anhieb, welche Frage ihr Kollege damit eigentlich hatte stellen wollen.
»Ach komm schon, Frank«, forderte sie, »ich bin dafür bereit, glaub mir. Irgendwann muss ich ja wieder anfangen, oder? Also los!«
Stirnrunzelnd nickte Hellmer und ließ den Blick über seine Notizen fliegen, bevor er mit dem Bericht begann.
»Jennifer Mason, einundzwanzig, Kanadierin. Wohnt hier mit zwei anderen Studentinnen und ist schon das zweite Semester in Frankfurt. Also etwa seit Januar, Februar, so genau wissen wir das noch nicht. Die Vermieter sind im Ausland, gestern Abend gab es hier eine Gartenparty. Fing wohl alles ganz harmlos an, es gab auch keine Klagen der Nachbarn, und es waren maximal sechs bis acht Personen. Dafür haben sie eine Menge konsumiert, es liegt Ecstasy herum, wir fanden einige Joints und Spuren von Kokain. Es gibt reichlich leere Flaschen, hauptsächlich Wodka und andere harte Sachen. Irgendwann muss die Party einen katastrophalen Verlauf genommen haben, denn wir fanden die Mason nackt auf ihrem Bett, übel zugerichtet und allem Anschein nach vergewaltigt. Laut der Spurensicherung leuchtet das Laken im UV–Licht wie ein Christbaum. Zu guter Letzt wurde ihr die Kehle aufgeschlitzt, so was hab ich lange nicht mehr gesehen. Die Meldung ging von einer der Mitbewohnerinnen ein, Ariana, nein Adriana, eine Italienerin.« Hellmer blätterte in seinen Aufzeichnungen. »Genau, Adriana heißt sie«, fuhr er fort, »und mit Nachnamen Riva. Sie ist kurz nach dem Eintreffen der ersten Beamten zusammengebrochen, deshalb sind unsere Infos auch noch recht vage. Ob ihr Kollaps dem Schock oder der Nachwirkung irgendwelcher Drogen geschuldet ist, das ist noch unklar. Sie wurde offenbar nicht vergewaltigt. Man hat sie jetzt erst mal in die BGU gebracht.«
»Wieso ausgerechnet die Unfallklinik?«
»Keine Ahnung.« Hellmer zuckte mit den Schultern. »Lag wohl einfach am nächsten, nehme ich an.«
»Was ist mit der anderen?«
»Stimmt«, sagte Hellmer hastig, »da gibt’s ja noch die Dritte. Helena Johnson, Amerikanerin. Von ihr fehlt seit der Party jede Spur.«
»Hmmm.«
Durant hob das Kinn in Richtung Flur und sah ihren Kollegen fragend an. »Die Leiche ist noch da, nehme ich an?«
Hellmer nickte und wies mit seiner Rechten quer über den kleinen Flur. »Leiche, Spurensicherung und Kollegin Sievers«, lächelte er matt. »Hier entlang.«
Julia Durant schätzte die Wohnung auf etwa hundert Quadratmeter. Neben der Eingangstür lag das Badezimmer. Linker Hand befand sich ein Raum, dessen Tür halb angelehnt war. Auf einem selbstgemalten Türschild stand der Name Helena. An der Wand gegenüber befanden sich zwei weitere Türen, beide weit geöffnet, die ebenfalls in private Zimmer führten. Rechts um die Ecke folgte eine schmale Tür mit einem jener billigen, messingfarbenen Beschläge, die es in jedem Baumarkt gab: Gäste-WC. Daneben führte ein offener Durchgang in die Gemeinschaftsküche. Die Einrichtung war eine bunte Mischung aus klobigem Siebzigerjahre-Inventar und günstigen IKEA-Möbeln. Im langgezogenen Flur beispielsweise ergänzte ein schlichter weißer Schuhschrank eine klobige, dunkelbraun lasierte Holzgarderobe und einen auf Kolonialstil gezimmerten Telefontisch. Ein schmaler, rahmenloser Spiegel täuschte dem von der Treppe her eintretenden Besucher einen geräumigeren Flur vor. Die Wände waren hell, und entlang der Decke zog sich eine aufgesetzte Stuckleiste. Alles in allem eine typische Studentenwohnung: günstig, funktional und doch mit einem Hauch von Individualität.
Durant ließ Hellmer den Vortritt. Als dieser gerade durch den Türrahmen des linken Zimmers treten wollte, eilte von innen eine kleine Gestalt in Richtung Flur und lief ihm direkt in die Arme. Ein dumpfes Stolpern ertönte, er fing die Person reflexartig mit seinen kräftigen Armen auf, dann vernahm Julia Durant ein spitzes, bekannt klingendes Kichern.
»Na, na, nicht so hastig«, ulkte Hellmer und löste die junge Frau sanft aus seiner Umarmung.
»Guten Morgen, Julia«, begrüßte die Beamtin sie und drehte sich noch einmal kurz zu Hellmer um, der bereits von einem Kollegen der Spurensicherung beiseitegewinkt worden war. Sie hatte die Stimme richtig zugeordnet. Sabine Kaufmann war eine quirlige, meist gutgelaunte Person von achtundzwanzig Jahren. Obwohl sie noch einige Zentimeter kleiner war als Julia Durant, stach sie überall durch ihren blonden Bubikopf hervor. Die Frisur passte hervorragend zu der hellen, mit Sommersprossen übersäten Haut und den wachsamen grünen Augen, denen sich, so sagte man, kaum ein Detail zu entziehen vermochte. Durant fragte sich, warum Hellmer sie in seiner Leiche-Spusi-Sievers-Aufzählung nicht erwähnt hatte.
»Hallo, Sabine«, erwiderte sie, und ihre Stimme klang dabei kühl. Sofort bedauerte sie ihren Ton und musste daran denken, dass sie die junge Kollegin damals immerhin selbst als ihre Urlaubsvertretung ausgewählt hatte. Und es war niemand anderes als Sabine Kaufmann gewesen, die Julia Durant in ihrem Verlies gefunden hatte.
»Schön, dich zu sehen«, fügte Durant deshalb mit einem ehrlichen Lächeln hinzu. »Alle wieder komplett heute, nicht wahr?«
»Kann man so sagen, ja. Wobei ich schon wieder auf dem Sprung bin.«
»War ja nicht zu übersehen eben. Wohin geht’s?«
Kaufmann klopfte mit der linken Hand an die Tasche ihrer Jeansweste, die sie über der engen, rosafarbenen Bluse trug. Ein Stück ihres Notizblocks ragte heraus.
»Hausbesuch bei einem US-Amerikaner, John Simmons. Ist wohl der Freund von Helena Johnson, der verschwundenen Mitbewohnerin, zumindest gibt es hier Fotos von den beiden.« Schulterzuckend fügte sie hinzu: »Ist einen Versuch wert, solange wir nichts anderes haben.«
»Na dann viel Erfolg. Ich sehe mir jetzt erst einmal die Tote an.«
»Mach dich auf was gefasst«, seufzte Kaufmann. »Ich glaube, da werde ich mich wohl nie dran gewöhnen.«
»Musst du auch nicht. Wir dürfen unsere menschliche Seite nicht verlieren.«
»Da hast du natürlich recht. Allerdings frage ich mich, wo der oder die Täter diese Seite gestern Nacht hatten.«
Ohne eine Antwort auf diese Frage zu suchen, die Julia Durant sich schon an so vielen Tatorten hatte stellen müssen, zwinkerten die beiden sich zu, und Sabine Kaufmann verschwand im Treppenabgang. Durant blickte ihr noch einen Augenblick hinterher, atmete tief durch und betrat Jennifer Masons Zimmer. Auf einem Futon, ähnlich dem, den sie selbst einmal besessen hatte, lag eine zierliche Gestalt. Das lange Haar war verklebt von Schweiß und Blut, die Arme und Beine hatte sie von sich gestreckt. Dies verwunderte Julia Durant ein wenig. Nach Hellmers Informationen über die Misshandlungen und die gewaltsame Penetration hätte sie Jennifer Mason in Fötalstellung erwartet, die Arme um den Unterleib geschlungen. Eine typische Körperhaltung von Frauen, die gerade Opfer sexueller Gewalt geworden waren. Stattdessen wirkte die junge Frau auf dem blutgetränkten Laken sonderbar entspannt, beinahe so, als hätte sie den Moment des Todes als Erlösung empfunden.
Andrea Sievers von der rechtsmedizinischen Abteilung bemerkte Julia Durant erst, als diese direkt neben ihr stand.
»Mensch, das ist ja ein seltener Anblick«, platzte sie heraus. Seit Julias Rückkehr hatten die beiden sich noch nicht gesehen. Tausend Fragen standen der emsigen Mittdreißigerin ins Gesicht geschrieben, doch Julia konnte förmlich sehen, wie ihre Kollegin sich zur Professionalität zwang. Ihr Gesichtsausdruck wurde wieder geschäftig, es war weder die richtige Zeit noch der richtige Ort für Wiedersehensfreude oder Smalltalk.
»Bin seit August wieder im Dienst«, sagte Durant deshalb nur, »und heute zum ersten Mal draußen unterwegs.«
Sievers nickte, und Durant musterte sie argwöhnisch. Obwohl sie keine verräterischen Signale zu erkennen vermochte, unterstellte sie der Rechtsmedizinerin ähnliche Zweifel wie Hellmer. Vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein, dachte sie. Aber es nervte sie ohne Ende, dass man ihr unterstellte, noch nicht bereit zu sein. Wenn überhaupt, durfte sie das nur selbst. Dann unterbrach sie die unangenehm werdende Stille und fragte schnell: »Hast du schon irgendwelche Erkenntnisse?«
»Das meiste wird sich erst sagen lassen, wenn wir sie im Institut untersucht haben. Bei der Menge an Verletzungen und Körperflüssigkeiten wird das eine ganz schöne Sisyphusarbeit werden.«
»Habe ich befürchtet, Hellmer hat schon so etwas anklingen lassen. Was ist mit Todesursache und Zeitpunkt?«
»Na ja, verblutet ist sie durch den vertikalen Einschnitt am Hals. Die Tatwaffe ist allem Anschein nach ein Küchenmesser, zumindest hat die Spurensicherung eines neben dem Bett sichergestellt. Trachea und Arteria carotis wurden durchtrennt, also Luftröhre und Halsschlagader, dadurch kam es zu einem schnellen Ausbluten, außerdem ist Blut in die Lungenflügel eingedrungen. Wie viel sie davon gespürt hat, ist schwer zu sagen, da von einem starken bis exzessiven Konsum von Betäubungsmitteln auszugehen ist. Hierzu mehr nach unseren Laboranalysen. Selbst ohne Drogen würde man bei einer solchen Verletzung relativ schnell das Bewusstsein verlieren und keinen Schmerz mehr empfinden.«
Mit gepressten Lippen beugte sich Julia Durant über den Futon und betrachtete Jennifer Mason.
»Vermutlich das Einzige, was ihr in dieser Nacht keine Schmerzen bereitet hat, wie?«
»Das ist zu befürchten«, seufzte Andrea Sievers. »Der ganze Körper weist unzählige Hämatome auf, besonders an den Innenseiten der Oberschenkel und an den Unterarmen.«
»An den Armen fixiert und die Beine auseinandergedrückt«, folgerte Durant angewidert. Sie war zeit ihres Lebens eine starke Persönlichkeit gewesen, eine jener Frauen, die sich ihrer weiblichen Reize zwar durchaus bewusst waren, sich aber niemals als Sexobjekte hätten deklassieren lassen. Mochte es auch wenig damenhaft sein, eine Zigarette nach der anderen zu rauchen, Salamibrot und Dosenbier zu verzehren und eine harte Schale zu mimen, so hatte Julia Durant sich genau auf diese Weise Respekt verschafft. Trotz ihrer unübersehbaren und äußerst reizvollen weiblichen Attribute gab sie auch einen guten Kerl ab. Jahrelang hatte sie diese Fassade gepflegt, die sie unnahbar machte und damit auch scheinbar unbesiegbar. Doch dann waren all diese Dinge geschehen, erst der Reinfall mit ihrem letzten Freund, Georg, anschließend der Zwist mit Hellmer und dann natürlich die Sache mit Thomas Holzer. Mit nur einem Handstreich hatte dieser Psychopath sie in seine Gewalt gebracht und anschließend in ein unterirdisches Verlies verfrachtet, wo er sie nackt, schutzlos und völlig isoliert einsperrte. Sie hatte geschrien und gewimmert, gezittert und gebetet, doch es hatte Tage gedauert, bis ihre Kollegen sie schließlich aus der Gewalt des Perversen befreiten. Für Durant, an der Holzer sich nicht nur körperlich vergangen hatte, war es eine Ewigkeit gewesen, die sie am Ende nur noch in katatonischer Regungslosigkeit verbracht hatte.
Julia Durant hatte die Nase gestrichen voll von dem sogenannten starken Geschlecht. Von Männern, die sich nicht anders profilieren konnten, als Macht über Schwächere zu demonstrieren, und gleichzeitig über nicht genügend Chuzpe verfügten, dies unter ihresgleichen zu tun. Holzer, das wusste Durant, würde sein Leben lang büßen, doch das war nur ein schwacher Trost.
»Der Tod muss zwischen drei und halb vier eingetreten sein«, setzte Dr. Sievers erneut an. »Ob die Betäubungsmittel auch ohne Kehlenschnitt zum Tode geführt hätten, wird sich im Labor zeigen.«
Frank Hellmer eilte mit schweren Schritten herbei. Julia befürchtete, ihm nun alles noch einmal erklären zu müssen.
»Habt ihr es?«, fragte er stattdessen zu ihrer Verwunderung.
»Ja. Das Opfer ist verblutet, der Todeszeitpunkt war spätestens gegen halb vier. Details gibt es dann von Professor Bock.« Dr. Sievers verstaute das Thermometer, diverse Röhrchen und eine altmodische Lupe in ihrem Koffer. Anschließend streifte sie sich die Einweghandschuhe aus gelblichem Latex von den Händen und steckte sie in eine Tüte. Nach einem sich vergewissernden Blick in Richtung der Kollegen von der Spurensicherung entledigte sie sich außerdem ihrer hellblauen Gamaschen. Mitsamt den Handschuhen verschwanden diese eingetütet in dem geräumigen Koffer. Ein Haarnetz zu tragen hatte die selbstbewusste Brünette stets abgelehnt, wie Julia Durant wusste. Ein ordentlich zusammengebundener Pferdeschwanz tat es auch, war Andreas Überzeugung.
»Ich verschwinde dann, wenn’s recht ist«, sagte sie. »Unten warten bestimmt schon die Gnadenlosen.«
Damit waren die Männer des Bestattungsinstituts gemeint, die die Leiche in die Rechtsmedizin transportieren sollten. Julia Durant nickte und deutete hinter sich. »Die standen schon Gewehr bei Fuß, als ich hier ankam.« Dann wandte sie sich an Hellmer: »Und du hast dich über den Stand der Spurensicherung informiert?«
»Ja, die wollten nur grünes Licht von mir, das gesamte Haus zu versiegeln. Werden wohl geraume Zeit hier zu tun haben.«
»Denk ich mir.«
»Das Messer und die hölzernen Bettkanten werden als Erstes auf Spuren untersucht, und es gibt ja auch die ganzen aufgerauchten Joints, Zigarettenstummel, Flaschen und Becher. Da werden sich Fingerabdrücke und Speichelreste en masse befinden. Und dann kann die KTU sich noch an dem Laken austoben«, schloss Hellmer.
»Ja, Andrea hat mir das bestätigt. Es gibt tatsächlich jede Menge Spermaspuren, alle frisch, das lässt sich ja unter UV nicht immer auf Anhieb unterscheiden. Die Anzahl lässt darauf schließen, dass es sich um mehr als einen Täter handelt.«
Jeder andere Kollege hätte nun wahrscheinlich einen süffisanten Kommentar über Manneskraft vom Stapel gelassen, und Julia Durant war in diesem Moment einfach nur dankbar, dass Hellmer die Klappe hielt. Genau betrachtet hatte er es ja auch nicht mehr nötig, ihr etwas vorzumachen. Doch diese gemeinsame Erinnerung war schon beinahe vergessen. Das war mit einer anderen Julia Durant gewesen.
»Was ich mich frage«, grübelte sie laut, »ist, warum es bei einer Vergewaltigung und anschließender Tötung so dermaßen viele Spuren gibt. Ich meine, jeder noch so abgedrehte Gewaltverbrecher ist sich doch der Tatsache bewusst, dass Blut, Sperma und Fingerabdrücke unfehlbare Beweise sind.«
»Worauf willst du hinaus?«, fragte Hellmer.
»Na überleg doch mal. Wir haben eine Studentenparty, eine Menge Alkohol und Drogen. Irgendwann artet es in eine Orgie aus. Mal angenommen, du würdest nicht mehr so genau wissen, wo die Grenzen verlaufen: Würdest du nicht wenigstens ein Gummi benutzen? Sei es nun, um nicht im Saft deines Vorgängers zu stochern, oder eben, wenn der Sex nicht einvernehmlich war, um nicht sofort deine DNA überall zu verteilen. Da haben sich gleich mehrere Personen völlig unlogisch verhalten, und so naiv ist doch heutzutage niemand mehr, oder?«
»Weiß nicht.« Hellmer zuckte die Schultern. »Im Drogenrausch wird ihnen das wohl gar nicht mehr bewusst oder einfach nur scheißegal gewesen sein. Vielleicht waren der Mörder und der oder die Sexualpartner auch verschiedene Personen? Es war im Protokoll von sechs bis acht Gästen die Rede. Wer sagt uns denn, dass die Mason in ihrem Vollrausch nicht ein, zwei ihrer Kommilitonen rangelassen hat und ihr danach jemand ganz anderes an die Gurgel gegangen ist? Könnte ein eifersüchtiger Freund sein oder ein verschmähter Liebhaber. Das ist doch alles noch viel zu spekulativ. Könnte ja sogar die Riva gewesen sein. Hast du deren Figur gesehen? Gegen die hätte sie doch selbst nüchtern keine faire Chance gehabt.«
»Jennifer Mason hatte heute Nacht überhaupt keine Chance«, antwortete Julia Durant mit einem Kopfschütteln. »Dann soll sie also, bevor es zur Gewalt kam, Geschlechtsverkehr mit mehreren Männern gehabt haben?«
»Kann doch sein, oder?«, entgegnete Hellmer mit unschuldigem Gesichtsausdruck.
»Natürlich«, entgegnete Durant spitz und warf ihrem Kollegen einen vernichtenden Blick zu. Hatte er den vergangenen Sommer einfach vergessen? Hatte er das Bild verdrängt, wie sie kaum die Treppe aus dem Verlies hinaufgehen konnte, weil ihr Unterleib an jeder nur denkbaren Stelle schmerzte? Oder hatte er geplappert, ohne zu denken? Diese Seite an Hellmer, die er nicht oft, aber eben immer wieder mal zeigte, brachte Durant auch nach all den gemeinsamen Jahren noch auf die Palme. Verstärkt wurde dies durch die allgemein sehr naiven Vorstellungen von Männern darüber, wie Frauen Sexualität empfanden und welche Bedürfnisse und Vorlieben dabei für sie vorherrschten. Lustgewinn durch schmerzhaftes Eindringen und damit einhergehende Verletzungen im inneren Schambereich jedenfalls wünschte sich keine normale Frau. Und Jennifer Mason machte bislang nicht den Eindruck, als habe sie auffällige sexuelle Orientierungen gehabt.
Hellmer stand noch immer mit ausdruckslosem Gesicht neben ihr, und Durant entschied sich, ihren Kommentar noch einmal zu unterstreichen.
»Das Einvernehmen endet für mich mit den Würgemalen und Blutergüssen an Hals, Oberarmen und Handgelenken, den Hautabschürfungen an den Oberschenkeln und den Hautrissen im Intim- und Analbereich.«
»Vielleicht hast du recht. Aber wir drehen uns im Kreis, merkst du das?« Tonfall und Worte klangen verdächtig nach einem von Hellmers typischen Friedensangeboten. »Lass uns irgendwo frühstücken gehen und die Kollegen von der KTU und Forensik ihren Job machen. Vielleicht können wir später zu Adriana Riva fahren und herausfinden, wer alles auf der Party war.«
»Und was ist mit Jennifer Masons Familie?«
Hellmer schüttelte energisch den Kopf.
»In Kanada ist es jetzt Mitternacht oder so. Außerdem haben wir die Eltern noch gar nicht ermittelt. Der Nachnahme Mason bedeutet im Deutschen nicht nur Maurer, er ist auch von der Häufigkeit vergleichbar. Füllt also ganze Spalten im Telefonbuch, da kann sich unser Dreamteam dran verausgaben.«
Julia Durant musste unwillkürlich grinsen. Hellmer meinte damit ihre Kollegen Kullmer und Seidel, die sich vor ein paar Jahren dazu entschlossen hatten, Berufliches und Privates nicht mehr voneinander zu trennen. Die Arbeit im Präsidium lag also in guten Händen. Mehr gab es zu dieser frühen Stunde einfach nicht zu tun.
»Na gut, Frank«, sagte sie. »Lass uns von hier verschwinden.«
Samstag, 7.50 Uhr
Mann, noch nicht mal acht Uhr«, kommentierte Frank Hellmer die in riesigen Lettern aufflammende Digitalanzeige seines Bordcomputers. Julia Durant musterte das protzige Interieur des Porsche interessiert, verkniff sich aber einen Kommentar. Bereits im vergangenen Sommer hatte sie dieses Thema mit ihrem Kollegen durchgekaut und verspürte nicht die geringste Lust auf eine Neuauflage. Letzten Endes ging es sie auch nichts an. Hellmer hatte wieder zu seiner Frau zurückgefunden, diese war nun einmal wohlhabend, und warum sollte sie ihr Geld nicht auch ausgeben. Lebe jetzt, sonst tun’s deine Erben, hatte Nadine irgendwann in grauer Vorzeit einmal gesagt. Von dieser Unbeschwertheit, das wusste Julia nur zu gut, war heute nicht mehr allzu viel übrig. Der Porsche allerdings war geblieben, und Hellmer lenkte ihn gerade auf die Borsigallee.
»Wo wollen wir denn frühstücken?«, fragte er und warf Durant einen Blick zu. »Im Hessencenter ein Café suchen oder lieber gleich die Kantine in der BGU?«
»Ach, ich weiß nicht«, seufzte sie. »Aber bitte bloß nirgendwohin, wo ich Café au Lait und Croissants vorgesetzt bekomme!« Zweifelsohne hatte Julia die Lebensart und das Verwöhnprogramm von Susanne Tomlin an der französischen Riviera zu schätzen gewusst. Doch seit ihrer Rückkehr genoss sie wieder die tägliche Wurst- oder Nutellaschnitte – Roggen- oder Körnerbrot wohlgemerkt und nichts, was einem Baguette auch nur im Entferntesten ähnelte. Dazu schwarzen, arabischen Kaffee aus einer einfachen Henkeltasse anstatt mit doppelt so viel Milch in einer Porzellanschale.
»Mir würde ein Ausflug auf die Fast-Food-Meile voll und ganz genügen«, gestand Durant. »Da gibt’s alles Mögliche an Frühstückskram und vor allem einen brauchbaren Kaffee.«
»Wie Madame wünschen«, nickte Hellmer und trat aufs Gas. Offenbar hatte er sein Ziel bereits im Kopf, und tatsächlich setzte er kaum drei Minuten später den Blinker, kreuzte die Straßenbahngleise und steuerte auf einen Parkplatz zu. Trotz des schrecklichen Tatorts, der Julia Durant noch deutlich vor Augen stand, verspürte sie nun heftigen Appetit. Dabei kam ihr in den Sinn, dass sie unbedingt diverse Snacks in ihrem Kühlschrank aufstocken sollte. Doppelt so groß wie der, den sich Julia damals für ihre eigene Küche ausgesucht hatte, machte sich in Susannes zweitürigem Monstrum sehr schnell eine unangenehme Leere breit.
Die Fahrt hatte kaum lange genug gedauert, um das Niveau von Smalltalk-Plattitüden zu verlassen, geschweige denn, dass sich ein Gespräch über den Fall hätte entwickeln können. Durant trat durch die doppelte Glastür in das Schnellrestaurant und hielt sie für Hellmer offen. Dabei wanderte ihr Blick bereits über die wenigen Anwesenden und suchte eine ruhige, möglichst abgeschiedene Ecke, in der sie sich ungestört unterhalten konnten.
»Soll ich dir was mitbringen?«, fragte Hellmer und deutete auf die bunten Plastiktransparente mit den Frühstücksangeboten. Eine der Empfehlungen war eine Art Schinken-Käse-Croissant, und als er sah, dass auch Julia das Bild gesehen hatte, grinste er breit.
»Untersteh dich!«, warnte sie ihn. »Bring mir irgendwas Fleischiges, und für hinterher noch was Süßes. Und einen ordentlichen Kaffee.«
Gemächlich schlenderte sie auf die Fensternische zu, die sie als idealen Sitzplatz auserkoren hatte, und nahm auf der rotbraunen Kunstlederbank Platz. Anders als zu späterer Stunde fand sie die Tischplatte unverklebt und ohne Krümel vor. Für einen kurzen Moment stützte sie die Ellbogen auf dem kühlen Marmor ab und verbarg ihren Kopf zwischen den Händen. Bitte nicht schon wieder, flehte sie in Gedanken, bitte jetzt kein Kreislauftief. Um sich zu entspannen, ging Julia im Stillen einige Übungssätze autogenen Trainings durch. Dieser Mummenschanz, wie sie die Übungen einst bezeichnet hatte, taugte tatsächlich etwas. Ruhe, Wärme und Atmung wahrnehmen, dabei eine Hand auf den Solarplexus legen. Wenn sie bloß niemand dabei erwischte. Gerade rechtzeitig, als Hellmer mit einem Tablett an den Tisch trat, auf dem sich nichts weiter befand als zwei stark dampfende Pappbecher, richtete sich Durant wieder auf.
»Na, hast wohl die Hälfte liegen lassen.«
»Nein, die produzieren noch. Wird alles frisch geliefert, sobald es fertig ist. Hier, dein Kaffee.«
Er schob einen der Becher in ihre Richtung, und Julia griff sich schnell drei der vier Zuckerbeutel. Sie riss sie alle gleichzeitig auf und versenkte den Inhalt in der tiefschwarzen Flüssigkeit.
»Ich sehe schon, manche Dinge ändern sich nie«, feixte Hellmer.
»Warum auch«, konterte Durant. Dann, nach einer kurzen Pause, sah sie ihren langjährigen Kollegen mit fragendem Blick an. »Manches hat sich aber schon verändert, oder?«
»Weiß nicht. Was meinst du denn?« Hellmer schien verunsichert.
»Na komm schon«, bohrte sie. »Erzähl mal was von dir und Sabine. Ihr tollt ja herum wie junge Rehe.«
»Ach, daher weht der Wind.« Nun schien Hellmer erleichtert zu sein. »Na ja, was soll ich sagen, wir haben ein produktives Jahr hinter uns.«
»Produktiv?«, wiederholte sie und verzog das Gesicht. Noch bescheuerter hatte er es wohl nicht ausdrücken können.
»Mensch, Julia, was soll ich denn sagen, verdammt?«, platzte Hellmer heraus. »Du hast die Kaufmann doch damals selbst vorgeschlagen und warst dann weg. Ist ja auch okay, hast du ja bitter nötig gehabt, sehe ich ein. Aber das Leben musste schließlich weitergehen.« Nervös trommelten seine Finger auf dem Plastiktablett. Etwas gefasster sagte er dann noch: »Hast du eigentlich ’ne Ahnung, was hier los war?«
Julia kannte die Akten, und zwar allesamt. Nach knapp vier Wochen Innendienst unter Bergers Fuchtel meinte sie, nahezu jeden noch so kleinen Vorgang der vergangenen dreizehn Monate auswendig herunterbeten zu können.
»Ist doch okay«, beschwichtigte sie ihren Kollegen und legte ihm die Hand auf den Unterarm. Etwas verwirrt stellte die vor wenigen Sekunden an den Tisch getretene Bedienung ein Tablett mit Pappboxen, Servietten und Plastikbesteck ab und eilte davon.
»Es ist nur«, begann Julia und rief sich die seltsame Szene vorhin im Flur der WG ins Gedächtnis, »dass ich mich manchmal des Eindrucks nicht erwehren kann, als bräuchte man mich nicht mehr. Ich ziehe in eine Wohnung, von deren Balkon ich Berger fast auf den Schreibtisch spucken könnte, knie mich voll rein, damit ich endlich wieder auf die Straße komme, und dann habe ich meinen ersten Tatort und muss feststellen, dass ich nur das fünfte Rad am Wagen bin.«
»So ein Quatsch.« Aber Hellmer klang nicht so überzeugend, wie sie es sich erhofft hatte.
Durant versuchte es anders: »Als ich vorhin zum Tatort kam, hast du nicht einmal ihren Namen erwähnt, eben so, als würde man ohnehin davon ausgehen, dass dort, wo du bist, auch sie nicht fern ist.«
Nun schien der Groschen zu fallen.
»Du meinst, weil es bei uns früher so war?«
»Zwölf Jahre lang, lieber Frank. Wir haben so ziemlich jede Höhe und Tiefe mitgenommen, die einem nur widerfahren konnte.«
Noch immer lag Julias Hand auf seinem Unterarm, und Hellmer legte darauf nun seine freie Hand. Zwei einsame Tränen sammelte sich unter ihren Augen, nicht dick genug, um herabzutropfen, aber sichtbar für Hellmer.
»Verdammt, ich bin ein Trottel«, presste er zerknirscht hervor. »Ich seh dich bald jeden Tag und hab keine Ahnung, wie’s in dir aussieht.«
»Frank, ich hab eine Scheißangst«, gestand Julia Durant. »Mir geht es alles andere als gut, aber wenn ich nicht bald wieder normalen Dienst machen kann, ertrag ich das nicht länger.«
»Ist schon gut, Frau Kollegin«, lächelte Hellmer und packte ihre Hand ganz fest. »Glaub mir, Berger hat nicht vor, dich als Bürokraft zu beschäftigen. Und so gut es mit Sabine auch läuft, ich möchte meine alte Partnerin ebenfalls gerne wiederhaben.«
Durant zog die Nase hoch, zwinkerte Hellmer dankend zu und befreite dann ihre Hand. Noch bevor sie mit dem ersten Pappkarton zu rascheln begann, hörte sie ihn etwas brummeln. Es hatte mit den unbestreitbaren Vorzügen zu tun, die eine junge gegenüber einer alten Kollegin hätte.
Lächelnd schüttelte Julia Durant den Kopf und biss voller Genuss in den mit Schweinehack, Bacon und Ei belegten Burger.
Manche Dinge änderten sich tatsächlich nie.
Adriana Riva musste ausgesprochen hübsch sein, dies kam jedoch inmitten der sterilen Atmosphäre des Krankenzimmers mit seinen weißen Laken, dem Krankenhaushemd und dem Tropf in ihrem blassen Unterarm nicht zur Geltung. Zwischen den Schlitzen der heruntergelassenen Jalousie drangen warme Strahlen der Morgensonne hindurch, und in dem grellen Licht leuchteten unzählige feine Staubpartikel, die bei jeder noch so kleinen Bewegung wild durcheinanderstoben. Die gibt es also sogar hier und nicht nur bei mir zu Hause, registrierte Durant zufrieden. Die beiden Kommissare waren vor knapp zehn Minuten an der BGU eingetroffen und hatten sich den Weg zur Patientin Riva erfragt. Dabei waren sie auf erstaunlich wenig Widerstand seitens der Ärzte gestoßen. Sie werteten es als gutes Zeichen, denn dann konnte der Schock des Mädchens nicht so schlimm sein. Im Fahrstuhl schließlich, unter den naserümpfenden Blicken eines jungen Assistenzarztes, hatte Hellmer sein piependes Handy herausgezogen. Einer SMS von Sabine Kaufmann zufolge war John Simmons zwar bei seiner gemeldeten Anschrift ausfindig gemacht worden, von seiner Freundin Helena Johnson jedoch gab es keine Spur. Simmons selbst läge noch im Delirium; Details später.
In Rivas Zimmer herrschte eine beklemmende Stille. Das zweite Krankenbett war nicht belegt, und Hellmer hatte sich zwischen diesem Bett und dem Fenster postiert und blinzelte schweigend durch die Schlitze der Jalousien. Sie hatten auf der Herfahrt entschieden, dass Julia als weibliche Beamtin die erste Befragung durchführen sollte. Sanft hatte sie die Hand auf den Unterarm von Adriana Riva gelegt, einige Zentimeter unterhalb des Butterfly, wie man umgangssprachlich die Flügelkanüle bezeichnete, die in der Vene steckte. Eine kurze Erinnerung huschte an Julias geistigem Auge vorbei. Vier Tage lang hatte sie im vergangenen Sommer die Infusionsflaschen beobachtet, die sich in ihren Arm entleerten. Eine nach der anderen, Tropfen für Tropfen.
»Ich weiß, Sie stehen unter Schock«, setzte sie an und beugte sich etwas nach vorne, um möglichst leise sprechen zu können. Mit leerem Blick starrte Adriana Riva zurück, zeigte ansonsten aber keine Reaktion.
»Hören Sie. Wir werden Sie so wenig wie möglich beanspruchen, Ehrenwort. Aber Sie müssen mir sagen, was gestern Abend geschehen ist.«
Adriana atmete etwas schneller.
»Frau Riva, möchten Sie mir etwas mitteilen?« Durant zog dabei unwillkürlich ihre Hand zusammen, die immer noch auf Rivas Unterarm lag. Sofort stieß das Mädchen einen spitzen Schrei aus und schlug panisch um sich.
»Smamma! Sparisci!« Sie begann zu hyperventilieren, und plötzlich schoss ihr Farbe ins Gesicht. Die heftige Reaktion kam für Julia völlig unerwartet, sie sprang auf, taumelte und stieß mit einem lauten Scheppern an das verchromte Metallgerüst mit dem Tropf.
Mit drei großen Schritten eilte Hellmer herbei.
»Hol eine Schwester!«, keuchte Durant, die sich wieder gefangen hatte. Wortlos stieß Hellmer die Tür zum Gang auf.
»Eine Schwester, schnell!«
Die Italienerin begann zu wimmern und gab stoßweise ein Kauderwelsch in ihrer Muttersprache von sich. Dabei zitterte sie und atmete hastig. Durant meinte, mehrmals das Wort Madonna herauszuhören. Eine Schwester eilte herbei und gab ihr unwirsch zu verstehen, dass sie ihr im Weg stünde. Durant und Hellmer zogen sich ans Fenster zurück und beobachteten, wie die beleibte Frau, deren türkisfarbener Kittel an den meisten Körperstellen gefährlich spannte, Adriana Riva den Kopf streichelte und sie mit sanfter Stimme beruhigte. Erst nach einer Weile begriffen sie, dass die Schwester ein Kinderlied summte. Den wenigen Worten und dem Aussehen nach vermutete Durant, dass es sich ebenfalls um eine Italienerin oder zumindest eine Italienisch sprechende Südländerin handeln musste, und Hellmers Blick verriet ihr, dass er dieselbe Schlussfolgerung gezogen hatte. Schließlich tupfte die Schwester dem Mädchen mit einer Mullbinde die schweißnasse Stirn ab und hob danach ihren Blick in Richtung der beiden Kommissare.
»Sie sollten sich was schämen!«
Ihr Akzent war noch erkennbar, doch ihrer Aussprache nach war sie schon seit vielen Jahren in Deutschland.
»Machen Sie Ihre Arbeit und wir machen unsere«, gab Hellmer patzig zurück.
»Hey, Moment, sie hat doch recht«, sagte Durant schnell, als sie das gefährliche Aufblitzen in den Augen der Schwester erkannte. »Wir stellen Frau Riva nur noch zwei Fragen, und dann lassen wir sie sofort in Ruhe, okay?«
Widerwillig winkte die Schwester ab und schimpfte: »Sie machen doch sowieso, was Sie wollen! Aber ich hole den Dottore, wenn’s sein muss!«
»Zwei Fragen, heiliges Ehrenwort«, bekräftigte Durant.
»Bene. Aber ich bleibe im Zimmer!«
»Kein Problem.«
Erneut trat Julia Durant an das Bett, diesmal von der anderen Seite. Sie ging etwas in die Hocke und flüsterte der wieder ruhig daliegenden Riva ins Ohr. »Können Sie mir sagen, wo Helena Johnson ist?«
Schweigen. Dann, als sie die Frage bereits wiederholen wollte, bewegten sich Rivas Lippen.
»Hel …«, klang es schwach, und in den Augen spiegelte sich Angst. »Dov’è Helena?«
»Das möchte ich von Ihnen wissen«, sagte Durant. »Können Sie sich erinnern, wo Ihre Freundin Helena ist?«
»No, no, Helena …«, keuchte das Mädchen und schüttelte den Kopf.
Die Schwester trat heran und schob sich an Julia Durant vorbei.
»Due domande. Sie hatten Ihre zwei Fragen.« Wieder stimmte sie einen leisen Gesang an und tupfte Rivas Stirn ab. Über die Schulter suchte sie den Blickkontakt zu Hellmer.
»Madonna, sehen Sie nicht, wie das arme Kind leidet? Kommen Sie morgen wieder!« Ein abschließendes Brummen, bevor sie sich wieder ihrer Patientin zuwandte, ließ vermuten, dass sie ihrem letzten Satz mit einer blumigen Metapher in ihrer Muttersprache noch etwas Nachdruck verliehen hatte.
»Komm, Frank, wir verschwinden von hier«, sagte Julia zu ihrem Kollegen, der recht ratlos wirkte. Sie ging langsam zur Tür und drückte die Klinke hinab.
»Gregorio«, flüsterte es plötzlich, und wie versteinert hielt die Kommissarin inne. Sie wagte nicht, sich zu bewegen, und fürchtete beinahe, eine Halluzination gehabt zu haben. Doch da sprach die Stimme erneut, noch immer mehr ein leises Stammeln, aber wesentlich deutlicher als zuvor.
»Taubert. Gregor Taubert.«
Dann verlor Adriana Riva das Bewusstsein.
Samstag, 11.05 Uhr
Vom Parkplatz der BGU hatte Frank Hellmer seinen Wagen auf die Friedberger Landstraße gesteuert, die sich mehrspurig in Richtung Innenstadt wand. Sie hatten den schlanken Wehrturm der Friedberger Warte passiert, hinter dessen rot-weißen Fensterläden man mit etwas Phantasie noch immer mit Bogen bewaffnetes Wachpersonal vermuten konnte. Danach die Abzweigung zum amerikanischen Generalkonsulat und schließlich den Hauptfriedhof. Anschließend waren sie an der Fachhochschule rechts in die Nibelungenallee eingebogen, eine Kreuzung, die Hellmer an normalen Wochentagen selbst zu dieser Zeit noch vermieden hätte. Doch der Samstagsverkehr hielt sich in Grenzen, vermutlich zog es die meisten Leute heute eher an die Badeseen anstatt auf die Zeil.
»Ziemlich doofe Idee eigentlich, den Peugeot in Fechenheim stehen zu lassen«, dachte Julia Durant laut. »Jetzt hab ich’s vom Revier nur einen Katzensprung bis nach Hause, und das Auto steht am anderen Ende der Stadt.«
»Kam mir auch schon in den Sinn«, pflichtete Hellmer ihr bei, »aber dir wäre andererseits eine nette Stadtrundfahrt mit mir entgangen.«
»Eine halbe Stadtrundfahrt, um genau zu sein.« Julia bedachte ihren Kollegen mit einem herausfordernden Blick und fügte hinzu: »Du wirst sie nachher natürlich noch abschließen und mich bei meinem Auto rauswerfen.«
»Nun …«
»Das war keine Frage!«
Der Parkplatz des Präsidiums war nicht einmal halb voll, und außer zwei rauchenden Uniformierten begegnete ihnen niemand. Schweigend stiegen Durant und Hellmer die Treppe hinauf und durchquerten den langen Gang, an dessen Ende ein einziges großes Fenster das Sonnenlicht aufsog. Ein Benjamini in einem schweren Pflanzenkübel stand mittig davor und schien sich mit seinen staubigen Blättern dankbar nach jedem Lichtstrahl zu recken. Die meisten Türen waren verschlossen, und aus den geöffneten hörte man kaum Geräusche. Alle Dienststellen waren nur mit dem wochenendüblichen Personalschlüssel besetzt, und auch die Schreibtische des K 11 standen zum großen Teil leer. Freundlich lächelnd nickte Durant Doris Seidel zu, die sich den Telefonhörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt hatte und leise sprechend die Tastatur ihres PCs bearbeitete. Peter Kullmers Arbeitsplatz war leer, nein, eher verlassen, korrigierte Durant in Gedanken. Der Schreibtisch war dermaßen überladen mit Laufmappen und Papieren, dass der Begriff leer absolut unpassend gewesen wäre. Kullmer war der Mann fürs Praktische, nicht für die Bürokratie. Wahrscheinlich war er auch jetzt in Sachen Ermittlung unterwegs. Das schloss Durant aus der Anwesenheit von Doris Seidel. Wo sie war, da war auch Kullmer. Warum sollte ein Partner eine Extraschicht schieben, während der andere zu Hause wartete?
Auch Sabine Kaufmann war noch nicht zurück im Büro. Die erste Dienstbesprechung mit Berger würde demnach eine recht dürftige Zusammenkunft werden.
Berger erwartete die beiden Kommissare bereits und begrüßte sie mit einem stirnrunzelnden Nicken. »Hatte gehofft, Sie erst am Montag wiederzusehen.« Er sah müde aus, war nicht rasiert, und Julia war sich beinahe sicher, dass er dasselbe Hemd wie am Vortag trug.
»Ihnen auch einen guten Morgen«, erwiderte sie.
»Dito«, ergänzte Hellmer.
Mit einem Ächzen richtete Berger sich auf und schob einige Papiere zur Seite. Er nahm einen Kugelschreiber und den Schreibblock zur Hand und rückte die Schreibtischunterlage gerade.
»Hilft alles nichts, bringen Sie mich mal auf den neuesten Stand.«
Nach einem kurzen Blickwechsel mit Durant begann Hellmer mit seinem Bericht. Julia beobachtete Berger, der sich Notizen machte, und versuchte zu entziffern, welche Fakten er dabei besonders wichtig fand. Vor ihrem geistigen Auge ließ auch sie den Tatort, das Opfer und die Gedanken zum möglichen Tathergang Revue passieren. Die Vermutung lag nahe, dass es sich um eine dieser zügellosen Studentenpartys gehandelt hatte, bei denen es immer wieder zu Exzessen kam. Studentinnen, die mit ihren weiblichen Attributen nicht geizten, dazu eine schwüle Sommernacht, reichlich Alkohol und Drogen. Ausgelassene junge Männer, die nicht interessiert waren an Philosophie oder Naturwissenschaft, sondern die Körper der Mädchen mit ihren Blicken verzehrten und sich immer weiter aufputschten. Mit jedem Schluck und jeder Pille sank die Hemmschwelle, irgendwann erledigte das Testosteron den Rest, und sie fielen wie die Tiere übereinander her. Doch war das wirklich schon alles?
Nicht für Julia Durant. Wer auch immer sich im Vollrausch einer Vergewaltigung schuldig macht, der schlitzt doch seinem Opfer danach nicht die Kehle auf. Warum sollte man sich mit einem Mord belasten, wenn das Rechtssystem für Sexualstraftäter doch genügend Möglichkeiten und Auswege bereithielt, zum Beispiel, sich auf verminderte Schuldfähigkeit zu berufen. Ein freiwilliger Entzug, begleitende Therapie und außerdem das stetige Bedauern, die vermeintlich lockenden Signale der jungen Frau schlicht und ergreifend falsch interpretiert zu haben. Durant hatte oft genug erlebt, wie den Opfern sexueller Gewalt eine Mitschuld angedichtet wurde.
»Die heftigen Verletzungen Jennifers schließen jede Form einvernehmlichen Verkehrs aus«, bekräftigte sie Hellmers sachliche Auflistung. »Das Mädchen wurde womöglich über Stunden gequält und danach ermordet. Da gibt es nichts zu beschönigen.«
»Hat auch niemand vor«, kommentierte Berger und suchte mit dem Zeigefinger eine bestimmte Stelle in seinen Notizen. »Ich hatte vor einer Viertelstunde Professor Bock am Telefon, der bestätigte noch einmal die außerordentliche Brutalität. Für Details werden wir uns bis Montag gedulden müssen. Der innere Schambereich des Mädchens muss eine einzige große Wunde sein.«
Durant seufzte und Hellmer fragte: »Was ist mit Alkohol und Drogen?«
»Der Schnelltest sagt, dass sie Kontakt mit Haschisch hatte. Blutalkohol dürfte bei etwa zwei Promille liegen. Koks war auf den ersten Blick keines in der Nase. Genaueres ist zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht drin, zumal sich Bock und Sievers primär auf die Sicherstellung fremder DNA konzentrieren.«
»Also hängen wir bis dahin in der Luft«, seufzte Durant.
»Wie man es nimmt«, sagte Berger. »Wir haben noch ein paar Verhöre, die wir führen können. Dafür müssen die Kerle nur erst mal wieder nüchtern werden.«
John Simmons, so fasste er kurz zusammen, war auf Empfehlung von Sabine Kaufmann von zwei Beamten zur ärztlichen Untersuchung begleitet worden. Einem Drogen- und Alkoholtest widersetzte sich der athletische Amerikaner zunächst erfolgreich. Er begann um sich zu schlagen, wobei er ungeahnte Kräfte freisetzte. Dabei habe er lauthals geschrien. Es hatte dann wohl eine Weile gedauert, bis die Beamten ihn überwältigen konnten. Wenn man ihrer Meldung Glauben schenken durfte, saß der zuvor noch wilde Stier Simmons nun wimmernd in einer Ausnüchterungszelle. Den heroisch dazugedichteten Anteil dieser Meldung konnte man vorerst nur erahnen.
Den Namen Gregor Taubert hatte Durant noch vor Verlassen der Klinik telefonisch ins Präsidium übermittelt, um das Personenregister prüfen zu lassen. Glücklicherweise gab es nur einen Treffer im Stadtgebiet, und da Kaufmann sich noch nicht zurückgemeldet hatte, hatte Kullmer sich auf den Weg dorthin begeben. Dieser war nicht einmal weit, denn Taubert war im Studentenwohnheim an der Bockenheimer Warte gemeldet, keine zwei Kilometer Luftlinie vom Präsidium entfernt. Wenn der Student sich allerdings in einem ähnlichen Zustand befand wie Simmons, so befürchtete Durant, würde auch diese Spur zunächst keinen wirklichen Zugewinn bedeuten.
»Hört mal kurz zu, Leute.« Doris Seidel hatte sich der kleinen Versammlung genähert und wedelte mit einem gelben Notizzettel.
»Frau Seidel«, nickte Berger auffordernd, und auch Hellmer und Durant richteten ihre Blicke auf die hübsche, zierlich wirkende und doch, wie man wusste, gut durchtrainierte Kollegin.
»Soeben hat mich die Leitstelle darüber informiert, dass im Günthersburgpark eine orientierungslose junge Frau aufgegriffen wurde. Sie ist dunkelhäutig und spricht bisher nur in wirrem Englisch. Sie trägt keine Papiere bei sich, aber …«
»Helena Johnson«, platzte es fast gleichzeitig aus Durant und Hellmer heraus.
»Äh, ja«, sagte Seidel etwas irritiert. »Ich entnehme eurer Reaktion, dass die Beschreibung passt. Die Beamten haben einen Krankenwagen gerufen und befinden sich derzeit noch an Ort und Stelle. Südlicher Parkeingang, Ecke Wetteraustraße.«
Lapidar winkte Berger den bereits aufgestandenen Kommissaren zu. Julia Durant suchte noch einmal den Blickkontakt, teils, um zu verstehen, warum ihr Chef so schlecht aussah, teils, um ihn wissen zu lassen, dass sie bereit war, sich voll und ganz auf den Fall zu stürzen.
»Nun verschwinden Sie schon«, sagte er mit einem Zwinkern. Er hatte sie offenbar verstanden, und es war sicher nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn auch verstehen würde.
Ein Jahr konnte man eben nicht innerhalb weniger Wochen aufholen.
Samstag, 12.24 Uhr
Die Mittagssonne brannte erbarmungslos auf die Stadt hinab, und über dem Asphalt flimmerte die Luft. Zum zweiten Mal an diesem Tag warteten Durant und Hellmer an der großen Ampelkreuzung des Nibelungenplatzes, diesmal in Fahrtrichtung Bornheim. Die Klimaanlage hatte auf der kaum drei Kilometer langen Strecke keine Chance, eine erfrischende Wirkung zu zeigen. Unruhig rutschte Durant auf dem Ledersitz hin und her.
»Sag mal«, begann sie zögernd, und Hellmer sah zu ihr hinüber und zog die Augenbrauen hoch. Er kannte seine Kollegin besser als jeder andere, und Julia wusste das. Dennoch schien er nicht zu ahnen, was ihr gerade in den Sinn gekommen war.
»Na, was gibt’s?«
»Ich trau mich das jetzt kaum zu fragen, weil ich dich nicht in Verlegenheit bringen will«, druckste sie herum. Verzweifelt hatte sie in ihren Erinnerungen der letzten vier Wochen gekramt, doch keine Antwort, ja, nicht einmal verwertbare Anhaltspunkte gefunden.
»Mach’s nicht so spannend«, stöhnte Hellmer, der mittlerweile wieder die Ampel beobachtete. Gut, dachte Julia, dann halt raus damit.
»Früher, also ich meine vor der Geschichte im letzten Sommer«, begann sie, »hattest du hier doch immer eine Packung Zigaretten rumfliegen.«
»Oh Mann, das ist jetzt nicht wahr, oder?«
Mit einem Ruck fuhr Hellmer an und schüttelte energisch den Kopf. Es sah so aus, als hätte er sich am liebsten mit der Hand vor den Kopf geschlagen.
»Du wolltest doch, dass ich damit rausrücke«, verteidigte sich Durant. Es war ihr durchaus geläufig, wie heikel das Thema Sucht bei ihrem Kollegen war. Wie der Alkohol ihn und auch die Menschen um ihn herum zu zerstören gedroht hatte. Sie wusste außerdem, dass das gelegentliche unbändige Verlangen nach einer Zigarette sie wohl bis ans Lebensende begleiten würde. Hellmer hingegen hatte sie seit ihrer Rückkehr nicht ein einziges Mal rauchen sehen, und es lag ihr fern, seine vermutete Abgewöhnung zu torpedieren. Doch Hellmer reagierte vollkommen anders als erwartet.
»Im Handschuhfach sind welche, bedien dich nur. Und gib mir auch eine.«
Verblüfft fuhr Julia herum. »Wie jetzt? Ich dachte, du hättest aufgehört?«
»Im Leben nicht«, prustete Hellmer. Dann, wieder ernster, fügte er hinzu: »Auch wenn ich Nadine damit wohl sehr glücklich machen könnte. Aber ich hatte mich schon gewundert, dass du nicht rauchst …«
Ihre Blicke trafen sich, es war ein kurzer, sehr vertrauter Moment, wie Julia ihn in den ganzen Monaten vor ihrer Entführung nicht mehr mit Frank erlebt hatte. Dann lachten sie beide lauthals, und der Porsche machte einen gefährlichen Schlenker.
»Pass bloß auf, sonst muss die Tabakindustrie bald einen neuen Spruch auf die Packungen drucken: Unachtsames Rauchen kann zu schweren Verkehrsunfällen führen.«
Durant nahm den Zigarettenanzünder, hielt die orange leuchtende Spirale an die Spitze und sog kräftig am Filter, bis die Glut knisternd übersprang. Hellmer tat das Gleiche, jedoch um einiges schneller, da er gleichzeitig über die nächste Kreuzung manövrierte. Ganz schön affig eigentlich, dachte sie, dass die Kripo im Porsche aufkreuzt. Doch es hatte sich bei den Kollegen der Mordkommission eingebürgert, dass man bei Rufbereitschaft mit dem eigenen Wagen zum Tatort kam. Besser so, als wertvolle Zeit zu verlieren.
Hellmer trat auf die Bremse und lenkte den Porsche nach links in eine verkehrsberuhigte Zone. Langsam und von einem dumpfen Vibrieren begleitet, schlich das Fahrzeug etwa zweihundert Meter über das Kopfsteinpflaster.
»Sag mal, hast du dir Berger vorhin genau angesehen?«
Hellmer schien etwas verwundert über den Gedankensprung. »Wegen Dreitagebart und Knitterhemd meinst du?«
»Ja, auch. Aber so allgemein ist er ganz schön alt geworden, finde ich. Vielleicht fällt mir das nach einem Jahr Abstand einfach mehr auf, als wenn man sich jeden Tag über den Weg läuft.«
»Weiß nicht, kann sein. Er hatte es die letzte Zeit immer mal wieder im Rücken, vielleicht liegt’s ja daran.«
»Hoffen wir es.«
»Er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, und wer weiß, wie lange er sich das hier noch antun will.«
Helena Johnson kauerte auf einer hölzernen Parkbank, deren grüner Lack schon einmal bessere Zeiten erlebt hatte. Trotz des Schattens der hochgewachsenen und weit verzweigten Linde in unmittelbarer Nähe war es drückend heiß. Dennoch war die junge Frau in eine leichte Decke gewickelt, die sie von den etwas abseits stehenden Sanitätern bekommen haben musste. Einer der beiden wickelte gerade eine Blutdruckmanschette zusammen. Von dem Notarzt, dessen Audi den Parkeingang blockierte, war nichts zu sehen.
»Schwächeanfall«, hörte Durant einen der beiden Sanis murmeln, der andere erwiderte etwas, das sie als »Schüttelfrost« interpretierte. Hellmer knöpfte sein verschwitztes Hemd um einen weiteren Knopf auf und schnaufte, während er auf die beiden zutrat. Durant setzte sich neben das Mädchen und neigte vorsichtig den Kopf zu ihr. Helena Johnson wirkte nicht nur übernächtigt, sondern auch irgendwie blass. Bei dunkelhäutigen Menschen schien Durant diese Diagnose allerdings zweifelhaft.
»Helena Johnson?«, fragte sie sanft und überlegte sich, ob eine Berührung angemessen wäre. Doch sie legte ihre Hand nicht um den noch immer leicht zitternden Körper. Keinesfalls wollte sie denselben Effekt wie bei Adriana Riva herbeiführen.
»Ich würde Ihnen gerne helfen«, fuhr Durant fort, »nur weiß ich nicht, wie.«
Dabei beugte sie sich noch etwas weiter vor und versuchte, Blickkontakt aufzunehmen. Mit leeren Augen starrte Johnson scheinbar durch die Kommissarin hindurch und zeigte keinerlei Regung. Doch dann, als Durant gerade den Kopf zurückziehen wollte, löste sich eine Träne, und das Mädchen sackte in sich zusammen. Noch während Julia Helena aufzufangen versuchte, reagierten auch die beiden Sanitäter. Sie sprangen herbei und verständigten sich mit knappen Worten darüber, wohl doch besser eine Trage zu holen.
Wimmernd kauerte Helena Johnson, eine großgewachsene und alles andere als zierliche Person, nun wie ein kleines, hilfloses Bündel im Arm der Kommissarin, die sich wie in einem Déjà-vu fühlte. Doch anders als ihre Mitbewohnerin begann sie nun zu plappern, erst undeutlich, dann immer lauter und mit einem klagenden Tonfall. »What have we done, my God, what have we done?«, jammerte sie. Für Julia Durant klang es beinahe so wie früher, damals, in der Kirche, wenn die alten Frauen Mea culpa beteten und ihre gar so große Schuld beklagten.
»Was haben wir getan, was haben wir bloß getan?«
Samstag, 14.28 Uhr
Erschrocken fuhr Alexander Bertram zusammen, als das rote Licht über seinem Monitor grell zu blinken begann. Einundzwanzig Stufen von jetzt an. Er klickte zweimal mit der Maus, schaltete den Flachbildschirm aus und erhob sich. In nahezu vollständiger Dunkelheit bahnte er sich geschickt seinen Weg und durchtrat wenige Sekunden später in geduckter Haltung eine achtzig mal achtzig Zentimeter große Luke in der Rückwand des antiken Kleiderschranks aus dunklem Nussbaumholz. Mit einer Klappe, die sich beinahe nahtlos in die Öffnung einfügte, verschloss Alexander den geheimen Durchgang, schob einen dunklen Anzug davor und verließ das Möbelstück.
Im hellen Tageslicht des Zimmers kniff er kurz die Augen zusammen, richtete sich auf und drückte die Schranktür von außen zu. Dann verharrte er einen Augenblick und lauschte. Tapp, tapp, tapp. Alexander musste seine Berechnung korrigieren. Den flinken Schritten nach zu urteilen war es nicht seine Mutter, die er auf den hölzernen Stufen hörte. Hannelore Bertram litt seit Jahren unter Asthma, so dass sie meist bei Stufe elf eine Verschnaufpause einlegte und von dort aus ein gequältes »Alexaaander« von sich gab. Diesem Ruf eilte die Hoffnung voraus, durch eine Reaktion ihres Sohnes den restlichen Aufstieg erspart zu bekommen. Gelegentlich, aber nur an ausgesprochen guten Tagen, gönnte Alexander ihr diese Erleichterung. Heute jedoch war es Wolfgang Bertram persönlich. Gerade rechtzeitig, bevor das dumpfe Pochen auf der hölzernen Tür ertönte, ließ Alexander sich in einen riesigen Sitzsack aus weißem Leder fallen und griff nach seinem bereitstehenden Netbook.
»Alex?« Die Tür öffnete sich langsam. Eine der vielen Unarten seines Vaters war, dass er nach dem Anklopfen sofort den Raum betrat. Ein-, zweimal mit seinen kräftigen Knöcheln auf das Türblatt trommeln und danach unmittelbar die Klinke betätigen. Mutter würde das im Traum nicht einfallen.
»Was’n los?«, gähnte der junge Mann und gab sich antriebslos. Mehr als einen kurzen, gelangweilten Blick gönnte er dem Eindringling nicht. Samstagnachmittags um diese Zeit verzogen sich seine Eltern meist hinaus in den Garten, einmal im Monat fuhren sie außerdem in den nahe gelegenen Großmarkt.
»Hör mal«, begann der beleibte Sechzigjährige, dessen Tonfall hin und wieder einen unangenehmen Hauch militärischen Drills hatte. Doch Alexander ließ sich nicht beirren. Er rechnete kurz nach und kam zu der Erkenntnis, dass heute tatsächlich der erste Samstag des Monats war. Also Großmarkt.
»Ich bleib daheim. Hab keine Lust«, sagte er mürrisch. Doch offenbar hatte sein Vater etwas ganz anderes sagen wollen.
»Unten ist ein Polizeibeamter«, beendete Wolfgang Bertram seinen begonnenen Satz. »Er will dich sprechen.«
Alexanders Magen zog sich zusammen. »Mich?«, fragte er und musste seine Ungläubigkeit nicht einmal spielen.
»Ja, es geht wohl um gestern Abend«, nickte der Vater. »Mann, Junge, du steckst doch nicht etwa in Schwierigkeiten, oder?« Plötzlich klang die Stimme überhaupt nicht mehr streng, er trat einen Schritt näher, und sein Blick wirkte ernsthaft besorgt.
»Ach Quatsch«, entgegnete sein Sohn, der sich mittlerweile wieder gefangen hatte. Bin mal gespannt, wer sein loses Mundwerk nicht halten konnte, dachte er im Stillen.
»Hilf mir mal bitte hoch, Papa«, forderte er seinen alten Herrn mit einer entsprechenden Handgeste auf.
»Wusste doch gleich, dass diese Dinger nichts taugen«, murrte der Alte und griff mit seiner riesigen Pranke nach dem ausgestreckten Arm seines Sohnes.
»Ich revanchier mich dann, wenn du mal wieder nicht aus dem Z1 kommst«, ulkte Alexander. »Aber jetzt sag doch mal, was will die Bullerei denn?«
Das bereits etwas freundlicher gewordene Gesicht von Wolfgang Bertram verwandelte sich sofort wieder in eine tadelnde Miene. »Sprich nicht so respektlos!«
»Ja, sorry«, entgegnete Alexander schnell. Bitte bloß nicht schon wieder die Leier über Recht, Ordnung und den Schutz der Bürger vor der Verwahrlosung der Gesellschaft. »Die Polizei meine ich natürlich. Was wollen die denn?«
»Weiß ich noch nicht genau.« Der Alte zuckte mit den Schultern. »Unten sitzt ein Kommissar, der sich bislang lediglich erkundigt hat, wo wir gestern Abend waren, also wir alle. Dann hat er auch gleich nach dir gefragt.«
Alexander Bertram hatte nichts anderes erwartet. Unter den kritischen Blicken seines Vaters kramte er eine zerknitterte Jeans hervor, die er gegen die Jogginghose tauschte. Das weiße T-Shirt war noch frisch genug, zumindest für sein Empfinden. Er spürte den kritischen Blick, der jeder seiner Bewegungen zu folgen schien. Gänzlich unbeeindruckt davon schlüpfte er in ein Paar Badelatschen und drehte sich in Richtung Tür.
»Wollen wir? Oder soll ich unterwegs in eine Galauniform schlüpfen?«
Kopfschüttelnd folgte der pensionierte General seinem Sohn nach unten.
Die Eingangshalle im Erdgeschoss der Villa war ein hoher, in Weiß und Altrosa angelegter Raum, dessen einzige Aufgabe darin bestand, die Besucher zu beeindrucken. Bittsteller wurden sich hier ihrer niederen Position bewusst, und potenzielle Rivalen wurden daran erinnert, dass sie es hier mit einem mächtigen Gegenspieler zu tun bekommen würden. Ein zwölfarmiger Kronleuchter aus leicht angelaufenem Silber, behängt mit Kristallen und ausgestattet mit elektrischen Kerzenbirnen, schwebte über dem Zentrum des Raumes, von dem man sich in drei Richtungen ins Haus hinein bewegen konnte. Zwei Türen waren verschlossen, eine dritte führte zurück in den Windfang des Eingangs und eine nach beiden Seiten geöffnete Schiebetür gegenüber der Treppe in das geräumige Wohnzimmer. Dort lagen wertvolle Perserteppiche mit dunklen rotbraunen Farbmustern, und eine riesige, glänzend braune Ledercouch mit zwei zugehörigen Sesseln lud in einem fünf Meter breiten Erker zum Verweilen ein. Antike Kommoden, ein zugeklappter Sekretär und zwei Bücherwände, die links und rechts die gesamten Seitenwände ausfüllten, ließen den Raum wie einen königlichen Lesesaal wirken.
Zielstrebig durchschritt Alexander das Wohnzimmer in Richtung der großen Fenster, die in alle drei Seiten des Erkers eingelassen waren. Wie überall im Haus war es auch hier angenehm kühl, obgleich man dem Beamten ansah, dass er vor kurzem noch stark geschwitzt haben musste. Er saß in einem Sessel mit Blick auf die Straße, gegenüber auf dem Sofa rutschte Hannelore Bertram nervös hin und her. Alexander schätzte den Mann auf Mitte vierzig, er war modisch, aber lässig gekleidet und kaute auf einem Kaugummi herum. Dazu nahm Alexander beim Näherkommen einen ihm fremden, schweren Duft wahr, den er als Aftershave einordnete. Ein parfümierter Bulle also, dachte er abfällig. Hat die Kripo heute ihr Männermodel geschickt?
»Alexander Bertram?« Der Mann erhob sich und streckte ihm die Hand entgegen. »Peter Kullmer vom K 11, Mordkommission.«
Alexander nickte und erwiderte den Gruß. Er musste sich korrigieren. Zugegeben, dieser Kullmer verstrahlte einen gewissen Charme und hatte Stil, aber von einem Dressman war er doch eine ganze Klasse entfernt.
»Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie das Recht haben, unter vier Augen vernommen zu werden«, sagte der Kommissar ernst und griff nach seinem Notizblock, der vor ihm auf der weißen Klöppeldecke lag. Nach einem schnellen Blick zu seiner Mutter, die mit gequältem Gesicht auf ein baldiges Ende dieses verstörenden Besuchs zu hoffen schien, und zu seinem Vater, der noch nicht Platz genommen hatte, schüttelte Alexander entschieden den Kopf.
»Nein, fahren Sie nur fort. Was auch immer Sie von mir wollen, ich habe nichts zu verbergen.«
»Gut«, begann Kullmer geschäftig, »dann verraten Sie mir bitte, wie Sie den gestrigen Abend verbracht haben.«
Alexander kratzte sich am Kopf.
»Oje. Wann beginnt bei Ihnen denn der Abend? Beim Abendbrot um sechs?«
»Alex!«, zischte Wolfgang Bertram erbost und stieß ihn an die Schulter.
»Ja, tut mir leid. Aber wenn mir mal jemand sagen würde, worum es geht, dann könnte ich auch gescheite Antworten geben.«
Offenbar entschied sich der Schönling zu einer anderen Strategie.
»Nun, Herr Bertram«, sagte er gedehnt und zog eine Fotografie zwischen den Seiten des Blocks hervor, »dann sagen Sie mir mal etwas zu dieser Person. Kennen Sie sie?«
Alexander fuhr zusammen und riss das Bild an sich.
»Oh, das ist doch Jenny!«, keuchte er, und um ein Haar hätte er begonnen zu hyperventilieren. Auf dem Foto war das ausdruckslose Gesicht von Jennifer Mason zu erkennen. Der aufgedruckte Zeitindex verriet, dass es keine drei Stunden alt war. Alexander vermutete, dass das Bild ein wenig retuschiert war, um die Leichenblässe nicht zu offensichtlich darzustellen, doch spätestens der metallene Hintergrund des Edelstahltisches verriet, dass das Bild wohl in der Gerichtsmedizin entstanden war.
»Was … was ist denn mit ihr passiert? Ich meine, wie … wer …«, stammelte er, als er bemerkte, dass Kullmer ihn erwartungsvoll musterte.