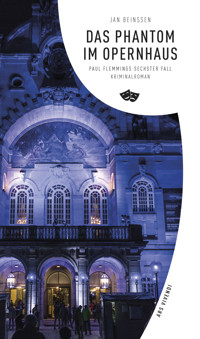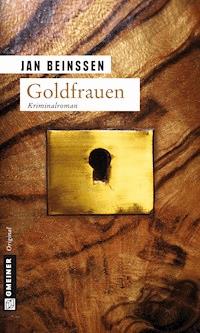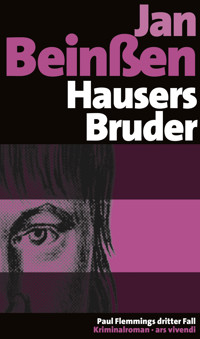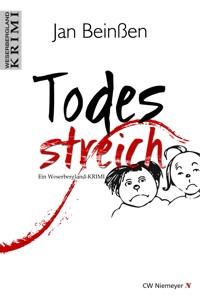
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Weserbergland-Krimi
- Sprache: Deutsch
Große Ferien. Sechs Wochen Urlaub weit weg vom Dauerstress in Berlin! Doch mit der Fahrt in seine Heimat, das norddeutsche Provinznest Wiedensahl, geht für den Lehrer Philip Lessing der Stress erst so richtig los: Seine sechzehnjährige Tochter Blümchen macht Zicken, die alte Lieblingstante Luise entpuppt sich als völlig vergreist – und das Leben im Dorf ist gelähmt durch das gespenstische Verschwinden zweier Bewohner. Philip fasziniert die geheimnisvolle Erotik der neuen Dorfärztin Pia, gerade die aber wird von den meisten verdächtigt, für den unheimlichen Spuk verantwortlich zu sein. Als Philip dem Mysterium mit Hilfe der schrulligen Privatdetektivin Trude auf den Grund gehen will, ist plötzlich auch Blümchen wie vom Erdboden verschluckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Jan Beinßen
Todesstreich
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2011 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Brigitte Mück, Carsten Riethmüller
Druck und Bindung: AALEXX Buchproduktion GmbH, Großburgwedel
Printed in Germany
E-Book-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
E-Book ISBN 978-3-8271-9807-5
Todesstreich spielt in den späten 1980er Jahren. In dieser Zeit sammelte der Autor erste Berufserfahrungen als „Rasender Reporter“ in den Landkreisen Schaumburg und Hameln-Pyrmont. Viele seiner Eindrücke und Erfahrungen mit Land und Leuten aus dieser Phase seines Lebens hat er in dem vorliegenden Roman verarbeitet. Inzwischen hat sich auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs in Schaumburg viel getan. Der Handlungsort Wiedensahl hat sich zu einem schmucken Dorf entwickelt und verfügt über ein modernes, erweitertes Wilhelm Busch-Museum.
Die Handlung ist frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
Das Buch erschien in limitierter Auflage erstmals 2001 unter dem Titel Messers Schneide. Mit Todesstreich liegt nun die vollständig überarbeitete Neuauflage dieses Romans vor.
Über den Autor:
Jan Beinßen, geboren 1965 in Stadthagen, war viele Jahre in der Welt der Zeitung zu Hause. Dabei führte ihn sein Weg von Stadthagen über Hameln nach Nürnberg, wo er seitdem als Journalist und Autor arbeitet. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.
Mehr über Jan Beinßen und seine Aktivitäten erfahren Sie unter www.janbeinssen.de
Stets findet Überraschung statt
Da, wo man’s nicht erwartet hat.
(Wilhelm Busch)
Für Edith
Erster Streich
Schweiß rann mir wie Suppe den Nacken herunter. Meine Lippen klebten salzig. Das Thermometer war stehen geblieben. Seit dem Nachmittag keinerlei Veränderung. Die Nacht konnte der Hitze nichts anhaben. Sie brütete über der Stadt wie eine fette Glucke. Ich lehnte mich auf die Fensterbank und lauschte dem Brummen der Autos. Gleichmäßig, monoton, es verstummte nie.
„Du machst dir Sorgen, ja?“
Marita stand hinter mir. Ich hatte sie nicht bemerkt. Im Halbdunkel des Zimmers sah ich nur schwach ihre Silhouette. Ihr weiches Haar fiel weit über die schmalen Schultern und bildete einen Kranz um das Gesicht, dessen weiche Züge im Schummerlicht kaum zu erahnen waren. Sie kam näher, und ich legte meinen Arm um sie. Marita zog mich sanft vom Fenster weg.
Ich sträubte mich schwach. Ihre Frage hallte in meinem Kopf nach, und es ärgerte mich, dass sie sie gerade jetzt gestellt hatte. Natürlich machte ich mir Sorgen! Was für eine Frage! Marita wusste, was mir meine Großtante bedeutete. Ich war quasi bei ihr aufgewachsen. Tante Luise war nicht nur eine Verwandte, sondern eine echte Freundin. Meine Ferien hatte ich früher fast ausnahmslos bei ihr verbracht. Ich rief sie an, wenn ich mich mit meinem besten Kumpel zerstritten hatte. Oder als mich, gerade mal fünfzehn, der Weltschmerz packte. Vor meinem allerersten Kuss bat ich sie um Rat. Weil ich nicht wusste, ob ich die Lippen geschlossen halten sollte oder ob mich das zum Verklemmten gestempelt hätte. Tante Luise half mir über Beziehungskrisen hinweg, und sie war es, die mir bei der Scheidung von meiner ersten Frau, Juliane, zur Seite stand und mich dabei durch ihre besonnene und erfahrene Art vor Ausrutschern warnte, die ich später bereut hätte.
Marita drückte den Schalter und tauchte unser Wohnzimmer in ungemütlich helles Licht. Links und rechts von ihr dicke Mauern aus Büchern. Neben ihr, auf dem Fußboden, unser kleiner tragbarer Fernseher, vor dem wir noch vor wenigen Stunden einträchtig gelegen und uns durchs Abendprogramm gezappt hatten. Im Hintergrund, auf unserem Balkon, schimmerten lackschwarz die prallen Früchte meiner Tomatenstauden im Mondlicht. Meine Marita, mittendrin in unseren bescheiden beengten Berliner Verhältnissen! Sie schob einige CDs beiseite, um sich auf dem Sofa Platz zu schaffen. Sie schlug die Beine übereinander und musterte mich aus blitzblanken Augen. Ich genoss den forschen Zug in ihrem zart geschnittenen Gesicht. Ihre winzigen Löckchen, jede für sich einzigartig und anders, purzelten zu beiden Seiten ihres Scheitels hinab, im ewigen Fall. Ein Schauspiel, von dem ich mich auch nach Jahren der Ehe nicht losreißen konnte, sobald ich mich darauf einließ. Wie bin ich bloß an diese Traumfrau geraten? In vielen Punkten intelligenter als ich. Vielleicht. Geradliniger ganz bestimmt.
„Fahr zu ihr!“
„Was?“
Wie sollte ich? Wir wohnten in Berlin, Tante Luise in Wiedensahl, einem verschlafenen Nest weit weg im Landkreis Schaumburg. Niedersachsen. Ländliche Einöde.
Marita neigte ihren Kopf und guckte mich mit genau den fordernden und entschiedenen Augen an, die ich so liebte. „In zwei Wochen sind große Ferien“, sagte sie ziemlich schroff. „Sechs Wochen lang kein Unterricht. Du kannst zu ihr fahren, wenn dich das beruhigt.“
„ … wenn du dann weniger schlecht gelaunt bist“, dachte ich ihren Satz weiter. Recht hatte sie. Die Nachrichten über den bedenklichen Gesundheitszustand meiner Tante gingen mir sehr nah. Meine Tatenlosigkeit, zu der ich hier in Berlin verdammt war, machte mich fertig.
„Wir können gemeinsam ja immer noch in den Herbstferien verreisen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagte Marita, und ihr gezwungenes Lächeln verriet, dass sie drauf und dran war, mir ein großes Opfer zu bringen.
„Ich weiß nicht …“ Marita hatte meine besondere Beziehung zu meiner Großtante stets toleriert, wenngleich sie sie wohl nie vollends begreifen konnte. Eigentlich hatten wir geplant, in den Sommerferien mit Blümchen nach Südfrankreich zu fahren. Mit einem geliehenen Wohnmobil. Womöglich der letzte Urlaub gemeinsam mit meiner Tochter. Sie wurde flügge, und nur die Aussicht, dass es auf französischen Campingplätzen meistens Diskotheken und demzufolge ausreichend aufgeschlossene, interessierte Jungs gäbe, konnte sie bewegen, uns noch einmal zu begleiten. Diese Reise war Marita nun bereit ausfallen zu lassen.
„Mach schon, Philip. Ruf sie an. Sie wird sich freuen!“ Sie strich sich energisch eine Lockenkaskade aus der Stirn. Sie wollte das Thema vom Tisch haben. Die Erleichterung, die ich verspürte, war trotz meines schlechten Gewissens ihr gegenüber groß. Doch Marita stellte Bedingungen. Blümchen – ich sollte sie mitnehmen. Marita hatte keine Lust, unsere pubertierende Göre die ganzen Wochen über beaufsichtigen zu müssen. Mit ihren frechen sechzehn Jahren würde sie Berlin unsicher machen. Jeden Tag, vor allem aber jede Nacht.
„Nimm sie mit aufs Land. Da hast du sie im Griff.“
Wer da wohl wen im Griff haben würde? Ich konnte mir Blümchens Reaktion auf diesen Vorschlag lebhaft vorstellen: Sie würde nicht fackeln, mir all ihre hormongenährte Wut entgegenzuschmettern. Sie würde ihre blauen Augen Funken sprühen lassen und jedes einzelne ihrer langen blonden Haare in einen Giftpfeil verwandeln. Ihre tausend Ringe würden sich in die wachsweißen Finger ihrer geballten Fäuste schneiden und nur darauf warten, auseinanderzusprengen, um mich zu treffen. Ihr ganzer ranker Körper würde sich anspannen und ihre Beine trittbereit unter ihrer himmelblauen Lieblingshose zittern. Und ihr Zorn würde einen feurig roten Kranz um die tätowierte Träne auf ihrer rechten Wange bilden – das höchste aller ihrer tausend Alarmzeichen.
Doch was sollte ich tun? Ich konnte es kaum ablehnen, meine eigene Tochter mitzunehmen. Marita, der Stiefmutter, konnte ich dies nicht aufbürden.
Blümchen, der mir längst über den Kopf gewachsene Spross aus meiner Ehe mit Juliane, war ein Wirbelwind. Die Kindheit hatte sie mit einer Lässigkeit abgelegt, mit der man sich alter Kleider entledigt. So, das kommt in die Altkleidersammlung und basta! Blümchen reifte viel, viel schneller heran, als ich das nachvollziehen konnte.
„Wir fahren mit der Bahn“, entschied ich, weil ich keine Lust hatte, mich mit dem Wagen die dreihundertfünfzig Kilometer über die chronisch verstopfte A2 zu quälen.
Zweiter Streich
Wesentlich verschlafener als erwartet.
Mein erster Eindruck von Wiedensahl, nach über drei Jahren Pause wohlgemerkt, war niederschmetternd. Schon ich verspürte wenig Lust, in diesem Kaff, in dem mir der beißende Gestank von Jauche entgegenwehte, die nächsten Wochen zu verbringen. Wie ging es erst Blümchen? Ich mied ihren Blick.
Da waren wir also: Ein schmaler Schlauch, durch den nur eine größere Straße führt, umsäumt von mäßig schöner Architektur. Ein Klecks auf der Landkarte. Wo war das Leben, das ich bunt und turbulent in meinen Erinnerungen bewahrt hatte? Wo die Menschen, die den Charme des Dorfs ausmachten? Unser Fahrer reduzierte die Geschwindigkeit. Es war kein anderes Auto weit und breit auszumachen. Auch bestand nicht die Gefahr, dass unvermittelt ein Kind vor den Kühlergrill des Mercedes springen könnte. Dennoch wählte er das bedachte Tempo einer Stadtrundfahrt. Die Straße blieb schnurgerade. Links und rechts nur die gleichförmigen Gebäude im norddeutschen Stil. Große Grundstücke, monoton sachlich gestaltet. Kein einziger Ausrutscher, der den uniformen Geschmack der Hausbesitzer stören könnte, etwa ein fremdartiges Tropengewächs oder eine Züchtung, die es in Norddeutschland nicht schon vor fünfzig Jahren gegeben hätte, kam mir zu Gesicht. Ein fades Bild: Alle Farben, selbst das kräftige Rot der Backsteinfassaden und das satte Grün der Gärten, erschienen mir seltsam blass, überbelichteten Dias ähnlich. Die Tachonadel sank auf dreißig, dann zuckte sie mühsam über dem Strich mit der Zwanzig. Die Eindrücke des Langweiligen wurden durch die behäbige Langsamkeit unseres Gefährts verstärkt.
Die beige Limousine, in der es penetrant nach Pfefferminze roch, rollte vor einem Haus aus, dessen Anblick unvermittelt wilde Gefühlsregungen in mir wachrief. Von außen betrachtet kein ungewöhnlicher Bau. Gebrannter Ziegel wie bei all den anderen. Hohe, gleichmäßig verteilte Fenster, deren ehemals hell lackierte Rahmen dringend eines neuen Anstrichs bedurften; was ebenfalls der still vereinbarten Norm in dem Dorf entsprach. Genau wie das Dach, schwarz vom Regen und Wind, durchsetzt mit dem grauweißen Kot der Tauben. Doch ich wusste um die Schätze seines Inneren. Dieses Haus war ein Märchenschloss. Jeder Raum barg seine Geheimnisse.
Ich bezahlte das Taxi, das wir uns am Bahnhof des nächsten größeren Orts, Stadthagen, genommen hatten. „Kommst du, Blümchen?“ Für einen Moment dachte ich, sie würde aus Protest sitzen bleiben. Dann ließ sie ihre schlaksigen Beine emporschießen, und im nächsten Augenblick erfasste eine Windböe ihr giftgrünes Sommerkleidchen. Sie ließ es hochwehen und gönnte dem Taxifahrer einen stieläugigen Blick auf ihr Höschen. Sie schnupperte in den heißen Sommerwind und ließ ihn durch ihr weißblondes, langes Haar wehen.
„Stimmt so!“, zwang ich den Blick des Taxifahrers auf das Geld in meiner Hand. Ich trug die Reisetaschen.
Meine Tante Luise machte nicht den Eindruck eines hinfälligen Menschen. Als wir ins Innere meines Märchenschlosses traten, ergriff mich ein vertrautes Wohlgefühl. Zunächst der Geruch (wie wichtig Gerüche doch sind!): ein leichtes, altmodisch-damenhaftes Wasser. Eine Prise parfümierter Seife. Dazu der Duft frischer, von Hand gemahlener Kaffeebohnen. Die Geruchsmischung suggerierte mir Jugend. Ich betrachtete flüchtig und gierig saugend sogleich das Interieur. Mit der zurückhaltenden Zaghaftigkeit des Besuchers eines Museums und doch ausgestattet mit den Kenntnissen des Direktors. Jedes Möbelstück hatte seine Bedeutung. Sei es die dünnbrüstige Vitrine mit den Schubladen, die seit Jahrzehnten klemmten und trotzdem oder gerade deshalb den raren Schmuck meiner Tante beinhalteten. Oder der schmale Wandschrank, fensterlos und ohne jeden Schnörkel, den ein aufgeschraubtes Bullauge aus Messing mit einem Spiegel in der Mitte zierte. Die Sessel, altertümlich, obwohl mit frischem hellen Tuch bezogen.
Es ist nicht abzustreiten: Luise war gealtert seit jener Zeit, in der wir uns manchmal täglich trafen, um meine Probleme zu erörtern (von ihren hörte ich selten). Gleichwohl war sie die Frau geblieben, die ich kannte wie kaum jemand anderen, und der ich wohl noch immer meine größten Geheimnisse anvertrauen würde. Die welke Haut, der matte Schimmer auf ihren Augen, die gebückte Haltung – meinetwegen, das mochten Alterserscheinungen sein. Aber rechnen wir einmal dagegen: Die vollen, kräftigen Haare waren eher schwarz als grau, der Blick clever, der Händedruck kräftig und bestimmt.
„Tante Luise!“ Ich umarmte sie innig.
„Sie hat nicht mehr alle beisammen“, sagte Blümchen. Später, nach einem ziemlich wortkargen Abendessen, als wir oben in einem der beiden Gästezimmer standen. Ich hatte den Drang, ihr eine zu kleben. „Du brauchst gar nicht so aggressiv zu gucken, Papa. Deine Tante hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und sie ist furchtbar schrumpelig im Gesicht.“
„Blümchen!“
Sie zupfte an ihrer Unterlippe. Das schlechte Gewissen? Wohl kaum, denn sie stichelte weiter: „Sie wiederholt sich dauernd. Ist dir das nicht aufgefallen? Sie fragt uns Sachen, die wir ihr gerade eben erzählt haben.“
„Du übertreibst“, wies ich sie zurecht.
Ich legte keinen Wert darauf, das Thema Alter tiefergehend mit einer Sechzehnjährigen zu diskutieren, knöpfte ihr das Versprechen ab, den Abend daheim zu verbringen und machte mich selbst so schnell wie möglich aus dem Staub. „Frische Luft schnappen“, sagte ich lapidar und ging ohne ein festes Ziel durch die Nacht. Vielleicht, dachte ich, würde ich auf einen Sprung in einer der beiden Kneipen reinschauen, die mir als besuchenswert in Erinnerung geblieben waren.
Dies war der Augenblick, in dem ich Pia das erste Mal über den Weg laufen sollte. Eine kleine, ängstlich wirkende Gestalt, die mit beiden Händen die Kapuze ihrer Jacke zusammenhielt, um den plötzlich einsetzenden lauen Sommerregen abzuwehren. Sie rannte über die Straße, an mir vorbei, schaute kurz auf. Ich sah ihre dunklen Augen aufblitzen. Und ich nahm in der linken Braue eine Narbe wahr. Mehr nicht. Aber es reichte für den Anfang.
Woran erkennt man den Moment, in dem man sein Herz verliert?
Dritter Streich
Wiedensahl, immerhin Geburtsort von Wilhelm Busch, war, ist und bleibt winzig. Es ist – da muss man sich nichts vormachen – eben nur eine Hand voll Häuser mit vielen flachen Feldern drumherum. Es gibt einen kleinen Supermarkt, einen Elektrohandel, den Marktplatz mit angrenzender Schlachterei (der Bäckermeister hatte vor Jahren Konkurs angemeldet) und das Museum, wo auch der Gemeinderat tagt. Dann noch die beiden Schankhäuser, zählt man das an der Grenze zum Nachbardorf mit, sind es drei. Ja, und die evangelische Kirche natürlich. Dies alles ist sorgsam angeordnet entlang der einen langen Straße, die das Dorf zusammenhält wie die Schnur einer Perlenkette. Tante Luises Haus stand am nördlichen Ortsausgang, sozusagen am oberen Schlauchende, fünf Minuten zu Fuß vom Marktplatz entfernt. Kein aufregender Stadtplan also. Aber Wiedensahl hatte ausreichend zu bieten, um meinen Terminkalender auszufüllen. Der erste Tag meines Urlaubs war zumindest schon ausgebucht: Frühstücken mit Tantchen, Gespräch mit dem Arzt über ihren Gesundheitszustand, Pflichtbesuche bei Bekannten, abends eine Einladung zum Schlachtfest. Tradition in der örtlichen Fleischerei.
Bis auf den Arztbesuch, den ich aufschob, weil ich befürchtete, mich am Ende Blümchens Meinung über Tante Luise anschließen zu müssen, erledigte ich alles nach bestem Gewissen. Inklusive Schlachtfest.
Als ich eintraf, war bereits das halbe Dorf versammelt. Ich schob mich durch den verqualmten, engen Verkaufsraum der Metzgerei, drückte mich am leergeräumten Tresen vorbei. Freundliches Lächeln nach links, ein Nicken nach rechts. Die Party stieg im Hinterzimmer. Wandhoch gekachelt in sterilem Weiß, dazwischen klobige, blitzblank geputzte Geräte aus Edelstahl. Ich erkannte einen Fleischwolf, die anderen Apparate konnte ich nicht einordnen. Auch hier dicker Zigarettenqualm; das ganze im kalten Licht von Neonröhren. Der Schlachtermeister trug noch seine Schürze. Sie war blutverschmiert. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, eine frische überzuziehen.
„Mensch, wenn das nicht Philip ist! Philip Lessing. Junge, lass dich drücken!“ Der Schlachter – ich hatte seinen Namen längst vergessen – presste mich an sich.
Er quetschte mir einen Plastikbecher, halb gefüllt mit Bier, in die Hand. In die andere ein Schnapsglas. Ich trank, sah rosige Gesichter um mich versammelt. Der Schnaps stieg mir sofort zu Kopf. Ich ließ meine Blicke über große Schüsseln mit Schweinegrütze, Gurken und Pellkartoffeln kreisen, griff mir ein halbes Brötchen, dick bestrichen mit schlachtfrischem Gehacktem und Zwiebelscheiben.
Ein Uniformierter stieß mich an. Gedrungen die Statur, eine Reihe matter Knöpfe spannte über seinem Bauch. Er hatte zwei Schnäpse bei sich; einen für mich. Er hieß Jäckel, oder war es Jändel? Seit unserem letzten Treffen war er tüchtig aufgestiegen. Irgendetwas Führendes bei der Polizei in Stadthagen, der Kreisstadt.
„Ich wusste ja, dass du deine Wurzeln nicht verleugnen kannst. Jetzt biste wieder hier!“
Es hatte keinen Sinn, ihn darauf hinzuweisen, dass mein Besuch zeitlich begrenzt bleiben würde. Wir stießen an, gossen den Schnaps hinunter. Er bestand darauf, mir „eine Schote“ zu erzählen:
„Haben wir doch letztens diesen neuen stellvertretenden Inspektionsleiter gekriegt. Keine Ahnung von nichts, der Junge!“ Er lachte, wobei er mir die gelben Stümpfe seiner Zähne zeigte. „Und da muss er das erste Mal einspringen, weil der Boss unterwegs ist. Und was macht er? Setzt sich ins Fettnäpfchen. Aber volle Kanne, sag ich dir!“
Im Nu sind zwei neue Biere da. Halb voll, schal im Geschmack. „Es war Heiratsmarkt in Wiedensahl. Das ganze Dorf auf den Beinen. Schon vormittags keiner mehr nüchtern. Aber, Junge, sag selbst: Tradition ist Tradition! Jedenfalls setzt der Idiot ausgerechnet an diesem Tag eine Alkoholkontrolle an. Die Kollegen warnen ihn noch, sagen: ,Nee, lass das mal besser. Nicht heute und vor allem nicht in der Nähe von Wiedensahl!’ Aber der Trottel lässt sich nicht davon abbringen. Weißt du, wen er als Erstes rausgezogen hat? Den Bürgermeister vom Nachbardorf. Und dann Dr. Scheel, den Steuerberater. Und Frau Bödemeyer, die Alte vom Gardinen-Bödemeyer. Ausgerechnet! Alle deutlich über der Promillegrenze. Klaro. Als Letztes …“ Er kicherte wie ein Lausebengel. „Als Letztes hatte er den Boss selbst an der Angel. Sturzbetrunken. Ich sag dir, Junge, der Vize ist im Erdboden versunken vor Scham.“
„Peinliche Sache.“
„Ja. Er hat sich inzwischen freiwillig versetzen lassen.“
„Und die Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer?“
„Keine Anzeigen. Alles annulliert. Natürlich. Prost!“
„Natürlich. Äh … , prost!“
Er wandte sich ab, und ich sehe noch immer seinen hässlichen Stiernacken vor mir. Breit und mit einer Haut wie Leder. Darauf krümmten sich kurze schwarze Haare, die wie kleine böse Pfeilspitzen aus seinem Kreuz ragten.
Ich war in einem Dorf. Hier galten andere Gesetze als in der Großstadt. Je schneller ich mich wieder ins dörfliche Leben einfinden würde, desto leichter könnte ich meine Mission erfüllen und für Luise eine Pflegekraft oder einen schönen und vor allem menschenwürdigen Heimplatz finden. Ich überlegte für Sekunden, ob ich den Polizisten danach fragen sollte. Doch dann spritzte mir ein Schwall warmer, zäher Flüssigkeit ins Gesicht.
Tosendes Gelächter erhob sich. Augenpaare von allen Seiten richteten sich auf mich. Entsetzt blickte ich an mir herunter, besah ungläubig die dunkelbraune Verfärbung auf meinem Hemd.
Ein kleiner Junge, rothaarig und mit Myriaden Sommersprossen in seinem feisten Gesicht, schickte sich an, einen halb gefüllten Sack auf mich zu richten. Die Umstehenden traten belustigt zurück. Ich begriff zu spät. Ein weiterer kräftiger Spritzer traf mich. Der Geruch verriet: Es war Blut! Der Kleine hatte es wohl beim Schlachten in eine Schweinsblase gefüllt, um damit die Gäste zu necken.
Ohne zu überlegen, machte ich einen Satz nach vorn, griff das Bürschchen am Kragen. Mühelos hob ich den Zwerg empor. Seine Füße strampelten hilflos, in seinem Gesicht stand die nackte Angst geschrieben.
„Aber, aber.“ Die schwere Hand des Polizisten ruhte auf meiner Schulter. Wortlos schüttelte er sein Haupt, das mich unweigerlich an einen Ochsenkopf denken ließ. Seine blassblauen Augen drohten mir.
Ich ließ den Jungen langsam zu Boden. Sobald er frei war, streckte er mir die Zunge heraus und flitzte weg. Eine matronenhafte Frau in schmutzigweißer Schürze kam auf mich zu. Mit beiden Händen hielt sie einen großen Korb aus geflochtenem Weidenholz. Er war über und über gefüllt mit Wurstwaren. Ich sah grobe Mettwurst, armdicke Blutwurst, ein reichliches Stück Stippgrütze, ein üppig bemessenes Ende Knackwurst, Brägenwurst und geräucherten Schinken. „Nimm’s unserem kleinen Horst nicht krumm.“ Sie presste mir den Korb in den Arm, umfasste mit ihren speckigen Fingern meinen Kopf, zog ihn an sich heran und setzte mir ihren dicklippigen Mund ans Ohr. „Du warst auch mal ein Strolch mit Faxen im Kopf, Philip“, zischte sie.
Erst jetzt erkannte ich die Frau des Fleischermeisters wieder. Natürlich! Ich war mit Tante Luise oft bei ihren Eltern einkaufen gewesen. Sie selbst war damals natürlich noch sehr jung, half aber schon im Geschäft aus. Sie hatte mir jedes Mal eine Scheibe Wurst über die Ladentheke gereicht. Ich sah mich zu einem dankbaren Lächeln genötigt. „Blut gibt zwar Flecken“, bemühte ich mich um einen Scherz, „aber was sind die schon gegen diesen prächtigen Wurstkorb.“ Die umstehenden klatschten spontan. Ich nahm vage ein „Bravo, Philip!“ wahr. Kaum hatte ich den Korb abgestellt, wurde mir das nächste Schnapsglas gereicht. Das heißt: Es wurde mir nicht gereicht, sondern in die Hand gepresst. Widerstand zwecklos. Diesmal war es der Schlachter selbst.
Auf die folgende Unterhaltung konnte ich mich kaum konzentrieren, denn der beißende Rauch in dem für die vielen Besucher zu engen Raum wurde dichter. Nirgends ein Fenster, das man hätte aufreißen können. Der Fleischermeister, ein fülliger Mann mit einem Allerweltsgesicht, das man kennt, selbst wenn man es niemals vorher gesehen hat, zwang mir ein Gespräch über Söhnchen Horst auf. Zwölf Jahre sei er kürzlich geworden, und alles sprach dafür, dass der schweineblutverspritzende Horst der ganze Stolz des Papas war.
Ich schaltete ab. Längst hatte ich den nächsten Schnaps intus, als ich mehr aus Langeweile denn aus Interesse Gesprächsfetzen von zwei anderen Männern aufschnappte. Zunächst ging es um Belanglosigkeiten. Den seit Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Niedergang des Dorfes, die Wut der Bauern auf die EU, die Flucht der jungen Leute in die Stadt und das ganze übliche Blablabla.
Aber dann meinte ich, einen mir wohl vertrauten Namen gehört zu haben. Unwillkürlich drehte ich mich um.
„He, kein Interesse mehr?“, schalt mich der Fleischer.
„Doch, doch“, log ich. „Ich habe mir eingebildet, den Namen Stollmann aufgefangen zu haben. Stollmann ist …“
„Unser Brandmeister“, kam es matt.
„Ja!“, sagte oder vielmehr lallte ich begeistert. „Es ist zwar ewig her, aber ich erinnere mich gern an ihn. Er hat mich früher in diesem riesigen roten Ungetüm mitgenommen, und ich meine, er hat für mich sogar mal das Blaulicht angedreht.
Wenn ich in Wiedensahl geblieben wäre, würde in meinem Schrank die Uniform der Freiwilligen Feuerwehr hängen.“ Und Stollmann war ein guter Bekannter meiner Tante. Ebenso besessen von der Heimatforschung wie sie.
Eine finstere Wolke schien über das Gesicht des Schlachters zu ziehen. „Stollmann ist … er ist …“
Ich ahnte Schlimmstes, ärgerte mich, das Thema angesprochen zu haben. Stollmann mochte inzwischen Mitte siebzig sein, wenn nicht achtzig. Ich hätte ahnen können, dass er nicht mehr lebte.
„Er ist verschwunden.“ Der Fleischer machte keine glückliche Figur. Die Sache behagte ihm ganz offensichtlich nicht.
„Heißt das …“ Den Rest, dass der alte Mann wahrscheinlich irgendwo im Feld neben einem Waldweg liegen würde, wo er bei einem Spaziergang einen Herzinfarkt erlitten und gestorben war, behielt ich aus Taktgründen lieber für mich.
„Er ist am helllichten Tag einfach verschwunden.“ Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn. Ich wusste nicht, ob es an der saunaartigen Hitze in dem Raum lag oder am Schicksal Stollmanns, das ihm nahe ging.
„Wie kann jemand einfach verschwinden? Hat er sich in Luft aufgelöst?“, bohrte ich.
„Ja. In Luft. Das trifft es. In Luft. So ist es gewesen“, sagte der Meister und ließ mich völlig verdattert stehen.
Die beiden Männer, die sich zuvor über Stollmann unterhalten hatten, waren nicht mehr auszumachen. Ich schaute mich um, rieb mir die Augen. Der Qualm war mittlerweile unerträglich. Und der Lärmpegel hatte sich dermaßen aufgeschaukelt, dass es in meinen Schläfen hämmerte. Energisch bahnte ich mir einen Weg nach vorn in den Verkaufsraum. Hier standen die Frauen. Auch sie mit Bierbechern in der Hand, die wenigsten aber tranken Schnaps. Ich nickte unverbindlich und steuerte geradewegs auf die Ladentür zu.
Die frische Luft schlug mir mit der Wucht eines Hammers entgegen. Plötzlich spürte ich den Alkohol mit aller Macht. Ich taumelte, musste mich auf einen Fahrradständer setzen. Ich ließ mein Gesicht in meinen Händen versinken, um es gleich darauf hochzureißen. Ich starrte in den sternklaren Himmel. Mir war schlecht. Bilder des Abends schossen mir durch den Kopf, und ich dachte an Stollmann. An seine Vorliebe für Wilhelm Busch. Seine unendlichen Vorträge über dessen Werke. Stollmann, der unermüdliche Rezitator!
„Man ist ja von Natur kein Engel,
Vielmehr ein Welt- und Menschenkind,
Und ringsherum ist ein Gedrängel,
Von solchen, die dasselbe sind …“
Ja, dieses Busch-Wort entsprach ganz Stollmanns Naturell. Vor meinem geistigen Auge löste sich der feingliedrige, freundliche Herr, dem jede Feuerwehruniform zu groß gewesen war, in seine Bestandteile auf. Er verrauchte im Nichts.
Ich schüttelte den Kopf und versuchte, wieder zu klarem Verstand zu kommen. Ich schaute auf die gegenüberliegende Straßenseite, konnte in der Dunkelheit aber kaum etwas erkennen. Gerade wollte ich mich aufraffen, um wegen meines Wurstkorbes noch einmal zurück in die verqualmte Fleischerei zu gehen, da bemerkte ich eine Bewegung. An der Tür des dritten Hauses gegenüber stand jemand. Moment, nein: Es waren sogar zwei. Ich kniff die Augen zusammen: ein Pärchen, eng umschlungen. Den Mann erkannte ich nicht. Er hatte mir seinen Rücken zugewandt und stand vornüber gebeugt, wohl, um seine deutlich kleinere Partnerin zu küssen.
Die Frau aber kannte ich sehr wohl. Ich bildete es mir zumindest ein. Es war die schemenhaft gebliebene Figur, die ich am Tag zuvor im Regen gesehen hatte. Mit der Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Ich konzentrierte mich darauf mehr zu sehen. Doch der Alkohol benebelte meine Sinne. Die Frau blieb ein zweites Mal nur ein vages, aus Konturen zusammengesetztes Bild und für mich unfassbar.
Tage später, als ich Pia von dem Abend erzählte, lachte sie laut auf und amüsierte sich über den „Spanner Philip“. Als ich nachhakte, ob sie es denn wirklich gewesen sei, die ich da in flagranti ertappt hatte, fiel das Lachen in sich zusammen, und sie sah aus wie ein zerbrechlicher Vogel, den ich in die Enge getrieben hatte.
Vierter Streich
Der Tag unseres Kennenlernens begann mit einem Schock. Ich hatte nicht besonders gut geschlafen. Ich war im Gästeraum, meinem alten Zimmer im oberen Stockwerk unter der Dachschräge untergebracht. Der Raum war klein, niedrig und stickig. Die Hitze plagte mich, sodass ich bald Kissen und Decke weggetreten hatte und bloß mit der muffigen Tagesdecke vorlieb nahm. Der Bettkasten knarrte bei jeder meiner Bewegungen. Ich stand immer wieder auf, strich ziellos durch das winzige Zimmer, stieß mich an dem runden, altmodischen Frisierstuhl, der seit Urzeiten vor der betagten Kommode stand, auf der ich allzu oft meine Hausaufgaben erledigt hatte. Eine miserable erste Nacht, die durch meine Schlaflosigkeit in die Unendlichkeit gestreckt wurde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!