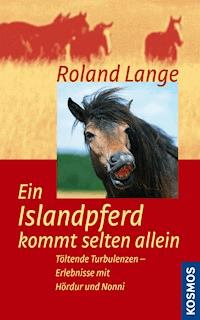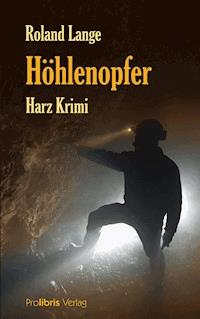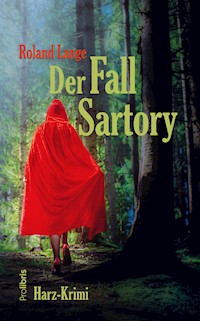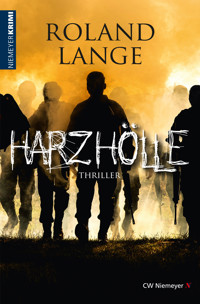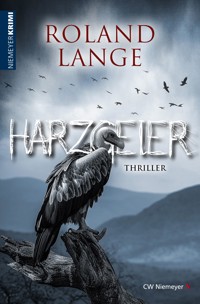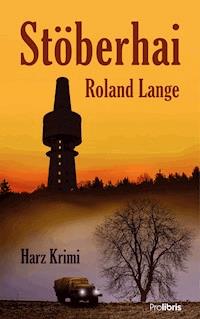Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Behrends' zweiter Fall: Der Osteroder Hauptkommissar Ingo Behrends wird zu einem blutigen Tatort im Harz gerufen. Zwei Landvermesser wurden aus nächster Nähe erschossen. Kein schöner Anblick in der Vorweihnachtszeit. Schnell stellt sich heraus, dass einer der beiden Ermordeten äußerst unbeliebt bei seinen Kollegen war. Außerdem finanzierte er seinen gehobenen Lebensstil durch dubiose Geschäfte. Und mit zwielichtigen Geschäftspartnern? Besonders ein Unbekannter mit dem Decknamen Puschkin rückt ins Zentrum der Recherchen, die Behrends mit seinem Ermittlungsteam in die Vergangenheit zurückführen. In die Zeit, als die Grenze zur DDR noch existierte und von Trupps aus Ost und West gemeinsam vermessen wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roland Lange
Todesstreifen
Harz Krimi
Prolibris Verlag
Handlung und Figuren sind frei erfunden. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
Break down the wall
and take the past away from us ...
(My Inner Burning, »When I'm gone«
aus dem Album »Eleven Scars«, März 2011)
Prolog
Der Treck kam nur langsam voran. Bei jedem Schritt knirschte der Schnee unter den Füßen der gebeugten Gestalten, die sich in einer düsteren Karawane vor dem bleichen, konturlosen Hintergrund dahinschleppten. Scharfer Wind blies ihnen entgegen, schleuderte feine Eiskristalle in ihre ausgemergelten Gesichter. Wie kleine Geschosse trafen sie ihre Haut, fanden jede Lücke in Jacken, Mützen, Lumpen und Tüchern, mit denen die Menschen sich zu schützen suchten. Seit etlichen Tagen hatte bittere Kälte das Land fest im Griff und fraß sich durch ihre Kleider. Die Strapazen des Marsches hatten sie müde gemacht, vielleicht auch die Hoffnungslosigkeit. Hinter ihnen lagen Schutt und Asche. Aber was lag vor ihnen? Was für eine Zukunft erwartete sie? Sie wussten es nicht. Keiner im Treck wusste es!
Mit nichts, außer dem wenigen, das sie bei sich tragen konnten und was auf den kleinen Handwagen passte, waren sie aus ihrem Dorf geflohen. Angetrieben vom dumpfen Kanonendonner der näher rückenden Front hatten sie das Nötigste zusammengerafft und waren damit zum Sammelplatz geeilt. Gemeinsam mit den anderen hatten sie den Marsch angetreten.
Es war ein Abschied für immer. Niemand hatte es laut gesagt, einige zu Anfang sogar trotzig von Rückkehr gesprochen. Doch insgeheim wussten sie alle, dass ihre Heimat verloren war, geraubt von einem erbarmungslosen Krieg, der ihnen schon die Männer, Söhne und Väter genommen hatte.
Im Treck liefen zwei Jungen mit, denen immer wieder verstohlene Blicke folgten. Das lag nicht allein an ihrer Größe und daran, dass sie mit ihren langen, dürren Beinen wie Störche durch die Gegend staksten. Noch mehr Aufmerksamkeit erregten ihre hellblonden Locken, die beinahe weiß schimmerten, wenn die Sonnenstrahlen für einen kurzen Moment durch die Wolkendecke brachen. Kein Augenpaar konnte sich diesem Anblick entziehen.
Die beiden Jungen hatten den Aufbruch mit zwiespältigen Gefühlen erlebt. Mit ihren neun Jahren waren sie alt genug, zu verstehen, was vor sich ging. Es machte ihnen Angst! Gleichzeitig spürten sie das Kribbeln in sich, das Jungen überfällt, auf die das große Abenteuer wartet, das Unbekannte, die Gefahr! Trotzdem wären sie nicht freiwillig gegangen, hätten ihr Zuhause verteidigt, zusammen mit ihrem Vater. Wäre er nur rechtzeitig zurückgekommen! Dieser große, kräftige Mann, der nicht viele Worte machte, sondern lieber Hände und Fäuste sprechen ließ. Vor dessen Strenge und Jähzorn sie sich gefürchtet hatten, solange sie denken konnten. Wie froh waren sie gewesen, als er in den Krieg ziehen musste und sie nicht mehr unter seiner Knute litten! Wie hatten sie immer das Ende seines Fronturlaubs herbeigesehnt! Doch dann, am Tag ihres Aufbruchs hatten sie sich gewünscht, er wäre bei ihnen gewesen. Mit ihm an der Seite wären sie nicht gewichen. Sie hätten sich todesmutig den verhassten Bolschewiken entgegengestellt, diesen menschlichen Ungeheuern, die nichts anderes als den Tod brachten! Niemals hätten sie ihr Heim kampflos aufgegeben, das kleine Haus mit dem üppigen Gemüsegarten und dem mächtigen Apfelbaum davor, in dessen Schatten sie noch im Sommer von Abenteuern und Heldentaten geträumt hatten.
Gemeinsam mit ihrer Mutter zogen die beiden Jungen den Handwagen. Längst war ihre Abenteuerlust dem quälenden Hunger und dem Schmerz in den Füßen gewichen. Stumpf blickten sie, wie alle anderen, vor sich auf den Weg, setzten mechanisch Schritt vor Schritt, klammerten ihre Hände um den Deichselgriff des Wagens, dessen Last ihnen von Tag zu Tag schwerer schien. Bleierne Müdigkeit hatte von ihnen Besitz ergriffen, im Gehen träumten sie von ihren weichen Betten zu Hause. Als ihre munteren Plappereien längst verstummt waren, hatte das Wehklagen eingesetzt. Mittlerweile schlichen sie in resigniertem Schweigen vorwärts. Der Trost ihrer Mutter war seit Langem zu schwach, um ihnen Mut zu machen.
Ein kleines Glück gab es dennoch für die beiden Jungen. Es hieß Marianne. Ein Mädchen in ihrem Alter, das ihnen sehr gefiel. Mit seinem kranken Vater und seiner Mutter ging es fast immer am Ende des Trecks. Die Zwei wären am liebsten ständig in Mariannes Nähe gewesen. Aber sie mussten den schweren Handwagen zusammen mit ihrer Mutter ziehen. Wenigstens einer von ihnen. So hatten sie beschlossen, abwechselnd nach hinten zu laufen und Marianne zu begleiten. Auch wenn es ihrer Mutter nicht lieb war. Auch wenn die anderen Jungen im Treck sie für Weiberfreunde hielten. Einer hatte es gleich zu Anfang ihrer Flucht gewagt, sich über sie lustig zu machen. Er hatte die Fäuste der beiden Brüder zu spüren bekommen. Seitdem sagte niemand mehr ein Wort.
Vor einigen Minuten war Fredi nach hinten gelaufen und ging nun neben Marianne. Sein Bruder stapfte allein neben seiner verstummten Mutter und mit unterdrücktem Zorn an der Deichsel des Handwagens dahin. In seinem Ärger nahm er das dumpfe Grollen zuerst gar nicht wahr. Doch bereits im nächsten Moment war die Hölle los!
»Tiefflieger!«
Der Schrei ging unter im Dröhnen der Propeller und dem Tackern der Bordkanonen. Die Menschen sprangen in Panik auseinander, ließen ihre Habseligkeiten stehen und liegen, warfen sich blindlings zu Boden oder versuchten, die wenigen Sträucher und vereinzelt stehenden Bäume zu erreichen oder in Gräben und hinter Schneewehen Deckung zu finden. Erbarmungslos zogen die MG-Garben eine tödliche Spur durch den Schnee, mähten alles nieder, was ihnen im Weg war; Alte und Junge, Männer, Frauen und Kinder. Ohne Rücksicht, ohne Unterschied. Immer und immer wieder drehten die beiden Tiefflieger ab, formierten sich zu einem weiteren Angriff. Dann zwei ohrenbetäubende Detonationen. Feuerfontänen schossen in die Höhe, wurden von gewaltigen schwarzen Rauchpilzen verschluckt. Schneewolken stoben auf, Metallsplitter und Holztrümmer flogen durch die Luft. Eisige Erdklumpen prasselten auf den Jungen nieder, der im Arm seiner Mutter auf dem Bauch in einer Mulde lag, das Gesicht in den Schnee gedrückt.
Dann, von einem Moment zum anderen, war alles vorbei. Die Tiefflieger hatten ihr tödliches Werk vollendet. Ihr Brummen verlor sich in der Ferne. Grabesstille. Es dauerte einige endlose Minuten, ehe sich die Ersten aus der Deckung wagten.
»Sammeln!«, rief jemand. Es wirkte wie ein Signal. Plötzlich überall Wehklagen und Geschrei. Die Überlebenden rannten orientierungslos durcheinander, warfen sich über Tote, wühlten in den Trümmern, sackten wimmernd zusammen. Verletzte stöhnten, wurden von beherzten Frauen und Männern notdürftig versorgt.
»Fredi!«, schrie die Mutter und der Junge an ihrer Seite fiel in ihr Schreien ein, rief ebenfalls nach ihm, seinem Bruder. Laut und panisch. Aber Fredi war nirgends zu sehen! Wo war er? Was war mit ihm geschehen? Der Junge riss sich von der Hand seiner Mutter los. Rannte weg von ihr, zurück an das Ende des Trecks, brüllte in schriller Verzweiflung: »Fred! ...Fredi!«
Vor einem leblosen Körper kam er zum Stehen. Dicht neben einem der Krater, den die Bomben gerissen hatten. Zu seinen Füßen ein bleiches Gesicht mit aufgerissenen Augen. Tiefblauen Augen. Die Stirn und die Wangen umrahmt von langen, schwarzen Haaren. Mariannes Gesicht. Wie Schneewittchen lag sie da. So schön!
Der Junge starrte auf das Mädchen zu seinen Füßen. Stumm. Unfähig, sich zu rühren. Eine eigenartige Faszination ging von dem leblosen Wesen aus, mit seinen Armen und Beinen, so unnatürlich abgewinkelt und verdreht. Der Körper lag in einem Bett aus blutrotem Schnee —ein Ort der Geborgenheit in einer Wüste voller Trümmer, Leichenteile, umherirrender Menschen.
Es dauerte eine kleine Ewigkeit, ehe er begriff. Etwas in ihm explodierte, schien ihn zu zerreißen. Das Bild vor seinen Augen brannte plötzlich wie Feuer. Fraß sich in seine Seele. Und fast gleichzeitig war die Angst um seinen Bruder wieder da. Schlimmer als zuvor. Wie kalter Stahl fuhr sie ihm in die Glieder, tiefer und schmerzhafter, als es je ein Tiefflieger-Angriff vermocht hätte. Er wollte laufen. Wegrennen. Es ging nicht. Er stand da, unfähig, sich zu rühren. Und er schrie, schrie, schrie ...
Eine Hand riss ihn an der Schulter herum.
»Komm’, Junge, du kannst ihr nicht mehr helfen.«
Es war eine Männerstimme, eine Männerhand. Er erwachte aus seiner Besinnungslosigkeit:
»Fredi ...! Fredi, wo bist du?« Sein Schreien war zu einem Wimmern verkommen.
Der Mann schob ihn seiner Mutter in die Arme, er schüttelte leicht den Kopf, als er sie ansah.
»Fredi! Mama, wir müssen Fredi finden!«
Sie blickte mit leeren Augen an ihm vorbei, machte keine Anstalten, nach seinem Bruder zu suchen.
»Los, los, weiter, wir müssen weiter!«, drängte der Mann.
»Mama! Wo ist Fredi? Ich gehe nicht ohne ihn! Ich muss ihn finden! Er braucht mich doch!« Tränen rannen ihm übers Gesicht. Endlich!
Sie schüttelte den Kopf, schien in Gedanken ganz weit weg: »Es hat keinen Zweck. Er ist tot«, sagte sie mit hohler, tonloser Stimme.
Der Mann ließ nicht locker. Schubste sie vorwärts: »Ihr könnt hier nicht stehen bleiben!«
Er hörte seine Mutter laut aufschluchzen: »Komm jetzt, Heini!«
»Fredi!«, schrie er, den Blick zurückgewandt, während sie ihn hinter sich herzog. Er sträubte sich, wollte sich aus ihrem Griff winden. Er durfte seinen Bruder nicht zurücklassen! Allein, hilflos ... verloren. Sie hielt ihn fest.
»Fredi ...! Fredi, wo bist du?«
Der eisige Wind riss seine Worte mit sich, zerfetzte sie, zerstreute die Silben ungehört über Leichen und Trümmern.
1.
Regungslos verharrte der Mann in der Deckung, die ihm das Unterholz bot. Mit dem Zielfernrohr des Präzisionsgewehres hatte er sein Opfer erfasst, hatte es durch die Scheibe des VW-Busses und den dicht fallenden Schnee ganz nah zu sich herangeholt. Klar und deutlich hob sich das blasse Gesicht seines Opfers von dem verschwommenen Umfeld ab. Im Fadenkreuz des Fernrohres schien ihm der Kopf mit dem schütteren grauen Haar zum Greifen nah. Dem zweiten Mann, vorn auf dem Fahrersitz, schenkte er keine Beachtung, überließ ihn seinem Mittagsschlaf.
Vor etwa einer halben Stunde hatte er sich auf den Weg gemacht, war im Schneetreiben, das am späten Vormittag eingesetzt hatte, hier heraufgekommen. Einige Minuten schon kauerte er da, leicht angelehnt an den Stamm eines Baumes im Heer der Fichten um ihn herum, einer wie der andere; hoch, schlank gewachsen, uniform –gutes Nutzholz eben. Bisher war alles nur ein Planspiel gewesen. Nicht mehr als ein surrealer Film in seiner Vorstellung, der an ständig wechselnden Orten, mit immer neuen Handlungsabläufen spielte, aber mit stets dem gleichen Ende. Irgendwann einmal, so hatte er gedacht, würde er aus dem Spiel Ernst werden lassen.
Aber gegen Mittag hatte sich alles überstürzt. Plötzlich waren sie aufgetaucht. Völlig unerwartet. Purer Zufall! Ihm war nur eine kurze Zeitspanne geblieben, um seine Entscheidung zu treffen. In diesen wenigen Minuten hatte sich etwas in ihm verändert. Wieder war der Film in seinen Gedanken abgespult, doch er hatte nicht mehr in der Position des Betrachters verharrt. Er war in das Geschehen hineingetreten, war plötzlich selbst zur Hauptfigur geworden. Fiktion war in Realität umgeschlagen.
Er hatte noch kurz mit sich gerungen, ob es nicht besser sei, sich an seinen Plan zu halten, in dem er die Reihenfolge seiner Opfer festgelegt hatte. Er war kein Freund spontaner Entschlüsse, bevorzugte akribische Vorbereitung. Andererseits erleichterte ihm die unverhoffte Chance vieles, und wirkliche Probleme dürften sich durch die zwangsläufige kleine Änderung in der Reihenfolge nicht ergeben. Er würde das mit seinem Kontaktmann besprechen, sobald er es hinter sich gebracht hatte. Nein, es gab kein Zurück. Er musste es tun. Jetzt!
Danach war alles wie von selbst gelaufen. Er kannte die Gewohnheiten der beiden Männer nur zu gut. Er hatte sofort gewusst, was zu tun war, um den Vermessungsingenieur zu töten.
Er musterte sein Opfer, spürte die Erregung. Nur mit Mühe konnte er sich zusammenreißen. Bloß keinen Fehler machen! Tief durchatmen, den Abzug langsam bis zum Druckpunkt zurückziehen. Die Handschuhe störten ihn nicht. Ihr Leder schmiegte sich an seine Hände, war dünn und weich, gleichzeitig warm genug, damit er keine klammen Finger bekam. Jetzt die Luft anhalten ... Wie oft hatte er es in der Vergangenheit schon so gemacht, fast nie danebengeschossen. Mechanische Abläufe, kalt, emotionslos. Allerdings waren seine Ziele bisher nur namenlose Objekte und Gestalten gewesen, die ihm nicht mehr entlockt hatten als gespannte Erwartung.
Plötzlich rührte sich etwas drüben im Dienstbus. Er ahnte es mehr, als dass er es sah, und schwenkte das Gewehr ein Stück von seinem Opfer weg nach rechts. Der Fahrersitz war leer, die Tür geöffnet. Irritiert ließ er das Zielfernrohr noch ein paar Zentimeter weitergleiten, suchte den Wald unmittelbar vor der Motorhaube ab. Nichts. Er schwenkte das Gewehr wieder zurück, tastete sich über die Seitenfront des Busses. Bekam den Kollegen des Ingenieurs ins Visier, als der gerade die Heckklappe öffnete. Gott sei Dank! Alles wieder unter Kontrolle. Aber verdammt noch mal, was hatte der Mann vor? Was kramte er da zwischen den Aufbauten im Laderaum herum? Wenn er sich mit seinem massigen Oberkörper doch nur ein wenig zur Seite drehen würde! Er beugte sich leicht ins Wageninnere, zog etwas heraus. Dann schloss er die Klappe wieder und ging einige Schritte den Weg entlang, weg vom Bus. Jetzt war auch zu erkennen, was er bei sich trug. Kurz darauf schlug er sich seitwärts in die Büsche.
Der Schütze im Unterholz atmete erleichtert aus, grinste in sich hinein. Er hatte gesehen, was er sehen wollte. Der Vermessungsgehilfe würde wohl eine Weile beschäftigt sein. Er lenkte das Gewehr zurück auf sein Opfer, bemerkte, dass der Ingenieur noch immer dösend im Fond des Busses lag, den Kopf gegen die Seitenscheibe gelehnt. Er konzentrierte sich jetzt ganz auf sein Ziel. Sein behandschuhter Finger krümmte sich wieder um den Abzug ...
2.
Die Zeiger der Uhr an der Wand gegenüber näherten sich der herbeigesehnten Konstellation. Nur noch wenige Minuten bis halb vier. Mit einem Seufzer schlug Ingo Behrends den Schnellhefter zu und legte ihn zurück auf den Aktenberg am äußeren Ende seines Schreibtisches. Zufrieden registrierte er, dass der Stapel in den vergangenen beiden Wochen beträchtlich geschrumpft war und etwas von seinem Schrecken verloren hatte.
»Das war’s«, brummte Behrends, »Feierabend.«
Er blickte aus dem Fenster seines Büros in der Northeimer Polizeiinspektion. Es hatte aufgehört zu schneien, aber wahrscheinlich nur für kurze Zeit. Noch immer zeigte sich der Himmel in bleiernem Grau und ließ befürchten, dass es schon in gut einer Stunde vollständig dunkel sein würde.
Der frühe Wintereinbruch in diesem Jahr hatte etwas Lähmendes an sich, fand Behrends. Alles lief irgendwie träger, stiller ab. Eine gewisse Beschaulichkeit hatte sich sogar in der Inspektion breitgemacht. Die Polizeiarbeit konzentrierte sich in diesen Wochen hauptsächlich auf den Straßenverkehr. Im K1, dem Fachkommissariat für Kapitaldelikte, herrschte dagegen seit geraumer Zeit beinahe gespenstische Ruhe — eine Ruhe, die Behrends dazu nutzte, liegen gebliebene Schreibarbeiten zu erledigen und Überstunden abzubauen. Seine Klientel hatte sich, so schien es, bereits Wochen vor dem Fest von der weihnachtlichen Botschaft inspirieren lassen und praktizierte Frieden und Liebe, anstelle von Brand, Mord und Totschlag. Ein beinahe paradiesischer Zustand, wäre da nicht die Kehrseite, die Schreibtischarbeit! Dafür war er einfach nicht geschaffen. In einem Büro eingesperrt zu sein, schnürte ihm zuweilen die Luft ab, grenzte fast schon an Folter.
Während Behrends den Computer herunterfuhr und seine Schreibutensilien in der Schublade verstaute, dachte er an Katrin und das Labskaus, das ihn zu Hause erwartete. Mit einem leisen Schmatzen versuchte er, dem plötzlichen Speichelfluss Einhalt zu gebieten. Wieder wanderten seine Gedanken zurück zu der Woche auf Sylt, die er sich zusammen mit seiner Freundin über Pfingsten gegönnt hatte. Es war ihr erster gemeinsamer Urlaub gewesen und gleichzeitig ein Härtetest für ihre Beziehung. So lange hatten sie bisher noch nie an einem Stück zusammen verbracht. Sie wussten nicht, ob sie es miteinander aushalten würden. Doch es war gut gegangen.
Am letzten Abend ihres Syltaufenthaltes hatte er Labskaus gegessen. Bis heute fragte er sich, welcher Teufel ihn damals geritten hatte, ausgerechnet Labskaus zu bestellen, ein Gericht, das ihm angesichts seiner Konsistenz bis zu jenem Tag immer sehr verdächtig vorgekommen war. Aber es hatte ihm geschmeckt. Sehr gut sogar. So gut, dass Katrin ihm versprechen musste, sich vom Koch das Rezept zu besorgen, um es zu Hause nachzukochen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!