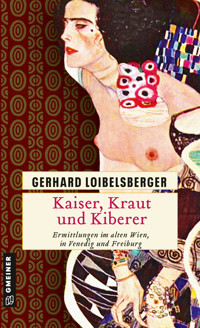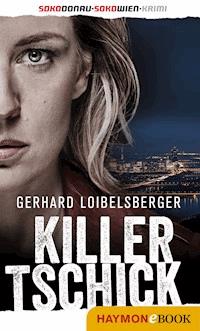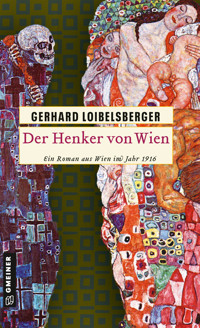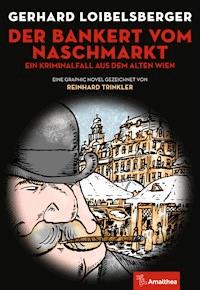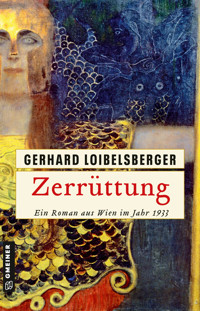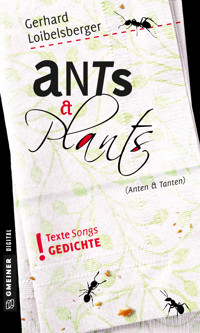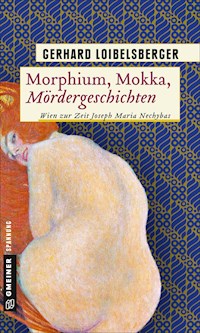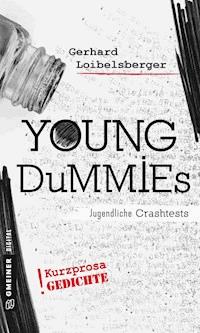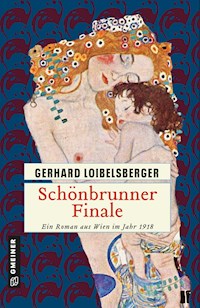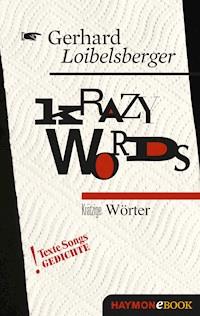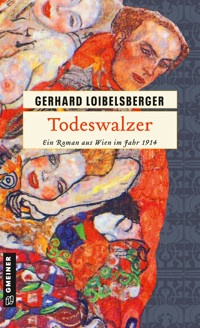
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Inspector Nechyba
- Sprache: Deutsch
Wien 1914. Zeitgleich mit Erzherzog Franz Ferdinand wird ein junger Mann ermordet. Inspector Nechyba kehrt aus seiner Kur zurück nach Wien, um die Ermittlungen zu übernehmen. In einer Atmosphäre des patriotischen Wahns und der Kriegshetze sucht er einen Serienmörder, der im Huren- und Zuhältermilieu sein Unwesen treibt. Während die Schlachten des Ersten Weltkriegs beginnen, kommt Joseph Maria Nechyba einer traumatisch gestörten Persönlichkeit auf die Spur, die ihre Opfer gnadenlos abschlachtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Gerhard Loibelsberger
Todeswalzer
Ein Roman aus dem alten Wien
Zum Buch
Wahn und Weltkrieg Im Juni 1914 wird Erzherzog Franz Ferdinand zeitgleich mit einem jungen Mann ermordet. Inspector Joseph Maria Nechyba bricht seine Kur ab und kehrt zurück nach Wien, um die Ermittlungen zu übernehmen. In einer Atmosphäre des patriotischen Wahns und der Kriegshetze sucht er einen Serienmörder, der im Huren- und Zuhältermilieu der Leopoldstadt sein Unwesen treibt. Ein Wiener Unterweltkönig wird zu Nechybas Gegenspieler, der seine Ermittlungen immer wieder stört und erschwert. Am 28. Juli erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg, worauf die politische Ordnung in Europa aus den Fugen gerät. Millionen Soldaten ziehen jubelnd in den Krieg und die Menschen frönen wie besinnungslos dem Tanz auf dem Vulkan. Und während die Schlachten des Ersten Weltkriegs beginnen, kommt Joseph Maria Nechyba einer traumatisch gestörten Persönlichkeit auf die Spur, die ihre Opfer gnadenlos abschlachtet.
2009 startete Gerhard Loibelsberger mit den »Naschmarkt-Morden« eine Serie historischer Kriminalromane rund um Joseph Maria Nechyba. 2016 goldener HOMER Literaturpreis für: »Der Henker von Wien«. 2011 und 2017 erschienen die Italien-Thriller »Quadriga« und »Im Namen des Paten«. 2018: »Schönbrunner Finale«, der letzte Roman der sechsteiligen Nechyba-Serie. 2019: »Morphium, Mokka, Mördergeschichten«. 2020: der historische Roman »Alles Geld der Welt«. 2021: der dystopische Thriller »Micky Cola« und »Alt Wiener Küche«.
Mehr Informationen zum Autor: www.loibelsberger.at
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag finden Sie bei uns im Internet: www.gmeiner-verlag.de
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes » Die Braut« von Gustav Klimt 1917 – 1918; http://www.zeno.org/nid/20004108655
ISBN 978-3-8392-4246-9
Widmung und Dank
Für meine Frau Lisa.
*
Ein Dankeschön an meine Lektorin Claudia Senghaas für ihre Geduld und ihr Verständnis sowie an Kurt Lhotzky für sachdienliche Hinweise.
Verzeichnis der historischen Personen
Friedrich Austerlitz (1862 – 1931): Chefredakteur der sozialdemokratischen Arbeiter-Zeitung, ab 1920 Abgeordneter zum Nationalrat.
Franz Ferdinand (1863 – 1914): Erzherzog und österreichisch-ungarischer Thronfolger.
Franz Josef I. (1830 – 1916): Kaiser von Österreich, König von Ungarn.
Ferdinand Gorup von Besanez (1855 – 1928): Zentralinspector der Wiener Sicherheitswache, ab Juli 1908 stellvertretender Polizeipräsident. Ab 1914 Polizeipräsident.
Dr. Albin Haberda (1868 – 1933): Gerichtsmediziner
Fanny Hofer (1861 – 1941): Wirtin in Bad Gleichenberg.
Wilhelm Karczag (1857 – 1923): Theaterdirektor, Bühnenautor.
Adolf Kratochwilla (1860 – 1938): Besitzer des Café Sperl.
Franz Lehár (1870 – 1948): Komponist.
Alfred Fürst Montenuovo (1854 – 1926): Obersthofmeister.
Erich Müller (1879 – ?): Theaterdirektor
Sophie Herzogin von Hohenberg (1868 – 1914): Frau von Franz Ferdinand
Johann Schwarzer (1880 – 1914): Fotograf, Kameramann und Filmproduzent. Gründete Österreichs erste Filmproduktion, die Saturn-Film.
Olga Schwarzer: dessen Ehefrau
Teil 1
Die Russen und die Serben,
Die hau’n wir jetzt in Scherben.
Und einen festen Rippenstoß
Kriegt England und der Herr Franzos.
Wir werden’s euch schon geben,
jetzt sollt ihr was erleben,
das große Maul habt ihr allein –
wir, aber wir, wir pfeffern drein.
Wir reden nix, wir deuten nix,
wir halten unsern Mund,
wir sind nur für die großen Wix,
Das ist für euch gesund.
Und wenn wir euch genug gebläut,
Dann sagen wir, auf Ehr’,
Es hat uns alle sehr gefreut,
Das nächste Mal noch mehr.
Felix Dörmann1, 1914
1 Österreichischer Lyriker, Schriftsteller und Librettist (1870 – 1928)
Prolog
Es war eine schwüle Sommernacht. Das Bettzeug klebte an seinem schweißnassen Körper und er wälzte sich unruhig hin und her. An Einschlafen war nicht zu denken. Schuld hatte aber nicht nur die Hitze. Es waren die Sorgen, nagende Sorgen, die ihn nicht einschlafen ließen. Wie sollte all das weitergehen? Wie konnte er seiner Schulden Herr werden? Nun, da er sich sowohl mit Elisabeth als auch mit Anni zerstritten hatte, war er mehr oder weniger ohne Einkommen. Und das alles nur wegen der Vroni! Warum hatte er sich mit dem Mensch überhaupt eingelassen? Wieder wälzte er sich hin und her, und dabei fiel ihm der zarte, glatte, unverbrauchte Mädchenkörper der Vroni ein. Das hatte ihm noch gefehlt! Jetzt war er auch noch erregt. Diese Nacht war für den Hintern. Oder sollte er dafür das Wort Popo verwenden? Er erinnerte sich an seine gutbürgerliche Kinderstube, von der er nun weit, sehr weit entfernt war. Une nuit de la merde. Ja, das war eher seine Diktion. Mein Gott! Im Gymnasium war er immer einer der Besten in Französisch gewesen. Der Liebling des homophilen Französischprofessors, mit dessen Avancen er immer gespielt, denen er aber nie nachgegeben hatte. Und dann kamen ihm die ganzen Künstlerinnen des Theaters an der Wien in Erinnerung. Sie alle hatte er dank der Beinstein, die damals noch unter ihrem Künstlernamen Henriette Hugó aufgetreten war, kennen gelernt. Dass er den um einiges älteren Damen gefiel, war kein Wunder: Als hübschen Knaben mit angenehmem Auftreten und guten Manieren hatten ihn sofort alle ins Herz geschlossen. Tja, so waren die Künstlergarderoben des Theaters an der Wien ein sicherer Hafen für ihn geworden, den er jederzeit ansteuern konnte, wenn sein cholerischer Vater ihn wieder einmal zusammengeschrien oder verprügelt hatte. Der feine Herr Hofrat! Ha! Vor Wut und weil er sowieso nicht einschlafen konnte, stand er auf und ging zu dem Waschtisch, der am anderen Ende der tristen Dachkammer stand. Aus dem Krug schenkte er sich ein Glas Wasser ein, das abgestanden schmeckte und obendrein lauwarm war. Pfui Teufel! Ganz kurz überlegte er sich, in die Hose zu schlüpfen, aus seiner Dachkammer ins 3. Obergeschoss des Hauses hinunterzusteigen und dort bei der Bassena frisches Wasser zu holen. Doch dazu war er zu bequem. Er lächelte süffisant und dachte: Mein ganzes Leben war ich wahrscheinlich immer ein bisserl zu bequem für alles … Dann trank er das lauwarme G’schlodder in gierigen Schlucken hinunter. Er stellte das Glas auf den Rand des Waschtischs zurück und trat an das große Atelierfenster, aus dem er auf die umliegenden Dächer sah. Nirgendwo war mehr Licht. Sein Blick schweifte über all die Fenster und Dachluken und er beneidete die Menschen, die dahinter friedlich schliefen. Seine Sorgen … seine verdammten Sorgen! Wenn er morgen nicht das Geld, das er dem Wucherer schuldete, zurückzahlen würde, war alles aus. Seine Träume, seine Projekte, alles. Nein, das durfte er nicht zulassen. Und als er so grübelnd dastand, erkannte er, dass es nur einen einzigen Ausweg aus seiner Situation gab. Und der hieß Beinstein. Um seine Schulden bezahlen zu können, würde er morgen bei ihr zu Kreuze kriechen. Gut, dass sie den Beinstein seinerzeit doch noch geheiratet hatte. Von ihm hatte sie nicht nur mehrere Zinshäuser, sondern auch ein stattliches Vermögen geerbt, als dieser kurz nach der Hochzeit die Patschen gestreckt hatte2. Die Beinstein war seine Rettung. Jawohl! Erleichtert ging er zum Bett zurück und ließ sich fallen. Zufrieden drehte er sich auf den Bauch und schlief kurze Zeit später tief und fest ein.
Wie ein Blitz fuhr ein stechender Schmerz von seiner linken Schulter in seine Brust. Dann noch einer und noch einer und … Herrgott! Luft! Er rang um Luft. Aufrichten. Mit aller Kraft aufrichten. Doch immer wieder und immer wieder bohrte sich der brennende Schmerz in seinen Rücken. Fuhr in seinen Oberkörper. Sein Gesicht fiel auf das Kissen. Eine Hand drückte seinen Schädel in die weiche Federmasse. Seine Gliedmaßen zuckten. Ein leises Röcheln. Dann war es still.
2 verstorben war
I.
Auf Joseph Maria Nechybas leichenblassem Antlitz war der Schnurrbart sorgsam aufgezwirbelt. Die Augen waren geschlossen, das dichte Haupthaar war mit weißem Stoff abgedeckt, genauso wie sein gesamter Körper. So aufgebahrt glich der Inspector auf frappierende Weise dem nun ebenfalls aufgebahrten, vor zwei Tagen in Sarajevo ermordeten Thronfolger Franz Ferdinand3. Mit dem feinen Unterschied, dass Nechybas Körper kein Einschussloch in Herzhöhe zierte. Wer genau hinsah, bemerkte, dass Nechybas Körper doch noch Lebenszeichen von sich gab: ein langsames, gleichmäßiges Schnaufen, das hin und wieder in ein röchelndes Schnarchen überging. Nechyba war eingeschlafen. Er schlummerte friedlich wie ein Kind und träumte von seiner Gattin Aurelia, die sich über ihn beugte und liebevoll über seinen Schlaf wachte. Später streckte sie dann die Hand aus und tätschelte ihm zärtlich das Gesicht. Nechyba brummte glücklich und wollte weiterschlummern. Doch die Hand gab keine Ruhe und plötzlich hörte er Aurelia sagen: »Herr Nechyba, aufwachen! Sie müssen jetzt aufstehen, Herr Nechyba.«
Verdrossen murmelte er: »Warum sagst denn Herr Nechyba zu mir? Und aufstehen will ich jetzt nicht.«
»Sind S’ doch nicht so kindisch, Herr Nechyba. Sie müssen jetzt aufstehen.«
»Müssen tu ich nur sterben. Und sonst gar nix«, brummte der Inspector trotzig. Doch die weibliche Stimme, die nun so gar nichts mehr von Aurelias Altstimme mit dem leichten oberösterreichischen Akzent hatte, insistierte: »Jetzt muss ich gleich bös’ werden, Herr Nechyba.«
Nein, so sprach seine Aurelia nicht mit ihm. Außerdem sagte sie immer Nechyba zu ihm und nicht dieses komische Herr Nechyba. Niemand sagte das. Im Dienst war er der Inspector Nechyba und daheim der Nechyba. So einfach war das. Also schlug er die Augen auf und sah in das kindliche Antlitz einer jungen Schwester, die ihn entrüstet mit ihren smaragdgrünen Augen anfunkelte. Jessasna! Die schaut ja aus wie ein Katzenvieh!, dachte er sich. Und genau so fauchte sie: »Jetzt stehn S’ endlich auf! Andere wollen ja auch noch behandelt werden!«
»Na, na, na … Musst dich ja nicht gleich aufregen, Kinderl. In meinem Alter geht das net so schnell. Weißt, ich hab’ tief und fest geschlafen und von meiner Frau geträumt.«
Ächzend schüttelte der Inspector seinen Oberkörper. Die Schwester entfernte das weiße Tuch von seinem Haupt und nahm die leichentuchartige Abdeckung von seinem Körper. Mit einem Seufzer der Enttäuschung stemmte Joseph Maria Nechyba seinen Körper aus dem Liegesessel hoch. Statt seiner geliebten Aurelia hatte ihn dieser kratzbürstige Trampel aufgeweckt. Noch immer benommen trat er aus der Solo-Inhalationskabine der Kuranstalt. An der Garderobe schlüpfte er in sein sommerlich leichtes Sakko, setzte seinen feschen Strohhut auf und vergewisserte sich, wann er die nächste Quellsol-Inhalationstherapie hatte. Dann spazierte er hinaus in den Park des steirischen Kurortes Gleichenberg. Oh, wie er seine Aurelia vermisste! Mindestens genauso wie seine Virginier Zigarren. Letztere hatte ihm der Kur-Arzt verboten. Diese Ärzte! Sie waren Schuld, dass er im Moment sein Leben ohne sein geliebtes Eheweib fristen musste. Vor sich hinbrütend und sich nach einer Zigarre sehnend spazierte er an den Rand des Ortes, zur sogenannten Schlucht. Hier, wo der malerische Eichgrabenbach herunterrauschte, führte ein steiler Pfad hinauf zur Constantinshöhe. Die Anstrengung des im ersten Teil des Weges stetigen Bergaufsteigens brachte Nechyba ordentlich ins Schwitzen und verscheuchte seine trüben Gedanken. Oben, bei Wellers Gasthof angekommen, freute er sich über ein schön gezapftes Krügel Bier und eine Portion kalten, hauchdünn aufgeschnittenen Schweinsbraten. Zum Drüberstreuen verzehrte er dann noch eine Portion Haussulz mit Zwiebel, das mit schwarzem, herrlich nussig schmeckendem Kürbiskernöl mariniert war. Dazu trank er ein Viertel reschen Welschriesling, der von einem benachbarten Weinberg stammte. Abschließend bestellte er sich ein Stamperl Vogelbeerschnaps, dessen Inhalt er mit Bedacht schlürfte. Er saß unter einer mit wildem Wein begrünten Laube und war mit sich und der Welt zufrieden. Wobei das nicht ganz stimmte: Die Welt machte ihm Sorgen. Schließlich war vorgestern der Thronfolger der Donaumonarchie von einem serbischen Attentäter in Sarajevo erschossen worden. Wenn das nur keine bösen Folgen haben würde! Nechyba wiegte den Kopf hin und her, kratzte sich nachdenklich an der Schläfe und beschloss dann, seine Befürchtungen mit einem weiteren Viertel Welschriesling zu verscheuchen.
3 Der österreichische Thronfolger war am 28. Juni 1914 von dem bosnischen Serben Gavrilo Princip erschossen worden.
II.
»Do, den müssen S’ unbedingt kosten, unsern Kirschenkuchen. Mit den besten Empfehlungen unserer Frau Sommer. Den hat’s heut’ ganz frisch in der Früh’ g’macht.«
Nechyba bekam einen roten Kopf. Die Frau Sommer hat ihm einen Gruß aus der Küche zugesandt. Ja, schickt sich denn das? Nechyba nahm einen Schluck Kaffee und biss von seinem mit Wurst belegten Steirersemmerl ab. Obwohl er nichts angestellt hatte, kam er sich wie ein untreuer Ehemann vor. Zugegeben, er hatte solche Sehnsucht nach seiner Frau Aurelia gehabt, dass es ihn förmlich in die Küche des Gasthofs ›Ungarische Krone‹ hineingezogen hatte. Ganz so wie seinerzeit, als er sich magisch von der Küche einer gewissen Aurelia Litzelsberger angezogen gefühlt hatte. Nun war er schon seit neun Jahren glücklich mit ihr verheiratet. Trotzdem verspürte er noch immer einen gewissen Drang zum Küchenpersonal. Obwohl er der Köchin der ›Ungarischen Krone‹ in keiner Weise nahegetreten war. Er hatte ihr weder ungebührliche Komplimente gemacht noch hatte er seinen Charme spielen lassen. Nein, er hatte mit ihr nur gefachsimpelt, was bei der Köchin, da er ja von Berufs wegen kein Koch war, großes Erstaunen hervorgerufen und, wie er nun sah, auch eine gewisse Sympathie geweckt hatte. Nechyba, der kein Freund eines süßen Frühstücks war, verzehrte eine zweite Wurstsemmel, bevor er sich schließlich mit einer gewissen Skepsis über den Kirschenkuchen hermachte. Doch bereits nach dem ersten Bissen schloss er die Augen und genoss die fruchtige Köstlichkeit. Ein Traum aus mit Zucker flaumig geschlagenen Eidottern, geschälten, fein geriebenen Mandeln und steif geschlagenem Eiklar. Auf diese wunderbare Teigmasse waren in Reih und Glied reife, saftige Kirschen geschichtet worden, die dann beim Backen jeweils ein bisschen Saft in den Teig abgegeben hatten. Aber halt! Da war noch etwas. Nechybas Gaumen verspürte nun ein zartes Zitronenaroma, das dem flaumigen Teig eine zusätzlich g’schmackige Note gab. Behaglich schlürfte er seine dritte Schale Kaffee und schloss bei jedem Bissen verzückt die Augen. Einem Peitschenschlag gleich holte ihn eine Stimme aus diesem tranceartigen Zustand: »Schmeckt’s, Herr Inspector?«
Erschrocken riss er die Augen auf. Vor ihm hatte sich Fanny Hofer, die resolute Wirtin des Gasthauses, aufgebaut.
»Aus Wien is’ des für Sie kommen, … ein Telegramm.«
Nun verschluckte er sich fast. Nach einer heftigen Hustenattacke nahm er das Telegramm entgegen und riss es mit fahrigen Bewegungen auf. Was er las, freute ihn gar nicht: erwarte ihren anruf stop dringend stop gorup von besanez. Nachdenklich starrte er auf die Nachricht. Was wollte sein Vorgesetzter von ihm?
»Is’ was passiert, Herr Inspector?«
»Das möchte ich gerne selber wissen. Der Herr Polizeipräsident möcht’ mich sprechen.«
»So, so«, murmelte die Hofer beeindruckt, »der Polizeipräsident …«
Auf der Post musste Nechyba geschlagene 10 Minuten warten, bevor die einzige Telephonzelle des Postamts frei wurde. Danach ließ er sich von einem Postbeamten verbinden. Nach mehrmaligem Weiterverbinden innerhalb der Polizeidirektion bekam er schließlich den Baron Gorup von Besanez an den Apparat. Der reagierte höchst erfreut: »Grüß’ Sie, Nechyba. Na, das is’ ja so schnell wie bei der Feuerwehr gegangen, dass Sie sich bei mir gemeldet haben. Ich sag’ Ihnen, die moderne Technik ist ein Wunder.«
»Herr Präsident, wo brennt’s denn?«
»Ein Mord, Nechyba. Ein Mord.«
»Und wieso betrifft das mich? Ich bin auf Kur in Bad Gleichenberg, in der Steiermark.«
»Gewiss, gewiss, Nechyba. Aber von hoher Stelle im Innenministerium wurde der Wunsch geäußert, dass Sie die Ermittlungen übernehmen sollen. Deshalb hab’ ich telegraphiert. Ich kann Sie natürlich nicht zwingen, Ihre Kur abzubrechen. Aber wünschenswert wär’ es schon.«
Genau das war die Tonart, die Nechybas Arbeitsethos ansprach und die ihn mitten in sein Beamtenherz traf. Wenn man im Innenministerium ihn als Ermittler wünschte, dann kam das einer besonderen Auszeichnung gleich. Da konnte er nicht Nein sagen. Deshalb murmelte er: »Ist in Ordnung, Herr Baron. Ich werde meine Sachen packen und so schnell wie möglich nach Wien kommen. Es wird wahrscheinlich aber erst übermorgen der Fall sein, dass ich in Wien ankomme.«
»Hervorragend, Nechyba, hervorragend. Sobald Sie in Wien sind, melden Sie sich bei mir. Gott beschütze Sie. Und: Bon voyage!«
Verwundert und wohl auch etwas verdattert verließ Nechyba das Post- und Telegraphenamt. Dabei murmelte er: »Wer zum Kuckuck ist ermordet worden, dass ich nach Wien muss?«
III.
»Gott strafe Serbien! Diese Balkanbrut, der Teifel soll s’ holen. Unseren … unseren hochwohlgeborenen Thronfolger … unseren Thronfolger abzuschlachten! Ja, was bilden sich die … die Bloßfüßigen denn ein? Österreich-Ungarn hat den Bosniaken die ersten befahrbaren Straßen und die Bahn gebracht. Ganz zu schweigen von den Telegraphenverbindungen und all den übrigen Segnungen des technischen Fortschritts. Und dann meuchelt so ein bosniakischer Serbe unseren Thronfolger. Sauerei! Ich sage nur: Sauerei. Statt dass sie dankbar sind, die serbisch-bosnischen G’fraßter, die … Ich sage nur: Gott strafe Serbien!«
Diese und weitere patriotische Brandreden gab der einzige Mitreisende in Nechybas Zugabteil von sich. Dann las er einige Minuten weiter in der Zeitung, bis er neuerlich eine Tirade gegen die Serben losließ. So ging das, seitdem Nechyba in Feldbach den Zug bestiegen hatte.
Dieser Tag war nicht Nechybas Tag. Denn er hatte viel zu früh und dazu auch noch ziemlich übel begonnen. Mit grünem Gesicht war Nechyba in aller Herrgottsfrüh’ in Feldbach von dem von einem alten Pferd gezogenen Wagen gestiegen. Das Geschüttel und Gerüttel der letzten Stunde, die er am Kutschbock neben dem Bauernknecht verbracht hatte, hatte den Inhalt seines Magens in Aufruhr versetzt. In diesem befand sich noch das wunderbare Abendessen, das er sich zum Abschied von der netten Frau Sommer in der ›Ungarischen Krone‹ hatte zubereiten lassen. Den Auftakt hatte eine g’schmackige Flecksuppe gemacht, gefolgt von einem Krenfleisch und zum Abschluss hatte es zwei extra große Stücke Kirschenkuchen gegeben. All das drückte nach der morgendlichen Fahrt auf dem Pferdefuhrwerk, mit dem Nechyba von Bad Gleichenberg über die Klausen nach Feldbach gelangte, mächtig in seinem Magen. Nach einer halben Stunde Wartezeit, die er sich mit einem kurzen Spaziergang vertrieben hatte, konnte er endlich weiter nach Graz fahren. Zu seinem Verdruss saß er mit einem extrem patriotisch gesinnten Hofrat der steirischen Landesregierung im selben Abteil. Dieser hörte und hörte nicht auf, politisch zu polemisieren: »Diese großserbischen Hetzer! Feige Mordlust leuchtet in ihren Augen. Jawohl! Feige Mordlust!«
Nechyba, dem die Tiraden allmählich auf die Nerven gingen, warf brummend ein: »Ja, kennen Sie denn Serben persönlich?«
Der Hofrat räusperte sich und hielt kurz inne. Dann fuhr er etwas leiser fort: »Das nicht. Aber ich kann’s mir denken. Jeder halbwegs intelligente und gebildete Mensch kann sich das denken, dass diese serbischen Bestien voll Mordlust in die Welt blicken. Das sind doch alles Mörder, Räuber, Kinderschänder …«
»Also, jetzt hör’n S’ aber auf! So ein Blödsinn!«
Der Hofrat beugte sich vor und fuchtelte mit dem ausgestreckten Zeigefinger vor Nechybas Nase herum: »Sind Sie am Ende ein Sympathisant Serbiens? Ein Vaterlandsverräter? Ein Spion? Sie! Sie … Ich werde jetzt den Schaffner rufen, dass der die Gendarmerie verständigt. Sie! Sie ehrloses, verräterisches Subjekt, Sie!«
Nechyba schlug mit einer knappen Handbewegung den fremden Zeigefinger vor seinem Gesicht weg. Gleichzeitig zückte er seine Polizeiagenten-Kokarde und knurrte: »Wenn hier wer wen verhaftet, dann ich Sie! Wegen Verursachung eines Aufruhrs.«
»Was erlauben Sie sich! Ich bin Hofrat der steiermärkischen …«
Nechyba beugte sich vor und grantelte: »Kusch, Depperta. Kein Wort mehr, sonst hol’ ich den Schaffner und lass’ dich bei der nächsten Station wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und wegen Aufruhr und politischen Hetzreden arretieren. Also halt’ die Gosch’n.«
Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu:
»Am besten schleicht4 Er sich jetzt aus dem Abteil da.«
Mit hochrotem Gesicht und fahrigen Bewegungen riss der Hofrat seinen Reisekoffer von der oberhalb der Sitze befindlichen Gepäckablage und verließ leise schimpfend das Abteil. Nechyba schnaufte zufrieden. Er zog sich die Schuhe aus und betrachtete seine Füße, die ob der Hitze ziemlich angeschwollen waren. Dann breitete er ein Taschentuch auf die Bank gegenüber und lagerte seine Füße darauf. Wenig später schlummerte er ein.
4 verschwindet er
IV.
Der 2. Juli 1914 war ein strahlend schöner und ziemlich heißer Sommertag. Goldblatt, der es an solchen Tagen schwer in seinem Redaktionszimmer aushielt, schnappte sich den Jungredakteur Hainisch und ging mit ihm auf den Naschmarkt. Schließlich sahen und hörten vier Augen und Ohren mehr als zwei. Am Markt summte und brummte das hundertfache Stimmengewirr noch intensiver als sonst. Der Tod des Thronfolgers bewegte die Menschen: vom zerlumpten Gassenjungen bis zur herausgeputzten Hofratswitwe, die ausnahmsweise ihr Dienstmädel auf den Naschmarkt begleitete. Nicht aus Solidarität, sondern um aus erster Hand den neuesten Tratsch über die Trauerfeierlichkeiten des ermordeten Thronfolgers und seiner ebenfalls toten Gemahlin, der Herzogin von Hohenberg, zu erfahren. Da sie eine geborene Gräfin Chotek war und nicht zum Hochadel zählte, war sie laut Hofzeremoniell dem Thronfolger nicht gleichgestellt. Obersthofmeister Fürst Montenuovo hatte deshalb verfügt, dass es kein offizielles Staatsbegräbnis 1. Klasse geben würde. Die Ränke und Intrigen, die um den letzten Weg des Thronfolgers und seiner Frau bei Hof geschmiedet wurden, waren natürlich ein großartiger Stoff für den Klatsch in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Zusätzlich lag eine gereizte, aggressive Stimmung in der Luft, die sich gegen alles Serbische richtete. So hörte Goldblatt den sonst so charmanten und sich zurückhaltenden Planetenverkäufer Stanislaus Gotthelf laut über das serbische Gesindel schimpfen, während seine buntgefiederte Papageiendame Hermi einer Kundin einen Horoskopzettel aus seinem Bauchladen pickte. Die ehemalige Soubrette und nunmehrige Hausbesitzerin Henriette Hugó diskutierte auf’s Eifrigste mit anderen Damen über Sinn und Unsinn des Hofzeremoniells, wobei man sich auch in diesem Kreis abfällig über die Serben äußerte. Am extremsten formulierte es aber die Greislerin Lotte Landerl:
»Serbien? Wissen S’, was ich mit den Serben machen tät? Ich würde einmarschieren! Jawohl! Einmarschieren, wie der Prinz Eugen. Zuerst wird Belgrad erobert und dann der schäbige Rest. Weil, so kann das net weitergehen. Wir Österreicher dürfen uns von den Serben nimmer papierln5 lassen. Wir müssen einmarschieren und denen ihren Thronfolger erschießen. Oder aufhängen oder so. Denn wie steht’s schon in der Bibel geschrieben? Aug’ um Aug’, Zahn um Zahn, Thronfolger um Thronfolger!«
»Verzeihen, Gnädigste, so steht das aber nicht in der Bibel!«
»Das is’ ma wurscht!«, schrie die Greislerin mit hochrotem Kopf und schob energisch die Extrawurstradeln in die Semmel.
»Einmarschiert und g’schossen g’hört!«
Goldblatt zahlte und verließ schleunigst die Greislerei. Die Wurstsemmel schenkte er seinem Jungredakteur, der sehr hungrig aus der Wäsche schaute. Goldblatt selbst war der Appetit vergangen.
Diese und unzählige andere Episoden diktierte er am späten Nachmittag im ›Café Sperl‹ dem Jungredakteur in die Feder. Als der Artikel fertig war, schickte er Hainisch in die Zeitungsredaktion in den 9. Bezirk. Er selbst entspannte sich beim Schmökern in den Tageszeitungen und beim Genuss eines weiteren ›Goldblatts‹. Schließlich betrat ein alter Bekannter, der Scharfrichter Lang, das Kaffeehaus. Freudig begrüßte er Goldblatt, den er schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatte. Als der Cafetier Kratochwilla seinem Stammgast Lang persönlich den Kaffee servierte, forderte dieser ihn zu einer Runde Tarock auf. Kratochwilla sah sich im Kaffeehaus um und meinte dann schmunzelnd: »Einen vierten Mann brauch’ ma noch. Aber da drüben sitzt eh der Malotta und macht ein Nachmittagsnickerchen. Den werden wir aufwecken und dann kann’s schon losgehen, meine Herren.«
Die Tarockrunde dauerte bis kurz nach 9 Uhr abends. Laut gähnend und mit müden Augen brach der Fuhrwerksunternehmer Malotta das Spiel ab. Er zahlte seine Spielschulden und murmelte: »Nichts für ungut, meine Herren. Aber ich bin hundemüde. Die Hitze untertags hat mich ganz fertig g’macht. Ich muss mich jetzt niederlegen gehen.«
Goldblatt war ebenfalls müde. Als er gezahlt und sich verabschiedet hatte, vernahm er nach dem Verlassen des Kaffeehauses von ferne Lärm sowie schrilles Pfeifen. Ein leiser Schauer überrieselte ihn, und er eilte über den Naschmarkt in Richtung Paulanerkirche. Plötzlich befand er sich inmitten einer Meute von mehreren hundert Menschen, die alle ganz aufgebracht waren. Sie sangen die Kaiserhymne und jemand verbrannte die dreifärbige serbische Flagge. Immer weiter drängte die Menschenmasse voran. Ihr Ziel: die serbische Botschaft sowie die nahe gelegene Wohnung des serbischen Botschafters. Um 10 Uhr abends gelang es der drängenden Menschenmeute, den Polizeikordon zu durchbrechen und sich mit einem seitlich stehenden Trupp von Demonstranten zu vereinigen. Die Sicherheitswacheleute wichen zurück, der Mob drängte voran, der Sperrkordon drohte sich in unzählige Rangeleien und Massenraufereien aufzulösen. Goldblatt, der von Natur aus eher zart gebaut war, wurde von den drängenden und prügelnden Kerlen hin und her gedrängt; wie ein Kork in der Meeresbrandung. Schließlich war der donnernde Hufschlag von unzähligen Pferden zu hören. 50 berittene Polizisten trieben ihre Pferde in die Menge, die erschrocken auseinanderstob. Goldblatt konnte von Glück reden, dass er nicht vom Hufschlag eines Polizeipferdes getroffen wurde. Zu Fuß und in mehreren Automobilen traf für die Polizisten weitere Verstärkung ein. So konnten die Demonstranten zurückgedrängt und neue, sichere Sperrkordons gebildet werden. Ein Bezirksinspector hielt folgende Ansprache vor den Demonstranten: »Wir kommen Ihnen ja sehr entgegen, aber warum wollen Sie uns Unannehmlichkeiten bereiten? Wir können und dürfen nichts tun.«
Lautes Johlen und gellende Pfiffe waren die Antwort. Der Inspector holte tief Luft und fuhr fort:
»Gehen Sie doch zu dem Leichenzug unserer teuren Toten. Hier haben Sie ja bereits Ihre patriotische Gesinnung gezeigt.«
Durch solches gütliche Zureden konnte die Menge etwas beruhigt und zurückgedrängt werden. Viele gingen dann tatsächlich weiter Richtung Ringstraße, um den Trauerzug zu sehen. Auch Goldblatt ging zum Schwarzenbergplatz vor. Für den kleinwüchsigen Redakteur war es nicht leicht, einige Blicke zu erhaschen, denn Prinz Eugen Straße, Schwarzenbergplatz und Ring waren von Hunderttausenden Menschen gesäumt. An allen Fenstern und Balkonen sah man Menschen stehen. Die Särge von Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Gattin Sophie fuhren in zwei schwarzen Wagen, die jeweils von sechs Rappen gezogen und von Erzherzog Franz Ferdinand-Ulanen, von Leibgardisten zu Fuß und zu Pferd sowie von zahlreichen hochgestellten Persönlichkeiten begleitet wurden. Als der Trauerzug am Schwarzenbergplatz vorbeigerollt war, schrie unmittelbar neben Goldblatt ein junger Kerl: »Nieder mit Serbien!« Unzählige Menschen stimmten ein, die Rufe schwollen zu einem Orkan an. Gleichzeitig begann ein unglaubliches Gedränge. Die Menschenmassen folgten dem Trauerzug. Es wurde gerempelt, gedrängt und getreten. Goldblatt versuchte verzweifelt aus diesem Strom herauszukommen. Als er am Rand angelangt war, sah er, wie plötzlich ein älterer Mann mit hochrotem Gesicht sich ans Herz griff und unter Krämpfen zusammenbrach und er wurde Zeuge, wie das Attentat von Sarajewo ein weiteres Todesopfer forderte.
5 verkackeiern
V.
Erschöpft und verschwitzt kehrte Henriette Beinstein gemeinsam mit ihrer Minna vom Naschmarkt nach Hause zurück. Meine Minnerl, so eine treue Seele!, dachte sich die Beinstein, als sie vor der flirrenden Hitze der Gumpendorfer Straße in den kühlen Flur ihres Hauses flohen. Ein Schauer überrieselte sie. Auch nach mehreren Jahren konnte sie es noch immer nicht fassen, dass dieses schöne Mietshaus ihr gehörte. Ihr, der ehemaligen Soubrette, die in früheren Jahren im Theater an der Wien und auch an einigen nicht so bedeutenden Bühnen beachtliche Erfolge gefeiert hatte. Damals war sie die Operettendiva Henriette Hugó. Heute, mit ihren über fünfzig Lenzen und einem fast doppelt so viel zählenden Körpergewicht, war sie für die Theaterwelt gestorben und vergessen. Außer zahlreichen Kontakten zu Ex-Kollegen und -Kolleginnen war ihr nichts geblieben. Aber immerhin: Diese Kontakte ermöglichten es ihr, eine kleine Agentur für Nachwuchstalente zu betreiben. Und so konnte sie ab und zu Bühnenluft schnuppern. Sie seufzte tief, als sie hinter ihrer Minna die flache, geschwungene Sandsteinstiege in den Mezzanin und danach in den ersten Stock hinaufkeuchte. Zum Kuckuck mit dem Übergewicht! Aber dagegen anzukämpfen, hatte Henriette Beinstein schon seit geraumer Zeit aufgegeben. Genauer gesagt seit dem Tod ihres Ehegatten, des Wurstfabrikanten und mehrfachen Mietshausbesitzers Wenzel Beinstein. Seit damals hatte sie sich in Sachen Essen und Trinken ein bisserl gehen lassen. Vor allem als sie merkte, dass junge Herren, die sie anziehend fand, sich nur mehr aufgrund massiver finanzieller Anreize mit ihr einließen. Das kränkte sie. Schließlich war sie einmal die gefeierte Sängerin Henriette Hugó gewesen, der die Männerwelt zu Füßen lag. Aber das war lange her. Keuchend erreichte sie hinter Minna, die die beiden schweren Einkaufskörbe ohne sichtliche Anstrengung in den 1. Stock getragen hatte, die Eingangstür zu ihrer Wohnung.
»Geh’, sperr auf, Minnerl!«, schnaufte sie, »ich möchte jetzt nicht in meiner Handtaschen nach den Schlüsseln suchen.«
Die Bedienstete, ihr genauer Status im Beinstein’schen Haushalt war nicht klar zu definieren, tat wie ihr geheißen. Minna Dokupil war der gute Geist in Henriette Beinsteins Haushalt. Ursprünglich als Dienstmädel eingestellt, war sie im Laufe der Jahre zur Haushälterin der gnädigen Frau aufgestiegen. Da Minna mit ihren 46 Jahren auch nicht mehr die Jüngste war, war sie froh, diese Stelle sowie das Vertrauen ihrer Arbeitgeberin zu besitzen. Und nicht nur die Stelle, sondern auch die Stellung behagten ihr. Denn sie war mittlerweile zur Vertrauten der Beinstein geworden. Das brachte unter anderem den Vorteil, dass sie nicht mehr in der Küche schlafen musste. Nein, Minna Dokupil bewohnte erstmals in ihrem Leben ein eigenes Zimmer. Darauf war sie, die in einer Kleinhäusler-Keusche aufgewachsen war, in der ihre siebenköpfige Familie in einem einzigen Raum gewohnt hatte, besonders stolz. Außerdem besprach die gnädige Frau alle ihre Sorgen und Probleme mit ihr. Als besondere Auszeichnung empfand Minna, dass sie monatlich ein stattliches Haushaltsgeld in die Hand gedrückt bekam, mit dem sie nach eigenem Gutdünken schalten und walten konnte. Auch was die Arbeiten im Haushalt betraf, war Henriette Beinstein äußerst großzügig. So durfte Minna die Schmutzwäsche zu den Wäschermädeln und danach zu einer Bügelfrau bringen. Außerdem wurde sie von ihrer Arbeitgeberin mit erstklassigem Gewand ausgestattet: von der spitzenbesetzten Unterhose bis zum Dirndl, in dem sie die Beinstein am Sonntag in die Kirche begleitete. Und was das Essen und Trinken betraf, so verstand es sich von selbst, dass sie sich nehmen konnte, was immer sie wollte. Aber Minna achtete darauf, nicht allzu dick zu werden, und hielt sich dementsprechend zurück.
»Minnerl!«
Henriette hatte sich nach der Hitzeschlacht am Naschmarkt ein kühles Bad gegönnt. Als sie in dem angenehm temperierten Wasser lag und die üppigen Rundungen ihres blütenweißen Körpers sah, erinnerte sie sich plötzlich voll Wehmut an den Stanislaus Gotthelf. Wie der seinerzeit ihre Körperfülle genossen hatte! Über zwei Wochen lang war er nicht aus ihrem Bett herausgekrochen. Träumerisch schloss sie die Augen und erinnerte sich, wie er sie an den unmöglichsten Körperstellen gestreichelt und, vor allem, wie er ihr üppiges Kopfhaar stundenlang gekrault hatte. Kein Mann hatte das jemals wieder so hingebungsvoll getan. Henriette hatte plötzlich das Bedürfnis, dass jemand ihren Kopf streichle. Und da sie in der Badewanne saß und sowieso ziemlich verschwitzte Haare hatte, rief sie lauthals: »Minnerl!«
Der Dokupil, die nach dem zweiten Ruf im Bad erschien, gab sie den Auftrag, Wasser zu wärmen und ihr die Haare zu waschen. Als dies fünf Minuten später geschah und Minna mit ihren kräftigen Händen ihre Kopfhaut massierte, schloss sie die Augen und begann zu träumen. Vom Gotthelf und von all den anderen jungen Kerlen, mit denen sie einst etwas hatte. Als die Kopfwäsche beendet war und Minna mit einem Handtuch Haupt und Haar trockenrieb, murmelte Henriette plötzlich: »Den Gotthelf Stani sollt’ ich wieder einmal zum Essen ausführen.«
VI.
Wie ein Pfeil, der unbeirrt sein Ziel sucht, so steuerte Aurelia den dicken Nechyba an. Dieser war völlig überrascht, als er im Menschengetümmel des Wiener Südbahnhofs plötzlich von seiner Frau umarmt wurde. Er war so verdattert, dass er erst mit einer kurzen Verzögerung ihre zärtliche Umarmung erwiderte. Dann drückte er sie allerdings so fest an sich, dass sie glaubte, ihre Rippen krachen zu hören. Und auch das Busserl, das sie ihm inmitten der Menschen vor unzähligen Fremden gab, erwiderte er stürmisch. Dann hielt er seine Frau lange in den Armen und sah sie einfach an. Wie zwei Gestrandete auf einer einsamen Insel, so standen Joseph Maria und Aurelia Nechyba im dichten Strom der Passanten. Dreieinhalb Wochen hatte er sie nun nicht gesehen. Und was noch viel schlimmer war: ihren Körper, ihre Lippen nicht gespürt. Das war in den elf Jahren, in denen sie sich nun kannten, noch nie vorgekommen. Neuerlich küsste er seine Frau und genoss, dass sie bei diesem Kuss ohne jeden Widerstand ihre Lippen öffnete.
»Habt’s ka Wohnung? Es ausg’schamte Bagasch6!«, keifte eine ganz in Schwarz gekleidete Alte. Normalerweise hätte er dem Weibsbild eine saftige Antwort gegeben. Doch nicht jetzt. Nicht in diesem Moment. Er legte vielmehr seinen Arm um Aurelias Taille, schnappte mit der anderen Hand seinen schweren Koffer und sagte : »Komm, herzallerliebste aller Köchinnen. Gemma heim.«
Später, in der Tramway, fragte er dann: »Wieso hast du Zeit, mich abzuholen? Warum arbeitest du nicht? Und woher hast du gewusst, mit welchem Zug ich komm’?«
Ein schmerzliches Lächeln zeigte sich auf Aurelias Gesicht. Sie streichelte ihm über die Wange und sagte leise: »Es ist was Schreckliches passiert …«
Nechyba, der draußen in der Prinz Eugen Straße die Polizei-Absperrungen für den nächtlichen Leichenzug sah, nickte und murmelte: »Ja ja, den Thronfolger haben S’ erschossen. Die narrischen Serben, die …«
Aurelia schaute ihren Mann mit großen Augen an und lächelte dann traurig: »Ja, das auch. Aber das betrifft mich nicht unmittelbar. Dass man hingegen den Alphonse vor zwei Tagen mausetot in einer Dachkammer aufgefunden hat, das …«
Weiter sprach sie nicht. Dicke Tränen rannen über ihre Wangen und Nechyba nahm sie nach einer Schrecksekunde in die Arme. Betroffen flüsterte er: »Das ist aber jetzt net wahr, dass der Schmerda Bub tot ist?«