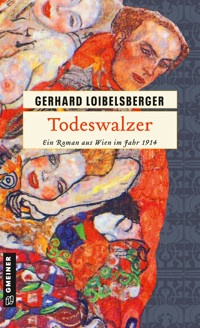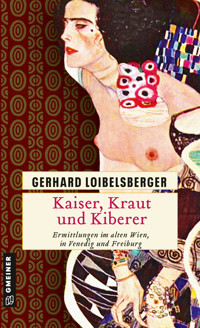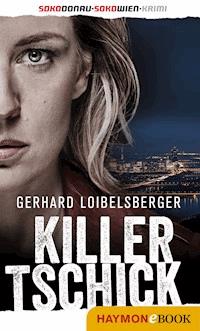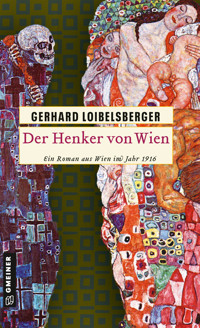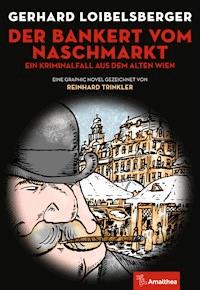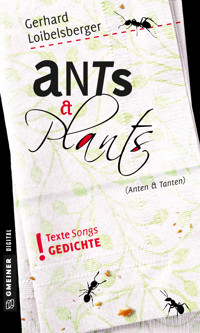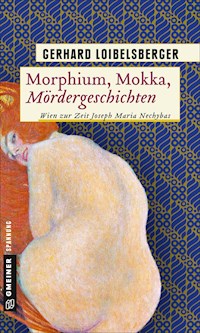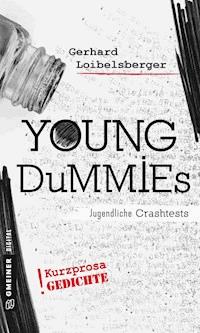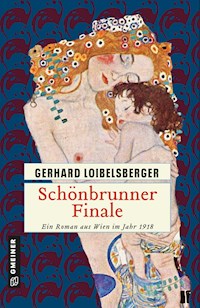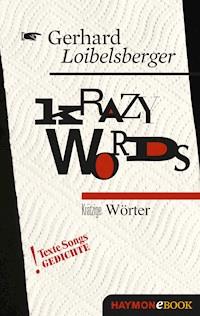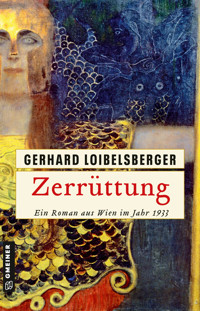
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Inspector Nechyba
- Sprache: Deutsch
Joseph Maria Nechyba genießt seinen wohlverdienten Ruhestand. Was den pensionierten Ministerialrat und vormaligen Oberinspector des k. k. Polizeiagenteninstituts aber zunehmend beunruhigt, ist die politische Entwicklung: Österreich wird unter Kanzler Dollfuß aufgrund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes aus dem Jahr 1917 autoritär regiert. In Deutschland ist Hitler Reichskanzler. Der nationalsozialistische Terror setzt mit aller Macht ein und schwappt immer heftiger nach Österreich über. Hass, Intoleranz, Verleumdung und Unversöhnlichkeit sorgen für ein Klima der Zerrüttung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gerhard Loibelsberger
Zerrüttung
Ein Roman aus Wien im Jahr 1933
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Klimt_-_Pallas_Athene.jpeg
ISBN 978-3-8392-7776-8
Vorbemerkung
Das ist kein Kriminalroman. Das ist ein auf Fakten basierender historischer Roman.
Alle kursiv gesetzten Stellen dieses Buches sind Originalzitate aus den Jahren 1933, 1934 und 1936.
*
Mein Dank gebührt meiner Frau Lisa sowie ihrer Liebe, Geduld und Nachsicht.
*
Für Hilfe und Information bedanke ich mich bei Wolfgang Maderthaner, Kurt Lhotzky, Andreas Pittler und Martina Meyer sowie bei meiner Großcousine Elfi und meinem Großcousin Karl.
Liste der historischen Personen
Marco d’Aviano
Kapuzinermönch und Berater Kaiser Leopold I. (1631–1699)
Viktor Adler
österreichischer Politiker, Arzt, Gründer der Sozialdemokratischen Partei (1852–1918)
Albrecht Alberti
österreichischer Politiker (Christlichsoziale Partei, NSDAP, Verband der Unabhängigen), Heimwehrführer (1889–1963)
Georg Maria Alexich
österreichischer Diplomat, außenpolitischer Berater der Heimwehrführung (1893–1994)
Quirinus Altmayer
Zunftmeister der Friseure (1875–1940)
Ludolf von Alvensleben
Attentäter, SS-Offizier, Kriegsverbrecher (1901–1970)
Georg Bernhard
Journalist, Politiker (1875–1944)
Karl Buresch
Finanzminister (Christlichsoziale Partei, Vaterländische Front) (1878–1936)
Gaspar Cassadó
spanischerCellist und Komponist (1897–1966)
Rudolf Dertil
österreichischer Nationalsozialist und Attentäter (1911– 1938)
Hubert Dewaty
österreichischer Politiker (Landbund, NSDAP) (1892–1962)
Engelbert Dollfuß
österreichischerautoritär regierenderBundeskanzler (Christlichsoziale Partei, Vaterländische Front) (1892–1934)
Hans Ebner
österreichischer Politiker (Heimatblock, Verband der Unabhängigen) (1889–1969)
Emil Fey
Wiener Heimwehrführer, Bundesminister, Vizekanzler (1886–1938)
Wilhelm Foerster
Astronom, Publizist, Pazifist (1832–1921)
Alfred Frauenfeld
österreichischer Nationalsozialist, NSDAP-Gauleiter in Wien, Generalkommissar der Krim (1898–1977)
Sigmund Freud
Arzt, Begründer der Psychoanalyse (1856–1939)
Ernst Glaeser
Schriftsteller (1902–1963)
Joseph Goebbels
Nationalsozialistischer Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda (1897–1945)
Hermann Göring
Nationalsozialistischer Politiker, Kriegsverbrecher (1893– 1946)
Sepp Hainzl
österreichischer Politiker (Heimatblock, NSDAP, FPÖ), SS-Standartenführer (1888–1960)
Werner Hegemann
Architekt, Schriftsteller (1881–1936)
Ernst Heilmann
deutscher Politiker (Sozialdemokrat) (1881–1940)
Rudolf Hirsch v. Planegg
bayerischer Politiker (BVP), Physiker (1900–1974)
Adolf Hitler
deutscher Diktator (1889–1945)
Josef Holzer
österreichischer Dirigent (1881–1946)
Miklós Horty
k.u.k. Admiral, von 1920 bis 1944 autoritär regierendes ungarisches Staatsoberhaupt (1868–1957)
Alois Hundhammer
bayerischer Politiker (BVP) (1900–1974)
Erich Kästner
Schriftsteller (1899–1974)
Carl Karwinsky
österreichischer Politiker (parteilos), Staatssekretär (1888– 1958)
Karl Kautsky
Philosoph, Marxist, Politiker (1854–1938)
Henriette Kern
Ziehmutter von Erich Loibelsberger (1869–1933)
Alfred Kerr
Schriftsteller, Theaterkritiker, Journalist (1867–1948)
Egon Erwin Kisch
österreichisch-tschechischer Journalist und Reporter (1885– 1948)
Berthold König
österreichischer Politiker (Sozialdemokrat), Gewerkschafter (1875–1954)
Wenzel Kovanda
tschechoslowakischer Politiker, Stadtrat in Brünn (1880–1952)
Leopold Kunschak
österreichischer Politiker (Christlichsoziale Partei, Vaterländische Front, ÖVP) (1871–1953)
Prälat Hans Leicht
bayerischer Politiker (BVP), Reichstagsabgeordneter (1868–1940)
Hans von Lex
bayerischer Politiker (BVP), Landtagsabgeordneter (1893– 1970)
Fritz Lichtenegger
österreichischer Politiker (Heimatblock), (1900–1975)
Erich Loibelsberger
Sohn von Rudolf Loibelsberger (1924–1933)
Rudolf Loibelsberger
Großonkel des Autors (1877–1936)
Emil Ludwig
Schriftsteller (1881–1948)
Karl Lueger
Gründer der christlichsozialen Partei, Wiener Bürgermeister (Christlichsoziale Partei) (1844–1910)
Heinrich Mann
Schriftsteller (1871–1950)
Karl Marx
Philosoph, Journalist (1818–1883)
Wilhelm Miklas
österreichischer Politiker (Christlichsoziale Partei), Bundespräsident (1872–1956)
Benito Mussolini
italienischer Diktator (1883–1945)
Odo Neustädter-Stürmer
österreichischer Politiker (Heimatblock), Staatssekretär, Bundesminister (1885–1938)
Carl von Ossietzky
Herausgeber, Journalist, Schriftsteller (1889–1938)
Anton Pfeiffer
bayerischer Politiker (BVP), Landtagsabgeordneter (1888– 1957)
Erich Maria Remarque
Schriftsteller (1898–1970)
Karl Renner
österreichischer Politiker (Sozialdemokrat), 1. Nationalratspräsident, Bundespräsident (1870–1950)
Fritz Schäffer
bayerischer Politiker (BVP), Landtagsabgeordneter (1888–1967)
Johann Schorsch
österreichischer Politiker (Sozialdemokrat), Staatsrat (1874–1952)
Kurt Schuschnigg
österreichischer Politiker (Christlichsoziale Partei, Vaterländische Front), Bundeskanzler (1897–1977)
Ignaz Seipel
Prälat, Politiker (Christlichsoziale Partei), Bundeskanzler (1876–1932)
Karl Seitz
österreichischer Politiker (Sozialdemokrat), Wiener Bürgermeister (1869–1950)
Ernst Rüdiger Starhemberg
österreichischer Politiker (Heimatblock), Bundesführer der Heimwehr, Vizekanzler (1899–1956)
Richard Steidle
österreichischer Politiker (Christlichsoziale Partei), Heimwehrführer, Tiroler Sicherheitsdirektor (1881–1940)
Sepp Straffner
österreichischer Politiker (Großdeutsche Volkspartei), 3. Nationalratspräsident (1875–1952)
Julius Streicher
nationalsozialistischer Publizist, Kriegsverbrecher (1885– 1946)
Josef Sturm
niederösterreichischer Politiker (Christlichsoziale Partei), Priester, Bauernbunddirektor, Landeshauptmannstellvertreter (1885–1944)
Kurt Tucholsky
Schriftsteller (1890–1935)
Josef Vinzl
österreichischer Politiker (Nationaler Wirtschaftsblock), (1867–1947)
Theodor Wolff
Schriftsteller (1868–1943)
Carl Fürst von Wrede
bayerischer Politiker (BVP), Landtagsabgeordneter (1899–1945)
Zitat
Man frage nicht, was all die Zeit ich machte.
Ich bleibe stumm;
und sage nicht, warum.
Und Stille gibt es, da die Erde krachte.
Kein Wort, das traf;
man spricht nur aus dem Schlaf.
Und träumt von einer Sonne, welche lachte.
Es geht vorbei;
nachher war’s einerlei.
Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte
Karl Kraus, Oktober 1933
Zwei Tage im März
»Wenn Sie heute Ihre Brüder, die flüchtenden Bolschewiken aus Deutschland, huldvoll aufnehmen wollen, so wird die Zeit hereinbrechen, in der auch Sie wieder genau so Ihre Binkel auf den Buckel nehmen werden müssen, mit denen Sie aus Galizien1 angereist sind, und werden weiter nach Süden gehen.«
Der Rede des Heimatblock-Abgeordneten Fritz Lichtenegger folgten Zwischenrufe von sozialdemokratischen Parlamentariern sowie eine Rede des steirischen Heimatblock-Abgeordneten Hainzl. Der sozialdemokratische Abgeordnete und Gewerkschafter Johann Schorsch antwortete:
»Alle Gewerkschafter wissen, dass die Gewerkschaften die Tatsache groß und stark gemacht hat, daß man durch Maßregelungen Märtyrer geschaffen hat. Durch solche Maßregelungen hat man niemals erreicht, daß eine Gewerkschaft zusammengebrochen ist, sondern dann erst justament ist die Arbeiterschaft auf dem Standpunkt gestanden: Wir lassen uns nicht unterkriegen!«
Nachdem der Landbündler Dewaty gesprochen hatte, schritt Bundeskanzler Dollfuß zum Rednerpult und verkündete, dass die Zeit zu ernst und die Situation zu schwierig sei, als dass man es auf eine Kraftprobe wie diesen Streik ankommen lassen dürfe. Die Regierung könne dem Antrag der Sozialdemokraten, keinerlei Maßnahmen durchzuführen, nicht entsprechen. Hingegen sei sie bereit, dem Antrag des Abgeordneten Leopold Kunschak zuzustimmen. Nach einer scharfen Antwort des Eisenbahnergewerkschafters Berthold König begann der Nationalrat abzustimmen. Da bei den Regierungsparteien einige Abgeordnete nicht anwesend waren, herrschte im Hohen Haus eine angespannte Atmosphäre.
Nationalratspräsident Dr. Renner gab bekannt, dass über die Anträge in der Reihenfolge, in der sie eingebracht worden waren, abgestimmt werde: zuerst über den sozialdemokratischen, dann über die beiden großdeutschen und zuletzt über den christlichsozialen. Der sozialdemokratische Antrag sowie der erste der beiden großdeutschen Anträge fanden keine Mehrheit. Dann wurde der zweite großdeutsche Antrag behandelt, der eine Ablehnung der Maßregelungen der Eisenbahner beinhaltete. Da die beiden Heimatblock-Abgeordneten Ebner und Hainzl sowie der Großdeutsche Vinzl weiße Stimmzettel abgaben, wurde der Antrag mit 81 zu 80 Stimmen angenommen. Es gab minutenlangen Applaus seitens der Sozialdemokraten. Dollfuß sah verdutzt drein, und etliche Stimmen forderten lautstark:
»Demissionieren, Herr Bundeskanzler! Demissionieren!«
*
Nechyba wachte so wie an jedem Sonntag etwas später auf. Schließlich hatte seine Frau Aurelia an diesem Tag frei und musste nicht knapp nach fünf Uhr früh aus den Federn. Er wachte auf, weil er sie in der Küche herumwerken hörte. Zufrieden döste er noch einige Zeit vor sich hin, bis der Duft von frisch gekochtem Kaffee ihn endgültig weckte. Mein Gott, ist das Leben als Pensionist schön, dachte er sich, als er in seine Patschen2 und in seinen Morgenmantel schlüpfte. Noch immer etwas tramhapert3 schlurfte er in die Küche, gab seiner Frau, die gerade am Herd stand, ein Busserl, sagte leise »Guten Morgen« und begab sich aufs Klo. Mein Gott, dachte er sich neuerlich, was ist das doch für ein Luxus, ein eigenes WC in der Wohnung zu haben und es nicht mit anderen Mietern teilen zu müssen. Der Abort am Gang, so wie es in seiner alten Wohnung in der Papagenogasse gewesen war, war Geschichte. Zufrieden setzte er sich wenig später zu seiner Frau an den Küchentisch, wo schon ein Häferl mit dampfendem Kaffee auf ihn wartete.
»Hast gut geschlafen, Nechyba?«
Er nickte, schlürfte den heißen Kaffee und murmelte:
»Und du?«
»Tief und fest. Bis du in der Früh plötzlich wie ein Walross zu schnarchen ang’fangen hast.«
»Geh, das hast sicher nur geträumt.«
»Und warum hat die Schnarcherei aufgehört, als ich dir einen Stesser4 geben hab?«
»Ah du warst das! Ich hab’ nämlich träumt, dass ich irgend so einen Ganeff5 verhafte, und dass sich der Falott6 wehrt. Aber wenn du das wegen meiner Schnarcherei warst, dann tut mir das leid. Hab’ ich nachher wenigstens nimmer g’schnarcht?«
»Du hast dich umgedreht, und a Ruh war.«
»Siehst, manchmal kommt man nur mit Stoßen und Schubsen weiter«, antwortete er schmunzelnd. Aurelia nickte, stand auf, streichelte über sein dünn gewordenes Haar und holte sich noch ein Häferl Kaffee. Dann schnitt sie von dem am Vorabend gebackenen Erdäpfelbrot7 zwei Scheiben ab, bestrich sie mit Butter, legte sie auf einen Teller und setzte sich wieder. Sie nahm eine Scheibe, biss ab und schob ihm den Teller mit der zweiten Scheibe vor die Nase.
»Da! Iss! Damit du mir net vom Fleisch fallst.«
Später, weil er gut aufgelegt war und weil er seiner Frau eine Freude machen wollte, begleitete er sie zur Heiligen Messe in die Pfarrkirche St. Ägyd in der Gumpendorfer Straße. Nach dem Gottesdienst trennten sich die Wege des Ehepaars. Er begab sich ins Café Jelinek, und Aurelia ging heim, um den sonntäglichen Schweinsbraten zuzubereiten.
Es war ein wunderbarer Sonntag. Föhn hatte die Schleier des morgendlichen Nebels zerrissen, und Nechyba verspürte an diesem 5. März zum ersten Mal, dass der Frühling nahte. Auf seinem Spaziergang atmete er mehrmals tief durch und empfand eine tiefe Zufriedenheit mit Gott und der Welt. Im Café Jelinek griff er zur Arbeiter-Zeitung, las die Schlagzeile Aus der Eisenbahnerkrise – eine Parlamentskrise. Alle drei Präsidenten des Nationalrates legen ihre Mandate nieder und runzelte die Stirn. Nach einem Schluck Mokka begann er zu lesen:
Die Krise, die durch den Entschluß der Regierung, die Eisenbahner wegen des Proteststreiks vom 1. März zu maßregeln, ausgebrochen ist. Ist gestern zu einer schweren Krise des Parlaments, zu einer wahren Staatskrise geworden. Die Regierungsparteien sind in der entscheidenden Abstimmung unterlegen; der Nationalrat hat mit einer Mehrheit von einer Stimme einen Antrag angenommen, dessen Sinn es war, daß wegen des Streiks keine Maßregelungen erfolgen dürfen. Unzählige Male haben die Regierungsparteien ihren Willen nur mit einer Mehrheit von einer Stimme durchgedrückt. Da sie gestern mit einer Mehrheit von einer Stimme unterlegen sind, wollten sie sich dem nicht fügen und versuchten Winkelzüge, die das Parlament geradezu gesprengt, die dazu geführt haben, daß alle drei Präsidenten des Nationalrates ihr Amt niedergelegt haben, so daß zur Stunde nicht einmal feststeht, wer jetzt überhaupt noch berufen ist, den Nationalrat zu einer neuen Sitzung einzuberufen!
Nachdem Nechyba den vier Seiten langen Bericht über die skandalöse Nationalratssitzung gelesen hatte, brummte er:
»Wenn das der Dollfuß und seine Regierung nicht ausnutzen werden …«
Herr Engelbert, der Kellner des Café Jelinek, der sich gerade an Nechybas Tisch vorbeibewegt hatte, hielt inne und grantelte:
»Gehen S’, hörn S’ auf mit dem Politisieren!«
»Wer politisiert denn? Ich habe nur eine Befürchtung geäußert.«
»Ihre Befürchtung teile ich durchaus. Aber trotzdem: Hörn S’ auf mit dem Politisieren. Es bringt nix. Der Bundeskanzler tut sowieso, was er will. Oder besser gesagt das, was der Heimatschutz und deren Führer ihm einflüstern. Sie werden sehen, über kurz oder lang werden wir in einem faschistischen Staat leben …«
Nechyba ließ die Zeitung sinken und war fassungslos. Er wollte nicht glauben, dass der Nationalrat sich selbst durch den Rücktritt aller drei Nationalratspräsidenten handlungsunfähig gemacht hat. Der Artikel endete übrigens mit folgenden Worten:
Damit war die Weiterführung der Sitzung unmöglich geworden. Die Sozialdemokraten erhoben sich und riefen:
Neuwahlen! Sofort Neuwahlen!
Als er das Wort Neuwahlen las, fiel ihm ein, dass heute ja der 5. März war und in Deutschland Wahlen stattfanden. Ihm schwante Übles. Er trank seinen Mokka aus, stand auf, zahlte und ergriff die Flucht. Gejagt von üblen Befürchtungen, die sowohl die Parlamentskrise in Österreich als auch die Wahlen in Deutschland betrafen, eilte er heim zu Aurelia. Zu einem Schweinsbraten, von dem er hoffte, dass er ihn von seinen düsteren Gedanken ablenken würde.
*
Uiii! Der Herr Vater ist böse. Sehr böse. Jetzt hat er ein Bierkrügl an die Wand geschleudert. I hab’ mich geduckt, weil so viel Splitter umadum8 g’flogen sind. Das Bier rinnt jetzt die Wand herunter. Uiii jegerl! Die Frau Mutter blazt9 und holt einen Fetzen10 zum Aufwischen. Der Herr Vater brüllt:
»Wannst net sofort zum Blazn aufhörst, zertrümmer ich die Kuchlkredenz!«
»Net die Kredenz! Bitte net die Kredenz, das is a Erbstück von der Oma.«
»Hör ma auf mit der g’schissenen Oma! Oma! Oma! Immer die Oma! Ich kann den Blödsinn von der Oma nimmer hören. Wannst noch einmal Oma sagst, zerleg i die ganze Kuchl.«
Jetzt hat sich die Frau Mutter hingekniet und wischt das Bier zamm. Der Herr Vater gibt ihr an Stesser, und sie hockerlt sich in die Ecke. Schlagt die Händ’ übern Kopf zusammen. Sie hat Angst. I hab auch Angst, aber i will sie net allein lassen. Der Herr Vater brüllt:
»Die schwindliche Familie! I halt die ganze Packlrass11 nimmer aus! Die Oma! Der Opa! Die Mizzi Tant’ und die ganzn andern Oaschg’sichter! Hör ma auf mit dieser Mischpoche. Da! Da schau den Buam an! Kasweiß is er im G’sicht. Und wer is schuld? Du! Weilst ihn immer so verzärteln tust. Da! Da schau ihn an! Das is ka Bua, des is a Seicherl12! Das hast du aus ihm g’macht!«
I halt den Herrn Vater nimmer aus. Bevor i mir vor Angst in die Hosn mach, renn i ausse auf die Straßn.
*
Als Nechyba am nächsten Morgen das Café Jelinek betrat, lag auf einem Kaffeehaustisch die aktuelle Kronen-Zeitung. Deren Titelseite zierte nicht, wie es sonst üblich war, ein Bild. Stattdessen sah er Riesenlettern, die den Betrachter förmlich anzubrüllen schienen:
Große Wahlerfolge der Nationalsozialisten.
6 Millionen Stimmen und 90 Mandate gewonnen.
Die Kommunisten empfindlich geschwächt.
Sozialdemokraten und Zentrum behaupten ihren Besitzstand.
Parlamentarische Mehrheit für Hitler gesichert.
Es dämmerte ihm, dass er gerade eine Zeitenwende miterlebte. Nach diesem Wochenende würde in Europa nichts mehr so sein, wie es war. Nechyba griff zur Kronen-Zeitung sowie zur Arbeiter-Zeitung, setzte sich in seine Stammloge und begann zu lesen. Plötzlich hörte er Herrn Engelberts Stimme:
»Wie üblich einen doppelten Mokka, Herr Ministerialrat?«
Nechyba schreckte aus seinen Gedanken hoch und grantelte:
»Ja. Und bringen S’ mir separat einen doppelten Cognac.«
Als Herr Engelbert die Getränke serviert hatte, bemerkte er beiläufig:
»Gar net schlecht … einen doppelten Cognac zum Gabelfrühstück … na dann prost!«
Nechyba funkelte ihn an und replizierte:
»Den brauch i, weil mir sonst das Frühstück wieder aufekommt.«
Dann deutete er auf die Titelseite der Kronen-Zeitung.
»Da! Da! Lesen S’ das! Da wird einem speiübel. Sechs Millionen Stimmen und 90 Mandate haben die Nazi gewonnen! Es ist zum Speiben13 … zum …«
Herr Engelbert unterbrach ihn mit einer unwirschen Handbewegung. In barschem Tonfall beschied er dem Gast:
»Hören S’ auf mit dem Politisieren!«
*
Später am Nachmittag, als er von seinem Chef abgelöst und aus dem im Pfandhaus erstandenen Smoking heraus- und in seine Alltagskleidung hineingeschlüpft war, ging Engelbert Novak das Gespräch mit dem Ministerialrat Nechyba nicht und nicht aus dem Schädel. Als ehemaligem Rotgardisten machte ihm die politische Entwicklung natürlich auch große Sorgen. Dass Deutschland nicht mehr zu retten war, hatte er seit dem 30. Jänner des heurigen Jahres befürchtet. Damals war Hitler mithilfe der Zentrumspartei zum deutschen Kanzler gewählt worden. Dass Hitler aber keine Zeit verstreichen ließ und nun bei den von ihm angezettelten Neuwahlen über 40 Prozent der Wählerstimmen gewinnen würde, hatte er nicht erwartet. Seit Anfang Februar waren viele deutsche Genossen und Genossinnen in sogenannte Schutzhaft genommen worden. Vorgestern bei der Wahl hat es vor vielen Wahllokalen Patrouillen von SA und SS gegeben.
»Wirklich freie Wahlen waren das sowieso nicht mehr«, seufzte Engelbert Novak, als er draußen vorm Café in der frischen Luft stand. Er zögerte kurz und überlegte, ob er heimgehen oder noch auf ein Bier in seinem Stammbeisl14 vorbeischauen sollte. Er entschloss sich für Letzteres. Schließlich wollte er den üblen Geschmack, den er nach seiner ganzen Grübelei am Gaumen verspürte, hinunterspülen.
*
Es war ein trüber Morgen. Das Außenthermometer zeigte etwas über null Grad an, und Rudolf Loibelsberger steckte der Kater vom Vorabend in den Knochen. Aufgewacht war er, weil ihn fürchterlicher Durst quälte. Nachdem er ein großes Glas Wasser hinuntergestürzt hatte, schlüpfte er ins Gewand, das vorm Bett am Boden verstreut lag. Es roch nach kaltem Zigarettenrauch, schalem Bier und Gulasch. Ekel überkam ihn. Diese Mischung erinnerte ihn an die unsägliche Diskussion, die es gestern Abend im Wirtshaus gegeben hatte. Durch sein benebeltes Hirn hallten die Kommentare über die aktuelle politische Situation wider:
»Der Hitler g’hört her. Auch bei uns. Zeit wird’s.«
Diese vom Schlosser Hradek in die bis dahin friedliche Stammtischrunde geknurrte Bemerkung hatte die Emotionen hochgehen lassen. Als sich der Schuster Lechner und der Trafikant Wasnigg dieser Meinung anschlossen, war ihm der Kragen geplatzt, und er hatte laut und deutlich dargelegt, dass die Nazi bisher nichts außer Unruhe und Terror zustande gebracht hatten. Und dass ihm persönlich der Hitler mit seiner komischen Gatschwelle15 sowie dessen Kompagnon, der feiste Göring, zutiefst zuwider waren. Daraufhin hatte ihm Hradek an den Kopf geworfen, dass der Millimetternich16 ja auch nicht der geborene Sympathler sei. Ein Wort gab das andere, und ein Krügel folgte dem nächsten. Er erinnerte sich dunkel, dass ihm das Argumentieren immer schwerer fiel und dass es ihm irgendwann gereicht hatte. An sein Heimkommen erinnerte er sich nicht mehr. Auch daran nicht, wie er ins Bett gekommen war. Erstaunt hatte er jetzt festgestellt, dass er in der Nacht noch das Gewand ausgezogen hatte, bevor er umgekippt und in einen unruhigen Schlaf gefallen war. Mit zittrigen Fingern kochte er Kaffee. Er machte das wie die Türken, indem er Kaffee und Zucker vermischte und mit Wasser aufkochte. Er überlegte, ob er auch Kaffee für seine Frau zubereiten sollte. Wo war sie überhaupt? In seinem benebelten Zustand hatte er zuvor gar nicht darauf geachtet, ob sie im Ehebett lag oder nicht. Er tapste zurück ins Schlafzimmer und sah, dass ihre Seite des Bettes zerwühlt, aber leer war. Er kratzte sich den brummenden Schädel, wankte zum Kabinett, wo der Bub schlief, öffnete die Tür und sah, dass seine Frau zum Buben unter die Decke geschlüpft war. Beide schliefen tief. Leise schloss er die Tür, begab sich zurück in die Küche und goss sich ein Häferl dampfend heißen Kaffee ein. Am Küchenfenster stehend, sah er in den Hinterhof hinaus und schlürfte das heiße Gebräu. Nachdem er es geleert hatte, stellte er das Häferl aufs Fensterbrett, nahm den Tabakbeutel aus der Hosentasche und wuzelte17 sich eine Zigarette. Seinem Zustand entsprechend geriet sie ziemlich krumm, doch das störte ihn nicht. Was ihn aber störte, war, dass die Blätter einer Zeitung, die der Wind am Vorabend herumgewirbelt hatte, überall im Hof verstreut lagen.
»Sauerei«, murmelte er und zwang sich, in seine Strickweste und in die Schuhe zu schlüpfen und hinauszugehen. Als Hausmeister duldete er im Hinterhof keinerlei Unordnung. Draußen empfing ihn feuchtkalte Morgenluft. Beim mehrmaligen Bücken und Aufheben des Papiers rutschte seine Hose nach unten, sodass ihm die Kälte beim Maurerdekolleté in die Hose kroch. Als er alle Blätter eingesammelt hatte, schlurfte er zum Koloniakübel18, um sie wegzuschmeißen. Doch da stach ihm eine große fette Überschrift ins Auge:
Angriff auf die Freiheitsrechte
Die Regierung hebt Versammlungs- und Preßfreiheit durch Verordnung auf.
Rudolf Loibelsberger stutzte. Er kratzte sich die Bartstoppeln, zögerte kurz und tapste dann mitsamt der eingesammelten Zeitung zurück in seine Wohnung. Dort braute er neuerlich Kaffee, diesmal nicht nur für sich, sondern auch für seine Frau sowie einen Kathreiner Malzkaffee für seinen Sohn. Die Häferln brachte er ins Kabinett und weckte beide sanft. Schließlich war es Viertel nach sieben, und der Bub musste aufstehen und in die Schule gehen. Anschließend strich er den beiden jeweils ein Butterbrot, das er ihnen ans Bett brachte. Dann setzte er sich an den Küchentisch, wo er sich neuerlich eine Zigarette wuzelte und anzündete. Er nahm einen Schluck Kaffee und begann den Leitartikel der zuvor eingesammelten und noch immer etwas feuchten Arbeiter-Zeitung zu lesen:
Um ½ 1 Uhr nachts erfahren wir, daß die Regierung gestern eine umfangreiche Verordnung beschlossen hat, die unter anderem das österreichische Versammlungsgesetz und das Pressegesetz wesentlich abändert, die grundlegenden Freiheitsrechte der Staatsbürger angreift.
Die Verordnung »stützt sich« auf das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz vom Jahr 1917, auf jenes Kriegsgesetz, das die Regierung ermächtigt hat, »während der Dauer der durch den Krieg hervorgerufenen außerordentlichen Verhältnisse durch Verordnung die notwendigen Verfügungen zur Abwehr wirtschaftlicher Schädigungen und zur Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln« zu treffen. Auf Grund dieser Ermächtigung will die Regierung die Versammlungsfreiheit und die Preßfreiheit aufheben!
»Was soll das? Wir sind doch net im Krieg«, murmelte Loibelsberger, nahm einen Schluck Kaffee und machte einen langen Zug von der Zigarette.
Dann las er weiter:
Mit gleichem Recht könnte man auf Grund dieser Ermächtigung durch eine Regierungsverordnung die Republik abschaffen und die Monarchie wieder einführen und dies damit begründen, daß dies »zur Abwehr wirtschaftlicher Schädigung« notwendig sei!
Dabei schreibt das Staatsgrundgesetz über die Rechte der Staatsbürger, also ein wesentlicher Bestandteil unserer Verfassung, ausdrücklich vor, daß Beschränkungen der Versammlungsfreiheit und der Preßfreiheit nur durch Gesetz getroffen werden können, also nicht durch Verordnung!
Seine Frau war nun ebenfalls aufgestanden, blinzelte verschlafen, setzte sich mit Kaffeehäferl und Butterbrot neben ihn und keppelte19:
»Gestern hast wieder einmal einen Rausch wie ein Eckhaus g’habt. Du bist ins Bett g’fallen und hast sofort zum Schnarchen ang’fangen, dass die Wänd g’wackelt haben.«
Von ihrer Keppelei irritiert, hatte er beim Lesen den Faden verloren. Und so stieg er ein Stück weiter unten wieder in den Artikel ein:
Die Regierung hat zunächst durch eine generelle Weisung angeordnet, bis auf weiteres alle Versammlungen und Kundgebungen, auch in geschlossenen Räumen, zu verbieten. Auf Vereinsversammlungen bezieht sich diese generelle Weisung nicht, sofern nicht »unter dem Vorwand solcher Versammlungen unzulässige politische Demonstrationen zur Durchführung gelangen«. In der vermetternichten Republik20 sollen politische Demonstrationen »unzulässig« sein!
Beim Lesen des letzten Satzes schluckte Loibelsberger und dachte: Jetzt wird der Dollfuß tatsächlich zu einem kleinen Metternich, zum Millimetternich. Mit flauem Gefühl las er weiter:
Dabei wird das alte Verfahren, daß der Staatsanwalt Zeitungen konfiszieren kann, also nicht eine Entscheidung des Gerichts einholen muß, wieder eingeführt! Und zum Ueberfluß werden auch schwere Strafen für die Beleidigung ausländischer Regierungen angeordnet! Wer also Hitler, Mussolini oder Horthy21 beleidigt, kann schwer bestraft werden! Auch wer die Sowjetregierung beleidigt?
Nun stand der kleine Erich fertig angezogen neben seinem Vater, um sich zu verabschieden und auf den Weg in die Schule zu machen. Er streichelte dem Buben gedankenverloren über den Kopf und las weiter:
All das ist ein offener Verfassungsbruch, ist die Aufhebung von staatsbürgerlichen Rechten, die durch die Verfassung gewährleistet sind, ist ein Staatsstreich der Regierung!
Diese Verordnung ist der erste Schritt zum Fascismus in Oesterreich!
*
Heut in der Nacht ist die Frau Mutter zu mir unter die Decke g’schlüpft. Weil der Herr Vater so laut g’schnarcht hat, dass i des sogar im Kabinett g’hört hab. Das macht die Frau Mutter dann, wenn der Herr Vater spät auf d’ Nacht aus dem Wirtshaus heimkommt und b’soffen wie eine Haubitze22 ist. Das hat übrigens der alte Herr Nechyba g’sagt, wie mein Herr Vater nach so einer Nacht laut umadum g’schrien hat. Das hab’ ich ihn zur Etti-Tant’ sagen gehört. Wobei i net weiß, was a Haubitze is. Irgendwas Großes wahrscheinlich. So groß wie die Räusche, die der Herr Vater immer wieder heimbringt. Heut’ in der Früh war er ganz lieb. Er hat der Frau Mutter und mir die Kaffeehäferln und dann auch die Butterbrote ans Bett bracht. Da hab’ i mi sehr g’freut. Und die Frau Mutter war ganz baff, hat net g’wusst, was sie sagen soll. Später, wie’s bei ihm am Küchentisch g’sessen is, hat’s aufs Neue mit ihm zu keppeln23 ang’fangen. Das hab’ i gar net leiwand24 g’funden. Wo er doch heut so lieb war, der Herr Vater.
*
Warum muß ich so lange leiden?
Die Verzweiflungstat eines Arbeitslosen. Ein erschütternder Abschiedsbrief.
Im Salzer-Wittgensteinschen Wald bei Kalksburg wurde Sonntag ein junger Arbeitsloser aus Meidling erhängt aufgefunden. In den Kleidern des Toten fand man ein an die Redaktion der »Kronen-Zeitung« gerichtetes Schreiben, in dem ein verzweifelter Mensch in Worten voll Bitterkeit die Welt anklagt, die ihm und so vielen anderen arbeitsfreudigen Menschen keine Existenzmöglichkeit bieten kann.
Furchtbares muß der Unglückliche in den letzten Stunden seines Lebens erduldet haben. Auf dem Briefumschlag schrieb er: »Es dämmert, ich treffe Vorbereitungen zum Sterben. Aber immer gehen Leute – warum muß ich so lange leiden?«
Im Brief heißt es: »Bin gezwungen, von dieser Welt zu scheiden, da ich seit Februar 1930 arbeitslos und seit Mai 1931 ausgesteuert bin. Habe alles mögliche versucht, um Arbeit zu bekommen, aber vergeblich. Da ich meiner armen, guten Mutter nicht länger mehr zur Last fallen will, habe ich mich entschlossen zu sterben. Ich wollte zuerst Hungers sterben, da ich aber bei der Mutter wohnte, konnte ich meinen Entschluß, einen qualvollen Tod zu erleiden, nicht ausführen.
Ist man verurteilt sich selbst umzubringen? Es ist vier Uhr nachmittags, ich habe höchstens noch zweieinhalb Stunden zu leben. Mein Schritt wird begreiflich erscheinen, wenn ich anführe, daß meine Mutter mit vierzehn Schilling, die sie wöchentlich als Unterstützung erhält, sich selbst, mich und meine Schwester, die Kontoristin, aber gleich mir ausgesteuert ist, erhalten muß.
Sollte man mich nicht ruhig sterben lassen, dann sei verflucht, wer mich daran hindert.«
Nechyba war betroffen. Er ließ die Kronen-Zeitung sinken und starrte beim Fenster des Café Jelinek hinaus. Der Wind trieb dicke Wolkenverbände vor sich her, sodass Licht und Schatten ständig wechselten. Und als er die sich laufend verändernden Schatten beobachtete, kam ihm vor, als ob die sonnigen Augenblicke immer spärlicher und die Schatten immer mächtiger wurden. Er hatte den Eindruck, dass dieses Spiel von Sonne und Wolken ein Abbild der politischen Situation war. Schwere dunkle Wolken kämpften gegen das Licht. Ein Schauer überrieselte ihn, und er hatte die furchtbare Ahnung, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis die Welt in Dunkelheit versinkt. Der Mokka schmeckte plötzlich extrem bitter, und er rief:
»Herr Engelbert, zahlen!«
Der Ober nickte, kam jedoch nicht. Nechyba kannte das. Ein Wiener Ober, der sofort herbeieilte, wenn man ihn rief, hatte keine Berufsehre im Leib. Das konnte man Herrn Engelbert nicht nachsagen, und so dauerte es ein paar Minuten, bis er sich schließlich bequemte, zu Nechybas Tisch zu kommen und zu kassieren. Ein ordentlicher Ober ist schließlich kein Laufbursche, dachte Nechyba, als er das Café Jelinek verließ. Unten an der Kreuzung Gumpendorfer Straße und Hofmühlgasse stand in einem Hauseingang ein Bettler. Seine Kleidung war zerlumpt, sein Haupt gesenkt, in der Hand hielt er einen speckigen Filz, der in besseren Tagen ein Herrenhut gewesen war. Nechyba, der noch immer ziemlich aufgewühlt war, zückte sein Portemonnaie und warf einen Schilling in den Hut. Er hörte ein gemurmeltes »Vergelt’s Gott …« und begab sich eiligen Schrittes heim. Der Ministerialrat i.R. sehnte sich nach der Geborgenheit seiner Wohnung, nach seinem Fauteuil und seinem Hornyphon25-Radioapparat. Auf Letzteren freute er sich ganz besonders, denn er hatte im Radioprogramm der Kronen-Zeitung gelesen, dass es zehn Minuten nach fünf ein Nachmittagskonzert gab, bei dem Stücke von Josef Lanner, Giacomo Meyerbeer und Franz Liszt gesendet wurden. Das wollte er auf keinen Fall versäumen.
*
»Herr Engelbert! Wo zum Kuckuck ist die heutige Ausgabe der Arbeiter-Zeitung?«
Der Ober, der gerade an einem Tisch im hinteren Teil des Kaffeehauses servierte, zuckte ob des lautstarken Ausbruchs zusammen. Irritiert hob er die linke Augenbraue und replizierte:
»Aber Herr Ministerialrat, ich bitte Sie. Was machen S’ denn für einen Bahöö26?«
»Weil ich mich ärgere, dass die Arbeiter-Zeitung net zu finden ist.«
Herr Engelbert durchsuchte in aller Ruhe die aufliegenden Zeitungen und Zeitschriften, wendete sich dann dem Zeitungsständer zu, wo zahlreiche Blätter in Zeitungshaltern aufgehängt waren. Als er auch dort nicht fündig wurde, murmelte er:
»Die hat der Erdboden verschluckt. Lesen S’ halt heut einmal was anderes.«
»Sie! Werden S’ net pampig27!«
»Herr Ministerialrat, das würde ich mir nie erlauben. Das steht mir nicht zu.«
Nechyba merkte, dass er in seinem Ärger zu weit gegangen war, und bedauerte seine Äußerung.
»Ist schon gut, Herr Engelbert. War nicht so gemeint. Ich bin halt ein Häferl28. Das war ich schon immer. Aber dass gerade heut’ die Arbeiter-Zeitung net greifbar ist, magerlt29 mich sehr. Ich wollt’ unbedingt wissen, was sie zum gestrigen Aussperren der Parlamentarier aus dem Parlament schreibt. Angeblich hat die Regierung Kriminalbeamte eingesetzt, die das Parlamentsgebäude geräumt und abgesperrt haben. Was sagen Sie dazu?«
Engelbert Novak schüttelte den Kopf und sagte das, was er in so einer Situation immer sagte:
»Hören S’ auf mit dem Politisieren.«
Nechyba kehrte brummelnd und grummelnd zu seinem Tisch zurück. Unterm Arm das sozialdemokratische Kleine Blatt sowie die ebenfalls kleinformatige Kronen-Zeitung. Das Kleine Blatt las er normalerweise nicht so gerne wie die Arbeiter-Zeitung, die inhaltlich und intellektuell doch einen wesentlich höheren Anspruch hatte. Die eher reaktionäre Kronen-Zeitung las er wegen des interessanten Chronikteils und des täglichen Radioprogramms, dem zu Beginn jeder Ausgabe auf Seite 2 großflächig Platz eingeräumt wurde. Das Kleine Blatt verkündete am Titel:
Die Sitzung hat getagt! Trotz Polizeiaufgebot der Regierung.
Die von Präsident Straffner einberufene Sitzung des Nationalrates hat getagt.
Bis 2 Uhr nachmittags währten die Bemühungen der Regierungsparteien, die beiden Oppositionsparteien zu bewegen, auf die Sitzung zu verzichten.
Da diese Bemühungen erfolglos blieben, drohte die Regierung, den Abgeordneten das Betreten des Sitzungssaales mit Gewalt zu verhindern. 100 Kriminalbeamte in Zivil zogen aus dem Parterre des Parlaments zum Sitzungssaal, um seine Eingänge zu besetzen. Aber sie kamen zu spät! Die sozialdemokratischen und großdeutschen Abgeordneten hatten sich bereits im Sitzungssaal versammelt, Präsident Straffner hatte seine Erklärung abgegeben. So konnte die Sitzung ordnungsgemäß geschlossen werden.
Nechyba ließ das Kleine Blatt sinken, seufzte und war heilfroh, dass er in Pension war und bei diesem Einsatz gegen demokratisch gewählte Abgeordnete nicht dabei sein musste. Er griff zur Kronen-Zeitung, die als Titelbild wie so oft etwas völlig Unpolitisches brachte: Tänzerinnen und Tänzer sowie die Bildunterschrift Das siamesische Schwesternpaar und die Liebe. Darüber befand sich allerdings direkt unter dem Zeitungskopf die Überschrift: Das Parlament von 210 Kriminalbeamten besetzt. Wie der Kampf um die Sitzung verlief.
Aha, dachte Nechyba, jetzt sind’s plötzlich nicht mehr 100, sondern 210 Kiberer30 gewesen. Typisch Kronen-Zeitung. Alles ein bisserl übertreiben und sensationslüstern darstellen. Trotzdem blätterte er weiter zu dem Artikel auf Seite 5:
Die Sitzung wurde abgehalten und nach ihrer Beendigung verboten. Fernbleiben der Regierung und der Mehrheitsparteien. »Es war keine Sitzung des Nationalrates« – behauptet die Regierung. Der kritische Tag ohne Zusammenstoß verlaufen.
Der gefürchtete Tag ist recht glimpflich verlaufen, die schwere Krise ist ohne ernsten Zwischenfall, ohne jede Anwendung von Gewalt, ohne eine einzige Verhaftung überstanden. Zusammenfassend kann man nur über den Verlauf des gestrigen Tages sagen: Die Regierung und ihre Parteien haben im Kampf ums Parlament gesiegt, die sozialdemokratische-großdeutsche Opposition hingegen hat die Schlacht ums Parlament gewonnen. Sieger in allen Lagern – diesen versöhnlichen Ausgang hat der Streit um ¾ 3 Uhr nachmittags genommen, der eine halbe Stunde vorher noch sehr bedrohlich ausgesehen hatte.
»Die Sitzung hat stattgefunden«, erklären die Parteien der Opposition.
»Die beabsichtigte Versammlung hat überhaupt nicht stattgefunden«, ließ die Regierung zwei Stunden nach Schluß der Sitzung mitteilen.
»So ein Kasperltheater!«, grantelte Nechyba. »Merkt der Dollfuß nicht, dass er und die Regierung sich lächerlich machen?«