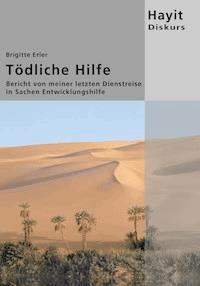
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mundo Marketing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hayit Diskurs
- Sprache: Deutsch
Entwicklungshilfe hatte sich Brigitte Erler zur Lebensaufgabe gemacht. Nach ihrer Rückkehr von einer Dienstreise nach Bangladesch kündigt sie jedoch fristlos ihren Job beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ihre Erlebnisse fasst sie unter dem Titel "Tödliche Hilfe, Bericht von meiner letzten Dienstreise in Sachen Entwicklungshilfe" zusammen. Sie fordert darin, Entwicklungshilfe müsse sofort eingestellt werden. Die These, dass wir überall, wo wir helfen wollen, nur Unheil anrichten, hat jahrelang für zahlreiche Diskussionen gesorgt. Das Thema hat bis heute nichts an Brisanz verloren. 1985 in erster Auflage erschienen, ist das Buch auch heute noch eine Fundgrube für alle, die sich mit Entwicklungshilfe beschäftigen und kritisch auseinandersetzen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pressestimmen zu Vorauflagen
„Und wenn Brigitte Erler sagt, die Hilfe dient überwiegend den falschen Leuten, halte ich das für übertrieben. Aber ich bin bereit, dem nachzugehen und andere aufzufordern: prüft die These; und prüft, wo man das, was nicht in Ordnung ist, durch etwas Vernünftiges ersetzen kann.“
Willy Brandt im Interview mit Brigitte Erler in DIE ZEIT, 08.11.1985
„Doch noch nie hat ein Eingeweihter der Entwicklungsbürokratie sein eigenes Werk, ein gutes Dutzend Entwicklungsprojekte in Bangladesch, so gnadenlos verrissen wie Brigitte Erler in ihrem soeben erschienenen Buch ‘Tödliche Hilfe’“
Der Spiegel Nr. 12/1985
„Das Buch sollte alle nachdenklich machen, die sich in Bürokratien und Organisationen der Entwicklungshilfe oder in entwicklungspolitischen Konferenzen und Zirkeln in der Selbstzufriedenheit wiegen, daß sie auf dem richtigen Wege sind.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.06.1985
„Wer eh’ schon Zweifel an der Hilfskräftigkeit seiner Steuergroschen hat, findet hier viele anschauliche Belege“
taz 19.03.1985
„Eine rasch wachsende Anhängerschaft findet dagegen die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Brigitte Erler mit ihrem Buch über die ‘Tödliche Hilfe’ und der darin enthaltenen These, daß jegliche staatliche Entwicklungshilfe grundsätzlich schädlich sei. Eine These, die Gegenstand zahlreicher Diskussionsveranstaltungen im ganzen Bundesgebiet ist.“
Frankfurter Rundschau, 07.02.1985
„Der moralische Stachel konnte nicht beseitigt werden, den Brigitte Erler in die öffentliche Diskussion über den Sinn von Entwicklungshilfe getrieben hat.“
WDR 1, Meldung und Meinung, 18.03.1986
„Das Buch kann auch trotz seines frühen Erscheinungsjahres immer noch all jene provozieren, die meinen, moderne selbstbestimmte und gleichberechtigte Entwicklungszusammenarbeit zu betreiben. Ein wichtiger Diskussionsbeitrag.“
Impressum
Die 1. Auflage des Buchs „Tödliche Hilfe“ von Brigitte Erler ist 1985 erschienen. Für die vorliegende 15. Auflage wurde die Rechtschreibung an die neue Schreibweise angepasst.
Anregungen und Kommentare an die Verlagsadresse oder per E-Mail an [email protected] sind gerne gesehen.
ISBN Print: 978-3-87322-081-6
ISBN PDF: 978-3-87322-105-5
ISBN ePub: 978-3-87322-106-2
ISBN mobi: 978-3-87322-137-6
15. Auflage 2010
Impressum:
Autorin: Brigitte Erler
Herausgeber: Ertay Hayit, M.A.
Redaktion: Cornelia Auschra, M.A.
Produktion: Mundo Marketing GmbH, Köln
Hayit Diskurs
Brigitte Erler
Tödliche Hilfe
Vorwort des Herausgebers zur 15. Auflage
Heftige, zum Teil essenzielle Kritik an Entwicklungshilfe prägte die dritte Dekade der entwicklungspolitischen Aktivitäten der Industrieländer, die Achtzigerjahre. Ihre Konzepte und Theorien standen auf dem Prüfstand, insbesondere nachdem einer der Väter der internationalen Zusammenarbeit, der schwedische Ökonom Gunnar Myrdal, öffentlich seinen Standpunkt änderte und die bislang geleistete Entwicklungshilfe für gescheitert erklärte.
Auf die gängige Praxis hatte dies zunächst wenig Einfluss. 1985 veröffentlichte Brigitte Erler, damalige Referentin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), das Buch „Tödliche Hilfe“. Schockiert über die Folgen staatlicher Entwicklungshilfe vor Ort beschrieb sie die einzelnen Stationen ihrer letzten Dienstreise durch Bangladesch. Während dieser Reise hatte sie feststellen müssen, dass die Ergebnisse aller Bemühungen immer auf dasselbe hinausliefen: Die Reichen wurden immer reicher – und zwar sowohl in den Entwicklungs- als auch in den Industrieländern –, die Armen immer ärmer.
Die meisten ihrer ehemaligen Mitarbeiter im Ministerium reagierten auf das Buch ablehnend. Offiziell wurden die Vorwürfe seitens des BMZ rundheraus abgestritten. Gleichwohl zeigen die kurz darauf hausintern in Auftrag gegebenen Studien und die sich anschließenden Korrekturen an den Definitionen und Zielsetzungen von Entwicklungspolitik, dass der Anstoß zur Selbstreflexion endgültig gegeben worden war.
„Tödliche Hilfe“ von Brigitte Erler ist nach wie vor ein wichtiges Dokumentfür alle, die sich kritisch mit Entwicklungshilfe auseinandersetzen. Die Projekt-Wirklichkeit vor Ort mag sich in den letzten 20 Jahren verändert haben,die Interessen der Wohlhabenden und die Wirkungen des Zusammenspiels der internationalen Kräfte, wie sie die Autorin beschreibt, nicht.
Der Text samt Anhang wurden für die vorliegende Ausgabe inhaltlich nicht verändert, da beides in historischem Zusammenhang steht. Die Schreibweise wurde der neuen Rechtschreibung angepasst. Wer sich für aktuelleDaten zu Bangladesch und Informationen zu Entwicklungshilfe-Organisationen interessiert, erhält mit Hilfe der neu in den Anhang aufgenommenenInternet-Adressen einen Einstieg in die eigene Recherche. Ertay Hayit, Köln
Vorwort der Autorin zur ersten Auflage 1985
Im Oktober 1983 kehrte ich von einer dreiwöchigen Dienstreise nach Bangladesch zurück und kündigte meine Stellung als Referentin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) fristlos.
Ich habe während des größten Teils meines Arbeitslebens Entwicklungspolitik betrieben. Nebenbei engagierte ich mich in verschiedenen Gruppen, die sich mit den Beziehungen zu den Ländern der Dritten Welt, besonders zu denen Afrikas, beschäftigten. Auf dienstlichen, politischen und privaten Reisen habe ich die Mehrzahl der Länder Afrikas sowie einige Asiens kennen gelernt.
Nach einer kurzen Tätigkeit beim Seminar für Sozialarbeit in Übersee der Caritas und nebenberuflicher Praktikantenbetreuung für die Carl-DuisbergGesellschaft siedelte ich nach Bonn über, um mich Aufgaben in der Zentrale bundesrepublikanischer Entwicklungspolitik, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, zu widmen.
Ich begann im Öffentlichkeitsreferat, schrieb Reden für die Minister Eppler und Bahr und übernahm dann die Zusammenarbeit mit Botswana und Sambia.
Nach zweieinhalb Jahren BMZ wurde ich für eine Legislaturperiode zum Mitglied des Deutschen Bundestages gewählt. Ich war Mitglied im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, im Ausschuss für Forschung und Technologie und Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Während dieser Zeit bemühte ich mich weiter eifrig, der Bevölkerung die Notwendigkeit von Entwicklungshilfe klarzumachen. Die verbreitete Grundeinstellung vor allem von Arbeitnehmern, die Neger seien dumm und faul, prangerte ich als Rassismus an und versuchte, diesem Vorurteil entgegenzuwirken. Mit wenig Erfolg. Mir war nämlich nicht bewusst, dass ich mit meiner Helferideologie selber zum Propagandisten des Rassismus wurde: Wenn ganze Völker mit ihren Problemen angeblich nicht allein fertig werden können, dann liegt es eben nahe, dass sie entweder dumm oder faul oder beides sind.
Bei meiner Rückkehr in das Ministerium übernahm ich die Zusammenarbeit mit Pakistan. Während des letzten dreiviertel Jahres meiner Dienstzeit übertrug man mir die Technische Zusammenarbeit mit Bangladesch.
Wenn in dem vorliegenden Bericht von „meinen“ Entscheidungen die Rede ist, meine ich damit immer nur Vorentscheidungen. Denn ausgabenwirksame Unterschriften dürfen nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung erst vom Referatsleiter an aufwärts geleistet werden.
Mein Entschluss, der Entwicklungshilfe den Rücken zu kehren, war das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen in der Entwicklungspolitik und zahlreicher Diskussionen innerhalb und außerhalb des BMZ. Den Anlass bildeten die Erlebnisse auf meiner letzten Dienstreise nach Bangladesch. Dort wurde mir die einzige noch verbliebene Illusion geraubt, dass wenigstens „meine„ Projekte zur Beseitigung von Elend und Hunger beitrügen. Ich erfuhr im Gegenteil, wie jede einzelne Komponente der unter meiner Verantwortung durchgeführten Projekte die Reichen reicher und die Armen ärmer machte. In Bangladesch bedeutet das in vielen Fällen den Unterschied zwischen Leben und Tod. Ich konnte die Einsicht nicht mehr verdrängen: Entwicklungshilfe schadet allen, denen sie angeblich nützen soll, ganzen Ländern wie einzelnen Betroffenen. Sie muss deshalb sofort beendet werden. Ohne Entwicklungshilfe ginge es den Menschen in den Ländern der Dritten Welt besser. Ich weiß wohl, dass die Veröffentlichung dieses Textes nicht das Ende der Entwicklungspolitik bewirken kann. Dazu läuft das Zusammenspiel zwischen der am Geschäft beteiligten deutschen Industrie, der Schicht der Reichen in den Entwicklungsländern und der großen Interessengemeinschaft von Bürokraten im Ministerium und in den Durchführungsorganisationen, von Consultings und Experten sowie den Entwicklungshilfe-Politikern, also dem ganzen Entwicklungshilfe-Jet-Set mit seinen hervorragenden Gehältern, interessanten Reisen und seinem hohen Sozialprestige, viel zu geschmiert.
Was ich erhoffe ist nur, dass die zahllosen gutwilligen Befürworter der Entwicklungshilfe erfahren, was ihre Steuergelder tatsächlich bewirken. Dabei habe ich skandalöse Projekte wie z. B. Polizeihilfe für die indonesische Regierung, die gerade Völkermord in Ost-Timor begeht, gar nicht erwähnt. Es geht hier nur um die normale Entwicklungshilfe, die den Anspruch erhebt, humanitären und sozialen Zielen zu dienen und die Unabhängigkeit der Entwicklungsländer zu fördern.
Mein Ehrgeiz zielt nicht auf eine weitere wissenschaftlich abgesicherte Analyse. Deren gibt es genug. Aber weder der große alte Mann der Entwicklungstheorie Gunnar Myrdal noch das Buch „Vom Mythos des Hunger“„ der hervorragenden Fachleute Collins und Lappé, die Senghaas’sche Abkoppelungstheorie oder P. T. Bauer von der London School of Economics haben mit ihrer Grundsatzkritik bei den Praktikern bisher irgendeinen Eindruck hinterlassen.
Ich beschränke mich darauf, ganz subjektiv Erlebnisse, Gespräche und Informationen wiederzugeben. Dabei habe ich bewusst die theoretischen Einsichten nicht von meinen persönlichen Erlebnissen getrennt. Denn ebenso wie meine Wahrnehmungen meine Theorievorstellungen beeinflusst haben, so haben mit Sicherheit auch die Theorien in meinem Kopf meine Wahrnehmungsfähigkeit gelenkt. Ich habe auch meine Gefühle nicht versteckt, da sie wahrscheinlich bei den meisten Menschen der entscheidende Faktor bei der Meinungs- und Willensbildung sind. Die miteinander eng verschwisterten Gefühle Mitleid und Hochmut bilden ja die Grundlage jeglicher Entwicklungspolitik.
Ein Distrikt wird entwickelt
Auf den Besuch des Projektes „Förderung der ländlichen Entwicklung im District Tangail“ hatte ich mich am meisten gefreut. Es war ein echtes Grundbedürfnisprojekt*, sollte die gesamte ländliche Entwicklung in einem Gebiet voranbringen und bestand aus verschiedenen Teilen, die sich gegenseitig ergänzen sollten:
– Förderung der Bewässerung durch Lieferung von Pumpen verschiedener Größe, die von Kleinbauerngenossenschaften betrieben werden sollten, – Förderung von kleinen privaten Pumpenreparaturbetrieben,
– Förderung von Landlosen, die sonst bei landwirtschaftlichen Programmen meist nicht beachtet werden,
– Förderung integrierter Landwirtschaft, um den ökologischen Erfordernissen gerecht zu werden,
– Kreditbeschaffung für Kleinbauern, um sie aus ihrer Abhängigkeit von den Geldverleihern zu befreien.
Das Projekt war auch nicht nur am grünen Tisch konzipiert worden. Während einer Vorlaufphase wurden alle Maßnahmen erst einmal in kleinem Stil erprobt und Studien dazu erstellt. Diese ersten Erfahrungen hatte ich dann mit dem Projektleiter und dem Projektsprecher der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) gründlich in Bonn durchdiskutiert. Auch die Botschaft in Dhaka war von dem Projekt begeistert. Endlich erreichte ein Projekt wirklich die Armen.
Die List mit den Pumpen
Mit dieser positiven Grundeinstellung machte ich mich also von Dhaka aus auf den Weg. Morgens früh um sechs brauchte der Torhüter des Hauses, in dem ich wohnte, zum Glück noch nicht, wie sonst üblich, die Bettlerinnen mit ihren nackten Kindern von der Toreinfahrt wegzuscheuchen – ein Anblick, der ja doch immer etwas auf die Stimmung drückte. Nach ca. zwei Stunden Autofahrt in Richtung Nordwesten erreichten wir Tangail, die Hauptstadt des Distrikts, in dem wir das Projekt angesiedelt haben. Für das Projekt mit seinen Experten wurde in Tangail ein Haus ausgebaut, in dem diese übernachten können, wenn sie im Projektgebiet arbeiten. Grundsätzlich wohnen fast alle Experten in Dhaka. Ein von ihnen liebevoll vorbereitetes üppiges Frühstück wartete auf uns, gemeinsam mit dem District Commissioner, der während unseres Gesprächs immer wieder auf eine schnellere Durchführung des Vorhabens drängte. Sie wollten endlich Pumpen sehen.
Nach dem Frühstück ging es als erstes zur Besichtigung einer Tiefbrunnenpumpe, die Land von ca. 80 Bauern bewässert. Herzstück des Projekts ist die Installation von Bewässerungspumpen und die Bildung von Genossenschaften, um diese zu nutzen. Beeinflusst von „small-is-beautiful“-Ideen hatte ich schon in Bonn bezweifelt, dass die aufwendigen Tiefbrunnenpumpen den mittelgroßen und den Handpumpen vorzuziehen seien. Der Projektleiter hat meine Bedenken vom Tisch gewischt: In vielen Gegenden liege das Grundwasser so tief, dass man mit kleineren Pumpen nicht herankäme. Zum anderen verlangten die Bauern die großen Pumpen. Und dass auch diese den Kleinbauern zugute kämen, sei ja durch die genossenschaftliche Organisation gewährleistet. Ich hatte mich damit zufrieden gegeben. Wie konnte ich von Bonn aus die Vorort-Kenntnisse des Projektleiters aus den Angeln heben? In Bangladesch erfuhr ich dann sehr schnell, allerdings durch Zufall, die richtige Antwort.
Die Pumpen, die wir installieren, kommen keineswegs den kleinbäuerlichen Genossenschaftsmitgliedern zugute. In Wirklichkeit machen einige wenige große Bauern damit riesige Geschäfte. Diese „local influentials“ (örtlich Einflussreiche) sind nicht in unserem Sinne oder gar im Sinne lateinamerikanischer Latifundienbesitzer reich. Ihre Häuser hoben sich in meinen Augen nicht wesentlich von denen der Kleinbauern ab. Ihr Landbesitz beträgt häufig nur 20-30 acre*. Aber sie verfügen über ein eng geknüpftes Netz von Beziehungen zu allen Mächtigen der Gegend und besitzen das Geld, um sich notfalls durch Bestechung bis hin zum gedungenen Mord Vorrechte zu erkaufen. Gleichzeitig betätigen sie sich häufig als ausbeuterische Geldverleiher und gehören dann meist zu den best gehassten Leuten im Dorf.
Die Geschäfte mit den Pumpen laufen folgendermaßen: Einer oder mehrere Reiche zahlen das Einstiegskapital für die Pumpe. Dann bestechen sie den Vertreter der Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC), der eigentlich nach technischen Kriterien den Standort für die Pumpe aussuchen soll, teilweise mit für Bangladesch riesigen Summen. Es war von bis zu 40.000 Taka* die Rede. So erreichen sie, dass die Pumpe auf ihrem Land installiert wird. Damit können die übrigen Bauern nichts mehr dagegen tun, dass der gesamte Gewinn aus der Pumpe an den neuen Besitzer fließt. Alle müssen ihm für das Wasser aus dem Brunnen ein Viertel ihrer Ernte abliefern. Der Reiche besitzt jetzt nicht nur die Verfügungsgewalt über die jeweilige Menge Wasser, die jeder bekommt, sondern es kommt sogar vor, dass der Pumpenbesitzer das Entgelt für die Bewässerung willkürlich auf ein Drittel der Ernte erhöht. Anfangs muss die Pumpe zwar noch abbezahlt werden – die Regierung verkauft die Pumpen, die sie von den Gebern kostenlos erhält, allerdings zu relativ niedrigen Preisen an die Bauern –, aber wenn sie abbezahlt ist, beginnt das große Geschäft. Ein Viertel der Ernte des gesamten, mit Hilfe der Pumpe bewässerten Landes bei nur sehr geringen Unterhaltskosten. So schaffen wir in großer Geschwindigkeit neue „water lords“.
Nachdem ich diese Zusammenhänge erfahren hatte, ging mir auch ein Licht auf, weshalb „die Bauern“ immer nur die größten Pumpen wollten. Große Geschäfte bringen mehr als kleine, logisch. Diese Tatsachen waren auch dem für die Pumpen zuständigen deutschen Experten bekannt. Aber er sah seine Aufgabe nur darin, möglichst rasch möglichst viele Pumpen zu installieren mit der Begründung, das BMZ – also ich! – wolle endlich etwas Vorzeigbares sehen und alles andere sei egal.
Die anderen Geber verhalten sich genauso. Die Weltbank z. B. hat in ihrem „Rural Development Program II“ (Ländliches Entwicklungsprogramm) denn auch aus diesen Erkenntnissen die logische Folgerung gezogen, einfach die Augen ganz fest zuzumachen. Sie lässt die Regierung in großem Maßstab Tiefbrunnenpumpen an Großbauern verkaufen. Kooperativen brauchen nur dem Namen nach zu existieren. Um ihren guten Willen zu dokumentieren hatte sie allerdings – offensichtlich die ultima ratio aller Geber – der Regierung eine neue Organisation für Kooperativen aufs Auge gedrückt, die schon nach kurzer Zeit der BADC an Bestechlichkeit in nichts nachstand. Aber das Leitmotiv der Weltbank ist eben „klotzen und nicht kleckern“. Tiefbrunnen für die Großen machen mehr her als Handpumpen für die Kleinbauern. Und die bangladeschische Regierung muss, um immer mehr Geld zu erhalten, ihre Fähigkeit, möglichst schnell Geld zu verbraten, nachweisen. Denn „Absorptionsfähigkeit“* ist ein wichtiges Kriterium für Entwicklungshilfe-Würdigkeit.
UNICEF war bei einem Projekt, das wir mitfinanziert haben, noch skrupelloser vorgegangen. Sie hatte keinen Gedanken auf die Zielgruppe ihrer Wohltätigkeit verschwendet. Aufgrund des durchaus logischen Gedankenganges, dass die Armen den Selbstkostenanteil für Trinkwasserpumpen nicht bezahlen können, hat UNICEF diese in einer landesweiten Aktion gleich den Reichen überlassen. Eigentliches Ziel war es, die bangladeschischen Dörfer mit gutem Trinkwasser zu versorgen. Was dabei herauskam, sahen wir zufällig in einem Dorf bei der Besichtigung eines anderen Projektes: Die Kinder des Reichen planschten fröhlich unter dem dicken Strahl herrlich klaren Pumpen-Wassers. Die übrigen Dorfbewohner zeigten uns verzweifelt die kaputte öffentliche Pumpe. Sie waren gezwungen, kilometerweit ihr Trinkwasser zu holen. Der Reiche ließ sie an seine Pumpe nicht heran. Gutachter, die das UNICEF-Projekt geprüft und einen dicken Bericht angefertigt hatten, konnten meine Frage, wer denn das Wasser nutze, nicht beantworten. Sie hatten sich lediglich darum gekümmert, ob die Pumpen technisch funktionierten. UNICEF verkauft dies als ein äußerst erfolgreiches Projekt. Wieder einmal Tausende von Kindern gerettet! Nach Auskunft eines hohen UN-Beamten – „Fragen Sie doch mal die UNICEF-Leute selber, was sie von sich halten!“ – kommen von den UNICEF-Geldern sowieso nur 20 % in den Entwicklungsländern an. Nach dieser Erfahrung kann ich nur sagen: Gottlob!
Ich glaube allerdings nicht, dass wir selbst bei größter Gewissenhaftigkeit und Überwachung der Genossenschaften die Macht der örtlich Einflussreichen mal so eben im Vorbeigehen unterlaufen könnten. Zu viel ist bekannt darüber, wie sie über Strohmänner Kontrolle ausüben und Projekte zu ihren Gunsten umfunktionieren, selbst wenn sie sich selbst nicht an einer Genossenschaft beteiligen dürfen. Wer könnte das von außen auch nur durchschauen, geschweige denn verhindern. Stattdessen geben wir ihnen immer mehr Mittel in die Hand, um reicher zu werden und die Ärmeren auszubeuten.
Wir besichtigten auch eine Handpumpe, mit deren Hilfe man einen acre bewässern kann. Sie wird in Bangladesch selbst hergestellt. Obwohl ich nicht viel von Bewässerung verstehe, leuchtete mir deren Nutzung gleich ein: Sie ist arbeitsintensiv, für Kleinbauern geeignet und benötigt keine Devisen für Herstellung und Betrieb. Aber die Experten waren da anderer Meinung. Die Handpumpe sei zu arbeitsaufwendig, da sie Tag und Nacht betrieben werden müsse. Ein wahrlich einleuchtendes Argument angesichts von 50 % Landlosen in fast jedem Dorf.
Als schwerwiegendere Begründung dafür, dass wir die großen Tiefbrunnenpumpen und nicht die kleinen Handpumpen installieren, führten die Experten die Grundwasserabsenkung an. Je mehr künstliche





























