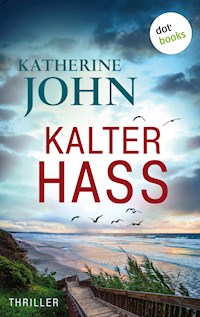Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wales Killings
- Sprache: Deutsch
Der Mann mit den zwei Gesichtern – der fesselnde Thriller »Tödliches Los« von Katherine John jetzt als eBook bei dotbooks. Der Waliser Sergeant Trevor Joseph hat schon vieles gesehen, was einem normalen Menschen den Schlaf rauben würde – aber diese schrecklich zugerichtete Leiche schockt sogar ihn: Das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten, wurde der Mann mit Benzin übergossen und angezündet – bei lebendigem Leib! Einziger Verdächtiger ist ein Obdachloser, der in der Nähe gesehen wurde. Als Trevor nach dem Mann fahndet, stößt er auf ein neues Rätsel: Der Gesuchte sieht einem Rechtsanwalt zum Verwechseln ähnlich, der seit zwei Jahren tot ist … und dessen Gesicht damals mit chirurgischer Präzision entfernt und gestohlen wurde! Hängen die beiden Fälle zusammen – und wer steht als nächstes Opfer auf der Liste des Unbekannten? »John verwebt in dieser hochspannenden Geschichte über Rache und Vergeltung geschickt medizinisches und psychologisches Hintergrundwissen mit einem packenden Plot.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Thriller »Tödliches Los« von Katherine John ist der zweite Band ihrer »Wales Killings«-Reihe, die Fans von Val McDermid begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der Waliser Sergeant Trevor Joseph hat schon vieles gesehen, was einem normalen Menschen den Schlaf rauben würde – aber diese schrecklich zugerichtete Leiche schockt sogar ihn: Das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten, wurde der Mann mit Benzin übergossen und angezündet – bei lebendigem Leib! Einziger Verdächtiger ist ein Obdachloser, der in der Nähe gesehen wurde. Als Trevor nach dem Mann fahndet, stößt er auf ein neues Rätsel: Der Gesuchte sieht einem Rechtsanwalt zum Verwechseln ähnlich, der seit zwei Jahren tot ist … und dessen Gesicht damals mit chirurgischer Präzision entfernt und gestohlen wurde! Hängen die beiden Fälle zusammen – und wer steht als nächstes Opfer auf der Liste des Unbekannten?
»John verwebt in dieser hochspannenden Geschichte über Rache und Vergeltung geschickt medizinisches und psychologisches Hintergrundwissen mit einem packenden Plot.« Publishers Weekly
Über die Autorin:
Katherine John wurde als Tochter einer deutschen Mutter und eines walisischen Vaters in Pontypridd unweit von Cardiff geboren. Sie studierte Englisch und Soziologie in Swansea; danach lebte und arbeitete in den USA und Europa, bevor sie nach Wales zurückkehrte und sich seitdem ganz dem Schreiben widmet. Katherine John lebt mit ihrer Familie auf der Gower-Halbinsel an der Südküste von Wales.
Katherine John veröffentlichte bei dotbooks bereits die »Wales Killings«-Reihe mit den Bänden »Finsteres Grab«, »Tödliches Los«, »Schwarze Narzissen« und »Kalter Hass«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2006 unter dem Originaltitel »Murder of a Dead Man« bei Hodder Headline. Die deutsche Erstausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Leblos« bei Rowohlt.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2006 by Katherine John
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2009 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Bettina Zeller bei Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-509-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tödliches Los« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Katherine John
Tödliches Los
Thriller – Wales Killings 2
Aus dem Englischen von Bettina Zeller
dotbooks.
Für Ross Michael Watkins
Prolog
Im Kellergeschoss des General Hospitals herrschte eisige Stille. Das leise Brummen des Boilers, der siedend heißes Wasser ins Heizsystem einspeiste, hätte nur jemand hören können, der direkt neben dem Fahrstuhlschacht oder der Treppe stünde, die nach unten in das Innere des Gebäudes führte. Der ständig auf Hochtouren arbeitende Warmwasserbereiter sorgte dafür, dass die Temperatur oben auf den Stationen nur selten auf ein erträgliches Maß fiel.
Durch das Treppenhaus hallte das dumpfe Klappern eines Rollwagens, der in den Fahrstuhl geschoben wurde; und einige Sekunden lang war das entfernte Surren von medizinischen Geräten zu vernehmen. Die Geräusche aus den oberen Etagen unterstrichen nur, wie deplatziert das hektische Krankenhaustreiben hier unten wirkte. Auch die Flure ‒ sie zweigten von der hell erleuchteten, weiß gefliesten Halle ab, die drei Viertel des Geschosses beanspruchte ‒ wirkten wie ausgestorben.
Selbst erfahrene Mitarbeiter, die sich längst an den auf den Stationen allgegenwärtigen Tod gewöhnt hatten, mieden nach Einbruch der Dunkelheit die Korridore, die zur Stahlflügeltür im Keller führten. In den Raum hinter dieser Tür wurden die Fälle gebracht, bei denen das General Hospital versagt hatte: Hier landeten all jene Patienten, die trotz der Pflege durch das Personal, des Fachkönnens der Ärzte und des medizinischen Fortschritts gestorben waren.
Ein junger blasser Mann, der offenbar nur selten die Sonne sah, beugte sich über den Rollwagen. Dabei fiel ihm eine Haarsträhne ins Gesicht, und seine Brille rutschte auf die Nasenspitze. Mit zitternden Händen konzentrierte er sich auf die anstehende Aufgabe. Das grelle, heiße Licht der tiefhängenden Leuchte, unter der er arbeitete, blendete ihn und brannte heiß auf seinem Nacken.
Er hielt inne und warf ängstlich einen Blick über die Schulter. Als er nichts Ungewöhnliches erblickte, tat er seine Nervosität mit einem Kopfschütteln ab und spreizte leicht irritiert seine Finger, die in Latexhandschuhen steckten. Anschließend machte er sich wieder daran, den Bauch der Leiche zu massieren, die er gerade aufbahrte. Vom Zuschauen wusste er, was zu tun war, doch nun, da Jim sich krank gemeldet hatte, musste er früher als erwartet einspringen.
Normalerweise verbrachten Jim und er den größten Teil der Nachtschicht in der Pförtnerloge, tranken Tee und blätterten alte Playboy-Ausgaben durch. Aber in dieser Nacht war alles anders als sonst. Obwohl es erst kurz nach halb drei war, gab es bereits drei Todesfälle, und zwei Stationsschwestern hatten ihm telefonisch eröffnet, er dürfe sich auf noch mehr Arbeit einstellen.
Er ballte die Hände zu Fäusten und presste sie so fest auf die Bauchdecke, bis aus dem geöffneten Mund der Leiche Luft strömte, die wie ein letzter Seufzer in der kalten Luft hing. Dem Krankenpfleger gefror das Blut in den Adern. Als er die Hände abermals auf die Bauchdecke legte, versuchte er, weder das Gesicht zu betrachten noch darüber nachzudenken, was für ein Mensch der Tote wohl gewesen war. Auf den an Handgelenk und Fessel befestigten Schildchen standen ein Name und eine Nummer. Er erinnerte sich nur an das Alter. Achtundzwanzig. Der Verstorbene war im selben Jahr, im selben Monat wie er geboren. Sogar die Schwester von der Unfallstation war über den tragischen Tod eines so jungen Menschen betroffen gewesen.
Wieso hatte er sich damals, als er sich für das Philosophiestudium entschied, eigentlich keine Gedanken über seine Zukunft gemacht? Hätte er etwas Handfestes wie Betriebswirtschaft oder Jura studiert, das ihn auf einen konkreten Beruf vorbereitete, müsste er jetzt nicht in dieser Totenhalle aus Fliesen und Stahl arbeiten, wo die Leichen aufbewahrt wurden, bis man sie bestatten und vergessen konnte.
Das Läuten des Telefons jagte ihm einen Schreck ein. Er brauchte einen Augenblick, bis er einen der Latexhandschuhe auszog, den Toten sich selbst überließ und den Hörer abnahm.
»Leichenhalle!«
Es meldete sich die vertraute Stimme einer Krankenschwester. »Station elf hier. Wir brauchen Sie sofort.«
»Können Sie nicht einen Träger rufen? Ich bin gerade beim Aufbahren.«
»Keiner frei.«
»Eine Krankenschwester?«
»Wir sind unterbesetzt. Momentan sind nur zwei Schwestern auf der Station.«
»Ich bin hier unten ganz allein.«
»Wir alle müssen uns mit irgendwelchen Problemen herumschlagen. Um es kurz zu machen: Es handelt sich um eine alte Dame in einem Vierbettzimmer. Die anderen Patienten sind wach. Außerdem herrscht wegen der Toten große Aufregung.«
»Ich komme gleich.«
Er legte den Hörer auf und kehrte zu dem Toten zurück. Der Leichnam ruhte mit ausgestreckten Beinen flach auf dem Rücken, die Arme lagen neben dem Rumpf. Die Augen waren geschlossen, und der Mund stand offen. Während er den Unterkiefer hochband, musterte er zum ersten Mal das Antlitz des Toten. Seine Züge waren ebenmäßig. Wenn seine Freundin ihn aufziehen wollte, schwärmte sie ihm immer von solchen Männern vor. Der Mann war groß gewesen, weit über einen Meter achtzig, und hatte dichtes, dunkles Haar. Was würde er nur darum geben, wenn er solches Kopfhaar haben könnte? Schlimm genug, dass seines seit jeher dünn war ‒ jetzt begann es sich sogar schon zu lichten. Er streifte den zweiten Latexhandschuh ab, warf ihn in den Mülleimer und zog ein neues Paar aus der Schachtel. Der Tote hier hatte es nicht eilig und konnte ruhig eine Viertelstunde warten. Länger brauchte er oben auf Station elf nicht.
Er schnappte sich ein Leintuch, das leise raschelte, als er es über den Toten breitete. Eigentlich war dies unsinnig, doch die Vorstellung, zu einem unverhüllten Leichnam zurückzukehren, behagte ihm nicht. Die dunklen Haare und die blasse Haut: Das alles wirkte so lebendig und gleichzeitig so tot.
Er nahm eine der leeren Rollbahren, die vor der Wand aufgereiht waren, und schob sie in den Flur. Die Vorschriften verlangten, dass die Leichenhalle entweder rund um die Uhr besetzt war oder zugesperrt wurde. So stand es jedenfalls in seinem Arbeitsvertrag, aber er hatte schnell gelernt, dass sich im Alltag niemand an die Regeln hielt. Vergessen hatte er die vertraglich vereinbarten Bestimmungen nicht, doch er hatte sich an den anderen Pflegern und Trägern ein Beispiel genommen und angewöhnt, sie schlicht und einfach zu ignorieren. Oftmals blieb ihm auch gar nichts anderes übrig, denn das Krankenhaus war chronisch unterbesetzt. Und obendrein war es ziemlich lästig, die Schlüssel aus der Tasche zu holen und abzusperren, nur um sie nachher wieder hervorzukramen und aufzuschließen.
Da die anderen Patienten wach waren, hatte er sich für eine dieser neuen, von den Amerikanern entwickelten Tragen entschieden, bei denen der Leichnam in eine Art Kiste gelegt, der Deckel geschlossen und anschließend ein Laken darüber gebreitet wurde. Einfach, aber effektiv. Ein flach liegendes Laken zog weniger neugierige Blicke auf sich als die deutlich sichtbaren Umrisse eines Toten unter einem Leichentuch. Auf der anderen Seite ließen sich Patienten, die mit eigenen Augen sahen, wie eine Leiche fortgeschafft wurde, von den Kisten auf Rädern natürlich auch nicht zum Narren halten.
Er musste an die Worte der Krankenschwester denken: Außerdem herrscht wegen der Toten große Aufregung. Wer war denn jetzt eigentlich aufgeregt? Das Personal? Die Patienten? Oder die Besucher? Bestimmt waren es die Besucher. Auf Station elf blieben die Verwandten der Patienten häufiger über Nacht; meist harrten sie stumm neben den Betten aus oder wanderten durch die Flure. Sie warteten auf das nahende Ende ihres Angehörigen, das fast immer nachts kam. Oder schien ihm das nur so?
Er schob die Bahre in den Lift und drückte auf den Knopf. Die Fahrt in den siebten Stock dauerte nicht lange. Sanft glitt der Fahrstuhl bis zur sechsten Etage, begann heftig zu vibrieren und blieb ein Stockwerk höher ruckartig stehen.
»Sie haben sich ja Zeit gelassen.«
»Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Heute Nacht bin ich der Einzige, der unten Dienst schiebt.«
»Hier entlang.« Die Oberschwester zeigte ihm den Weg. Mit seiner Vermutung über die Angehörigen hatte er richtig gelegen. Eine Frau mit sorgenvoller Miene folgte ihnen.
»Schwester …«
»Ich bin gleich bei Ihnen. Hier.« Sie stieß eine Tür auf, die in ein kleines Krankenzimmer führte. Rund um das Bett gleich neben der Tür waren die Vorhänge zugezogen. Er schob die Trage durch den engen Eingang und stieß mit einer Lernschwester zusammen, die gerade den Tropf abhängte. Ihr Blick verriet, dass sie unter Schlafmangel litt. Er öffnete den Deckel der Kiste.
»Sie war ein richtiger Schatz«, flüsterte die Lernschwester. »Hat nie gejammert.«
Während sie ihm half, die ausgemergelte Tote mit dem schlaffen Kiefer vom Bett auf die Bahre zu hieven, fällte er eine Entscheidung. Anstatt am frühen Morgen ins Bett zu gehen, würde er daheim nur kurz duschen, sich umziehen, zum Arbeitsamt gehen und die Stellenaushänge durchsehen. Und wenn es dort nichts für ihn gab, würde er eine Zeitung kaufen und die Jobinserate studieren. Es musste doch eine Arbeit geben, die besser war als diese hier.
»Danke. Ich komme jetzt allein zurecht.« Er verschloss die Kiste, breitete das Laken darüber und achtete darauf, dass die Bahre nahezu vollständig unter dem Stoff verschwand. Auf dem Weg zum Fahrstuhl nickte die Oberschwester ihm zu. Die besorgte Frau von vorhin drehte sich rasch um, als er an ihr vorbeiging. Dennoch hatte er ihren Blick bemerkt und fragte sich nun, ob die zusätzlichen Ausgaben des Krankenhauses für solche Bahren sich überhaupt lohnten.
Da so früh am Morgen nur wenig Betrieb auf den Stationen herrschte, war der Fahrstuhl in der Zwischenzeit nicht gerufen worden. Mit einem Knopfdruck öffnete er die Tür und fuhr die Rollbahre in die Kabine. Auf der Fahrt in den Keller ruckelte der Lift wieder. Die Tür glitt auf und gab den Blick in einen menschenleeren Korridor frei.
Er schob die Bahre auf die Leichenhalle zu. Vor der Tür blieb er stehen und schaute sich um. Eigentlich bestand dazu gar keine Veranlassung. Weder hatte er etwas gehört, noch war ihm etwas Außergewöhnliches aufgefallen. Trotzdem beschlich ihn ein Gefühl des Unbehagens.
Er atmete tief durch und rief sich in Erinnerung, dass er ein erwachsener Mann war, der immerhin schon einen Abschluss in Philosophie geschafft hatte. Hier unten gab es nichts, wovor er sich fürchten musste. Oder wie Jim es im Scherz formuliert hatte: »Unsere Kunden mögen vielleicht mit ihrem Los hadern, aber wer weiß das schon? Beschweren können sie sich ja nicht mehr.«
Er schob den vorderen Teil der Rollbahre durch die Tür ‒ und blieb wie angewurzelt stehen.
Der Leichnam des jungen Mannes saß aufrecht auf seiner Trage und starrte ihn an. Das Leintuch lag in Falten vor seinem Schoß.
Jim hatte ihn zwar davor gewarnt, dass so etwas hin und wieder passierte, wenn noch Luft im Bauch war, doch im Augenblick war er viel zu sehr von Grauen gepackt, um sich über die Ursache den Kopf zu zerbrechen.
Der weiße Oberkörper des Toten hatte gut ausgebildete Muskeln, und die Brustbehaarung war dunkel und dicht. Aber das Porzellanweiß des Rumpfes stand in einem Entsetzen erregenden Kontrast zur bluttriefenden, bläulich roten Masse, die dort zu sehen war, wo sich vor Kurzem noch das Gesicht befunden hatte. Nur die Augen waren noch geblieben ‒ grell-weiße Augäpfel mit dunklen Iriden ‒, die über freiliegenden Wangenknochen den Betrachter anstarrten. Zwei Zahnreihen in einer lippenlosen Mundöffnung zeigten ein scheußliches Grinsen.
Er war wie hypnotisiert und konnte den Blick nicht abwenden. Er bemerkte an den Seiten des Kopfes zwei Stümpfe ‒ die Überreste der Ohren ‒, sah die schwarzen Höhlen zwischen den Augen, wo zuvor die Nase gewesen war, und starrte den ausgefransten Haaransatz über dem blanken Stirnbein an. Als ihm endlich ein Schrei über die Lippen kam, geisterte ihm ein einziges Wort durch den Kopf: gehäutet!
Er musste daran denken, wie sein Vater früher auf dem heimischen Bauernhof Hasen geschossen und ihnen anschließend das Fell abgezogen hatte. Offenkundig war mit dem gleichen Geschick das Gesicht dieses Mannes fein säuberlich entfernt worden. Aber wieso, um Himmels willen, häutete jemand einen Toten?
Kapitel eins
»Zwei … vier … sechs … acht … wer hat Angst vor heute Nacht … Erde … Hölle … Himmel.« Das Mädchen balancierte auf einem Bein, bückte sich und las einen flachen Stein von einem der Quadrate auf, die auf den Boden des Spielplatzes gemalt waren. Dann legte die Kleine ihn neben den Fuß, mit dem sie hüpfte, und verpasste ihm einen Stoß, woraufhin er über die weißen Karos auf dem schwarzen Asphalt schlitterte.
»Nach Hannah bin ich dran.« Ein dickliches Kind drängte ein anderes zur Seite und stellte sich vor die Mädchen, die in einer Warteschlange standen.
»Nein, stimmt nicht!« Der Fuß des Mädchens, das gerade den Wurfstein bewegt hatte, schwebte in der Luft. »Kelly ist dran.«
»Hau ab, du Dränglerin.« Das Mädchen, das weggeschoben worden war, nahm wieder seinen Platz ein.
Die schrillen, hohen Kinderstimmen schallten über den Schulhof und durch die Zaungitter in eine Gasse, wo ein furchtbar dünner Mann mit schmutzigem Gesicht, dunklen Bartstoppeln und verfilzten, schulterlangen Haaren sie beim Spiel beobachtete. Der Stoff des fleckigen schwarzen Mantels schlackerte um seine Knie. Darunter trug er eine abgerissene, speckige Hose. Nur sein Schuhwerk ‒ hellrote Basketballschuhe mit leuchtend blauen Schnürsenkeln ‒ verlieh seinem Aufzug etwas Farbe.
Er zuckte mit den Schultern, um das Gewicht des Rucksackes zu verlagern, den er trug. Sein eindringlicher, wilder Blick folgte den Bewegungen, die das Mädchen auf dem Himmel-und-Hölle-Feld machte. Hannah war ein anmutiges Kind, groß gewachsen für eine Grundschülerin, schlank und ohne den für ihr Alter üblichen Kinderspeck. Ihr silberblondes Haar war zu einem dicken Zopf geflochten, der ihr bis zur Taille reichte, und sie hatte kornblumenblaue Augen, die auf dem tristen Schulhof wie Emaille funkelten. Die Kleine war bei Weitem das hübscheste Kind in der Gruppe. Ein Schwan auf einem See, der voll von hässlichen Entlein war. Ihre gertenschlanke Gestalt ließ schon die Grazie und Schönheit der Frau erahnen, zu der sie heranwachsen würde.
»Miss! Ein dreckiger alter Mann beobachtet uns!«
Die schrille Stimme gehörte einem kleinen Jungen, der etwas abseits von den anderen am Zaun saß. Eine Frau mittleren Alters in einem grauen Wollkleid und einer weiten blauen Strickjacke begann, quer über den Hof zum Tor zu rennen. Alle anderen Kinder in Hörweite drehten sich um und schauten zur Gasse. Der Mann ging rasch zum gegenüberliegenden Fußweg und hastete davon.
»Das ist mein Vater!« Hannah ließ den kostbaren Wurfstein fallen, der sie berechtigte, bei jedem Spiel als Erste zu hüpfen, warf den Zopf über die Schulter und lief aus dem Schulhof, ehe die Frau mittleren Alters, die noch zu weit weg war, sie davon abhalten konnte. Ohne auf den Verkehr zu achten, eilte die Kleine über die schmale Straße. Bremsen quietschten. Ein Autofahrer fluchte leise.
»Daddy!«, schrie Hannah, doch der Mann rannte weiter. »Bleib doch stehen!«
Er hielt inne und warf einen Blick über seine Schulter. Tränen hatten grauweiße Schlieren auf seinen dreckigen Wangen hinterlassen.
»Daddy … Du bist ja gar nicht mein Daddy!«
Der Mann sprintete wieder los und ließ das schluchzende Kind auf dem Bürgersteig zurück.
»Komm, Hannah, sei brav.« Die Frau im grauen Wollkleid trat zu ihr.
»Nein!« Hannah weigerte sich, die ausgestreckte Hand der Frau zu nehmen. »Gehen Sie weg, ich will zu Daddy!«
»Wer immer das auch gewesen sein mag, jetzt ist er weg. Komm, wir gehen jetzt wieder in die Schule.«
»Er hat wie mein Daddy ausgesehen. Bis er sich umgedreht hat. Ich dachte, er ist ‒«
»Du kannst dich in Mrs. Jones’ Zimmer setzen. Wir rufen deine Tante an. Du darfst heute früher nach Hause gehen. Was hältst du davon, Hannah?« Die Frau geleitete das Mädchen durch das Schultor.
Ein Kollege tippte der Lehrerin auf den Arm und flüsterte: »Polizei?«
Die Lehrerin schüttelte den Kopf. »Läuten Sie die Glocke und schaffen Sie die Kinder rein. Und dann rufen Sie Hannahs Tante an. Ob die Polizei verständigt werden soll, müssen der Schulleiter und Miss Davies entscheiden.«
»… happy birthday, lieber Trevor, happy birthday to you«, sang Peter Collins für seinen Kollegen Trevor Joseph, als Lyn Sullivan eine Schokoladen-Sahne-Torte mit brennenden Kerzen in Trevors Wohnzimmer brachte.
»Er ist nicht dein lieber Trevor, sondern meiner«, sagte Lyn und stellte die Torte auf den Tisch, um den Trevor und seine Gäste sich geschart hatten.
»So wird es wohl sein«, stimmte Peter zu. »Seit meinem fünften Lebensjahr hat mir keiner mehr eine Torte spendiert oder eine Party für mich veranstaltet.«
»Wie soll das auch gehen, wo du jede freie Minute in diesem fürchterlichen White Hart verbringst?«, meinte Sergeant Anna Bradley, Peters Kollegin und Begleiterin an diesem Abend.
»Woher willst du wissen, dass es dort fürchterlich ist? Du hast den Pub ja noch nie von innen gesehen.«
»Das ist auch nicht nötig. Ein Blick von außen reicht schon.«
»Du musst jetzt die Kerzen auspusten, Trevor.« Lyns Lächeln wirkte gezwungen. Nachdem sie seit sechs Monaten mit Sergeant Trevor Joseph vom Dezernat für Schwerverbrechen zusammenlebte, war das Netteste, was sie Freunden und Familienangehörigen erzählen konnte, dass Polizisten »anders« waren. Und das waren sie auch. Diese Andersartigkeit manifestierte sich in ihren Arbeitszeiten, ihren Gewohnheiten, ihrem Sinn für Humor ‒ vor allem in ihrem Sinn für Humor. Und was für die Polizei im Allgemeinen galt, galt ganz besonders für Sergeant Peter Collins vom Drogendezernat.
Trevors Freund war selbst in guten Zeiten nur schwer zu ertragen, und es war schon eine ganze Weile her, seit Lyn und Trevor eine gute Zeit verlebt hatten. Vier Monate, um genau zu sein. Inzwischen zermürbte die Beziehung, die so vielversprechend begonnen hatte, sie zunehmend, was an ihren unterschiedlichen Arbeitszeiten lag ‒ deshalb verbrachten sie ihre Freizeit größtenteils getrennt und verpassten so viele Gelegenheiten, gemeinsam etwas zu unternehmen. Egal für welche Schicht sich Lyn eintrug, immer wieder musste sie nach Dienstschluss in ein leeres Haus zurückkehren, weil Trevor auf der Jagd nach Verbrechern war.
Allein den Termin für diese Geburtstagsparty festzulegen hatte bereits ein beträchtliches Maß an Organisationstalent erfordert. Sie musste den Dienstplan in der psychiatrischen Einrichtung ändern, wo sie als Krankenschwester arbeitete, endlose Telefonate mit Trevors direktem Vorgesetzten, Inspector Dan Evans, und mit seiner Kollegin Anna Bradley führen und Trevor wiederholt halb im Spaß, halb im Ernst mit ernsthaften Konsequenzen drohen, falls er sich nicht diesen Abend frei halten würde. Und selbst jetzt rechnete sie insgeheim immer noch damit, dass jeden Moment das Telefon läutete und sich die Hälfte ihrer Gäste verabschiedete. Die Vorstellung, dass die Feier sich bald in Wohlgefallen auflöste, war ihr so sehr auf den Magen geschlagen, dass sie den Räucherlachs, den kalten Braten und die selbstgemachten Salate kaum anrührte.
Lyn tröstete sich mit dem Gedanken, dass gleich die Kerzen ausgepustet wurden und sich alle auf den Alkohol stürzten. Mit etwas Glück war Trevor in Kürze so betrunken, dass er gar nicht mehr arbeiten konnte. Nach sechs Wochen war dies der erste Abend, den Trevor daheim verbrachte. Wieso war sie eigentlich auf die Schnapsidee verfallen, ausgerechnet heute dreißig Leute einzuladen?
»Blas die Kerzen aus, Trevor, dann können wir endlich einen heben«, grummelte Peter.
Trevor holte tief Luft und tat, worum Peter ihn gebeten hatte.
»He, Kumpel, ich kann es gar nicht leiden, wenn mein bester Zwirn eingesaut wird«, beschwerte sich Andrew Murphy, ein altgedienter Constable. »Auch nicht vom Geburtstagskind.« Er schnippte einen Klecks Sahne, der auf seinem Tweedsakko gelandet war, wieder in Richtung Torte.
»Wenn man bedenkt, was dieses Sakko schon alles abgekriegt hat, dann ist ein Klecks Sahne doch eigentlich gar nichts, Andy. Ist immer noch besser als Blut und andere Körpersäfte.« Anna reichte Lyn ihren Teller. »Ein großes Stück, bitte, mit einer extra Portion Sahne.«
»Wie hältst du es beim Job nur mit ihr aus?«, wollte Peter von Trevor wissen, der die Torte in große, ungleiche Stücke schnitt.
»Viel interessanter ist doch die Frage, wie Anna es mit Dan Evans und Trevor aushält, oder?« Lyn verteilte die Tortenstücke auf Tellern und reichte sie herum.
»Ich muss noch dreimal befördert werden, dann kann ich jeden Sergeant in der Stadt zu Büroarbeit verdonnern«, meinte Anna und grinste mit vollem Mund.
»Und ich muss noch fünf Dienstgrade höher klettern, dann kann ich jede Polizistin zu Schreibarbeit, Hausarbeit und Liebesdiensten verdonnern.« Peter stieß mit Trevor an. »Lass uns auf eine reine Männertruppe trinken.«
Anna schaute Peter in die Augen. »Sergeant, warten Sie nur, bis ich Ihre Vorgesetzte bin.«
»Ich bezweifle stark, dass es bei der Polizei einen Mann gibt, der auch nur den Hauch einer Ahnung davon hat, was die Gleichberechtigung der Geschlechter bedeutet«, sagte Lyn und warf Peter einen vernichtenden Blick zu.
»Ich erlaube all meinen Frauen, auch mal oben zu sein. Davon darfst du dich bald selbst überzeugen, Anna.« Peter schlang den Arm um ihre Taille.
»Darf ich daraus schließen, dass deine früheren Eroberungen die vorteilhafte Position genutzt und gleich nach etwas Besserem Ausschau gehalten haben?« Anna nahm seine Hand von ihrer Taille und ließ sie fallen.
Lyn, die Peters Gerede langweilte, brachte die leere Tortenplatte in die Küche. Die Arbeitsfläche war mit dreckigem Geschirr, zerknüllten Papierservietten, angeknabberten Hühnerflügeln, benutzten Gläsern, Messern und Gabeln übersät. Sie entfernte die Speisereste von den Tellern, verstaute das Geschirr und Besteck in die Geschirrspülmaschine und stellte sie an.
»Ich entschuldige mich für meine taktlosen Kollegen.« Trevor stellte sich hinter sie und drückte ihr einen Kuss auf den Nacken. »Du hättest deinen Bruder und deine Kolleginnen aus dem Krankenhaus einladen sollen.«
»Für meine und deine Freunde ist in diesem Haus nicht genug Platz.«
»Dann hättest du eben nur deine einladen sollen.«
»Zu deinem Geburtstag?«
Er drehte sie herum. Sie waren auf gleicher Augenhöhe, denn mit einem Meter dreiundachtzig war Lyn nur knapp drei Zentimeter kleiner als er. Er küsste sie langsam und leidenschaftlich. Mit einem Schlag fiel ihr wieder ein, weshalb sie vor sechs Monaten bei Trevor eingezogen war, und das Unbehagen, das Peter Collins und der ganze Abend hervorgerufen hatte, legte sich schlagartig.
»Danke.«
»Wofür?«, wollte sie wissen.
»Für meine Geburtstagsparty. Und dafür, dass es dich gibt, dass du mit mir zusammen bist. Was hältst du davon, wenn wir deinen Geburtstag ohne Freunde feiern?«
»Es wäre mir auch lieber gewesen, wenn wir den heutigen Abend nur zu zweit gefeiert hätten, aber ich war mir nicht sicher, ob du dann überhaupt erscheinst.«
»Hast du am Wochenende Dienst?«
»Selbstverständlich. Erzähl mir nicht, dass du frei hast.«
»Ich dachte, wir könnten mal nach Cornwall fahren.«
»Auf den Bauernhof deiner Mutter?« Sein Vorschlag zauberte ein Funkeln in ihre dunklen Augen. Bislang war sie seiner Familie noch nicht vorgestellt worden. Er hatte ihr von seiner Mutter, seinem Bruder, seiner Schwägerin, den Nichten und Neffen erzählt, und sie hatte mit ihnen auch schon telefoniert. Trotz Trevors gegenteiliger Beteuerungen glaubte sie allerdings, dass seine Familie die Verbindung zwischen ihnen beiden nicht guthieß.
»Ich möchte mit dir angeben.«
»Vielleicht mögen sie mich nicht.«
»Sie werden dich lieben.« Wieder küsste er sie. »Und dann können wir all meine geheimen Verstecke von früher aufsuchen.«
»In dem Fall tausche ich selbstverständlich meinen Dienst.«
Er zog sie noch fester an sich. »Sollen wir nach oben gehen?«
»Das fällt doch auf.«
In dem Moment flog die Küchentür auf und schlug mit voller Wucht gegen Lyns Rücken. Wie ein Wirbelwind rauschte Peter an ihnen vorbei.
»Wir verdursten noch, Kumpel, während du dich hier mit Florence Nightingale vergnügst. Ein prima Gastgeber bist du.«
Der speckige Mantelrücken glänzte im gelben Licht der Straßenlaternen, und die zerrissene Hose sah noch schlimmer aus als am Morgen. Sein Aussehen war dem Mann, der vom Meer kommend in die Jubilee Street bog, jedoch völlig gleichgültig. Mit der Flasche in der Hand torkelte er umher, stolperte plötzlich und fiel auf die Knie.
Neben der vierstöckigen Häuserzeile, die aus der Ferne sehr elegant wirkte, erschallte derbes Gelächter. Bei etwas näherer Betrachtung konnte man allerdings sofort sehen, dass die Farbe von den schönen Fassaden aus dem achtzehnten Jahrhundert abblätterte, das Holz morsch war und die meisten Fenster mit Pressspanplatten verbarrikadiert waren. Doch all das nahm der Säufer in seinem Zustand überhaupt nicht wahr. Für ihn zählte nur, dass er in der Nähe seiner »Herberge« war. Die prächtigen Häuser, die wohlhabende Kaufleute vor langer Zeit erbaut hatten, verfielen langsam. Die Stadt hatte eine Handvoll noch bewohnbarer Gebäude verschiedenen Kirchen und gemeinnützigen Organisationen überlassen, die sich um Obdachlose kümmerten.
Dem Trunkenbold glitt die Flasche aus der Hand. Als sich ihm von hinten ein Mann näherte und sie auflas, hob der Säufer den Blick.
»Hast du ein paar Groschen übrig, Kumpel?«
»Ich spendier dir die.« Der Fremde reichte ihm eine Flasche Whisky.
Der Säufer öffnete den Schraubverschluss und trank gierig. »Guter Stoff«, waren die einzig verständlichen Worte, die er herausbrachte, als sich die ungewohnte Wärme in seiner Kehle ausbreitete. »Bist ein guter Kumpel. Einer der besten … verdammt gut …«
»Lass uns hinter die Anschlagtafel gehen. Da wird man nicht ganz so nass.«
»Bist ein Weichei, das ist dein Problem. Lebst wohl noch nicht lange auf der Straße. Hier sind wir doch geschützt.« Sein Ton war jetzt streitlustig. Der Mann, der ihm die Flasche gegeben hatte, wurde misstrauisch. Er wusste, wozu Männer fähig waren, die auf der Straße lebten.
»Du magst hier ganz zufrieden sein«, entgegnete er ruhig. »Aber du hast auch schon eine halbe Flasche intus.«
»Willst du mir damit verklickern, ich hätte zu viel von deinem Fusel getrunken?« Der Säufer versuchte vergeblich, sich zusammenzureißen, als er dem anderen Mann die Flasche zurückgab. Er wollte sich aufsetzen, verlor jedoch das Gleichgewicht und fiel nach hinten in den Dreck.
»Die Flasche habe ich dir gegeben, weil ich wollte, dass du einen Schluck nimmst«, erklärte sein Kamerad. »Aber hier im Freien sind wir ungeschützt, und du weißt doch, wie die anderen sind. Wenn die davon Wind kriegen, nehmen sie uns den Sprit weg.«
»Ich pass schon auf«, sagte der Säufer mit schleppender Stimme, während sein vernebelter Verstand sich mühte, die drohende Gefahr abzuschätzen.
»Jetzt steh mal auf.« Eine Hand packte den verdreckten Mantelrücken. Das Geräusch von reißendem Stoff hallte durch die Straße. Dem Betrunkenen gelang es, sich mehr schlecht als recht ‒ und auch nur mit Hilfe des Fremden ‒ auf den Beinen zu halten. Als er nach vorn schwankte, stieg dem Mann, der ihm die Flasche gegeben hatte, der übel riechende, säuerliche Gestank ungewaschener Klamotten in die Nase.
»Noch ein Schritt.«
Der Trunkenbold fiel Kopf voran hinter die Anschlagtafel, auf der für ein Bier geworben wurde, das ‒ wenn man dem Bild glaubte ‒ üppige junge Frauen anlockte. Er drehte sich um und streckte die Arme hoch.
»Mehr!«, bettelte er.
Die Whiskyflasche wanderte erneut in seine Hand.
»Guter Stoff …« Er ließ die Flasche fallen. Sein Kumpel sah zu, wie sie über den Boden rollte und gegen ein Stück Beton schlug. Der verschüttete Whisky vermischte sich mit dem Regenwasser.
Der Mann ließ den Blick durch die Jubilee Street wandern. Wie er gehofft hatte, war weit und breit niemand zu sehen. Die Obdachlosenunterkünfte schlossen ihre Pforten früh ‒ notgedrungen, denn die Nachfrage nach Betten war meistens größer als das Angebot. Alle, die eine Weile auf der Straße gelebt hatten, wussten, dass es um diese Uhrzeit für sie in der Jubilee Street nichts mehr zu holen gab. Um fünf Uhr nachmittags standen die Ersten für einen Schlafplatz an. Spätestens um sechs waren alle Betten der Heilsarmee und in den Heimen anderer Wohltätigkeitsorganisationen vergeben. Und das Haus der katholischen Kirche, das im Kampf gegen Läuse und Flöhe stets den Kürzeren zog, war kurze Zeit später ebenfalls voll. Gegen acht Uhr erschien die Polizei und verscheuchte die Nachzügler. Obwohl die Gesetzeshüter nur sporadisch auftauchten, trieb sich nach Einbruch der Dunkelheit jedoch nur selten ein Streuner in der Gegend herum. Und so war es auch in dieser Nacht.
Bis auf die Schlaglöcher, in denen sich schwarz glänzende Pfützen gebildet hatten, schimmerten die Straßen mattgrau. Immer noch fiel leichter Regen. Der Mann lauschte: Kein Schritt, kein Motorengeräusch störte die Ruhe. Im Erdgeschoss der Heime brannte zwar Licht, aber aus den Gebäuden drang kein einziges Geräusch.
Ungerührt betrachtete er den Trinker, der mit geschlossenen Augen, weit gespreizten Beinen und schnarchend am Boden lag. Er schläft wie ein Toter, dachte der Mann und musste unwillkürlich lächeln, weil ihm diese Redewendung eingefallen war.
Die Tasche, die er dabeihatte, stellte er auf den Boden. Er öffnete sie und holte eine Plastikflasche mit einer durchsichtigen Flüssigkeit, einen großen Blechkanister und ein Jagdmesser mit zwölf Zentimeter langer Klinge heraus. Jetzt war es an der Zeit, sein Werk zu verrichten.
Pater Sam Mayberry, der das katholische Heim leitete und noch spät über den Geschäftsbüchern saß, hörte einen Schrei. Einen durchdringenden, bestialischen Schmerzensschrei. Kostbare Minuten gingen verloren, bis er die Eingangstür aufgesperrt hatte. Das Erste, was er sah, waren Flammen, die hinter der Anschlagtafel loderten. Als er hinüberlief und laut rief, jemand möge doch die Feuerwehr verständigen, entdeckte er eine dunkle Gestalt im Feuer. Just in dem Moment, wo er bei ihr war, erstarb das Wehklagen.
Als das Telefon läutete, war Lyn beinahe erleichtert. Sie nahm den Hörer ab und schaute zu Trevor hinüber, der sich mit Anna und Peter unterhielt. Dass er das Klingeln gar nicht gehört hatte, verriet ihr, dass er schon ein paar Drinks zu viel intus hatte.
»Ist Trevor da?«.
Sie erkannte den singenden walisischen Akzent von Trevors Vorgesetztem sofort.
»Ich hole ihn an den Apparat, Inspector.«
»Es tut mir leid, aber ‒«
»Ist schon in Ordnung«, unterbrach sie Evans. Das Erste, was sie als Lebenspartnerin eines Polizisten gelernt hatte, war, dass ein »Aber« nie etwas Gutes bedeutete. Auf einem Polizeiball hatte eine verstimmte Ehefrau sich bei ihr darüber beklagt, dass ein Notfall immer Vorrang hatte, selbst wenn der Gerufene sich gerade auf einer Beerdigung oder Hochzeit befand ‒ oder gar der Geburt des eigenen Kindes beiwohnte.
»Tut mir leid, Lyn.« Trevor stand im Hausflur und streifte einen gesteppten Anorak über. Anna saß schon draußen im Wagen, den der Inspector geschickt hatte.
»Hör auf, dich zu entschuldigen. Ich habe nichts anderes erwartet.« Lyn trat einen Schritt zurück, als die Wohnzimmertür aufging.
»Aber du hast dir so große Mühe gemacht …«
»Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Wir werden uns auch ohne dich amüsieren.« Mit einem Whisky in der einen und einer Zigarre in der anderen Hand stand Peter im Türrahmen.
»Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel ‒ zumindest bei dir.«
Peter registrierte Trevors sarkastischen Unterton, ignorierte ihn jedoch. Er zog an seiner Zigarre, kehrte in den lauten Raum zurück und hinterließ eine säuerliche Rauchschwade in der Diele.
»Ich komme so schnell wie möglich zurück.« Trevor wollte Lyn umarmen, aber sie wich zurück und verschwand in der Küche.
»Ich bleibe nicht wach und warte auch nicht auf dich.« Ihre Stimme klang verärgert, doch ihm blieb keine Zeit, sie zu besänftigen.
»Bis später.« Er öffnete die Haustür und ging durch den Garten. Am unteren Ende der schmalen Zufahrt wartete der Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht.
»Verdammt, du hast dir aber Zeit gelassen«, beschwerte Anna sich. »Was war denn los? Musstest du noch einen doppelten Cognac reinziehen, um dich davon zu überzeugen, dass du heute tatsächlich Geburtstag hast?«
Zwanzig Minuten später wünschte sich nicht nur Trevor, er hätte sich einen Drink mehr genehmigt. Dan Evans stand mitten auf der Jubilee Street und wartete auf sie. Links und rechts von ihm parkten Streifenwagen und Feuerwehrautos. Hinter ihm waren die Mitarbeiter der Spurensicherung damit beschäftigt, Absperrband um Pfosten zu wickeln und ein Stück Brachland und Gehweg von der Größe eines Fußballfeldes abzuriegeln. In der Mitte, hinter einer Anschlagtafel, glimmten die schwelenden Überreste eines Feuers. Die ganze Straße roch nach verbranntem Fleisch.
»Bitte, nicht noch mehr Wasser oder Schaumlöscher!«, rief Patrick O’Kelly den Feuerwehrmännern zu. Der Pathologe vom General Hospital, der auch für die Polizei arbeitete, stieg über das Absperrband und schritt zur Leiche.
»Tut mir leid wegen Ihrer Party, Trevor.« Dan Evans steckte sich einen Pfefferminzbonbon in den Mund, als Trevor und Anna aus dem Wagen stiegen.
»Mir auch«, meinte Anna.
»Hatten Sie Spaß?«, erkundigte sich der Inspector.
»Irgendwer bestimmt«, antwortete Trevor.
»Womit haben wir es zu tun?«, fragte Anna nüchtern. Sie versuchte, den wehleidigen Unterton in Trevors Stimme sogleich wieder zu vergessen. Es gab nichts Schlimmeres als einen Bullen, dessen Beziehung vor die Hunde ging. Sie erkannte die Symptome, weil ihr das Szenario vertraut war. Die Polizeiarbeit war Gift für Ehen oder längere Beziehungen. Als das Telefon wieder einmal während der entscheidenden Phase des Liebesaktes klingelte, hatte das ihrer letzten Beziehung den Gnadenstoß verpasst.
»Wir haben einen Leichnam oder was davon übrig ist.« Evans zeigte auf die rauchende Asche, die Patrick studierte, während er Latexhandschuhe, Stiefel und einen sterilen weißen Papieroverall anzog.
»Sieht nicht so aus, als wäre noch viel übrig«, merkte Trevor an.
»Mord?«, fragte Anna.
»Das muss uns Patrick sagen.« Evans führte sie zum Absperrband.
»Bau das Zelt auf, bevor die Asche über die Docks geblasen wird!«, rief Patrick seinem Assistenten zu, der eine schwere Holzkiste aus dem Fahrzeug der Spurensicherung hievte. »Gibt es Zeugen?«, fragte er den Inspector, ohne den Blick von dem verkohlten Haufen zu heben.
»Sam Mayberry.«
»Pater Sam Mayberry?«, hakte Trevor nach.
»Er behauptet, er kennt Sie.« Evans bot Trevor und Anna Pfefferminzbonbons an. »Er hat einen Schrei gehört, brauchte aber ein paar Minuten, bis er seine Tür aufgesperrt hatte. Als er dann endlich die Straße überquerte, sah er nur noch eine brennende Masse mit einem schreienden Oval in der Mitte ‒ das sind seine Worte, nicht meine.«
»Sonst hat er niemanden gesehen? Oder gehört, wie jemand weggerannt ist?«, fragte Trevor.
»Nein.« Evans sah zum Obdachlosenheim der katholischen Kirche hinüber. Sam Mayberry, ein kleingewachsener und korpulenter Mann, stand in der Tür und sprach mit Captain Arkwright, die das Heim der Heilsarmee leitete. »Aber ich habe nur kurz mit ihm geredet. Vielleicht hat er ja noch mehr zu sagen.«
»Gibt es etwas, was darauf hindeutet, dass es sich hierbei um einen Mord handeln könnte?« Trevor hatte schon mehrfach mit Patrick zusammengearbeitet. Zu Beginn einer Ermittlung musste man dem Mann jedes Wort aus der Nase ziehen. Der Pathologe äußerte sich erst, wenn er sich seiner Sache hundertprozentig sicher war. Daher gingen die Ermittlungen bei »verdächtigen Todesfällen« anfangs immer recht schleppend vonstatten.
»Ich kann verraten, dass der- oder diejenige nicht lange durchgehalten hat, falls er oder sie noch am Leben war, als das Feuer ausbrach.« Patrick richtete sich auf und drückte das Kreuz durch. »Und da war Benzin im Spiel.«
»Woraus schließen Sie das?«, wollte Evans wissen.
»Aus dem Geruch.« Patrick winkte den Fotografen der Spurensicherung heran. »Sobald das Zelt steht und alles fotografiert wurde, kann ich mir die Leiche genauer anschauen. Erst wenn sie für den Abtransport bereit ist, kann ich möglicherweise mehr sagen.«
Anna stöhnte. Ihre Hoffnung, auf die Party zurückzugehen, zerschlug sich. »Das wird eine lange Nacht.«
»Und sie wird noch länger, denn Sie müssen alle Personen befragen, die in den Obdachlosenheimen untergekommen sind«, ordnete Evans an.
Trevor, der vor acht Monaten ins Dezernat für Schwerverbrechen versetzt worden war, hielt seinen Mund. Im Gegensatz zu Anna, die erst vier Monate dabei war, wusste er, wie lang sich eine »lange Nacht« hinziehen konnte.
»Vor dem Schrei hast du nichts gehört oder gesehen, Sam?«, fragte Trevor.
»Wie ich Inspector Evans schon erzählte«, sagte Pater Sam Mayberry, der außerhalb von Kirchenversammlungen selten und im Heim nie mit seinem Titel angeredet werden wollte, »war ich im Büro und habe über den Rechnungsbüchern gesessen …«
»Um welche Uhrzeit?« Trevor spürte einen stechenden Schmerz zwischen den Augen. Er war leicht verkatert und hatte einen trockenen, metallischen Geschmack im Mund. Und der Gestank, der trotz eines weiteren Regengusses in der Luft hing, drehte ihm fast den Magen um. Am liebsten wäre er nach Hause gegangen und hätte sich zu Lyn ins Bett gelegt. Stattdessen feuchtete er mit der Zunge die Bleistiftspitze an und zückte den Notizblock.
»Viertel vor zwölf. Ich habe auf die Uhr im Flur geschaut. Die Bürotür stand offen.« Beim Nachdenken verzog Sam sein gnomartiges Gesicht. »Ich hörte einen Schrei …«
»Und vorher?«
»Nichts Ungewöhnliches. Das Geräusch des Regens …«
»Es hat geregnet?«
»Leicht, aber stetig, so wie jetzt. Als ich nach draußen lief, wurde ich nass.«
Trevor hielt seine Aussage auf dem Block fest.
»Ich war mir nicht mal sicher, ob da ein Mensch schrie. Ich bin aufgesprungen und zur Tür rausgelaufen.«
»Und was genau hast du gesehen?«
»Wie ich dem Inspector schon sagte: eine dunkle Gestalt in einem Feuerball. Sah wie eine Comicversion von einem Menschen aus.«
»Hat er gestanden oder gesessen?«
Mayberry runzelte die Stirn. »Vermutlich kniete er.«
»Wieso denken Sie das?«, fragte Anna.
»Weil die Gestalt zu weit unten am Boden war, um aufrecht zu stehen. Und sie fuchtelte mit den Armen herum, als zerkratze sie sich mit den Fingern das Gesicht.«
»Das Gesicht?« Trevor hob den Blick von seinem Notizbuch.
»Könnte das Gesicht gewesen sein oder auch der Hinterkopf. Ich kann es nicht genau sagen. Das Feuer war so hell, dass ich nur eine dunkle Silhouette erkennen konnte.«
»Und sonst ist dir niemand auf der Straße aufgefallen?«
»Ich habe mich nicht umgeschaut«, antwortete Sam mit seinem leichten irischen Akzent. »Ich habe um Hilfe gerufen. Hinterher habe ich der armen Seele die Sterbesakramente erteilt.«
»Danke, Sam.« Trevor verstaute den Notizblock und den Stift in der Hemdtasche. Da waren sie auch während der Geburtstagsparty gewesen. Aus Gewohnheit? Lyn würde es wohl eher als Konditionierung bezeichnen. »Wir brauchen eine offizielle Aussage, aber das kann bis morgen früh warten. Falls dir in der Zwischenzeit noch etwas einfallen sollte …«
»Rufe ich das Dezernat an und spreche mit dir, Inspector Evans oder Peter.«
»Ich arbeite nicht mehr mit Peter zusammen, Sam. Er ist immer noch im Dezernat für Drogendelikte.«
»Dann hat man dich also befördert?«
»Nein, es war bloß eine Versetzung.«
»Hat das Opfer geschrien, als Sie ihm die Sterbesakramente erteilt haben?« Anna trat näher. Das harsche, wenig schmeichelhafte Licht der Straßenlaterne fiel auf ihr Gesicht und akzentuierte ihre römische Nase, ihre tiefliegenden Augen mit den schweren Lidern, die markante Schädelform.
»Glücklicherweise nicht, denn da hatte sich schon eine beachtliche Menschenmenge eingefunden. Captain Arkwright war auf die Straße gekommen und Tom Morris und die Hälfte der Leute, die bei ihnen heute übernachten. Alle wollten wissen, was es mit dem Geschrei auf sich hatte.«
»Ist Ihnen jemand aufgefallen, der eigentlich nicht hier sein sollte?« Im Unterschied zu Trevor hatte Anna kein Notizbuch dabei. Ohne zu fragen, griff sie in die Tasche ihres Kollegen und zog Block und Bleistift heraus.
»Kommt darauf an, was Sie unter ›eigentlich nicht hier sein sollte‹ verstehen.«
»Die Anwohnerschaft hier in der Jubilee Street ist, um es mal so zu formulieren, ständig im Fluss«, erklärte Trevor.
»Die Gäste, die bei uns absteigen, wechseln von Nacht zu Nacht. Vor allem in meinem Haus. Natürlich gibt es in allen Unterkünften welche, die regelmäßig kommen. Captain Arkwright beherbergt die Frauen, Tom Morris die Jüngeren, und bei mir tauchen meistens die Älteren auf. Aber wir alle nehmen auch Obdachlose auf, die nur einmal hier aufkreuzen. Manche sind auf Arbeitssuche, und wenn sie keine kriegen, ziehen sie weiter. Andere, die mehr Glück haben, finden eine neue Bleibe. Ein paar tauchen nur kurz auf, und dann sieht man sie nie mehr. Diese Gruppe, vor allem die Jüngeren, haben meiner Einschätzung nach bald die Nase gestrichen voll vom Leben auf der Straße, springen über ihren eigenen Schatten und gehen wieder nach Hause.«
»Aber in der Menge waren auch Personen, die Sie nicht gekannt haben?«, hakte Anna nach.
»Sicher doch, aber nicht aus meinem Heim. Bei mir sind heute Nacht nur Stammgäste abgestiegen. Für Tom Morris oder Captain Arkwright kann ich nicht sprechen. Beide sind gutherzig und setzen sich wie ich dafür ein, dass die Leute von der Straße kommen. Doch im Kampf gegen die Autoritäten stehen wir alle auf verlorenem Posten.«
»Darüber habe ich gelesen«, sagte Anna. »Ist es nicht so, dass die Stadt versucht, die Heime zu schließen, weil diese Gegend saniert werden soll?«
Sam nickte. »Die Kirche hat mein Haus von der Stadt gepachtet, genau wie die Heilsarmee. Aber da wir eine symbolische Miete zahlen, können sie uns dichtmachen, wann immer es ihnen in den Kram passt. Und da Tom direkt Unterstützung von den sozialen Diensten erhält, die wiederum der Stadt unterstehen, hat er noch weniger in der Hand als wir.«
»Und dann bleiben den Obdachlosen nur noch die Gebäudeeingänge und die Unterführungen im Stadtzentrum.«
»Ich will ja nicht respektlos erscheinen, Sergeant Bradley, aber da Ihre Kollegen sie von dort verscheuchen und das Pier vor einer ganzen Weile abgerissen wurde, haben die Obdachlosen eigentlich keinen Ort mehr, wo sie übernachten können.« Sam schüttelte den Kopf. »Am Ende sterben sie an Unterkühlung. Es braucht nur einen harten Winter, dann sind wir sie los.«
»Möglicherweise will die Stadt ja genau das.« Anna drückte Trevor den Notizblock in die Hand.
»Ich weigere mich zu glauben, dass irgendjemand seinem Nächsten wirklich etwas Böses wünscht.«
»Vergiss nicht, die Stadtverwaltung ist kein Mensch, Sam, sondern eine knallharte, unmenschliche und gesichtslose Institution. Ich dachte, das hättest du inzwischen begriffen.« Trevor steckte den Notizblock wieder in seine Tasche.
Dan Evans’ beeindruckende, mehr als einen Meter neunzig große Gestalt näherte sich ihnen. »Patrick kann den Leichnam jetzt abtransportieren. Wir helfen den Jungs, die Meute zurückzudrängen, und fangen dann an, die Leute in den Heimen zu befragen.«
Anna und Trevor folgten ihrem Vorgesetzten.
»Hat Patrick schon etwas rausgefunden?«, fragte Trevor, als sie aus Sams Hörweite waren.
»Entweder wurde das Opfer mit Benzin übergossen oder hat es selbst getan. Erkennbar sind nur noch ein Schuh mit einem Fuß und ein verkohlter Schädel.«
Sie kehrten zu der Stelle zurück, wo Patrick die sterblichen Überreste zum Abtransport vorbereitet hatte. Vor dem Zelt, das aufgestellt worden war, damit die Asche nicht in alle vier Himmelsrichtungen verstreut wurde, warteten ein Leichensack und ein Zinksarg. Patrick durchsuchte mit einer Hand, die in einem Latexhandschuh steckte, vorsichtig die warme Glut und fischte behutsam jedes verkohlte Fundstück heraus. Ein Stück inspizierte er längere Zeit und schwenkte es dann durch die Luft. »Wangenknochen.«
Trevor starrte den flachen dunklen Knochen an, an dem noch längliche Fleischfetzen hingen.
»Er lag neben dem hier.« Patrick deutete auf einen Steinbrocken, den er in Plastik gewickelt hatte. »Der Körper des Toten muss auf ihm gelegen und so die Luftzufuhr unterbunden haben. Wie ihr sehen könnt, ist der Stein nur leicht angesengt.« Wieder musterte er das Knochenstück, holte dann einen Lichtstift aus der Brusttasche und richtete ihn auf seinen Fund. »Das da, diese diagonale Schramme im Knochen, könnte von einem Messer stammen.«
»Verstehe ich Sie richtig?«, fragte Evans.
»Gut möglich, dass erst dieser Teil des Gesichtes entfernt und anschließend das Opfer in Brand gesteckt wurde.« Er nahm eine Plastiktüte aus seinem Koffer, legte den Knochen hinein und hielt sie gegen das Licht. »Wer auch immer das getan hat, hat sauber gearbeitet. Man muss sich nur den kleinen Stummel an der Seite ansehen. Sauber durchtrennt, nicht verbrannt. Das Ohr wurde abgetrennt, bevor die Flammen es erwischten.«
Kapitel zwei
»Hattest du keine Vorstellung davon, wie es laufen wird, wenn du mit Trevor zusammenziehst?« Peter hatte die Gläser im Wohnzimmer eingesammelt und leerte sie im Spülbecken aus.
»Trevor hat mich gewarnt«, räumte Lyn ein. »Vielleicht wollte ich ihm nicht glauben.«
»Es heißt ja, Liebe mache blind. Dass man davon auch taub wird, ist mir neu.« Peter zog den Mülleimer hervor, packte den schwarzen Sack darin und verknotete ihn oben.
»Wie kommst du denn zurecht? Mit deinen Freundinnen, meine ich.«
Peter warf ihr einen Blick zu und verkniff sich die spöttische Bemerkung, dass von »Zurechtkommen« keine Rede sein konnte. Lyn hatte einen überaus reizvollen Körper, und die langen schwarzen Haare und die bemerkenswert dunklen Augen ließen sie jünger als einundzwanzig erscheinen.
Ihm war Lyn vor Trevor aufgefallen. Bei ihrer ersten Begegnung hatte sie als Krankenschwester auf der Station gearbeitet, auf der Trevor wegen einer Verletzung gelandet war. Schweren Herzens hatte Peter auf einen Annäherungsversuch verzichtet. Aber nicht wegen Trevor, denn sein Kollege war damals viel zu schwach gewesen, um überhaupt Notiz von ihr zu nehmen, sondern wegen ihres Alters. Sie hatte so rein und unschuldig gewirkt ‒ viel zu unschuldig, um mit den Altlasten klarzukommen, die ein Polizist Ende dreißig nun mal mit sich herumschleppte.
Als er mitkriegte, dass sie bei Trevor eingezogen war, klopfte er seinem Freund auf die Schulter und bezeichnete ihn als »Glückspilz«. Ein gewisses Maß an Neid war zwischen Freunden schon erlaubt. Nun aber wurde ihm eines klar: Wenn er Lyn jetzt Avancen machte, setzte er möglicherweise etwas in Gang, das er später nicht mehr kontrollieren konnte. Es würde außerdem den einzigen guten Freund verprellen, den er hatte; und dieses Risiko wollte er auf keinen Fall eingehen. Zumal ihre Freundschaft schon seit vielen Jahren bestand ‒ seit er und Trevor in den Polizeidienst eingetreten waren.
»Ich habe keine Freundin.« Er hob den Sack aus dem Mülleimer.
»Anna ‒«
»Anna und ich streiten auf dem Revier und hin und wieder auch in meiner Wohnung, aber nicht in meinem Bett. Das, was uns am meisten verbindet, sind die Differenzen. Ihr habt uns beide eingeladen, und so sind wir gemeinsam gekommen.«
»Und mehr ist da nicht?« Sie klang enttäuscht.
»Nur Geplänkel.« Er ging zur Hintertür hinaus, warf den Sack in die Mülltonne und kehrte in die Küche zurück. Er trödelte beim Händewaschen und zögerte den Moment heraus, bis er wieder Blickkontakt aufnahm. Peter war durch und durch Polizist. Er war darauf gedrillt, zu verhören, zu befragen und Straftäter aufzuspüren. Im Verlauf der Zeit hatte dieses Verhaltensmuster dazu geführt, dass er irgendwann gar nichts mehr empfand. Es war schon schlimm genug, dass er hin und wieder Mitleid für die Opfer empfand, aber im Privatleben kam er mit seinen Gefühlen überhaupt nicht zurecht.
»Du warst doch mal verheiratet?«
Das war eine Feststellung, keine Frage. Offenbar hatte Trevor ihr davon erzählt. »Meine Ehe war eine Katastrophe.«
»Weil du nie für sie da warst, wenn sie dich gebraucht hat?«
»Weil wir ganz unterschiedliche Dinge vom Leben wollten.«
»Aber wenn ihr so verschieden wart, wieso hast du sie dann geheiratet?«
»Zu viel Romantik, zu viel Alkohol. Warum heiraten die Leute? Bei ihr war es wahrscheinlich der Nestbauinstinkt. Sie wollte ein Heim, und mit meinem Gehalt kriegte sie einen höheren Kredit und ein größeres Haus.«
»So etwas über jemanden zu sagen, mit dem man mal zusammengelebt hat, ist gemein.«
»Es mag vielleicht gemein klingen, aber stimmen tut es trotzdem.« Sein Blick schweifte über die klaren Linien der blauweißen Küche. »Sie hatte … hat einen grauenvollen Geschmack«, korrigierte er sich. Er war daran gewöhnt, von seiner Frau in der Vergangenheitsform zu sprechen. Deshalb fiel es ihm manchmal schwer, sich zu erinnern, dass sie noch lebte. »Gemusterte Auslegware, die das Auge beleidigt. Und haufenweise Gartenzwerge. Auf jeder freien Fläche im Haus irgendwelcher Krimskrams, sogar auf den Arbeitsflächen in der Küche. Und überall stand EIN GRUSS AUS BRIGHTON in Goldlettern drauf.«
»Du machst Witze?«
»Nein. Keine zwölf Monate nachdem ich mit ihr vor den Altar getreten war, fing ich an, meine Abende im White Hart zu verbringen. Ich brauchte dringend ein neues Zuhause, weil ich es einfach nicht ertragen konnte, all diese Zwerge zu sehen, wenn ich stinkbesoffen war …«
»Peter!«
»Irgendwann hat sie jemanden gefunden, der ein Faible für sie und die Zwerge hatte. Da haben wir uns getrennt.«
»Trevor hat mir erzählt, du hättest ihr das Haus überlassen.«
»Ich hätte es nicht verkraftet, die Zwerge ihrer Heimat zu berauben. Und außerdem wäre ich die Dinger nicht mal auf dem Flohmarkt losgeworden.« Er faltete den Beutel auseinander, der für den Mülleimer gedacht war. »Ist ’ne traurige Geschichte.« Er versuchte, einen spöttischen Ton anzuschlagen, was ihm aber nicht so richtig gelang. »Und bei der Polizei kein Einzelfall. Die Frau des Superintendent ist auch auf und davon.«
»Das habe ich gehört. Und Dan Evans ist Witwer.«
»Der war schon Witwer, als er bei uns anfing.«
»Und Trevor hat sechs Jahre lang mit einer Frau zusammengelebt.«
Er lehnte sich an den Küchenschrank. Das war es also, worauf sie von Anfang an abgezielt hatte. Er war nicht gewillt, ihr irgendetwas zu erzählen, das Trevor ausgelassen hatte. Lyn war Trevors Baustelle, nicht seine. So wie Trevors Vergangenheit allein dessen Angelegenheit war und sonst niemanden etwas anging, es sei denn, Trevor hatte Lust, alte Kamellen aufzuwärmen.
»Er hat mir von ihr erzählt«, sagte sie, als sie merkte, dass es Peter gar nicht behagte, wenn sie in Trevors Vergangenheit herumschnüffelte. »Ihr Name war Mags, und nachdem sie ihn verlassen hatte, konnte er nicht mehr in der Wohnung leben, die sie gemeinsam gekauft hatten.«
»Die er gekauft hatte«, korrigierte Peter sie. »Mags hat nie auch nur einen Penny beigesteuert, aber Trevor war ja schon immer eine leichte Beute. Der Kerl besteht darauf, die Rechnungen seiner Freundinnen zu begleichen.«
Lyns Gesicht färbte sich dunkelrot.
»Ach, Mist!« Er öffnete eine Dose warmes Bier, das auf der Arbeitsplatte stand, und trank einen Schluck. »Das war nicht auf dich gemünzt.« Er fuhr mit dem Handrücken über seinen Mund.
»Geld interessiert mich nicht.« Sie starrte auf ein dunkles Fenster, in dem sich ihr Gesicht spiegelte. »Ich würde liebend gern einen monatlichen Betrag beisteuern und helfen, die Hypothek abzutragen. Das würde unsere Beziehung festigen. Mich stört, dass ich Trevor nie sehe. Ich habe immer das Gefühl, im Weg zu sein. Als wäre ich nur eine Last.« Tränen verschleierten ihre Augen.
»Du bist ihm wichtig, Lyn. Wahrscheinlich bist du das Einzige, was ihm im Leben etwas bedeutet.« Peter verspürte das Verlangen, ihre Tränen wegzutupfen, wagte es jedoch nicht. »Und ich kann dir garantieren, dass er niemals eine andere Frau anschauen wird, solange er mit dir zusammen ist.«
»Wie kannst du dir dessen so sicher sein?« Jedes Mal wenn Trevor nachts nicht nach Hause kam, geisterten durch ihren Kopf recht anschauliche Vorstellungen davon, wie er »die andere Frau« aufsuchte und sich mit ihr vergnügte.
»Bevor du aufgetaucht bist, hat er jahrelang keine Frau angerührt. Du bist ja viel jünger als er, und bei dir mag das anders sein, aber Männer im fortgeschrittenen Alter sind in der Regel nur dann leidenschaftlich, wenn sie eine Weile lang wie ein Mönch gelebt haben.«
»Du bist unverbesserlich!« Ihre Bemerkung über Peter klang zwar etwas verächtlich, dennoch hatten seine Worte bewirkt, dass sie nicht mehr weinte und sogar ein Lächeln zustande brachte. Sie griff nach einem Lappen und wischte über die Arbeitsflächen.
»Früher hat er mitunter Frauen von fern angehimmelt, aber mehr ist nach Mags nicht gewesen. Bewunderung aus der Distanz. Vielleicht hat er sogar die eine oder andere angesprochen, aber wenn er das getan hat ‒ das schwöre ich ‒, hatte das mit dem lob zu tun.«
»Du bist gar nicht so schlimm, wie ich dachte.«
»Verrate mir, wo der Staubsauger ist, dann mache ich im Wohnzimmer noch klar Schiff und wasche mich von weiteren Sünden frei.«
»Es ist drei Uhr früh.«
»Die Wand zwischen eurem Haus und dem der Nachbarn ist doch recht dick, oder?«
»Ja, aber ‒«
»Ich kann Unordnung nicht leiden, junge Frau.« Er öffnete die Besenschranktür im Flur. »Da ist er ja.«
Keine zehn Minuten später hatten sie mit vereinten Kräften aufgeräumt, und Peter schlenderte die Strandpromenade hinunter, die zu seiner Wohnung führte. Zum Abschied hatte er Lyn ganz nonchalant einen flüchtigen Kuss auf die Wange gehaucht, aber erst als die Haustür schon offen stand und die Nachbarn oder vorbeikommende Passanten sie hätten sehen können. Nur so vermochte er der Versuchung zu widerstehen, sie an sich zu reißen und ihr zu geben, was sie sich wünschte. Eigentlich war das Trevors Aufgabe, doch offenbar schnallte der Bursche das nicht.
Nachdem Peter sich verabschiedet hatte, wanderte Lyn ruhelos durchs Haus. Sie löschte das Licht, prüfte, ob alle Türen abgeschlossen waren, und verrückte Gegenstände, die schon an ihrem angestammten Platz standen. Als ihr kein Vorwand mehr einfiel, weshalb sie noch länger aufbleiben sollte, ging sie nach oben ins Schlafzimmer. Auf dem Kopfkissen lag Trevors Geschenk. Eigentlich hatte sie es ihm vor dem Schlafengehen überreichen wollen. Sie nahm die kleine Schachtel in die Hand, zupfte an dem blauen Band herum, das um das silberne Geschenkpapier gewickelt war, und stellte sie auf seinen Nachttisch. Im Badezimmer zog sie das kurze schwarze Kleid aus und duschte sich eine halbe Stunde lang heiß. Sie hätte es Trevor gegenüber niemals zugegeben, aber sie schindete Zeit in der Hoffnung, dass sie bei seiner Rückkehr noch wach war.
Als sie schließlich unter die Bettdecke kroch, nahm sie einen Reiseführer von Trevors Nachttisch. Vermutlich hatte er ihn gekauft, als er den Besuch seiner Mutter plante, die auf einem Hof in Südwestengland lebte. Vielleicht konnte er ja doch nachvollziehen, wie sie sich fühlte?
Sie wollte noch ein paar Seiten lesen, doch am Ende überwältigte sie der Schlaf. Als der Wecker um halb sieben klingelte, fiel ihr Blick als Erstes auf das blau und silbern verpackte Geschenk. Wieder einmal hatte sie eine Nacht allein verbracht.
»Ist das der Letzte?«, erkundigte sich Trevor bei Tom Morris. Der Sozialarbeiter war von der Stadt abgestellt worden, um die Wohlfahrtseinrichtung zu unterstützen, die das Obdachlosenheim führte. Toms liebenswürdiger Umgang mit den Schlafgängern und der Respekt, den ihm selbst die schwierigsten Kandidaten trotz seiner Jugend zollten, beeindruckten Trevor sehr. Morris, der nicht älter als fünfundzwanzig wirkte, sah gut aus und war sympathisch. Liebevolle Bemerkungen über die Ehefrau ließen Trevor darüber spekulieren, wie gut Mrs. Morris mit dem Umstand zurechtkam, dass ihr Gatte laut eigenem Bekunden sechs Tage die Woche außer Haus schlief. Nach dem Lächeln von Morris zu urteilen, verkraftete seine Gattin es weit besser als Lyn.
Er beobachtete, wie Morris’ Finger über eine Namensliste in einem speckigen Buch fuhr. »Siebenundzwanzig.«
Trevor blätterte die vor ihm liegenden Unterlagen durch. »Siebenundzwanzig«, bestätigte er.
»Dann sind wir durch.«
Da Sam Mayberry das Feuer zuerst entdeckt hatte und die Obdachlosen erst später dazugestoßen waren, rechnete niemand damit, von ihnen etwas Neues zu erfahren. Doch Evans wollte auf Nummer sicher gehen und hatte darauf bestanden, dass jeder sich ein Heim vorknöpfte und dass mit allen geredet wurde, die in der Jubilee Street übernachtet hatten.
»Freut mich, dass die Mitarbeiter vom Dezernat für Schwerverbrechen so gründlich arbeiten. Wenn die Heime am Morgen die Pforten öffnen, kann niemand sagen, wohin die Schlafgänger gehen.« Superintendent Bill Mulcahy stand vor der schäbigen Flurtür und trug eine griesgrämige Miene zur Schau, die nicht nur vom trostlosen Umfeld herrührte. »Patrick erwartet uns in der Leichenhalle.«
»Ich bin fertig, Sir.« Trevor warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Halb acht. Am liebsten wäre er jetzt nach Hause gegangen, um Lyn zu sehen, zu duschen und sich umzuziehen. Doch er wusste, dass es völlig zwecklos war, Mulcahy um dieses Privileg zu bitten.
»Danach setzen wir uns im Dezernat zusammen und sprechen den Fall durch.«
»Sir.« Trevor ging zur Tür. Auf einmal lechzte er nach dem Cognac, den er daheim hatte stehen lassen, und fragte sich, ob das ein Zeichen von Alkoholismus war. Bislang hatte er frühmorgens noch nie das Verlangen gehabt, sich einen Drink zu genehmigen. Und dass ein neuer Tag angebrochen war, merkte er erst, als er Mulcahy aus dem hell erleuchteten Flur nach draußen in den verregneten grauen Morgen folgte. Nach seiner inneren Uhr war es noch Nacht. Tiefe Nacht. Zeit, ins Bett zu gehen und mit Lyn zu kuscheln.
»Ich will, dass innerhalb einer Stunde alles in Zone A mit Schildchen versehen und im Labor ist«, schallte Mulcahys Stimme über das abgesperrte Gelände. Im fahlen Licht der Morgendämmerung schalteten Männer in weißen Overalls, Stiefeln und mit Latexhandschuhen ihre Taschenlampen aus und kämmten das Gelände ab. Unter den Mitarbeitern von der Spurensicherung entdeckte Trevor auch Andrew Murphy und Chris Brooke. Ihre gequälten Mienen verrieten ihm, dass sie noch eine ganze Weile lang auf der Party geblieben waren und nun unter einem Kater litten.
»Habe das hier in Zone A gefunden, Sir.« Andrew hielt eine Plastiktüte mit einer Whiskyflasche hoch.