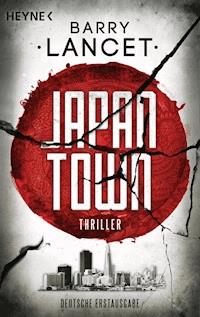9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Töte die Vergangenheit
Jim Brodie, feingeistiger Experte für asiatische Kultur und zugleich in den Kampfkünsten bewandert, hat in Tokio die Ermittleragentur seines Vaters übernommen. Eines Tages suchen ihn der alte Akira Miura, ehemaliger Geschäftsmann und Soldat im Zweiten Weltkrieg, sowie sein dubioser Sohn auf. Miura fürchtet, dass ihm Feinde aus der Vergangenheit nach dem Leben trachten. Die Spur deutet auf die Triaden und auf ein schreckliches Kriegsverbrechen hin, dessen Ausläufer in die Gegenwart zu reichen scheinen. 12 Stunden später wird Miuras Sohn im Vergnügungsviertel Tokios ermordet aufgefunden, grausam verstümmelt. Brodie muss in die Welt der Geheimbünde und der Mächtigen eintauchen in einem Kampf um Schuld und Sühne, in dem ein Menschenleben nichts zählt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Ähnliche
ZUM BUCH
»Acht waren schon tot, als Akira Miura vor unserer Tür auftauchte und um sein Leben bangte. Als der Tumult draußen losbrach, führte ich gerade ein Ferngespräch mit London, bei dem ich einer Original-Tuschezeichnung von Sengai, dem bekannten japanischen Zenpriester, auf die Spur kommen wollte. Das Gerücht war aus Großbritannien gekommen, also ließ ich nichts unversucht, dieses mutmaßliche Juwel für einen Klienten in San Francisco dingfest zu machen, der jeden töten würde, um es zu bekommen, vor allem aber mich, wenn ich ihm nicht dazu verhalf. Menschen brachten sich schon für weniger um. Eine Erkenntnis, die sich jeden Tag aufs Neue bestätigte, seit ich bei Brodie Security war ...«
ZUM AUTOR
Barry Lancets große Liebe zu Japan nahm vor über 30 Jahren ihren Anfang. Nach einer ersten Asienreise beschloss Lancet, seine Heimat Kalifornien zu verlassen und für längere Zeit in Tokio zu leben. Er blieb über 20 Jahre in Japan, arbeitete bei einem großen Verlag und entwickelte zahlreiche Bücher vor allem über die japanische Kunst und Kultur. Als Lancet eines Tages aufgrund eines Missverständnisses stundenlang von der Tokio Metropolitan Police verhört wurde, beschloss er, einen Thriller zu schreiben: Sein Debüt Japantown war geboren.
Besuchen Sie Barry Lancet im Internet unter www.barrylancet.com
LIEFERBARE TITEL
Japantown
BARRY LANCET
TOKIO
KILL
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Ulrike Clewing
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe TOKIO KILL erschien 2014
bei Simon & Schuster, New York
Vollständige deutsche Erstausgabe 06/2015
Copyright © 2014 by Barry Lancet
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: Büro Überland,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock/
Tairy Greene; MC_PP; Angelo Giampiccolo
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-15828-6
www.heyne.de
Die Rückseite hat auch eine Rückseite.
JAPANISCHES SPRICHWORT
TAG 1
TIRADEN
KAPITEL 1
TOKIO, 14:36 UHR
Acht waren schon tot, als Akira Miura vor unserer Tür auftauchte und um sein Leben bangte.
Als der Tumult draußen losbrach, führte ich gerade ein Ferngespräch mit London, bei dem ich einer Original-Tuschezeichnung von Sengai, dem bekannten japanischen Zenpriester und Schöpfer des berühmten Werkes Kreis-Dreieck-Viereck, auf die Spur kommen wollte. Das Gerücht war aus Großbritannien gekommen, also ließ ich nichts unversucht, dieses mutmaßliche Juwel für einen Klienten in San Francisco dingfest zu machen, der jeden töten würde, um es zu bekommen, vor allem aber mich, wenn ich ihm nicht dazu verhalf.
Menschen brachten sich schon für weniger um. Eine Erkenntnis, die sich jeden Tag aufs Neue bestätigte, seit ich bei Brodie Security war, der Agentur für Privatermittlungen und Personenschutz, die mein Vater vor über vierzig Jahren in der japanischen Hauptstadt gegründet hatte.
Säße ich jetzt in meinem Antiquitätengeschäft in San Francisco statt in Tokio hinter dem ramponierten Schreibtisch meines Vaters, hätte mich das Gebrüll im Vorzimmer kalt gelassen. In Japan aber galt ein lautstark geführtes Wortgefecht als äußerst schwerer Verstoß gegen die guten Sitten.
Wenn nicht mehr.
Mari Kawasaki klopfte an meine Tür. »Brodie-san, ich glaube, Sie sollten mal kommen.«
Sie war dreiundzwanzig, sah aber aus wie sechzehn. Mari war die Computerexpertin in der Agentur. Als ich in die Stadt kam, stand sie mir zur Seite. Wir waren ein kleines Unternehmen, und jeder machte so ziemlich alles.
»Darf ich Sie später zurückrufen?«, fragte ich meinen Londoner Gesprächspartner. »Ich muss hier kurz etwas erledigen.«
»Natürlich«, sagte er. Ich notierte rasch seine Bürozeiten, entbot ihm einen höflichen Gruß zum Abschied und trat in den Flur im Erdgeschoss hinaus.
Mari deutete zur anderen Seite des Raums, wo drei stahlharte Burschen von Brodie Security einen vierten Mann gegen die Wand drückten. Der Mann warf ihnen empörte Blicke zu, und als meine Leute keine Anstalten machten, nachzugeben und von ihm abzulassen, stieß er jene Art verzweifelter Seufzer aus, mit denen Angestellte im mittleren Management renommierter Firmen ihre Untergebenen zu demütigen pflegen.
Auch das zeigte keine Wirkung.
Mari verdrehte die Augen. »Er ist einfach hier reingeplatzt und wollte mit Ihnen reden, ohne einen Grund zu nennen oder am Empfang zu warten.«
Als der unangemeldete Besucher sich den Leuten von Brodie Security widersetzte, wurde er kurzerhand zur Raison gebracht. Unser Job brachte es mit sich, dass man auf alle möglichen zwielichtigen Gestalten traf. Die Älteren erzählen sich immer wieder die Geschichte von diesem reaktionären Irren, der mit gezogenem Kurzschwert aus dem Aufzug sprang und zwei meiner Leute ins Krankenhaus brachte.
»Beruhigen Sie sich«, raunzte einer der drei Männer. »Wenn Sie sich bitte einfach nur zum Empfangsbereich …«
Der Büromensch war außer sich. »Aber es ist wichtig. Mein Vater ist ein kranker Mann. Verstehen Sie das nicht?« Dann sah er mich und brüllte auf Japanisch durch die Halle. »Sind Sie Jim Brodie?«
Da ich der einzige Weiße inmitten einer Ansammlung von Asiaten war, stellte das sicher keine allzu gewagte Schlussfolgerung dar. Unser Überraschungsgast war auf jene unaufdringliche Art, wie sie Japanern eigen ist, recht gutaussehend. Er war in den Fünfzigern und steckte in dieser unerlässlichen Bürokluft – in seinem Fall dunkelblau – mit weißem Hemd und perfekt gebundener roter Seidenkrawatte, die ihn einiges gekostet haben dürfte. An den Handgelenken blitzten platinverdächtige Manschettenknöpfe. Seine Erscheinung war tadellos, und unter normalen Umständen wäre er als harmlos durchgegangen. Jetzt aber war er so aufgebracht, dass er sich fast von innen her aufzulösen schien.
»Ja, das bin ich«, antwortete ich in seiner Muttersprache.
Er straffte sich. Seine Augen füllten sich mit Wasser. »Bitte erlauben Sie, dass mein Vater hereinkommt. Es geht ihm nicht gut.«
Aller Augen richteten sich auf den Greis, der geduldig am Empfang wartete. Der Mann hatte volles silbergraues Haupthaar und sah auf eine ganz ähnlich unauffällige Weise recht gut aus: wohlgeformte Wangenknochen, ein festes Kinn und dunkelbraune Augen von der Art, die Frauen typischerweise ins Schwärmen geraten lassen.
Zum Gruß schwang er einen hölzernen Spazierstock und tapste auf unsicheren Beinen um den unbesetzten halbrunden Tresen herum, der in unseren schmucklosen Räumlichkeiten als Empfangdiente. Mit bemerkenswerter Entschlossenheit schlurfte er weiter. Seine Hände zitterten. Der Stock schwankte. Er keuchte bei jedem Schritt. Dennoch entbehrten seine Mühen nicht einer gewissen Noblesse.
Er hatte sich eigens für diesen Ausflug stadtfein gemacht. Ein brauner, maßgeschneiderter Anzug, der vor drei Jahrzehnten vermutlich schon unmodern gewesen war. Als er näherkam, ließ der Duft von Mottenkugeln darauf schließen, dass er sich die Klamotten für diesen Besuch aus einem angestaubten Kleiderschrank gefischt hatte.
Einen Meter vor mir blieb er stehen und blinzelte mit unerschrockenen braunen Augen zu mir hoch. »Sind Sie der Gaijin, von dem es in den Zeitungen hieß, dass er die Japantown-Killer in San Francisco geschnappt hat?«
Gaijin bedeutet soviel wie ›Fremder‹, wörtlich ›außenstehende Person‹.
»Schuldig im Sinne der Anklage.«
»Und sich davor noch mit den Yakuza angelegt hat?«
»Ebenfalls schuldig.«
Es war unvermeidlich, dass die Morde auf der anderen Seite des Ozeans und das Intermezzo mit der japanischen Mafia in Japan in die Schlagzeilen kamen.
»Dann sind Sie mein Mann. Das klingt nach reichlich Kerben im Colt.«
Ich lächelte, und sein Sohn, der sich von der anderen Seite genähert hatte, flüsterte mir ins Ohr. »Das sind die Medikamente. Die machen ihn so sentimental, manchmal sogar etwas wirr. Dass er herkommen könnte, habe ich ihm nur gesagt, damit er Ruhe gab. Hätte doch niemals gedacht, dass er es tatsächlich tut.«
Sein Vater runzelte die Stirn. Er hatte nicht gehört, was sein Sohn gesagt hatte, aber er war aufgeweckt genug, um es sich zu denken. »Mein Sohn ist der Ansicht, dass ich nicht mehr ganz dicht bin, nur weil ich ein paar Jahre zugelegt habe. Ja, ich bin dreiundneunzig und war bis letzten Dezember durchaus in der Lage, ohne diesen verdammten Stock fünf Kilometer am Tag zu laufen.«
»Ein paar Jahre? Vater, du bist sechsundneunzig. Du solltest nicht mehr so in der Stadt herumrennen.«
Der Alte hielt seinem Sohn den Stock unter die Nase. »Das nennst du herumrennen? Auf dem Friedhof in Aoyama gibt es Grabsteine, die bewegen sich schneller als ich, aber hier oben, meine grauen Zellen, die funktionieren noch sehr gut. Und im Übrigen, wenn ein Mann in meinem Alter nicht mehr das eine oder andere Jahr unter den Tisch fallen lässt, um der Damenwelt zu imponieren, dann ist es vorbei mit ihm.«
Der Typ fing an, mir sympathisch zu werden.
»Warum gehen wir nicht in mein Büro?«, schlug ich vor. »Dort ist es ruhig. Mari, führst du die Herren bitte hinein? Ich komme gleich nach.«
»Folgen Sie mir bitte«, forderte sie die beiden auf.
Nachdem Mari die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, wandte ich mich einem blassgesichtigen Mitarbeiter zu, der direkt am Eingang stand. »Gibt es sonst noch etwas, außer dass sie ohne Termin aufgetaucht sind?«
»Nur den Nachnamen. Miura.«
»Gut, danke. Wissen Sie, wo Noda ist?«
Kunio Noda war unser Chefdetektiv und im Wesentlichen der Grund, weshalb ich unbeschädigt aus der Japantown-Sache rausgekommen bin.
»Er ist im Asakusa-Fall unterwegs, sollte aber bald zurück sein.«
»Schicken Sie ihn zu mir, sobald er da ist, okay?«
»Mach ich.«
Ich ging zurück in mein Büro und tauschte Visitenkarten und die üblichen Verbeugungen mit den Neuankömmlingen aus. Der Name des Vaters war Akira Miura, und er war früher Senior-Vizepräsident in einer größeren japanischen Handelsgesellschaft gewesen.
Der Sohn mit der teuren Krawatte war ein Fuku bucho oder stellvertretender Bereichsleiter bei Kobo Electronics. Auch seine Firma war recht ansehnlich, seine Position hingegen weniger, zumal für einen japanischen Büroangestellten in den Fünfzigern. Ordentlich Geld verdiente man erst, wenn man es zum Bucho, der nächsten Stufe für Yoji Miura, gebracht hatte. Also lebte er entweder über seine Verhältnisse oder von irgendwoher floss Geld.
Während ich mich setzte, sagte ich: »So, meine Herren, wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
Bevor sie antworten konnten, klopfte Mari an die Tür und brachte auf einem Tablett grünen Tee in gemusterten Porzellantassen mit Deckeln herein. Gästeporzellan. Höflichkeit ist in Japan oberstes Gebot.
»Ich war im Krieg, Mr. Brodie«, fing Akira Miura an, nachdem Mari mein Büro verlassen hatte.
Spricht ein Japaner vom Krieg, dann meint er den Zweiten Weltkrieg. Und nur die jüngsten Soldaten – jetzt die ältesten Veteranen – waren heute noch am Leben. Nach dem Weltkrieg war Japan in keinen Waffengang mehr verwickelt worden.
»Aha«, sagte ich.
Miura senior fixierte mich mit den Augen. »Was wissen Sie über japanische Geschichte, Mr. Brodie?«
»Eigentlich eine ganze Menge.«
Meine Arbeit auf dem Gebiet der japanischen Kunst machte profunde Kenntnisse über die Geschichte des Landes, seine Kultur und Tradition zwingend erforderlich.
»Wussten Sie, dass in der alten japanischen Armee Befehle fraglos befolgt wurden, oder der kommandierende Offizier jagte einem eine Kugel in den Kopf?«
»Ja.«
»Gut. Dann wissen Sie vermutlich auch, dass mein Land einen Teil der Mandschurei erobert, ihm den Namen Mandschukuo gegeben und einen Marionettenstaat errichtet hatte.«
Ich wusste es, was ihn zu freuen schien.
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts war Japan in China einmarschiert, hatte diesen Übergriff mit dem Bau von Eisenbahnlinien besiegelt, Siedler ins Land geschafft und Filialen für seine riesigen Konglomerate errichtet. Dann setzte es 1932 bekanntermaßen Puyi als Chinas zwölften und letzten Herrscher der Qing-Dynastie ein, vom Volk als der letzte Kaiser verehrt.
Miura sagte: »1940 wurde ich als Offizier an die mandschurische Front geschickt. Meine Männer und ich haben viele Schlachten geschlagen. Mit einem neuen Befehl wurden wir dann an einen Außenposten an der Grenze verlegt, nach Anli-dong. Wir hatten den Auftrag, die Gegend zu stabilisieren. Und so wurde ich Bürgermeister von Anli und Umgebung. Zahlenmäßig waren wir weit unterlegen, zweihundert zu eins, aber die japanische Armee stand damals im Ruf, sehr kampfstark zu sein, sodass es uns gelang, alles ohne größere Zwischenfälle unter Kontrolle zu halten. Zwar bin ich immer für Gewaltlosigkeit eingetreten und habe mich auch immer daran gehalten, aber mein Vorgänger hatte ein ziemlich skrupelloses Regiment geführt. Jeder männliche chinesische Provokateur kam vor ein Erschießungskommando oder Schlimmeres. Und die Frauen wurden Kriegsbeute. Und genau deshalb brauche ich Sie.«
»Für etwas, das sich vor über siebzig Jahren ereignet hat?«
»Haben Sie von den neuesten Einbrüchen in Tokio gehört?«
»Klar. Zwei Familien im Abstand von sechs Tagen brutal niedergemetzelt.«
»Haben Sie auch mitbekommen, dass die Polizei Triaden im Verdacht hat?«
»Natürlich.«
»Sie hat recht.«
Allein die Erwähnung dieser schwerterschwingenden chinesischen Gangs ließ mich zusammenzucken. In San Francisco war ich mit ihnen aneinandergeraten, damals, als ich noch im Mission District wohnte. Das hatte kein gutes Ende genommen.
»Was macht Sie so sicher?«
Miuras faszinierend braune Augen füllten sich mit Angst: »In Anli-dong sagten sie mir, dass sie uns kriegen würden. Jetzt haben sie uns.«
KAPITEL 2
Er hatte meine ganze Aufmerksamkeit. »Was macht Sie so sicher, dass die Triaden es nach all den Jahren auf Sie abgesehen haben?«
»Weil ich weiß, was nicht in den Zeitungen stand.«
»Nämlich?«
»Zwei von meinen Männern sind tot.«
Meine Männer. »Und das haben Sie der Polizei gesagt?«
»Uma no mimi ni nembutsu«, entfuhr es ihm mit unverhohlener Verachtung.
Er hätte auch sagen können: Perlen vor die Säue. Was soviel bedeuten sollte wie: Die japanische Polizei ist zu einfältig, um das zu begreifen.
»Aber Sie haben es ihnen gesagt?«
Er zuckte mit den Schultern. »Sie waren nicht davon zu überzeugen, dass die Morde möglicherweise auf ›längst vergangene Zeiten‹ zurückgehen.«
In den Kriegsjahren trat die japanische Polizei zu Hause genauso rigoros auf wie die Armee im Ausland. Nachdem der Krieg gewonnen war, wurde die Polizei entmachtet. Das Vakuum füllte eine äußerst schwerfällige Bürokratie. Bis heute sind all ihre Entscheidungen geprägt von großer Bedächtigkeit, sodass für Brodie Security und ihresgleichen eine Menge zu tun ist.
»Und was lässt Sie etwas anderes annehmen?«
»Mein Bauchgefühl.«
Sein Sohn lächelte huldvoll.
Ich ignorierte Miura junior, wenngleich mir seine Bemerkungen über den labilen Zustand seines Vaters nicht aus dem Kopf gingen. »Und was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl?«
»Dass es kein Zufall ist, wenn zwei meiner Männer so schnell hintereinander umgebracht werden.«
Ich sagte: »Nehmen wir an, dass Sie recht haben. Wie könnte Brodie Security helfen?«
»Indem Sie mein Haus bewachen.«
Sein Sohn wollte, dass ich ihm den Gefallen tat, also sagte ich: »Das können wir gerne machen. Aber Sicherheit erfordert Männer, die in Teams arbeiten, und das ist nicht billig. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen?«
»Ich bin mir sicher.«
Ich sah seinen Sohn an, der widerwillig nickte.
»Okay«, sagte ich. »Wir stellen ein paar Tage Männer für Sie ab.«
»Außerdem möchte ich, dass Sie herausfinden, wer meine Freunde niedergemetzelt hat.«
»Die Morde haben es auf die Titelseite geschafft. Sie können sich darauf verlassen, dass die bei der Polizei ganz oben auf der Liste stehen.«
Er schüttelte den Kopf. »Die Polizei ist nichts als ein Haufen Idioten. Ich gab ihnen einen Tipp, und die haben es nicht einmal für nötig befunden, das zu überprüfen. Beide Männer haben zusammen gedient, weil sie in derselben Gegend aufgewachsen sind. Am selben Ort wurden sie auch umgebracht. Es handelt sich nicht um eine Einbrecherbande, die es auf die Nachbarschaft abgesehen hat, wie die Polizei vermutet, sondern um die Triaden von Anli-dong, die sich meine Männer vorgenommen haben.«
Es klopfte an der Tür und Noda rumpelte herein, ohne auf eine Reaktion zu warten. Der Chefdetektiv war klein, gedrungen und hatte den Körperbau einer Bulldogge – breite Schultern, kräftiger Oberkörper und ein plattes, humorloses Gesicht. Sein auffälligstes Merkmal war eine Narbe über der Augenbraue, an der Stelle, an der ihn einst ein Yakuza-Schwert getroffen hatte. Nodas Antwort hinterließ jedoch eine noch tiefere Wunde.
Ich stellte die Herren einander vor und brachte Noda auf den Stand der Dinge. Als ich auf die Triaden zu sprechen kam, stöhnte er auf.
»Wie? Du hältst Triaden für möglich?«, fragte ich, um meinem chronisch einsilbigen Ermittler eine erhellendere Antwort zu entlocken.
Chinesische Banden gab es in Japan schon seit Jahrzehnten. Ihre Wurzeln ließen sich bis an das Ende der Ming-Dynastie in China zurückverfolgen, als sie sich als politische Gruppierung zusammen mit der Obrigkeit gegen die einfallenden Mandschuren zur Wehr zu setzen begannen und als Helden gefeiert wurden. Glanz und Gloria verblassten mit der Zeit, aber die Bestie brauchte Futter. Die Anführer der Triaden suchten andere Möglichkeiten, um versiegende Quellen wieder zum Sprudeln zu bringen und stießen auf das leichte Geld – Schutzgeld, Erpressung, Kreditwucher, Prostitution und Drogen. Zuerst zu Hause und dann natürlich auch in Übersee. In Tokio trieben diese Gangs in obskuren Bezirken wie Shinjuku, Ueno und anderen Enklaven ihr Unwesen. Ein größerer Stützpunkt befand sich in Chinatown in Yokohama, knapp dreißig Zugminuten entfernt.
Noda zuckte mit den Schultern. »Kann schon sein.«
»Und?«
»Schwierig.«
Mundfaul wie immer.
Miura sah erst Noda, dann mich an. »Also übernehmen Sie den Fall?«
»Noda?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ist unser Job.«
Was soviel hieß wie, dass Brodie Security mit den Triaden schon zu tun gehabt hatte. Das war es, was ich eigentlich wissen wollte. Ich war noch neu im Geschäft meines Vaters, hatte die Hälfte der Firma erst vor elf Monaten übernommen. Aber meine Ahnungslosigkeit vor einem Klienten zur Schau zu stellen, kam nicht in Frage.
»Okay«, sagte ich. »Wir können uns die Sache mal ansehen. Die Leute, die mein Vater noch angeheuert hat, machen ihre Arbeit sehr gut.«
»Das werden sie auch müssen«, sagte Miura, während sein Blick Unheil witternd auf Noda ruhte.
»Wie viele sind von der Truppe noch übrig?«
»Achtundzwanzig haben den Krieg überlebt, aber die meisten sind schon lange tot. Zu unserem letzten Treffen kamen nur noch sieben. Mitsumoto starb anschließend an einem Aneurysma im Kopf und Yanaguchi an der Vogelgrippe, die er sich letztes Jahr bei einem Besuch in Anli eingefangen hatte. Vor den Überfällen waren wir noch zu fünft.«
Blieben also noch drei.
»Wo sind die anderen beiden?«
»Einer ist in das Ferienhaus eines Freundes in Kiushu gefahren. Wo genau, wollte er mir nicht sagen. Der andere ist zu seinem Sohn aufs Land gegangen.«
Noda und ich sahen uns an. Der Rest von Miuras Truppe hatte also Tokio fluchtartig verlassen. Wenn das kein Beleg für wahre soldatische Tugend war.
Eine letzte Frage hatte ich noch:
»Wenn Sie ihr Amt in Anli-dong mit dem gebotenen Fingerspitzengefühl ausgeübt haben, warum möchte dann jemand Sie und Ihre Männer nach all der Zeit am liebsten tot sehen?«
Er seufzte: »Da war das Schmutzige an der Sache. Immer wenn hohe Tiere vorbeikamen, erwarteten sie eine Art Unterhaltungsprogramm. Jedes Mal wurden wir aufgefordert, ›Verräter auszujäten‹ und ›Kontrollen einzurichten‹.
Der erste Befehl bedeutete, dass irgendwelche Bewohner des Dorfes in einer Reihe im Gefängnis aufgestellt werden mussten, um Schießübungen abzuhalten. Der zweite beinhaltete die private Begutachtung lokaler Schönheiten. Diesen Befehlen konnten wir uns nicht widersetzen, sonst hätten sie …«
»… Ihnen eine Kugel in den Kopf gejagt.«
Miuras Oberkörper sackte unter der alten Schuld zusammen. »Ohne mit der Wimper zu zucken.«
»Verstehe.«
»Nach dem ersten Besuch eines solchen hohen Tiers drohten mir die Triaden. Ich sagte ihnen, dass ich Befehlsgewalt nur über die hätte, die meinem Kommando unterstanden, darüber nicht. Das hat sie nicht überzeugt. Wenn Sie die Uniform der Machthaber tragen, dann müssen Sie dafür bluten. Damals haben sie nicht gehandelt, weil sie wussten, dass weitere Dorfbewohner leiden würden, wenn es zu Übergriffen auf Soldaten kam. Aber sie sagten mir, dass sie eines Tages zurückkommen würden.
Jahre später, als China japanischen Touristen endlich die Einreise erlaubte, fuhren ein paar von uns zurück. Wir besuchten die Familien, die wir kannten. Wir waren entsetzt, als wir sahen, wie arm sie waren und es heute noch sind. Wir sind oft wieder hingefahren, haben ihnen Geld und moderne Geräte gebracht, japanische Reiskocher zum Beispiel. Wir aßen und tranken zusammen und taten unser Möglichstes, um es wieder gutzumachen. Aber wir konnten nicht für alle etwas tun. Ich glaube, dass unsere Reisen ein altes Ressentiment wieder aufleben ließen. Wir verteilten sogar unsere Adressen. Das mag ein Fehler gewesen sein.«
Noda knurrte. »Vergeltung wurde gefordert.«
Miura pflichtete ihm durch ein Kopfnicken bei. »Mein Mörder ist in Tokio, Brodie-san. Das spüre ich.«
Ein Team von sechs Leuten eskortierte Akira Miura nach Hause.
Dort angekommen, würden zwei erst die Nachbarschaft und anschließend die Läden in der Umgebung durchkämmen. Zwei andere würden das Haus sichern und Fenster, Türen und alles andere verschließen, wodurch man sich von außen Zugang verschaffen konnte. Dann würden Haus, Garage und der Garten auf Abhörgeräte, Peilsender und Brandsätze durchsucht. Das dritte Duo würde mit Miura das Sicherheitsprotokoll ausarbeiten, einschließlich Fluchtplan für den Notfall, und die folgenden zwölf Stunden zu seinem Schutz dableiben, bis es von zwei ausgeruhten Bewachern abgelöst würde.
Aber bevor sie das Büro von Brodie Security verließen, setzte die Truppe sich mit den Miuras im Besprechungsraum zusammen, um die Vorgehensweise zu besprechen. Mitten im Gespräch schlich sich der Sohn plötzlich davon und suchte Noda und mich in meinem Büro auf.
»Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie sich meines alten Herren annehmen«, sagte er. »Die Morde haben ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Aber ich möchte ganz offen mit Ihnen reden. In letzter Zeit haben wir Anzeichen von Verwirrtheit, einer leichten Paranoia, an ihm erkannt.«
»Ist er früher schon einmal so aus der Fassung geraten?«, erkundigte ich mich.
»Nein, aber die Ärzte haben uns erklärt, dass wir uns auf einen langsam fortschreitenden Abbau einstellen müssen.« Noda und ich warfen uns Blicke zu.
»Okay, dann weiß ich Bescheid«, sagte ich. »Trotzdem möchten wir den Fall ernstnehmen, bis wir vom Gegenteil überzeugt sind.«
Yoji Miura schien nicht überzeugt zu sein. »Ihre Gegenwart wird meinen Vater beruhigen, kann also nicht schaden. Aber unter uns, Sie werden sehen, das ist ein Babysitter-Job.«
Nodas Blick verfinsterte sich. »Zwei Männer ermordet. Das ist wohl doch etwas mehr als ein Babysitter-Job.«
Der Chefdetektiv sprach mit leiser, furchteinflößender Stimme. Yoji starrte ihn entgeistert an, bis er begriff, dass Nodas Erregung nicht ihm, sondern dem galt, was sich da draußen möglicherweise zusammenbraute, in Lauerstellung lag, oder eben auch nicht. Trotzdem machte Miura junior einen großen Bogen um Noda, als er mein Büro verließ. Der Detektiv folgte ihm kurz darauf und murmelte undeutlich etwas wie »Von nichts eine Ahnung, diese Typen« vor sich hin.
Wieder allein in meinem Büro, lehnte ich mich in meinem Sessel zurück und starrte an die Decke. Tief in mir rührte sich etwas Elementares, durchmischt mit dem Sog der Ängste von Miura senior. Der Alte gefiel mir, der Veteran, der eigens für diesen Besuch einen muffigen Anzug aus dem Schrank holt und sich mit Freuden drei Jahre jünger macht, um »der Damenwelt« zu imponieren.
Für seine Kameraden, die sich aus dem Staub gemacht und Tokio zugunsten sicherer Gefilde verlassen hatten, hegte ich weniger Sympathie. Ebenso wenig für die Bedrohung, die sich von drei Seiten anzuschleichen schien – Einbrüche, chinesische Triaden und alte Kriegsgräuel. Ich hatte in meinem Leben schon Einiges durchgemacht, eine Menge erlebt und auf die harte Tour lernen müssen, die Vorboten von Gefahren zu erkennen und ernstzunehmen.
Schon möglich, dass dies die überflüssigste Aktion war, die die Welt je gesehen hat. Vielleicht aber war es auch nur der Auftakt von etwas besonders Unangenehmem.
KAPITEL 3
Irgendetwas muss in der Luft gelegen haben, denn der Ärger nahm kein Ende. Erst London, dann Tokio.
»Hab rumtelefoniert und bin auf einen Stümper gestoßen«, sagte Graham Whittinghill, der britische Händler, als wir unser Telefongespräch weiterführten. »Ich fürchte, ich habe gehörig danebengegriffen.«
Ich drückte das Headset mit der Hand fester ans Ohr. So etwas gehörte nicht zu den Nachrichten, auf die ich scharf war. Was Graham meinte, war, dass er und ein Konkurrent, ein Amateur in Sachen japanische Kunst, eine Art Revierkampf ausgefochten hatten. Manchmal muss man sein persönliches Netzwerk ein wenig ausbauen. Und dann mischen sich Leute, denen man hofft, vertrauen zu können, in ein Geschäft ein, indem sie versuchen, das Werk als Erste in die Finger zu kriegen, und zwingen einen damit, einen weiteren Mittelsmann einzuschalten.
»Kommt vor«, erwiderte ich.
»Tut mir wirklich leid. Auf einmal wurde der Kerl komisch und hat mir einen Haufen Unsinn aufgetischt.«
»Also einen richtigen Scheiß?«
»Vom Allerfeinsten«, sagte mein britischer Freund. »Ich werde mich heute Abend darum kümmern.«
Vor vier Jahren hatten wir uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und uns auf Anhieb gut verstanden. Graham war groß und schlaksig, hatte aschblondes Haar und ein Zwinkern in den Augen. Mein Spezialgebiet war die japanische Kunst, seines die chinesische. Ich brauchte jemanden, dem ich vertrauen konnte, denn auf dem Markt für chinesische Kunst tummelte sich eine albtraumhafte Menge erstklassiger Fälscher, die es vermochten, fünfundneunzig Prozent der Interessenten zum Narren zu halten. Der schon fast krankhaft schüchterne Graham gehörte glücklicherweise zu den anderen fünf Prozent.
Ich sagte: »Helfen Sie meinem Gedächtnis auf die Sprünge. Kennen Sie sich mit japanischen Tuschezeichnungen überhaupt aus?«
Dass Sengai ein brillanter Meister der Pinselführung war, konnte niemand behaupten. Vielmehr verstand sich der Zen-Mönch ausgezeichnet darauf, die Vorliebe der Japaner für Schlichtheit auf eine sehr menschliche Weise zu vermitteln. Seine Werke waren humorvoll, verspielt und im besten Falle tiefgründig. Sengai lachte über das Leben. Er fühlte mit denen, die in der Tretmühle des Alltags gefangen waren, ergötzte sich aber an der umfassenden Erkenntnis, dass das Leben nicht von Dauer ist. Die Erleuchtung hatte ihn frei und zufrieden gemacht, und dieses Wissen ließ seinen Pinselstrich tanzen.
»Nein. Ich bin nur in der chinesischen Kunst zu Hause, es sei denn, japanische Werke stellen chinesische Motive dar, was durch einen glücklichen Zufall auch für Darstellungen chinesischer buddhistischer Mönche in Sengais Werk gilt.«
»Ach wirklich? Warum?«
»Um das zu erklären, müsste ich ganz schön weit ausholen. Das hat Zeit, bis wir uns das nächste Mal auf ein Bier treffen. Im Augenblick haben wir dringendere Fragen zu klären.«
»Na schön. Dann lassen Sie uns die Sache unter Dach und Fach bringen, bevor der Schurke sie versenkt. Werfen Sie einen Blick auf die Dokumente und holen Sie den Besitzer dann zu einer Videokonferenz, damit ich mir am Monitor ein Bild machen kann.«
»Geht klar. Weil ich derjenige bin, der das Unternehmen in den Sand gesetzt hat, schlage ich vor, dass wir mit meiner Provision vielleicht auf die Hälfte des Üblichen runtergehen?«
»Nicht mal im Traum würde mir das einfallen«, entgegnete ich.
»Das ist sehr nobel von Ihnen, Sir, aber das Angebot bleibt bestehen.«
»Das wird an meiner Meinung nichts ändern.«
Stille breitete sich aus, und Grahams Wertschätzung schien mit Händen greifbar.
»Übrigens«, setzte er einen Moment später nach, »wo wir schon beim Thema sind. Sollte Ihnen zufällig eine Sengai-Darstellung eines chinesischen Mönchs über den Weg laufen, rufen Sie mich bitte umgehend an. Zu jeder Tages- und Nachtzeit.«
»Warum sagen Sie das jetzt?«
»›Eine Möhrenfliege kommt selten allein‹. Bauernweisheit meines Großvaters aus Cornwall.«
Und dabei ließen wir es bewenden – während sich das Pack zusammenrottete und das Unheil seinen Lauf zu nehmen drohte. Der nächste Schlag saß tief. Er war gemein und erwischte mich kalt.
KAPITEL 4
Als ich meine sechsjährige Tochter von einem langjährigen Freund der Familie abholte, hatte sie schon gegessen, war gebadet und vollkommen erledigt. Zu Hause angekommen, wollte Jenny nur noch eine Gutenachtgeschichte hören, ein Wunsch, den ich ihr gern erfüllte, auch wenn sie der Schlaf schon auf der dritten Seite übermannte. »Zu Hause«, das war in Tokio der behagliche Bungalow meines Vaters, der einen doppelten Zweck erfüllte. Einerseits als Bleibe, wenn ich mich in der Stadt aufhielt, gelegentlich aber auch als sicherer Unterschlupf für Klienten, jetzt wo Brodie Security offiziell im Geschäft war.
Mit unserer gegenwärtigen Reise wollten wir uns nach den nervenaufreibenden Ereignissen in Japantown eine kleine Auszeit gönnen. Ich hatte ein paar Besorgungen in Tokio und Kioto zu erledigen, ein paar Dinge für das Büro einzukaufen. Danach würden Jenny und ich in den Ferienmodus schalten. Den Miura-Fall wollte ich spätestens übermorgen Noda übergeben.
Mit einem Glas Suntory-Whisky ließ ich mich im Wohnzimmer aufs Sofa fallen, um die Einzelheiten unserer Reise nach Kioto noch einmal durchzugehen. Aber dazu kam es nicht. Immer wieder schossen mir Jun Hamadas letzte Worte durch den Kopf:
»Worum geht’s?«, hatte er bei unserer letzten Besprechung bei Brodie Security gefragt.
»Darum, den zu erwischen, der Miuras Kumpels auf dem Gewissen hat«, sagte ich.
Hamada, unser Fachmann für chinesische Banden, stutzte. »Wenn wir von Triaden sprechen, können wir das vermutlich vergessen.«
»Warum?«
»Die sind wie Ameisen. Zuerst siehst du nur eine oder zwei. Fängst du aber an, im Nest zu stochern, schwärmen sie aus.«
»Klingt nicht gut.«
Seine Knollennase zuckte. Hamada war ein abgebrühter Ex-Cop aus Osaka und hatte schon so manche Schlacht geschlagen. »Damit dürften Sie richtiger liegen, als Ihnen lieb ist.«
In Grübeleien versunken blieb ich noch lange auf. Hamadas Worte gingen mir nicht aus dem Kopf. Ich kippte meinen dritten Whisky herunter. So weich der gut gereifte Tropfen auch war, vermochte er dennoch nicht, das dumpfe Gefühl aufzulösen, das in mir aufstieg.
Ich trug mich gerade mit dem Gedanken, ins Bett zu gehen, als Inspektor Shin’ichi Kato von der Metropolitan Police in Tokio mich gegen Mitternacht auf meinem privaten Handy anrief und Hamadas Bemerkungen geradezu hellseherische Kraft verlieh.
TAG 2
DER NACHHALL DES KRIEGES
KAPITEL 5
00:17 UHR
E s klopfte, und ich öffnete Officer Rie Hoshino, eine der wenigen Frauen bei der Tokioter Polizei, die Tür.
»Brodie-sama?«, begrüßte sie mich formvollendet auf Japanisch.
»Ja.«
»Haben Sie mit Inspektor Kato gesprochen?«
Ich nickte. »Er sagte, dass Sie kommen würden, wenn auch nicht so früh.«
Inspektor Katos Schützling hatte Rouge und Lidschatten aufgelegt, beides stilsicher und äußerst dezent, zweifellos, um sich leichter Zugang zu der Männerwelt zu verschaffen, um die es sich bei der Metropolitan Police von Tokio zweifellos handelte. Ihre Uniform bestand aus der unvermeidlichen marineblauen Jacke und Hose, einem himmelblauen Hemd und einer dunklen Krawatte unter einem breiten, spitz zulaufenden Kragen. Messingknöpfe rundeten das Bild ab, das, von gewissen Unterschieden abgesehen, dem ihrer männlichen Kollegen sehr ähnelte. Sie hatte hellbraune Augen und einen frischen Teint.
»Sind Sie soweit?« Sie bedachte mich mit einem zuvorkommenden Lächeln, ohne ihrer Stimme den geschäftsmäßigen Ton zu nehmen.
»Klar, zu allen Schandtaten bereit. Haben Sie den Babysitter mitgebracht?«
Auf Hoshinos Handzeichen erschien eine jugendlich wirkende Polizeirekrutin. »Das ist Kawakami. Nicht verheiratet, aber die älteste von fünf Geschwistern. Ist das in Ordnung?«
Kawakami machte eine Verbeugung. »Sie müssen sich um nichts kümmern, Brodie-sama. Ihre Tochter ist bei mir in den besten Händen. Wie heißt sie?«
»Jenny, aber sie hört auch auf Yumiko. Das ist ihr zweiter Vorname. Meine Handynummer liegt auf dem Tisch. Rufen Sie mich an, wenn sie aufwacht und Sie sie nicht beruhigen können. Sie … ist manchmal etwas ängstlich.«
Jenny hatte ein Elternteil verloren, ein Umstand, der ihr Radarsystem immer sofort anspringen ließ, wenn ich mich zu weit von ihr entfernte. Die kindliche Sicht auf einen Alleinerziehenden konnte etwas Bedrohliches haben.
Kawakami bestätigte meine Anweisungen mit einer zweiten Verbeugung, und Hoshino warf einen Blick auf ihre Uhr. »Wenn sonst alles in Ordnung ist, dann möchte ich Sie bitten, jetzt mitzukommen. Wir haben nicht viel Zeit.«
Sie begleitete mich zu einem Streifenwagen, der draußen wartete. »Bitte nehmen Sie hinten Platz. Ist Vorschrift.«
Kaum hatten wir die engen Sträßchen des Wohnbezirks verlassen, trat Hoshino aufs Gas. Sie schaltete das rote Rundumlicht auf dem Dach ihres Streifenwagens ein und tanzte mit dem Wagen um die anderen Autos herum, als würden sie in Zeitlupe fahren.
Hoshinos Blick traf meinen im Rückspiegel. »Alles in Ordnung bei Ihnen?«
»Ja, alles in Ordnung. Aber wer hat Ihnen diesen präzisen Fahrstil beigebracht?«
»Mein Vater hat mir ein paar Tricks gezeigt, nachdem ich ihn immer wieder bekniet habe, dass ich als seine Tochter auf der Straße auch ganz gut zurechtkäme.«
»Wieso auch?«
»Ich habe zwei Brüder.«
»Und? Wie waren Sie?«
»Schneller und besser.«
Schweigend fuhren wir weiter, bis ich fragte: »Wohin geht es?«
»Kabukichoˉ.«
Ein kalter Schauer fuhr mir den Rücken hinab. Zwar ging es in Kabukichoˉ nicht so anarchisch zu, wie Gerüchte es verkündeten, harmlos war das Viertel aber auch wieder nicht. Gewalttätige Auseinandersetzungen, die durchaus tödlich verlaufen konnten, waren an der Tagesordnung.
»Mitten in der Nacht? Das verheißt nichts Gutes.«
»Der Inspektor möchte Sie persönlich ins Bild setzen.«
»Etwas Ernstes also?«
Resolute kakaobraune Augen warfen mir einen Blick zu: Es war doch nicht so einfach, ihr etwas zu entlocken.
Also versuchte ich es anders. »Arbeiten Sie gern für Kato?«
Im nächsten Moment jagte sie den Wagen um eine Ecke, ohne die Reifen zum Quietschen zu bringen, sah mich im Rückspiegel an und sagte nur, ja.
»Und die Arbeit bei der Polizei?«
»Ich bin damit aufgewachsen. Vater, Großvater, zwei Brüder. Alle bei der Polizei.«
»Die erste Frau?«
»Ja.«
»Ich frage mich …«
»Einen Moment bitte«, unterbrach sie mich und ließ das Signal kurz aufheulen, worauf zwei klapprige Taxis wie aufgeschreckte Kakerlaken blitzartig zur Seite huschten.
Hoshino sah mich im Rückspiegel wieder an. »Was wollten Sie sagen?«
»Waren Sie letzten Herbst in Katos Einheit?«
Sie fuhr in eine weitere Kurve hinein, dann wieder heraus und gab erneut Gas. »Als Sie und er, äh, zusammengearbeitet haben? Nein.«
»Dann wissen Sie also gar nicht, was passiert ist?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
Also war sie im Bilde.
Wir fuhren in den Tunnel, der unter den Schienen der japanischen Staatsbahn nördlich des Bahnhofs Shinjuku entlangführte, bogen links ab und sausten dann hinter der Endhaltestelle der Seibu-Shinjuku-Linie vorbei.
Die Straßen füllten sich mit Leben.
Wir waren angekommen.
KAPITEL 6
Wir befanden uns am Rand von Tokios größtem Vergnügungsviertel für Erwachsene.
Über unseren Köpfen türmten sich Neonschilder mit kanji-Schriftzügen übereinander, die von den Fassaden der oberen Stockwerke ultraschmaler Gebäude hervorsprangen. Eine Flut aus roten, blauen und grünen Lichtern schwappte über die Windschutzscheibe.
Lautstark und mit vom Alkohol geröteten Gesichtern schlenderten Nachtschwärmer auf beiden Seiten die Straße entlang.
»Ganz schön viele Leute unterwegs, für einen Donnerstag«, bemerkte ich.
»Sie läuten das Wochenende ein.«
Abgesehen von ein paar Pachinko-Spielhallen, Kinos, Restaurants und Karaokebars war in diesem Viertel tagsüber nicht viel los. Erst nach Einbruch der Dunkelheit zog es Tausende in die Kneipen, die izakayas, in die Nudelrestaurants und exklusiveren japanischen »Snack Bars« mit attraktiven Hostessen, die fortwährend kicherten und sich für einen angemessenen Preis auch willig zeigten, das männliche Ego zu streicheln. Denselben Service bekamen Frauen in den »Host Bars«, wenn sie ein paar Scheine hinblätterten.
Je tiefer wir in das Geflecht von Nebenstraßen eindrangen, desto langsamer kamen wir voran. Das Geschäft mit dem Sex blühte, Freudenhäuser und Liveshows mischten sich ins Bild. Ebenso die Schlepper vor Striplokalen und Oben-ohne-Clubs. Und in den ganz dunklen Ecken trieben sich die Strichmädchen herum.
Hoshino manövrierte den Wagen mit der Schnauze in eine schmale Gasse hinein. Der Glanz der Neonbeleuchtung verblasste. Schatten schlichen an den Rückseiten der Gebäude entlang. Vor uns erfassten die Scheinwerfer das Heck eines anderen Streifenwagens. Gelbes Polizeiband war unmissverständlich von einer Wand zur anderen gespannt.
Als Hoshino den Motor abstellte, machte sich Dunkelheit breit.
»Freut mich, dass Sie noch unter den Lebenden weilen, Brodie.« Inspektor Kato streckte mir die Hand entgegen, und ich ergriff sie.
Während ich aus dem Wagen ausgestiegen war, hatte er sich aus der Dunkelheit herausgelöst und war mit einer fließenden Bewegung unter dem Absperrband hinweggetaucht.
»Ich versteh nicht, warum die Sie immer noch eine Marke tragen lassen.«
Weiße Zähne grinsten mir aus einem dunklen Gesicht entgegen. »Wer versteht das schon?«
Vor elf Monaten waren wir uns im Rikyu-Fall begegnet. Nicht als Freunde, damals war ich der Verdächtige. Kato hatte einen walnussfarbenen Teint und Falten in den Winkeln seiner Augen und am Mund. Nach außen war er ein Ausbund an Unordnung. Er mochte den Tag noch so aufgeräumt und ordentlich beginnen, es dauerte keine halbe Schicht, bis er aussah, als wäre er aus einem überdimensionalen Wäschetrockner herausgeschleudert worden. Seine Kleidung – an diesem Abend schwarzer Trenchcoat und grauer Anzug – war vollkommen zerknittert, und das silbergraue Haar glich einem Heuhaufen, den der Wind vor sich hergetrieben hatte. Doch all dieser Nachlässigkeit zum Trotz war er die Besonnenheit in Person. Nichts konnte sein inneres Gleichgewicht stören. Bevor er seinem Vater zur Polizei folgte, hatte der nachlässige Inspektor sich zum buddhistischen Mönch ausbilden lassen.
Kato versuchte offensichtlich, mein Äußeres einer bestimmten Richtung zuzuordnen. »Früher James Dean?«
Ich trug dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Lederjacke. Meine Stilsicherheit war nur mäßig geschult und kaum geeignet, die Aufmerksamkeit eines der gefeierten Fashion-Gurus von Tokio auf sich zu ziehen. Immerhin hatte ich mir vor langer Zeit eingeprägt, dass dunkle Farben nicht nur geeignet waren, mein welliges schwarzes Haar und die blauen Augen zur Geltung zu bringen, sondern auch meine Möglichkeiten der optischen Anpassung optimierten, wenn ich mich in dunkleren Gegenden herumtrieb.
»Nein, das ist beim Waschen passiert.«
Er nickte. »Ist nicht einfach als Alleinerziehender. Tut mir leid, dass ich Sie Ihrer Tochter entreißen musste.«
Ich sagte: »Sie werden vermutlich einen guten Grund dafür haben.«
Seine Augenbrauen zogen sich zusammen. »Leider ja.«
KAPITEL 7
Mit einer knappen Geste bedeutete der Inspektor mir, dass ich ihm folgen sollte, und ging den Weg zurück, den er gekommen war. Ich duckte mich unter dem Absperrband hinweg, schob mich langsam an dem zweiten Wagen vorbei und wäre fast über den Grund der mitternächtlichen Vorladung gestolpert.
Auf dem Kopfsteinpflaster lag ein zu Brei geschlagenes Etwas aus Haut und Knochen, das einmal ein menschlicher Körper gewesen sein musste.
Der Kopf des Opfers war bis zur Unkenntlichkeit entstellt – die Kieferknochen zerschmettert, die Nase platt, die Augen zugeschwollen. Die Lippen waren wie überreife Früchte zerplatzt, die vorderen Schneidezähne ausgeschlagen. Was nicht vollkommen zerstört und zerquetscht war, war von einer Kruste violett-braunen Blutes überzogen.
Die Leiche war die eines Mannes japanischer Herkunft.
Er trug einen Anzug.
Darüber hinaus gab es nichts, was an einen Menschen erinnerte. Nicht einmal seine eigene Mutter würde ihn erkennen.
Ich holte tief Luft. »So etwas bekommt man nicht oft zu sehen.«
»Die haben es an Gründlichkeit nicht fehlen lassen«, pflichtete der Inspektor mir bei.
Unerbittlich hatten sie zugeschlagen und es dabei nicht bewenden lassen. Beide Beine wie auch der linke Arm waren ihm gebrochen worden. Der rechte Arm fehlte ganz.
Auf der Suche nach einem Hinweis, warum er mich mitten in der Nacht hierher geholt hatte, sah ich Kato an. Aber der Inspektor stand wie zu einem steinernen Buddha erstarrt da.
Ich suchte die Umgebung nach dem fehlenden Arm ab. Zunächst sah ich den Weg hoch in die Richtung, wo das MPD eine Absperrung gezogen hatte, um Schaulustige fernzuhalten, dann zur anderen Seite den Weg hinab zu dem zweiten Streifenwagen und in die dunklen Ecken und Winkel hinein. Nichts.
Ich ging ein Stück nach vorn, um besser sehen zu können, und als ich mich wieder der Leiche zuwandte, erspähte ich ein Stück Isolierband, das ihm unter dem Gesicht hing. Ein blutdurchtränkter Socken haftete an dem Klebeband. Eine weiße Sportsocke. Keine Marke. Keine Streifen. Kein Logo. Irgendeine. Ein bestialischer Knebel. Simpel aber unbezwingbar. Wer immer das getan hatte, dumm war er nicht.
Die beiden Streifenwagen hielten neugierige Blicke von der Rückseite des Tatortes fern. Vorn aber, wo der Weg in eine größere Straße mündete, vermochten weder ein paar Streifenpolizisten noch die Kegel und das Absperrband, mit denen die Einmündung versperrt war, die arme Seele, die vor mir auf dem Boden lag, vor der Demütigung in aller Öffentlichkeit zu schützen.
Angetrunkene Gaffer ergötzten sich an dem Anblick, einer weiteren Attraktion.
Meine Arbeit bei Brodie Security führte mich gelegentlich an seltsame Orte. Orte, die ich im Leben nie aufsuchen wollte. Orte, an denen ein Antiquitätenhändler einfach nichts zu suchen hatte. Da ich fünf Jahre am Rand von South Central L.A. und zwei weitere in einem gefährlichen Viertel von San Francisco verbracht hatte, bis ich mir Besseres leisten konnte, war mir Gewalt nicht fremd, was allerdings nicht bedeutete, dass ich sie gleich mögen musste. Was mich heute Nacht hierher gebracht hatte, waren Verpflichtungen, die in Japan tief verwurzelt waren. Ich war Inspektor Kato einiges schuldig. Im Übrigen hatte er meinen Vater gekannt.
»Wo ist das passiert?«, fragte ich.
Jemanden so zusammenzuschlagen dauerte seine Zeit. Riskant, da die Stelle leicht einzusehen war. Außerdem war die Blutlache um den Toten herum relativ klein. Was zu der Erkenntnis führte, dass es eine zweite Stelle geben musste.
»Da drüben«, sagte Kato mit einer Kopfbewegung in Richtung einer dunklen Nische. »Da geht es etwa drei Meter rein. Es ist die Rückseite eines Spirituosengeschäfts, das schon vor Stunden geschlossen hat.«
»Sie erlauben?«
Der Detective schüttelte den Kopf. Drei Schritte später blickte ich in eine verdreckte Mauernische, die zu einer Hintertür führte. Jede Menge Blut, aber kein Arm, keine Zähne. Zwei ramponierte Mülleimer, die an einer Mauer lehnten, waren alles, was der Schauplatz zu bieten hatte.
Ich ging zu der Leiche zurück. »Nachdem sie ihn geknebelt hatten, konnten sie sich Zeit lassen.«
Der Inspektor fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, sagte aber nichts.
»Gibt es eine Spur von dem Arm?«, fragte ich.
Kato schüttelte den Kopf.
»Von den Zähnen?«
Wieder ein Kopfschütteln.
Kato war gänzlich verstummt. Er durchbohrte mich mit seinem Blick. Sein weiblicher Schützling stand in einem diskreten Abstand hinter ihm und beäugte mich nicht minder konsterniert wie ihr Chef, senkte den Blick aber sofort, kaum dass ich in ihre Richtung sah.
Irgendetwas stimmte nicht.
Ich sagte: »Wie kann ich helfen?«
Kato hob den Blick und sah mich offen und fragend an. »Eine dieser Kleinigkeiten, auf die wir von Zeit zu Zeit stoßen.«
ENDE DER LESEPROBE