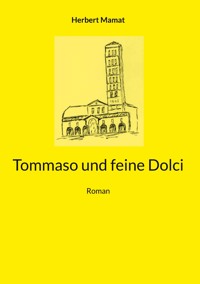
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf einer Bank in der Villa Borghese, Roms großem Park, wird ein junger Padre gefunden. Offensichtlich ist er ermordet worden. In seinem Strumpf ist ein Büchlein mit Texten des Thomas von Aquin versteckt. Was aber hat der große Philosoph des Mittelalters mit einem Mord im modernen Rom zu tun? Tommaso und feine Dolci - ein leicht philosophischer Kriminalroman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bücher sind einfach die bessere Wirklichkeit!
Wiederum für meine Gitta – ist doch klar!
Inhalt
Erstes Vorwort: Anmerkungen des Herausgebers
Zweites Vorwort: Brief des Autors an den Herausgeber
Rom, Samstag, 31. August
Rom, Sonntag, 1. September
Rom, Montag, 2. September
Erster Exkurs: Thomas von Aquin
Rom, Dienstag, 3. September
Rom, Mittwoch, 4. September
Zweiter Exkurs: Das Werk des Thomas von Aquino
Rom, Donnerstag, 5. September
Rom, Freitag, 6. September
Rom, Samstag, 7. September
Rom, Sonntag, 8. September
Rom, Montag, 9. September
Rom, Dienstag, 10. September
Rom, Mittwoch, 11. September
Rom, Donnerstag, 12. September
Rom, Freitag, 13. September
Rom, Samstag, 14. September
Rom, Sonntag, 15. September
Rom, Montag, 16. September
Rom, Dienstag, 17. September
Rom, Mittwoch, 18. September
Rom, Donnerstag, 19. September
Rom, Freitag, 20. September
Rom, Samstag, 21. September
Rom, Sonntag, 22. September
Rom, Montag, 23. September
Rom, Dienstag, 24. September
Rom, Mittwoch, 25. September
Rom, Donnerstag, 26. September
Rom, Freitag, 27. September
Rom, Samstag, 28. September
Rom, Sonntag, 29. September
Rom, Montag, 30. September
Rom, Dienstag, 1. Oktober
Rom, Mittwoch, 2. Oktober
Erster Nachtrag: Rom, Freitag, 18. Oktober
Zweiter Nachtrag: Rom, Montag, 28. Oktober
Erstes Vorwort: Anmerkungen des Herausgebers
Nun bin ich mehrmals so schwach gewesen, aus den zuerst chaotischen, später immerhin doch recht geordneten Aufzeichnungen eines Mannes, der schon lange in Rom lebt, ein Buch zu machen. Es ist ein deutscher Professor der Philosophie, der in seiner Heimat, aber auch in Rom, an verschiedenen Universitäten gearbeitet hat, inzwischen aber emeritiert ist. Er wohnt seit vielen Jahren in Trastevere, einem der uralten Stadtteile Roms, ist dort auch verheiratet, hat zwei Töchter, forscht wohl ab und zu noch an Zusammenhängen, die sich mir nicht erschließen, isst gern und gut und schreibt und schreibt, wenn es etwas Wichtiges zu schreiben gibt.
Bei dem Inhalt der Aufzeichnungen geht es um einen Kriminalfall, im Wesentlichen um eine Form von Verbrechen, die in den letzten Jahren zunehmend eine scheußliche Aktualität bekommen haben. Mehr will ich dazu nicht verraten. Professor X (Er will auch weiterhin nicht, dass ich seinen Namen hier nenne. Ich vermute, dass er die Rache der mit seiner Hilfe überführten Verbrecher fürchtet!), Professor X also hat mir zum fünften Male so etwas wie ein Manuskript zugeschickt, und ich werde mich in den nächsten Wochen wohl wieder bemühen, ein Buch daraus zu machen. Den Brief, den er seinem Text beigefügt hat, will ich hier als ein zweites Vorwort abdrucken.
Zweites Vorwort: Brief des Autors an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr,
möglicherweise haben Sie gehofft, nach den Mühen, die ich Ihnen mit meinen bisherigen Manuskripten gemacht habe, nie mehr etwas von mir zu hören, und tatsächlich sind ja nun auch seit unserer letzten Zusammenarbeit wieder rund zwei Jahre vergangen, in denen ich Sie nicht gestört habe, Jahre mit gewaltigen Stürmen, zerstörerischen Überschwemmungen, einer weltweit wütenden Pandemie und den üblichen Verbrechen widerwärtiger Diktatoren, zwei Jahre, in denen ich mich in Rom dagegen in relativer Ruhe meiner Familie und meinen Studien widmen konnte. Es gab hier seit vielen Monaten kein Verbrechen, bei dem mein langjähriger Bekannter, der Commissario Settembri, Grund gehabt hätte, mich um meine Hilfe zu bitten. Und inzwischen ist er ja auch aus dem Polizeidienst ausgeschieden.
Nun hat es aber doch einen Vorfall gegeben, über den zu berichten sich lohnt. Settembri ist von einem seiner früheren Mitarbeiter um Rat gebeten worden, und mich hat er in die Arbeit einbezogen, weil er wohl glaubte, meine Kenntnisse der älteren italienischen Philosophie könnten bei der Lösung des Falles nützlich sein.
Das Manuskript, das ich Ihnen mit dieser Post zusende, ist das Ergebnis der Zusammenarbeit bei der Aufklärung eines besonders perfiden Verbrechens. Machen Sie, wenn der Inhalt Sie anspricht, ein Buch daraus! Ich lasse Ihnen bei der Überarbeitung meiner Notizen vollkommen freie Hand. Zum Titel habe ich allerdings wieder einen Vorschlag. In gewisser Weise würde sich das Buch, wenn es denn erschiene, ja an die vier Romane aus Rom anreihen, die vorausgegangen sind. Ich denke also „Tommaso und feine Dolci“ wäre ein passender Titel, denn beide, der große Thomas von Aquin und leckeres Gebäck, spielen in meinen Aufzeichnungen eine Rolle, wenn auch, wie es sich im Laufe der Ermittlungen herausgestellt hat, keine wirklich bedeutende. Aber auch über den Titel lasse ich mit mir reden. Sie wissen, wie Sie mich erreichen können.
Mit freundlichen Grüßen
Rom, Samstag, 31. August
An Vorahnungen mag ich nicht so recht glauben. Sie widersprechen meinen Vorstellungen von Logik. Wie können denn aus meinem Unterbewusstsein Informationen über die Zukunft aufsteigen? Woher also sollen die Ahnungen kommen? Und soll ich etwa die Existenz von Geisterwesen annehmen, die mir zuflüstern, was morgen geschehen wird? Das wäre doch die reine Spökenkiekerei!
Und doch! Manchmal könnte man schon ins Grübeln kommen. Da sagt zum Beispiel Giuliana, meine süße und immer noch wunderschöne Giuliana, wir sind gerade dabei den Abendbrottisch abzuräumen: „Professore, wir haben schon wochenlang nichts von unserem Commissario gehört. Was ist los mit Settembri? Er ist nicht mehr der Jüngste. Hoffentlich ist er nicht krank!“
Und dann dauerte es drei Minuten oder vier, vielleicht auch fünf, da schellt unsere Haustürklingel. Nach dem Abendessen! Um Viertel nach acht! Das ist ganz und gar ungewöhnlich. Der Abend gehört uns. Unser Bekanntenkreis ist überschaubar. Die beiden Töchter haben einen Schlüssel. Sie würden auch anrufen, wenn sie vorhaben, uns zu besuchen. Vielleicht ein Streich! Irgendein Lümmel, der sich einen Spaß macht und die Klingel fremder Leute drückt? (Schellemännchen nannte man solche Racker in meiner Jugend!)
„Settembri!“ behauptet Giuliana.
Unmöglich! sage ich. Der ruft vorher an, wenn er uns sehen will. Der hat immer angerufen, wenn es etwas zu besprechen gab.
Giuliana ging also zur Sprechanlage, die man uns schon vor Jahren angebracht hat. Aus Vorsicht! Wir wohnen schließlich in Rom! In Trastevere! Da lässt man nicht jeden in die Wohnung. Das ist hier schließlich genauso gefährlich wie in Dortmund oder Hildesheim!
„Kommen Sie hoch!“ höre ich Giuliana sagen. „Nein, nein, das ist wirklich kein Problem! Sie dürfen uns auch um Mitternacht oder zu Weihnachten besuchen! Doch, doch, das ist mein voller Ernst!“
Und als sie wieder hereinkommt, und ich sie fragend anblicke: „Settembri! Ich habe es doch geahnt!“
Na ja! Ich möchte trotzdem behaupten: Ahnen funktioniert nicht. Es ist ganz bestimmt besser, sich nicht darauf zu verlassen!
Settembri, der seit einigen Jahren pensionierte Kommissar, tritt ein, entschuldigt sich wortreich für die Störung zu einer so unmöglichen Zeit, wie er das ausdrückt, setzt sich, nippt an den Glas Cirò, das ich ihm hingestellt habe, und sagt: „Sie beide sind immer noch dieselben! Hellwach auch noch am Abend! Gut so! Das freut mich ungemein! Schrecklich, wenn die Menschen vor der Zeit alt und pomadig werden!“
Wie ich Sie einschätze, Commissario, sind Sie so spät am Abend ganz bestimmt nicht gekommen, um uns dieses freundliche Kompliment zu machen. Ich brauche nicht zu betonen, dass Sie bei uns gern gesehen sind, immer, zu jeder Tageszeit, aber ich kenne Sie lang genug. Sie sind nicht hier ohne einen bestimmten, einen wichtigen Grund.
„Und den kann ich mir schon denken!“ fiel mir Giuliana ins Wort. „Es gibt wieder irgendwo einen scheußlichen Mord. Und natürlich muss ich mir wieder Sorgen um dich machen.“
Settembri lachte. Ein wenig. Lautes Lachen passt nicht zu ihm.
„Wir kennen uns, wir kennen uns lange genug“, sagte er. „Natürlich haben Sie Recht, Giuliana, liebe Freundin! (Ich schätze ihn sehr, und ich freue mich, wenn er Freund oder Freundin sagt! Mit diesen Bezeichnungen geht er nämlich sparsam um, sehr sparsam!) Mein Kollege Franco ist zu einem merkwürdigen Mordfall gerufen worden und hat mich gleich über Einzelheiten informiert, soweit sie schon bekannt sind. Ich habe immer noch einen sehr guten Kontakt zu ihm, wie sie wissen, und er wünscht es ausdrücklich, dass ich ihn ab und zu berate. Und in diesem Fall hat er mich sofort gebeten, auch Sie in unsere Arbeit einzubeziehen, Professore. Möglicherweise kann uns ein Philosoph helfen.“
Mit wenigen Worten will ich zunächst einmal unseren Besuch vorstellen: Settembri war über Jahrzehnte ein namhafter und erfolgreichen Kriminalkommissar, Franco ist sein Nachfolger im Amt, und er geniert sich nicht, sein großes Vorbild regelmäßig zu Rate zu ziehen. Und ich, der emeritierte Professor für alte Philosophie, durfte ihnen einige Male bei der Aufklärung rätselhafter Fälle helfen. Na ja, besonders hoch habe ich meinen Einfluss auf die Ermittlungen der beiden nicht eingeschätzt, aber diese tüchtigen Fachleute sind doch immer sehr höflich und interessiert mit mir umgegangen. Sie haben so getan, als sei meine Hilfe wichtig. Und wenn diese Hilfe vielleicht auch nicht viel gebracht hat, so hat sie mir immerhin tiefe Einblicke in die Polizeiarbeit gegeben. Settembri ist mir ein lieber Freund geworden, und Franco behandelt mich stets mit großem Respekt. Das tut gut! Settembri ist also ein pensionierter Commissario. Ich werde gleich und auch später noch Gelegenheiten finden, ihn näher vorzustellen!
Erzählen Sie! bat ich.
„Darf ich Ihnen einen caffè kochen“ fragte Giuliana. „Und auch einige Turiddu-Plätzchen dazulegen? Haben Sie die schon mal gegessen? Es ist ein sehr, sehr feines Mandelgebäck. Müssen Sie probieren! Die hat meine Mutter gebacken. Bessere finden Sie nirgends.“
„Wenn Sie mich nicht allein caffè trinken lassen! Und zu ein paar dolci müssen Sie mich auch nicht überreden!“
Wir warteten auf den Espresso. Settembri saß ruhig, aufrecht und konzentriert auf seinem Stuhl. Unruhig und aufgeregt habe ich ihn nie erlebt. Er ist immer noch schlank und drahtig, und er ist immer perfekt elegant gekleidet. Das war er auch im Dienst, und dieses Auftreten, ruhig, beherrscht und fast ein wenig zu korrekt in seinem Äußeren, hat sicherlich so manchen Gauner eingeschüchtert und zum Erfolg des Kommissars beigetragen.
Als Giuliana den caffè gebracht hatte, als wir ihn getrunken hatten, dieser römische Kaffeeextrakt ist ja nur ein Schluck, begann Settembri seinen Bericht. Wie immer konzentriert, exakt, ohne ein überflüssiges Wort.
„In der vergangenen Woche, vorgestern, um genau zu sein, bekamen wir einen Anruf. Der Anrufer war ein tassista. Ich habe einen Toten entdeckt, sagte er dem diensthabenden Beamten. Ich bin mit meinem Taxi vorhin über eine Straße der Villa Borghese gefahren, so gegen neun Uhr, da saß ein Mann auf einer Bank, bekleidet mit einer Soutane, den Kopf gesenkt. Das fiel mir nicht weiter auf. Als ich eine viertel Stunde später zurückfuhr, saß der Mann noch genauso da. Das schien mir nicht normal zu sein. Also hielt ich an, stieg aus, ging hin und sprach ihn an. Als er nicht reagierte, fasste ich seine Schulter an. Da fiel er seitlich auf die Bank. Ich habe versucht, seinen Puls zu ertasten, aber da war nichts zu fühlen. Natürlich habe ich sofort bei der Polizei angerufen. Soweit der tassista“, unterbrach der Commissario seinen Bericht. „Jetzt komme ich zu unserem Part.
Unsere Leute sind sofort hingefahren, und weil Franco gerade seinen Schreibtisch abgeräumt hatte, er also mit seiner aktuellen Arbeit fertig war, schloss er sich ihnen an. Er sagte mir, der Hinweis auf die Soutane habe ihn dazu gebracht.
Wenn das ein Priester ist, dachte er, dann kriege ich möglicherweise Schwierigkeiten, wenn ich mich nicht selbst um den Toten kümmere.
Ich fasse jetzt zusammen, was mein Kollege an dem Abend notiert hat und was er inzwischen recherchieren konnte. Der Tote ist ein junger Mann, 31 Jahre alt, Priester, er war bekleidet mit seiner Soutane. Sein Vorname ist Renato. Der Nachname tut nichts zur Sache. Er stammt aus einem Dorf östlich von Napoli und ist der einzige Sohn seiner Eltern, die beide noch bei guter Gesundheit sind. Gestorben ist er an einer tüchtigen Dosis Strychnin. Es lag auch ein Fläschchen unter der Bank, in dem noch Giftreste waren. Unsere Leute dachten zuerst an Selbstmord. Dann kamen Zweifel auf, und jetzt ist Franco fest davon überzeugt, dass der junge Mann ermordet worden ist.“
Wenn ein Mensch sich umbringen will, setzt er sich nicht abends auf eine Bank in der Villa Borghese, sagte ich.
Und Giuliana fragte entrüstet: „Wer ermordet denn einen Priester? Die Nachrichten, die man bekommt, werden aber auch immer ekelhafter!“
„Ja, warum dieser Mord? Und wer ist der Täter?“ Settembri führte noch einmal das Tässchen, das natürlich längst leer war, an den Mund.
Und wieso denkt Franco an Mord? fragte ich. Hat er eindeutige Hinweise gefunden.
„Die Anzeichen sind überdeutlich, auch wenn der Täter offenbar einiges getan hat, einen Selbstmord vorzutäuschen“, fuhr Settembri fort. „Ja, natürlich haben die Beamten zunächst an Selbstmord gedacht. Auch Franco. Wer sollte denn auch einen jungen Priester umbringen? Bei näherem Hinsehen aber sprach gar nichts mehr für eine Selbsttötung. Dieser junge Mann war ein freundlicher, fröhlicher, gesprächiger Mensch. Das sagen Leute aus seinem Umfeld. Das sagen auch seine Eltern. - Sie scheinen sich zu wundern, Professore, dass wir nach rund 48 Stunden schon so viele Informationen haben! Warten Sie ab! Wir haben noch mehr.
Am Nachmittag vor seinem Todestag hat er mit zwei anderen Priestern und einem befreundeten Laien zusammengesessen. Sie haben geplaudert, ein Glas Wein getrunken - Nur eins, sagen die Zeugen! -, und dabei war dieser Renato wie immer: Ein fröhlicher, ein geradezu witziger Plauderer. Unmöglich, dass der schon im Kopf hatte, sich einen Tag später umzubringen! Das sagte einer der drei Freunde, ein älterer Priester. Und dieser Mann wusste auch, dass Renato vorhatte, an diesem Wochenende seine Eltern zu besuchen. Da bringt man sich doch nicht um!
Aber es gibt noch andere Anzeichen für Mord. Der Tote hat Hämatome an den Oberarmen und einen offenbar frisch abgebrochenen Schneidezahn, und das Fläschchen, in dem das Gift nachgewiesen werden konnte, ist völlig frei von Fingerabdrücken. Ich bitte Sie: Kann man annehmen, dass ein Selbstmörder Gift trinkt, sich dabei einen Zahn abbricht und dann seine Fingerabdrücke sorgfältig von der Giftflasche abwischt, bevor er sich zum Sterben hinsetzt? Das ist ganz unvorstellbar!
Weil nun bei diesem jungen Priester ein Selbstmord so dilettantisch vorgetäuscht worden ist, gehen wir davon aus, dass die Täter – Ein einzelner Mann hätte diesen kräftig gebauten jungen Menschen nicht zwingen können, das Gift zu schlucken! – dass also die Täter keine Profis, keine erfahrenen Killer waren. Die würden so nicht vorgegangen sein. Die würden auch statt Gift eher eine Pistole benutzt haben. Ja, und damit haben wir in diesem Fall doch schon etwas herausgefunden: Es handelt sich offensichtlich um Mord, ausgeführt sehr wahrscheinlich von mindestens zwei Männern, für die so etwas kein Alltagsgeschäft ist.“
Wir schwiegen. Nachdenklich. „Armer Kerl!“ sagte Giuliana.
„Ich habe Ihnen in der Vergangenheit wohl schon mehrfach erklärt“, nahm Settembri noch einmal das Wort, „dass wir mit den meisten Tötungsdelikten wenig Arbeit haben. Im Ernst: Manchmal gibt es Fälle, die können sogar unsere Büroangestellten klären und für den Staatsanwalt vorbereiten. Da sitzt zum Beispiel ein Mörder nach seiner Tat weinend neben seinem Opfer, ein anderer rast auf der Flucht mit seinem Auto gegen einen Baum und muss nur noch eingesammelt werden, mancher stellt sich nach der Tat freiwillig auf einer Polizeiwache, und bisweilen gibt es gleich mehrere Zeugen, auch Zeugen, die den Täter und das Opfer gut kennen, und dann kann es ganz leicht sein, den Täter zu finden und zu verhaften.
Hier ist es anders. Ich fürchte, dass diese Tat eine harte Nuss für uns wird. Dieser Mord wirkt seltsam, bizarr, ohne irgendeinen Bezug, den wir erkennen könnten, er scheint so ganz sinnlos. Ein harmloser, lieber Mensch, ein Mann offenbar ohne Feinde ist ermordet worden. Wir sehen die Tat, wissen jedoch nicht, wo wir den Mörder suchen sollen.“
Aber sie sind heute Abend nicht ohne besonderen Grund mit dieser Geschichte zu mir gekommen, Commissario! sagte ich.
„Ach ja, die Aufgabe für den Philosophen! Sofort, sofort! Der Tote hatte nur zwei Dinge bei sich, ansonsten waren seine Taschen vollkommen leer, so als ob man ihn ausgeraubt hätte. Er hatte noch seinen Ausweis in einer Tasche der Soutane, so dass wir sofort wussten, um wen es sich handelt, und dann trug er eine ältere Ausgabe mit Auszügen aus dem Werk das Tommaso d’Aquino bei sich. Der Ausweis half uns nicht nur, seine Identität festzustellen, sondern über seinen Vermieter auch seine Bekannten zu finden und auch schon jemanden mit Fragen zu seinen Eltern zu schicken. Das haben dort zuständige Beamte auf unsere Bitte hin getan. Der Tommaso aber ist rätselhaft. Vielleicht ganz ohne Bedeutung. Warum soll ein Priester nicht in den Schriften des Tommaso lesen? Ich lese andere Bücher, wenn ich lese, aber ich bin kein Maßstab. Vielleicht aber hat das Buch ja auch eine besondere Bedeutung, vielleicht kann es uns in die Nähe der Täter führen.“
Warum haben die Täter es ihm gelassen? fragte ich. Haben sie es in der Eile nicht gefunden? Viel Zeit hatten sie ja wohl nicht. Auch am Abend kann jederzeit ein Jogger durch den Park laufen.
„Ja, das ist seltsam! Dieser Renato trug lange Strümpfe, und das Büchlein, kleinformatig und mit einem weichen Umschlag, steckte oben im rechten Strumpf. Ein seltsamer Verwahrungsort, weil es auch in eine Tasche seiner Soutane gepasst hätte.“
Er scheint sich etwas dabei gedacht zu haben, überlegte ich. Die Aufbewahrung eines Buches im Strumpf, auch wenn es klein und flach ist, muss möglicherweise doch etwas unbequem sein. Das macht man nicht ohne Grund. Wenn Sie das Buch ausgewertet haben, würde ich es mir gern ansehen. Vielleicht entdecke ich einen Hinweis. Was allerdings nicht sehr wahrscheinlich ist. Es gibt haufenweise Tommaso-Ausgaben, und es gibt sie in allen Kultursprachen. Aber vielleicht kann ich noch mehr für Sie tun. Ich werde mich gern umhören. Hier in der römischen Priesterschaft habe ich nämlich einige sehr gute Bekannte. Die würden mir unbedingt helfen, wenn es etwas zu helfen gibt.
„Noch einen caffè?“ fragte Giuliana den Commissario.
„Grazie mille!“ antwortete Settembri. „Ich habe Sie schon zu lange in Ihrer Abendruhe gestört. Draußen wartet ein Beamter, der mich nach Hause fährt. Der Arme langweilt sich bestimmt.“
Er stand auf, grüßte, küsste Giulianas Hand, und dann brachte ich ihn zur Tür.
„Danke für Ihre Bereitschaft, uns zu helfen“, sagte er noch. „Morgen früh sollten wir telefonieren. Einverstanden?“
Dann ging er die Treppe hinunter, rasch wie ein junger Mann. Ich sah ihn unten verschwinden. Seine Stellung im Kommissariat und seine Beziehung zum Nachfolger Franco müssen immer noch so eng sein, dachte ich, dass man ihm jederzeit ein Polizeifahrzeug und sogar einen Fahrer zur Verfügung stellt. Als ich nach meiner Emeritierung die Universität verließ, drückte man mir die Hand. Damit war ich entlassen. Das war mein Abschied, ein endgültiger Abschied nach vielen Jahren gewissenhafter Arbeit! Abgesehen von einem Kollegen, mit dem ich einigermaßen befreundet bin, habe ich niemals mehr etwas gehört von meiner ehemaligen Dienststelle.
„Schon wieder ein Mordfall!“ sagte Giuliana, als ich mich gesetzt hatte. „Und schon wieder sollst du helfen!“
Ach, meine Hilfe, Liebste! Was kann ich da schon helfen? Meine Hilfe in der Vergangenheit war schließlich immer nur marginal.
„Trotzdem werde ich Angst um dich haben. Es kann doch nicht ohne Gefahr sein, wenn man versucht, einem Mörder auf die Spur zu kommen! Wie auch in der Vergangenheit haben wir ja nicht die geringste Vorstellung, wo die Täter zu suchen sind. Was sind das für Leute, die einen so jungen, offenbar vollkommen harmlosen Priester umbringen, die ihn so gezielt, so unbarmherzig ermorden? Das schien ihnen doch ungeheuer wichtig gewesen zu sein. Da steckt eine große Wut dahinter oder eine große Angst vor irgendeiner Aufdeckung. Ja, vielleicht soll der Mord etwas verdecken! Nein, Professore, das ist kein gewöhnlicher Mord! Da geht es nicht um einen erbärmlichen Erbstreit, nicht um eine lange Fehde zwischen Nachbarn, und der arme Renato ist auch nicht das Zufallsopfer eines irren Mörders, der herumläuft und ziellos tötet. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass dahinter eine mächtige Kraft steckt. Das wird gefährlich! Das wird unbedingt gefährlich! Halte dich möglichst im Hintergrund! Diese Täter töten wieder, wenn sie fürchten, entdeckt zu werden. Sie töten wieder, wenn sie fürchten, dass die Absicht, die sie bei ihrem Verbrechen gehabt haben, vereitelt wird.“
Ich habe ihr still und mit großem Vergnügen zugehört. Sie hat genau das gesagt, was mir auch durch den Kopf ging. Haargenau!
Du hast Recht, sagte ich also. Wie immer! Das ist eine Analyse, die überzeugt. Aber jetzt sollten wir mit unseren Spekulationen aufhören. Vielleicht haben wir morgen schon neue, interessante Informationen, und dann müssen wir neu und ganz anders spekulieren.
Meine Giuliana ist bemerkenswert klug! Sie hat bloß acht Jahre lang eine Pflichtschule besucht. In einem Vorort von Rom. Viele Schüler in einer Klasse, zu viele. Stets Unruhe. Eine Lehrerin, die selbst nur elementar ausgebildet war. Giuliana hat trotzdem Lesen und Schreiben gelernt, fehlerfrei; sie hat mit mir gelernt, die deutsche Sprache recht gut zu verstehen und auch zu sprechen; ein bisschen Englisch hat sie sich selbst beigebracht; und sie ist tüchtig, ja geradezu perfekt in dem Modegeschäft, das ihr gehört. Ihre Einschätzung von Problemen ist beinahe immer schlüssig. Oh, sie ist klug! Klugheit oder gar Weisheit hängen wohl nur bedingt mit dem Schulabschluss zusammen. Ich habe Hochschullehrer kennengelernt, die außerhalb ihres engen Spezialgebiets einigermaßen dämlich waren, oft sogar sehr dämlich. Und die vielen Lumpen, die sich zurzeit bei den Wahlen überall in Europa für die Lumpenparteien entscheiden, sind in ihrem Denken offenbar auch nicht besonders leistungsstark, selbst wenn sie Brötchen backen, Dachziegel einhängen oder einen Automotor reparieren können. Vor Jahrzehnten war man einfach privat blöde, heute sammelt man sich in Rechtparteien. Die Dummheit ist die mit Abstand verbreitetste Krankheit auf der Welt. Und ist nicht der grausige Krieg der Kremlbande auch ein Beweis für eine abgrundtiefe, grässliche, grausame Dummheit? Und wenn das so ist, dann zeigt dieser Krieg auf schreckliche Weise, welche Auswirkungen die Dummheit haben kann. Sie ist auf gar keinen Fall bloß ein privater Defekt! Sie kann furchtbare Folgen für viele haben. Mein Vater sagte manchmal: Ein bisschen Intelligenz schadet in keinem Gewerbe. Umgekehrt kann man sagen: Dummheit schadet in jedem Gewerbe. Und im zwischenmenschlichen Bereich ist sie oft furchtbar.
Morgen wissen wir mehr, sagte ich, als wir schon beinahe eingeschlafen waren. Morgen erfahren wir vielleicht auch, dass die Aufklärung dieser Untat ganz unspektakulär sein wird.
„Schön, dass du mich trösten willst! Ich habe trotzdem Angst, schlecht zu träumen.“ Aber nach wenigen Minuten hörte ich meine süße Frau schon tief und ruhig atmen. Ich wünsche ihr so sehr einen angenehmen Traum!
Rom, Sonntag, 1. September
Wir waren früher als gewöhnlich auf den Beinen. Das ergibt sich manchmal so, und oft weiß man gar nicht, warum das so ist. Unser Körper ist keine Maschine. Weil wir uns meistens erst gegen Mitternacht ins Bett legen, schlafen wir morgens bis kurz nach sieben, und dann machen wir uns langsam fertig (Schließlich bin ich schon sehr deutlich über fünfzig, und da braucht man etwas mehr Zeit!), dann frühstücken wir mit großer Gemütlichkeit, plaudern, lachen, trinken nach einem caffè einen weiteren caffè oder auch eine Tasse Filterkaffee, fragen uns: Was liegt heute an? und dann ist immer noch genug Zeit, bis neun Uhr in Giulianas Geschäft zu sein. Am Sonntag übrigens ist das Geschäft am Vormittag auch geöffnet. Das ist üblich im Italien. Der morgendliche Rhythmus ist also auch an diesem Tag nicht anders. Ein wirklich vollkommen freies Wochenende ist eine Seltenheit, aber möglich. Wir sind Herren unserer Zeit. (Sagt eine Frau heutzutage: Ich bin Herrin meiner Zeit?)
An diesem Morgen war ich früh wach. Ich konnte auch nicht wieder einschlafen, warf mich noch eine Weile im Bett herum, dann fasste Giuliana nach meiner Hand, sie war also ebenfalls wach geworden, sie küsste mich auf die Stirn, stand auf und verschwand im Bad, und da wollte ich auch nicht mehr liegenbleiben. Es war erst kurz nach sechs.
Beim Frühstück schwiegen wir uns zunächst eine Weile an. Was selten ist! Der Mordfall ging uns durch den Kopf, beiden, denn beinahe gleichzeitig sagte wir etwa: Also – jetzt geht es wieder los!
„Da geht es offensichtlich um Wichtiges!“ behauptete Giuliana und biss in ihr Marmeladenbrot. Eine selbst gemachte Marmelade! Meine Schwiegermutter (Die Schwiegereltern wohnen nicht weit von uns!) ist eine Meisterin in der Kunst, hinreißende Marmeladen zu kochen! Und dezent kauend fügte sie hinzu: „Glaub mir. Das wird gefährlich für den, der seine Nase dahinein steckt!“
Ein Mord innerhalb der Geistlichkeit, antwortete ich, das kann doch nicht so bedrohlich werden. Der Mörder ist gewiss kein Berufskiller. Der sitzt jetzt irgendwo im Verborgenen und zittert vor Angst. Und wenn der Postbote schellt, dann fürchtet er schon den Polizeizugriff.
„Da solltest du nicht zu sicher sein! Nehmen wir einmal an, dass das Morden nicht zur Hauptbeschäftigung des Täters gehört, dann wird er gerade besonders verzweifelt versuchen, seine Tat zu vertuschen. Und wenn er seine Entdeckung befürchtet, dann wird er in seiner Verzweiflung wieder morden.“
Wir müssen abwarten, sagte ich weise. Wenn ich den Commissario treffe, werde ich Neues erfahren. Jetzt können wir ja nur spekulieren.
„Aber das Spekulieren macht mir durchaus Spaß!“ lachte Giuliana. „Es ist so eine nette Gehirnarbeit. Und manchmal sind uns dabei doch auch ganz vernünftige Gedanken gekommen.“
Wir hatten unser Frühstück so ziemlich abgeschlossen. Rührei mit Schinken, dunkles Brot, Pecorino, außer der selbst gemachten Marmelade noch ein Heidehonig, den mir ein Freund aus Deutschland geschickt hat. Der Gute versorgt mich bisweilen mit gutem Typischen aus der Heimat, weil er wohl denkt, dass mir hier in Italien Wesentliches abgeht! Es geht doch nichts über die deutsche Küche! sagte er manchmal. Aber dann lachte er und fügte hinzu: Ist natürlich Quatsch! Wenn ich schon mal zum Essen gehe, dann gehe ich meistens zum Italiener hier in unserer Straße. Auf jeden Fall: Der Honig meines Freundes ist ausgezeichnet! Giuliana goss mir noch ein wenig Kaffee nach, da ging das Telefon.
„Settembri!“ sagte meine liebe Frau. „Ich wette! Das kann nur Settembri sein!“
Natürlich war es der Commissario!
„Professore“, sagte er nach einer kurzen Begrüßung, „ich denke, dass Sie längst auf den Beinen sind, dass ich Sie also nicht ernsthaft störe. Franco legt Wert auf Ihren Rat. Können wir uns um neun Uhr an der Santa Maria treffen? Wir finden hier leicht einen Dienstwagen, und für Sie sind es zu Fuß kaum zehn Minuten. Oder ist Ihnen das zu früh?“
Nein, nein, ich komme gern, und Sie haben uns kein bisschen gestört, sagte ich. Sie wissen aber, dass meine Frau ihr Geschäft auch heute am Sonntag öffnet. Um neun. Ich komme also lieber eine knappe Stunde später, damit ich sie zuerst hinbringen kann. Ist das in Ordnung?
Es war in Ordnung. Wenn Franco schon am Sonntag arbeitet, so hat er ja doch wohl mehr Zeit als üblich, und Settembri ist nun nach seiner Pensionierung sowieso ein Freizeitpolizist. Giuliana räumte die Küche auf, und ich ordnete die Betten im Schlafzimmer, dann machten wir uns zum Ausgehen fertig.
Ich zog eine leichte Jacke an, denn es ist morgens hier in Rom zwischen den Häusern und im Schatten noch recht kühl, Giuliana trug ein Kleid mit viel Rot und wenig Schwarz, dazu eine kurze Jacke, und sie sah wie immer hinreißend aus. Wir schlossen die Wohnungstür hinter uns ab, Schloss, Riegel, noch ein Schloss, das macht man hier so, auch wenn die Einbrecher keineswegs täglich auf der Matte stehen, und gingen los, Hand in Hand, raus aus der Haustür, zuerst nach links, dann rechts durch eine enge Gasse hin zu ihrem Geschäft.
Es war gerade neun Uhr. Ich hatte noch Zeit bis zu der Verabredung mit Settembri und Franco. Giuliana wollte in ihrem Laden einiges regeln, ordnen, dekorieren, bevor die ersten Kundinnen kommen würden. Wenn es möglich ist, gehen wir gemeinsam aus dem Haus, und wenn ich Zeit habe, und seit meiner Emeritierung kann ich mir fast immer Zeit nehmen, helfe ich ein bisschen aus in ihrem Geschäft. Manchmal verkaufe ich sogar Kleider, und es hat sich noch nie eine Dame über meine rudimentäre Kompetenz beklagt! Eine gewisse Beredsamkeit und ein paar freundliche Komplemente können fehlende Fachkenntnisse durchaus ersetzen!
Und dann war es Zeit aufzubrechen. Ein Kuss, noch einmal ein Zunicken, dann schloss ich die Ladentür hinter mir, und wie immer versetzte es mir einen kleinen Stich, als ich meine Giuliana verlassen musste. Ich weiß den Grund nicht, aber mir scheint, dass meine Zuneigung zu ihr im Alter noch wächst!
Die kleinen Straßen, die engen Gassen in Trastevere sind längst mein Zuhause geworden. Nein, da gibt es nichts Spektakuläres! Römische Highlights darf man hier nicht erwarten. (Die Santa Maria ist die wichtigste Ausnahme!) Alte Häuser, viele ein wenig heruntergekommen, kleine Geschäfte, Einwohner, deren Vorfahren schon hier wohnten. Trastevere war einmal ein Vorort der armen Leute, der Handwerker und der unbedeutenden Kaufleute. Das hat sich geändert. Trastevere ist Mode geworden. In den vergangenen Jahrzehnten konnte man so manches Haus günstig kaufen, um es dann, vor allem im Inneren, prachtvoll zu renovieren. Auch das hat sich geändert. Wirklich günstig ist hier nichts mehr zu haben. Die Preise selbst für ziemlich baufällige Immobilien sind stark gestiegen. Die Zeit der Schnäppchen ist vorbei. Der Attraktivität von Trastevere hat das aber nicht geschadet. Der Vorteil vermutlich: Man wohnt hier ein wenig abseits vom Weltstadttrubel und ist doch, wenn man will, in wenigen Minuten mitten drin.
Der Platz vor der Santa Maria in Trastevere war so früh am Morgen schon ungewöhnlich belebt, und die Tische vor dem Caffè di Marzio waren alle besetzt. Zu der herrlichen Kirche Santa Maria werden regelmäßig ganze Busladungen von Touristen gebracht, mal mehr, mal weniger, und so erklärt sich der Andrang auch zu ungewöhnlichen Tageszeiten. Die Santa Maria ist auch tatsächlich eine der bedeutenden Attraktionen in Rom. Vor allem ihre Mosaiken sind sensationell.
Die Tische sind besetzt. Alle. Mit Settembri kann ich erst in etwa einer halben Stunde rechnen. Und er ist pünktlich. Immer! Was tun? Ich werde hier auf keinen Fall herumstehen und warten. Gehe ich hinein in die Santa Maria? Man kann sie nicht oft genug ansehen! Da winkt mir ein Mann zu. Er sitzt allein an einem Tisch vor dem Caffè. Meint er mich? Doch – seine Geste ist unmissverständlich. Also gehe ich hin, und er bietet mir an, mich an seinen Tisch zu setzen. Es ist ein alter Mann, eingehüllt in einen dunklen Mantel, der irgendwie zu weit zu sein scheint, ein alter Mann, weißhaarig, mit einem mittellangen Bart, auch weiß, schneeweiß. Er trinkt einen caffè, und als der Kellner sofort herbeikommt, so als habe er schon auf mich gewartet, wahrscheinlich kennt er mich längst als einen Begleiter des Commissario, bestelle ich auch einen caffè und un pò d’acqua gassata.
Buon giorno! habe ich gegrüßt. Der Mann hat mir nur zugenickt, aber nun fragt er ganz unvermittelt: „Glauben Sie an Gott?“
Wahrhaftig eine ungewöhnliche Frage! Eine ganz unerwartete Frage! Ist es nicht so: Die Leute sprechen mit den Leuten über alles, aber nicht über ihren Glauben. Nein wirklich: In unseren doch eigentlich christlich geprägten Ländern spricht man über Hinz und Kunz, über Diätrezepte und die Entwicklung in Afghanistan, aber nicht über das persönliche Christentum, über Gott, über die Hoffnung auf Auferstehung. Seltsam! Das sind doch nun wirklich bedeutsame Themen!
„Glauben Sie an Gott?“ fragte er noch einmal. Offenbar habe ich zu lange gezögert mit einer Antwort. Ich bemühe mich, ein unüberraschtes, ein interessiertes Gesicht zu machen.
Ja schon, sage ich, doch ich glaube an Gott. Jedenfalls meistens, denn ich habe auch Fragen, Unsicherheiten, Probleme. Er macht es einem nicht leicht. Man hätte ja gern Beweise. Geht aber nicht. Ich bin Philosophieprofessor, müssen Sie wissen, und mir ist natürlich bekannt, dass man Gottes Existenz nicht beweisen kann. Wenn er ist, dann ist er der ganz Andere, vollkommen außerhalb unserer Vorstellung.
„Aber Sie glauben ein bisschen an ihn?“ fragte der Fremde.
Kennen Sie den Tommaso? fragte ich zurück.
„Klar“, antwortete er, „den von Aquino, den Kirchenlehrer.“
Der hat sinngemäß gesagt: Das höchste Wissen von Gott, das wir erlangen können, besteht in dem Wissen, dass er gänzlich über unserem Denken ist. Aber er hat, erklärte ich, trotzdem Gottesbeweise versucht. Natürlich geht das nicht, und das wusste er wohl auch. Es sind keine wirklichen Beweise, sondern so etwas wie Denkanstöße. Alles Entstandene, sagt er sinngemäß, ist aus etwas anderem entstanden und das wieder aus einem andern. Alles, was ist, hat eine Ursache, und die hat wieder eine Ursache, und so kann man das weiterdenken. Aber am Ende dieser Kette oder an ihrem Anfang, wie man will – was ist da passiert? Wer hat das alles angestoßen? Wer hat es sich ausgedacht? Tommaso sagt: Das war Gott!
„Und damit haben Sie nun Probleme?“ fragte der Mann lächelnd.
Ja, sagte ich, wenn Gott am Anfang das Universum erfunden hat, wer hat dann ihn erfunden? Und wenn er nicht erfunden worden ist, wo war er, wenn es doch noch nichts gab? Und was hat er damals gemacht? Und wenn das Universum vier Milliarden Jahre alt ist oder sieben oder dreizehn, ich kenne mich da nicht so aus mit der neuesten Forschung, warum hat er so lange gebraucht dafür, und warum hat er den Menschen so spät gemacht? Und warum ist dieser Mensch so erbärmlich unvollkommen? Warum ist er so oft mehr Kain als Abel?
„Sie hängen sich ganz schön rein, Herr Professor“, lachte der Mann. „Aber so kommen Sie der Sache nicht näher! Es ist vertrackt, das sehe ich ja ein, aber den Glauben muss man wagen. Sozusagen ohne Netz und doppelten Boden. Wahrscheinlich muss man Gott wollen.“
Und Sie, wollen Sie ihn? fragte ich.
„Unbedingt!“ antwortete er. „Schon aus Selbstschutz. Wie sollte ich sonst das Leben aushalten? Und wie die Aussicht auf den Tod? Soll etwa der ganze Sinn meiner Existenz darin liegen, sechzig, siebzig, achtzig Jahre lang im besten Fall ein anständiges Leben zu führen und dann einfach spurlos zu verschwinden wie das Gras? Das genügt mir nicht! Schauen Sie, dieser Herr nähert sich Ihnen! Sind Sie verabredet? Ich mache ihm Platz.“
Er stand auf, nickte mir zu und ging hinüber zum Kellner, um zu bezahlen. Settembri war an meinen Tisch gekommen, und er setzte sich ohne weitere Umstände.
„Ein merkwürdiger Herr“, sagte er. „Hatten Sie ein nettes Gespräch?“
Nett kann man das nicht nennen. Es war ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Wir haben uns über keinen Geringeren als Gott unterhalten, und wir waren uns darüber einig, dass man seine Existenz nicht beweisen kann. Da hilft alles nichts: Man muss ihn tapfer glauben. Unser Tommaso sagt zum Thema: ‚Das ist das Äußerste unserer Gotteserkenntnis: Wir können wissen, dass wir Gott nicht wissen.‘
„Weiter als der Tommaso sind Theologen und Philosophen heute auch noch nicht!“ stellte Settembri vollkommen richtig fest, dann winkte er den Kellner heran, der grüßte beinahe devot und brachte ihm im Nu einen caffè, und da sahen wir auch schon unseren Freund Franco, der sich durch eine Touristengruppe drängte.
„Da kann ich machen, was ich will“, sagte er, nachdem er uns begrüßt hatte, „der Commissario Settembri schafft es immer, vor mir am Treffpunkt zu sein.“
„Sie waren doch noch stets rechtzeitig zur Stelle“, lachte Settembri. „Ohne Ihre Zuverlässigkeit wären Sie nicht mein Nachfolger geworden. Nun berichten Sie mal! Gibt es was Neues?“
„Nun – wir wissen inzwischen einiges über das Opfer und auch über den Tathergang. Der Tote war geweihter Priester, sein Name Renato F., sein Alter 31 Jahre. Er wohnte in einem für kirchliches Personal angemieteten Haus ein ganzes Stück weg vom Vatikan. Ein Freitod ist ausgeschlossen. Das hat die Obduktion ergeben. Er wurde ermordet. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Aber das wisst ihr schon. Das Gift, das die Mörder benutzt haben, war Strychnin. Es ist eine schnell wirkende Substanz, durch die die Atmung gelähmt wird. Ein schneller Tod, aber mit furchtbaren letzten Minuten. So stelle ich mir das vor. Man hat ihm das Gift mit Gewalt in den Mund gezwungen. Freiwillig hätte er es nicht geschluckt. Auf Gewalt deuten blaue Flecken an den Oberarmen und Verletzungen an den Zähnen hin. Weil dieser Renato ein durchaus kräftiger Mann war, kann es als gesichert gelten, dass es zwei Mörder waren, die ihm das Gift eingeflößt haben. Drei werden es nicht gewesen sein. Je größer die Zahl der Täter ist, desto mehr muss abgesprochen werden und desto größer ist die Gefahr, das sich einer verplappert.
Der Fundort ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Tatort. Vor der Bank, auf der man ihn gefunden hat, ist der Boden zerstampft. Es gibt aber keine verwertbaren Abdrücke von Schuhsohlen. Auch sonst haben wir nichts gefunden, was auf die Täter hinweist.“
Franco hielt inne.
„Das sind Informationen über die Tat und den Tatort“, sagte Settembri. „Und sonst?“
„Wir wissen noch wenig. Die Befragungen in seinem Umfeld fangen erst richtig an. Bisher hat sich bestätigt, was wir gleich von seinen Freunden oder Bekannten erfahren haben: Er war ein gescheiter, fröhlicher, angenehmer Mann. Ausgeschlossen, dass er Feinde hatte.“
„Nun wird aber nur sehr selten ganz ohne ein Motiv gemordet“, warf Settembri ein, „und weil ein Zufallsmord durch einen irren Massenmörder bei diesem Giftmord ganz undenkbar ist, müssen wir davon ausgehen, dass ein Motiv vorliegt.“
Und das wird dann doch wohl ein Motiv sein, das außerhalb seiner Familie, seines Freundeskreises, seines Alltags liegt, sagte ich. In diesen Kreisen kann sich ein so freundlicher Mensch kaum einen Feind gemacht haben, der sich zu einem so perfiden und grausamen Mord herausgefordert fühlt. Also hat sich dieser junge Mensch, denke ich, mit irgendeiner potenten Macht angelegt, die nicht mit sich spaßen lässt und die im Verborgenen bleiben will.
„Ja, so denke ich mir das auch“, bestätigte Franco meine Meinung. „Und wenn es sich dabei um eine innerkirchliche Macht handelt, dann wird die Aufklärung dieses Mordes eine sehr schwere Aufgabe für uns. Sollte unsere Annahme richtig sein, dann werden wir nämlich auf viele Mauern des Schweigens stoßen, Mauern, die mindestens so perfekt sind, wie wir das von der Mafia kennen. Man wird uns bei unseren Untersuchungen und Befragungen die dicksten Steine in den Weg legen; wir können keinerlei Unterstützung erwarten; man wird uns behindern, diffamieren, beschimpfen; geschickte Rechtsanwälte werden versuchen, uns die Berechtigung abzusprechen, im Bereich des Klerus überhaupt Recherchen durchzuführen.“
„Und der Tommaso?“ frage Settembri.
„Interessant, aber zunächst geheimnisvoll. Wir haben, von diesem Büchlein abgesehen, überhaupt nichts bei dem Toten gefunden, keine Geldbörse, keine Kreditkarte, kein Smartphone, nicht einmal ein Taschentuch. Den Ausweis allerdings hat man ihm gelassen, wohl mit Absicht, wobei mir diese Absicht allerdings nicht so ganz klar ist. Vielleicht sollte er helfen, uns an Selbstmord glauben zu lassen. Bleibt also dieses kleine Büchlein mit den Tommaso-Texten, das er in seinem Strumpf versteckt hatte, wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, was er sich dabei gedacht hat.“
Haben Sie schon hineingeschaut? fragte ich. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen?
„Es sind Textstellen unterstrichen. Eine ganze Menge sogar. Und neben einigen Textstellen sind handschriftlich kurze Bemerkungen eingetragen. Es gibt mindestens 25 solcher Randnotizen, schätze ich. Genau gezählt habe ich diese Stellen nicht. Geschrieben sind sie teils in Latein, teils in Italienisch.“
Kann ich das Buch sehen, wenn Sie es untersucht haben? fragte ich.
Franco: „Selbstverständlich! Ich möchte Sie sogar ausdrücklich darum bitten, sich diese Anmerkungen genau anzusehen. Vielleicht sind sie bloß Ausdruck eines engagierten Studiums, vielleicht aber enthalten sie auch entscheidende Hinweise. Falls das so ist, Professore, traue ich Ihnen mehr als mir selbst die Kompetenz zu, sie zu finden.“
Settembri: „Und ich möchte Sie bitten, Professore, uns eine kleine Übersicht über den Kirchenlehrer Tommaso und sein Werk zu geben. Vielleicht hilft uns das. Ich weiß von ihm nur, dass es ihn gab und dass er wichtig ist.“
Ich: Für die katholischen Kirche ist er als Kirchenlehrer immer noch von größter Bedeutung. Es fällt mir auf, dass der arme junge Mann ausgerechnet den Tommaso bei sich hatte, ausgerechnet diesen großen theologischen Theoretiker. Das macht mich nachdenklich, aber noch weiß ich nicht, in welche Richtung ich nachdenken soll.
Franco: „Ich lasse Ihnen das Buch bringen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Unnötig zu sagen…“
Ich: …dass ich höchst vorsichtig damit umgehen muss! Das versteht sich, und selbstverständlich wird es meine Wohnung nicht verlassen.
Wir hatten unseren dritten caffè ausgetrunken. (Ich sollte meinem Magen nicht zu viel Kaffee zumuten!) Settembri winkte, und der Kellner kam an unseren Tisch.
„Commissario?“ fragte er.
„Ich möchte zahlen“, antwortete Settembri, „sechs caffè und ein Wasser.“
Da hat es keinen Zweck, sich zu sträuben. Der Commissario würde in einer solchen Situation niemals Geld annehmen. Es ist auch in Italien weitgehend üblich, dass einer aus der Runde die ganze Rechnung bezahlt. Man vermeidet das peinliche Getrenntbezahlen, auf das man in Deutschland so gern besteht. Entweder bekommt derjenige, der bezahlt hat, seinen Anteil später, was sich vor allem bei sehr hohen Rechnungen anbietet, oder es bezahlt bei der nächsten Gelegenheit ein anderer. Das ist so üblich, und das hat sich bewährt, weil es von niemanden schamlos ausgenutzt wird. Übrigens kann sich Settembri eine gewisse Großzügigkeit leisten: Seine Frau besitzt ein florierendes Reisebüro. Das Ehepaar ist ohne Zweifel wohlhabend.
Und was mich immer wieder wundert: Der Commissario ist hier in Rom beinahe überall bekannt! Das mag an seiner langen Dienstzeit liegen, ist aber auch Folge seiner freundlichen Art. Er ist immer höflich und ausgeglichen. Ich habe bei Vernehmungen, an denen ich teilnehmen durfte, mehrfach erfahren, dass er selbst mit üblen Verbrechern beinahe respektvoll umgeht. Mir scheint, dass Drohen und Anbrüllen ihm auch weniger Erfolg bei Aufklärungen eingebracht hätten. Settembri ist nun mal ein Gentleman. Er verhält sich vornehm, könnte man mit Recht sagen, immer, und das wird akzeptiert und honoriert.
„Wir werden nun alle bekannten und erreichbaren Kontaktpersonen des Toten befragen“, sagte Franco, als er uns die Hand reichte.
Und ich werde auch versuchen, Erkundigungen einzuziehen, versprach ich. Ich habe einige Bekannte unter den Wissenschaftlern im Klerus, das sagte ich dem Commissario schon. Vielleicht kann ich da etwas erfahren, das uns nützlich ist.
Die beiden gingen fort, ich aber blieb noch sitzen und schaute ihnen nach. Sie verschwanden zwischen den Touristen, die den Platz bevölkerten, in Richtung Via del Moro. Franco hatte, noch zwischen den Tischen, kurz telefoniert. Wahrscheinlich wartete ganz in der Nähe ein Beamter mit einem Polizeiwagen auf ihn.
„Haben Sie noch einen Wunsch, Professore?“ Der Kellner kannte mich offensichtlich auch schon als einen häufigen Begleiter des von ihm hoch geschätzten Commissario.
Gibt es noch ein Cornetto con crema? fragte ich. (Das sind, wenn sie morgens ganz frisch geliefert sind, wunderbare Röllchen oder Hörnchen mit einer wahrhaft unwiderstehlichen Vanillecreme!)
„Kommt sofort!“ Er verschwand und kam nach kaum einer Minute zurück, das Hörnchen auf einem Teller und zusätzlich mit einem Cappuccino, den ich gar nicht bestellt hatte, der aber die beste denkbare Ergänzung zu dem Gebäck ist.
Es kam dann noch ein Musikant an meinen Tisch. Er spielte so eine Art Harmonium, nicht einmal schlecht, und er verstand es, mir seinen Pappbecher hinzuhalten, ohne sein Spiel dabei zu unterbrechen. Selbstverständlich legte ich ihm einige Euro hinein. Das mache ich immer. Ich kann ohne schlechtes Gewissen nicht an Bettlern vorbeigehen. Und dieser Musikant ist ja eigentlich gar kein Bettler. Er bezahlt, was ich ihm gebe, mit seiner Musik. Die Kellner sehen es nicht gern, wenn ihre Gäste mit oder ohne Musik, wenn sie mit Sonnenbrillen oder Billigschmuck belästigt werden, und der Musikant verschwand auch still und leise, als unser Kellner auftauchte und ein einigermaßen böses Gesicht aufsetzte. Er wird sich mit Sicherheit zur nächsten Bar aufmachen. Dass viele Lokale in dieser Jahreszeit ihre Gäste auch im Freien bedienen, kommt ihm zugute. Geht er allerdings hinein in ein Restaurant, bekommt er sehr wahrscheinlich eine deutliche Abfuhr, bisweilen auch eine sehr deutliche!
Vom Rest des Tages ist nicht mehr viel zu berichten. Nach Giulianas Rückkehr aus ihrem Geschäft aßen wir nur eine Kleinigkeit – wie stets, wenn es das Wetter zulässt, auf dem Balkon. Den Nachmittag über beschäftigte ich mich mit Thomas von Aquin, Giuliana mit Büroarbeiten, die in einem Geschäft eben auch anfallen. Literatur zum Tommaso habe ich in einer hübschen Auswahl im Haus. Abends kam Marzia, die jüngere unserer beiden Töchter, hereingestürmt. „Habt ihr noch etwas zu essen?“ Hatten wir! Und was wir hatten, das aß sie mit sichtbarer Begeisterung. Und so ging dieser Abend mit einer gemütlichen Mahlzeit und einer fröhlichen Plauderei zu Ende.
Rom, Montag, 2. September
Ich hatte dem Commissario zugesagt, ihm ein paar Informationen über Thomas von Aquin zusammenzustellen. Das Tommaso-Büchlein, das der tote Priester in seinem Strumpf stecken hatte, ist immerhin der einzige konkrete Hinweis, den die untersuchenden Beamten haben. Aber worauf weist er hin? Steht er überhaupt in irgendeinem Zusammenhang zu dem Mord? Egal! Versprochen ist versprochen, und ich werde mich daranmachen, dem Freund Settembri seinen Wunsch zu erfüllen. Ja, er ist ein Freund! Wir halten in unserer Beziehung, die doch nun schon viele Jahre besteht, einen vornehmen Abstand. Wir denken nicht daran, uns zu duzen, haben aber trotzdem ein sehr enges Verhältnis zueinander, das vermutlich für den Rest unseres Lebens halten wird. Ein Freund? Ja, ich bin sicher, er würde sehr viel einsetzen, wenn es nötig wäre, mir zu helfen. Settembri ist ein Gentleman. Für die Zuverlässigkeit seines Charakters, seines Anstands, seines Edelmuts lege ich meine Hand ins Feuer. (Edelmut – eines der bedeutsamen Wörter, die aus der Mode gekommen sind! Schade!)
Also der Tommaso d‘Aquino! Wer wäre besser geeignet, dem Commissario die gewünschten Informationen zu liefern, als ein emeritierter Philosophieprofessor, der dazu noch Spezialist für ältere italienische Philosophie ist? (Ich vermute allerdings, dass wir Hinweise eher in dem Büchlein selbst, also bei den Randnotizen, als in dem Text des großen Philosophen finden, dass eine Beschäftigung mit seinem Leben und Werk also bloß ein intellektuelles Vergnügen ist! Macht nichts. Wie gesagt: Versprochen ist versprochen!)
Ich hatte meine Giuliana zu ihrem Geschäft gebracht. Die Eingangstür war schon geöffnet. Carolina, die Angestellte, die Freundin Giulianas, die kompetente Helferin im Geschäft und blitzgescheite Plauderin, war wieder einmal früher gekommen als ihre Chefin.
„Buon giorno, Giuliana! Buon giorno, Professore!“ rief sie uns entgegen, fröhlich wie immer, mit blitzenden Augen.
„Ausgeschlafen? Gemütlich gefrühstückt?“ neckte sie uns. Sie darf sich das erlauben, ja, das macht gerade ihren Charme aus.
„Bevor ihr gekommen seid, hätte ich beinahe schon ein Kleid verkauft, aber die Kundin hat es sich anders überlegt. Der Geiz sprach ihr aus den Augen. Wahrscheinlich geht sie jetzt zu einer der Billig-Ketten und kauft ein Kleid aus Asien. Niedriger Preis, schlechte Qualität, genäht von Kindern und hunderttausend Exemplare in ganz Europa. Was sage ich? Eine Million in der ganzen Welt! Der reine Müll! Den Mist kauft sie in diesem Augenblick. Ja, ja, Professore, ich weiß, was Sie jetzt unbedingt sagen wollen: Die asiatischen Menschen dahinten auf der anderen Seite unserer Erdkugel brauchen die Arbeit, brauchen ihren Lohn, wollen essen usw. Aber muss uns der Schund vom Markt verdrängen? Wo bleiben die edlen Fachgeschäfte, die es einmal in unseren Städten gab?“
Denken Sie auch daran, Carolina, dass diese Frau vielleicht nicht imstande ist, unsere Preise zu bezahlen? Unsere Kleider sind in jeder Hinsicht von hoher Qualität, aber sie sind für manchen Geldbeutel ein wenig teuer.
„Ach, ich ärgere mich ja auch weniger über diese Frau als über die großen Handelsketten, die in der ganzen Welt den gleichen Schund verkaufen. Andererseits: Wir kommen doch trotz unserer Preise ganz gut zurecht. Wir haben unsere Stammkunden und viele Touristen kommen in unseren Laden, und gute, teure Kleidung verkauft sich offenbar immer noch besser als die teuren Schirme, Hüte, Schuhe oder die Wäsche, die es bis vor einigen Jahren noch in alten, berühmten Fachgeschäften gab, in Geschäften, die leider alle so nach und nach verschwunden sind, vom Markt verdrängt, in Konkurs gegangen.“
„Ja“, nickte Giuliana, „wir können mit unserem Umsatz zufrieden sein. Wir haben ja tatsächlich gesehen, dass gerade viele Spezialgeschäfte in den letzten Jahren aus dem Zentrum verschwunden sind. Wir brauchen uns hier vorläufig keine Sorgen zu machen.“
„Einen caffè, Professore!“ wechselte Carolina gekonnt das Thema. „Die Saeco ist schon betriebsbereit. Ach, schauen Sie: Dieses grüne Kleid sollten wir ins Schaufenster hängen, Chefin! Das ist ein besonders schönes Stück!“
So ging das noch eine Weile hin und her. Ich bekam auch meinen caffè, bekam auch einen Kuss von meiner Giuliana, und Carolina ließ es sich nicht nehmen, mich zu umarmen und mich auf beide Wangen zu küssen. Wie käme ich dazu, mich dagegen zu wehren?
Ja, und dann sagt sie: „Ein junger Mann ist nun mal nicht zur Hand!“ Aber sie grinst dabei hinterhältig, und ich weiß, dass sie nur scherzt. Wir mögen uns.
Auf der Straße war es noch angenehm kühl, und ich hätte jetzt gern einen Spaziergang gemacht, aber der Tommaso wartete, und ich konnte nicht absehen, wieviel Zeit er mich kosten würde. Ich ging also auf dem kürzesten Weg nach Hause, legte mir ein paar Tommaso-Texte und einen entsprechenden Band einer Buchreihe über die großen Philosophen des Abendlandes auf den Schreibtisch, öffnete den Computer, um auch bei Meister Google nachzusehen, und machte mir die ersten Notizen, ordnete dann, was ich auf vielen Zetteln notiert hatte und fasste es zusammen. Das ging schneller als erwartet, aber im Grunde ist das ja auch mein Handwerk. Und hier ist das Ergebnis!
Erster Exkurs: Thomas von Aquin
Commissario, Sie kennen meine Forschungsgebiete als Professor, die römische und die ältere lateinische Philosophie in Italien, und wenn ich Ihnen nun sage, dass Tommaso zu den bedeutendsten Philosophen überhaupt gehört, was Sie ja selbstverständlich auch wissen, dann werden Sie mir gern glauben, dass ich in meinem langen Berufsleben sicherlich mehr als ein Dutzend Vorlesungsreihen und Seminare gehalten habe, die sich ausschließlich oder doch überwiegend mit diesem Denker beschäftigt haben. Die Zuhörer waren übrigens neben den Studenten der Philosophie, die wohl oder übel teilnehmen mussten, immer auch angehende Theologen. (Die auch wohl oder übel teilnehmen mussten!)
Nun ist mir aber gerade in diesen Tagen klar geworden, dass ich mich bei diesen Veranstaltungen eigentlich immer nur ausschließlich mit seinem Werk beschäftigt habe, was ja auch logisch ist, aber kaum mit seinem Leben, kaum mit der Persönlichkeit, die hinter dem Werk steht. Dieser Mensch ist doch schließlich auch geboren worden, war ein Kind, ein Jugendlicher, hat gelebt wie jeder, ist gestorben wie jeder, hatte auf seinem Lebensweg Schmerzen, Freuden, hat geliebt, hat Menschen bewundert, gehasst, verachtet, war mal voller Schwung, mal müde, hatte Hunger, hat gegessen, musste sich um Kleidung, Wohnung, Schlafplatz kümmern. Mit einem Wort: So eine Geistesgröße ist neben seiner Geistesarbeit auch ein ganz normaler, verletzlicher Mensch!
An dieser Stelle muss ich einfügen: Vieles von dem, was ich an den verschiedenen Universitäten gelehrt habe, egal zu welchem Fachgebiet oder zu welcher Persönlichkeit, wurde für eine konkrete Situation zusammengestellt, wurde schriftlich fixiert und dann vorgelesen, und das habe ich heute nicht mehr präsent. Ich habe es schlicht vergessen. Das mag an meinem Alter liegen, liegt in diesem Fall aber auch daran, dass der große Tommaso schon seit Jahren nicht mehr zu meinen Interessen gehörte. Als ich nun in mehreren Büchern die Abschnitte gelesen hatte, die dort als Einführung oder als Nachwort auf das Leben des Tommaso eingehen, stellte ich fest: Das ist alles ungemein dürftig! Die Verfasser kennen die Stationen seines Lebenswegs, ihn aber nicht. Sehen Sie es mir also nach, wenn die folgenden Zeilen oberflächlich bleiben!
Tommaso d’Aquino (in Deutschland Thomas von Aquin) wurde 1224 oder 1225 geboren, also vor ziemlich genau 800 Jahren. Er entstammte einer vornehmen und wohlhabenden Familie. Sein Vater hieß Landulf und war ein Graf von Aquino, die Mutter, typisch für jene Zeit, wird nirgends erwähnt. Die Familie wohnte in einem heute nicht mehr erhaltenen Schloss Roccasecca in dem Dorf, das auch heute noch den Namen Aquino trägt. Dieses Dorf liegt in der Nähe von Cassino, also grob gesagt irgendwo zwischen Neapel und Rom.
Schon 1230, als sehr kleines Kind, kam Tommaso als Schüler zu den Benediktinern in Monte Cassino. Stellen Sie sich das vor, Commissario: Der kleine Tommaso war fünf Jahre alt! In diesem Alter sind unsere Kinder heute im Kindergarten. Dieser kleine Kerl aber kam in die Obhut und Erziehung von wissenschaftlich denkenden Mönchen! Es wird eine ziemlich elitäre Unterrichtung gewesen sein, denn wir dürfen wohl annehmen, dass der Junge keine Klasse mit dreißig Kindern besuchen musste! Die Mönche von Monte Cassino waren wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit, Tommaso genoss mit ziemlicher Sicherheit das, was man heute Einzelunterricht nennt, eine bessere Bildung konnte er also gar nicht bekommen.
1239 wird er zur Universität von Neapel geschickt, um dort zu studieren. Da ist er 15! Unsere heutigen Gymnasiasten gehen dann noch drei Jahre zur Schule! Jahre später schließt er sich einem Dominikanerorden an. Gegen den Willen seiner Familie.
Er ist fünfundzwanzig, und dieser junge Mann muss bereits über einen sehr festen Charakter verfügt haben. Es wird nicht leicht gewesen sein, sich gegen den Vater, den Herrn Grafen, durchzusetzen! Die Familienstrukturen waren damals streng und klar. Es wird sogar erzählt, dass seine Familie ihn eingesperrt hat, um ihn zu hindern, zu den Dominikanern zu gehen. Und weiter: Seine Schwester habe ihn aus dieser Gefangenschaft befreit. Aber da mag es sich um Legenden handeln!
Ich habe mich gefragt: Warum geht dieser junge Mann in ein Kloster? Die Eltern hätte ihn sicher gern als Verwalter und Abgabeneintreiber auf den Ländereien der Grafenfamilie gesehen. Ich vermute, es war weniger tiefe Frömmigkeit als vielmehr unbändiger Wissensdurst. Das Wissen, über das man damals verfügte, war in den Klöstern gesammelt. Nur dort gab es Zugang zu Büchern, Schriften, Quellen aller Art; nur dort lebten Männer (Frauen nur selten!), die man als die geistige Elite ihrer Gegenwart bezeichnen könnte. Nirgendwo sonst hätte der junge Tommaso Zugang zu den Wissenschaften seiner Zeit bekommen können. Aber noch einmal: Wir wissen überhaupt nicht, was Tommaso in den ersten zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren seines Lebens gedacht, erlebt, erstritten hat, ob er geliebt hat oder gehasst! Es gibt bloß ein paar Daten. Und mit diesen kargen Daten geht es weiter, wenn wir versuchen, seinem Leben auf den Grund zu kommen.
Er geht nach Paris und wird Schüler des Albertus Magnus, der ein berühmter Lehrer seiner Zeit ist. Bei dieser wie bei den vielen anderen Reisen, die Tommaso in seinem Leben unternommen hat, muss man sich klarmachen: Für die Strecke von Napoli nach Paris braucht man heute gut zwei Stunden mit dem Flugzeug, mit dem Zug einen halben Tag. Aber was war das für eine monatelange, mühevolle und auch gefährliche Reise in jenem Jahrhundert! Es war eine Reise unter den schwierigsten Bedingungen, unter unsäglichen Strapazen, die auch an den widerstandsfähigen Körper eines jungen Mannes größte Anforderungen stellte, und es war sicherlich auch eine Reise, für die man beträchtliche Geldmittel aufwenden musste. Und Räuberbanden, die auf Reisende lauerten, gab es auch!
Von Paris aus geht Tommaso mit Albertus Magnus nach Köln, dann wieder nach Paris, schließlich für viele Jahre nach Italien (Anagni, Orvieto, Rom, Viterbo). Das war in den Jahren 1259 bis 1268, danach reist er noch einmal nach Paris, dann zurück nach Neapel. Und immer schreibt er! Auf die Ergebnisse seiner Forschungen ist er aber wohl nicht übermäßig stolz gewesen. Irgendwann soll er alles, was er gelehrt und geschrieben hat, als leeres Stroh bezeichnet haben. Diese Bescheidenheit, falls es sich bei dem Bericht nicht auch um eine Legende handelt, ist mir höchst sympathisch!
Papst Gregor X. lädt ihn ein, an einem Konzil in Lyon teilzunehmen. Tommaso wird aber krank und stirbt am 7. März 1274, also schon im Alter von fünfzig Jahren. Bereits 1323 wird er heiliggesprochen.
Fünfzig Jahre – und in diesem doch recht kurzen Leben hat er Schrift um Schrift verfasst. Die wichtigen sind vermutlich alle erhalten, wie ich annehme. Nur über sein privates Leben wissen wir so gut wie nichts. Wie hat er sich gekleidet, ernährt, wie hat er sein Leben finanziert? Hat er gesungen, gespielt, gefeiert? Hatte er Freunde, Helfer, Menschen, die ihm nahestanden oder ihm zuarbeiteten? Er war zweifellos schon zu Lebzeiten eine sehr berühmte Persönlichkeit, aber was von ihm bekannt ist, das klingt eher anekdotisch: Wahrscheinlich war er wohlbeleibt, also sagen wir ruhig: Er war wohl ziemlich dick! Er schrieb viel, und offenbar hat er nicht gern und nicht viel geredet. Mitstudenten nannten ihn den stummen Ochsen. Das wäre dann eine wenig liebevolle Bezeichnung. Und: So nennt man einen Menschen, den man für genial hält, eigentlich nicht!
Mir scheint, Commissario, dass dieser Lebenslauf nichts hergibt für den Fall, den Franco bearbeitet! Vielleicht aber gibt es in seinem Werk, in seinen Schriften einen Hinweis! Morgen oder vielleicht übermorgen will ich versuchen, Ihnen auch darüber einen kleinen Überblick zu verschaffen. -
Später, in Giulianas Mittagspause, das ist in der Regel zwischen eins und vier, kam ich doch noch zu meinem Spaziergang. Wir machten unseren Gang gemeinsam, Hand in Hand, wie immer, und wir unterhielten uns angeregt, auch wie immer. Es ist schon bemerkenswert, und es ist eine Tatsache, die auch andere Ehepaare erleben: Wir haben stets etwas zu erzählen! Eigentlich sollte doch zwischen Eheleuten, die mehr als 25 Jahre verheiratet sind, alles gesagt sein! So ist es aber nicht! Es gibt immer ein Thema, und es wird nie langweilig.
„Es ist merkwürdig“, sagt meine Frau, „dass mich die Fälle, in die du dich hineinziehen lässt, so sehr beschäftigen. Mein Metier ist es doch, Kleider und solche Sachen anzubieten, also günstige und trotzdem attraktive Kleidung im Großhandel oder bei Herstellern zu kaufen und sie dann mit Gewinn an Kunden zu verkaufen. Der Gewinn muss die Geschäftskosten abdecken und noch ein bisschen für mich abwerfen. Es schadet auch nichts, wenn der Gewinn mal ein bisschen höher als gewöhnlich ausfällt, aber reich werden will ich damit nicht, darum verkaufe ich möglichst preiswert. Das hat sich bewährt, und meine Kundinnen mögen mein Geschäft und auch mich, die Inhaberin. Das also ist mein Job. Was gehen mich Settembris und Francos Probleme an? Nun bist du aber wieder einmal ein Teil dieser kleinen Mannschaft geworden, und ich habe wie immer Angst, dir könnte etwas zustoßen. Diese Angst könnt ihr mir nicht nehmen, auch wenn ihr euch bemüht, alles ganz harmlos aussehen zu lassen. Ist es da ein Wunder, wenn meine Gedanken um euren Fall kreisen? Aber die Sorge um dich ist nicht der einzige Grund, mir darüber Gedanken zu machen. Das Problem selbst reizt mich. Das ist offensichtlich. Ich finde eure Detektivarbeit spannend, und eure Probleme lassen mich nicht los. Ihr habt mich immer an euren Überlegungen beteiligt, und dann war das für mich wie Rätsellösen. Spannend! Aufregend! Und hattet ihr den Fall gelöst, war ich erleichtert, aber auch irgendwie zufrieden. So als hätte ich mitgeholfen.“
Ich kann dich gut verstehen, Liebste! sagte ich. Wir sind so innig verbunden, wie solltest du da unbeteiligt bleiben? Und es geht dir also offenbar wie mir: Das Problem packt mich. Es lässt mich nicht mehr los. Die Arbeit daran, die Überlegungen, die Gespräche mit den Kommissaren, all das wird fast zur Sucht. Und es ist gut, dass du mich mit deinen Ideen unterstützt. Du hast nämlich sehr oft durchaus erfolgreich mitgeholfen! So macht das alles noch viel mehr Spaß. Die Polizisten müssen ihre Nachforschungen und ihre Ergebnisse geheim halten. Das versteht sich. Aber sie haben vor dir nie etwas verschwiegen, und sie haben nie von mir gefordert, dir nichts von unseren Gesprächen zu erzählen. Im Ernst: Für Settembri gehörst du zum Team, spätestens seit unserem letzten Fall in Apulien. Und Franco denkt genauso wie sein ehemaliger Chef.
Während unseres Gesprächs waren wir ein Stück die Viale di Trastevere gegangen (Viel Verkehr! Viel Lärm, vor allem wenn die Straßenbahn vorbeifährt! Und ganz schlimm sind manche Motorräder! Ich wundere mich, dass die nicht aus dem Verkehr gezogen werden!), dann bogen wir nach rechts in die Via Morosini ein, weiter durch die Via Mameli und die Via Paglia und dann rechts zur Santa Maria in Trastevere. Giuliana ging hinein für ein kurzes Gebet, ich zum Staunen über so viel architektonische Schönheit. Bisweilen bete ich auch, aber, das muss ich einräumen, nicht so regelmäßig und wahrscheinlich auch nicht intensiv genug. Ich denke aber, dass Gott mich schon versteht. Wenn es ihn gibt, versteht er alles. Wenn es ihn gibt, ist er überall, sogar in mir. Giuliana übrigens bedrängt mich nie. Sie macht sich allerdings manchmal lustig über meine protestantische Nüchternheit.
Durch die Via Paglia waren wir zwei jungen Frauen gefolgt, die Arm in Arm gingen, langsam, so als müssten sie sich gegenseitig stützen. Bisweilen strich die eine der anderen übers Haar. In der Santa Maria sahen wir sie wieder. Die eine, möglicherweise die Ältere, kniete vorn in einer Bank, den Kopf tief gesenkt, die andere lag neben ihr im Gang auf dem Boden, lang hingestreckt, das Gesicht im Arm vergraben. Tatsächlich: Sie hatte sich auf den Boden gelegt! Ein Bild tiefer Demut oder Reue oder Trauer oder völliger Verzweiflung. Ungewöhnlich!





























