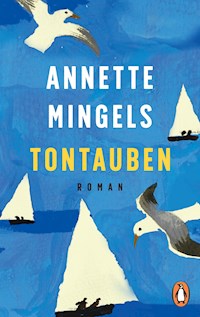
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Paare, zwei Geschichten, eine fatale Begegnung
Eine Insel in der Nordsee. Hier leben Anne und David mit ihren zwei Kindern. Eines Nachts kommt die dreizehnjährige Yola bei einem Unfall ums Leben. Die Ehe der Eltern droht an der Trauer zu zerbrechen, die Schwester flüchtet sich ins Geigenspiel. Sie fühlt sich schuldig. Von einem Täter fehlt jede Spur. Dieselbe Insel: Auf einer Tagung lernen sich Ester und Frank kennen, beide sind verheiratet. Aus anfänglicher Skepsis entwickelt sich eine Affäre. Als es Zeit wäre, heimzufahren, bleiben sie: hin- und hergerissen zwischen Skrupeln und der Faszination für ihre neue Leidenschaft. Dann kommt es zum Streit ...
»Tontauben« erkundet die Tiefe menschlicher Beziehungen in Schmerz und Leidenschaft. Und stellt auf eindringliche Weise die Frage nach der Schuld.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Annette Mingels wurde 1971 in Köln geboren. Sie studierte Germanistik und Soziologie und schloss mit einer germanistischen Dissertation ab. Für ihr literarisches Schreiben erhielt sie verschiedene Auszeichnungen, zuletzt 2017 für den Roman »Was alles war« den Buchpreis Familienroman der Stiftung Ravensburger Verlag. Von 1997 bis 2009 lebte Annette Mingels in der Schweiz, danach in den USA und Hamburg. Seit 2018 lebt sie in San Francisco.
Tontauben in der Presse:
»Das grausame Verhängnis von Liebe und Tod – so intensiv und verstörend ist es kaum je beschrieben worden.« Michael Braun
»Mit virtuoser Lakonie beschreibt Annette Mingels Bilder und Momente, die man nicht vergisst.« Sandra Kegel
»Wie Annette Mingels von Lebensträumen, den Selbstvorwürfen, der Sinnsuche und ihren kleinen Grausamkeiten erzählt, das ist hohe sprachliche und psychologische Kunst.« Emotion
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
ANNETTE MINGELS
TONTAUBEN
ROMAN
Erstmals erschienen 2010 unter dem Titel Tontauben bei DuMont, Köln. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: Favoritbüro Covermotiv: © Trevelyan, Julian & Fedden, Mary/British/Bridgeman Images E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-26961-6V002www.penguin-verlag.de
Auch wenn dieses Buch auf einem realen Ereignis beruht, sind Orte, Figuren und Geschehnisse doch fiktional. Den Vorbildern in der Wirklichkeit danke ich für ihre Offenheit.
A. M.
I
DANACH
Es wird kalt. Jeden Tag kommt der Winter ein Stück näher. Gestern hat David die Autoreifen gewechselt. Jetzt, hat er gesagt, können wir in die Berge fahren. Hast du Lust, in die Berge zu fahren? Anne hat den Kopf geschüttelt. Ich glaube, ich möchte lieber hierbleiben, hat sie gesagt.
Es gab eine Zeit, da sind sie jeden Winter in die Berge gefahren. Mit der Fähre aufs Festland. Dann die lange Fahrt. Acht Stunden hin, acht zurück. Die Kinder auf dem Rücksitz. Yola, die sagte, lass uns etwas spielen, und Karen, die irgendwann einwilligte und mit ihrer kleinen Schwester spielte. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wer bin ich. Bist du ein Mann? Ja. Bist du berühmt? Ja. Kennt man dich aus dem Fernsehen? Nein. Bist du tot?
Am Sonntag unternehmen sie einen langen Spaziergang. Die Landstraße entlang, vorbei am Campingplatz, auf dem zu dieser Jahreszeit nur noch zwei, drei Wohnwagen stehen, über die Holzbrücke zur Fußgängerzone. Sie setzen sich in ein Café ans Fenster. Schauen die Vorübergehenden an, manche schauen zurück. Als sie auf die Promenade treten, ist der Wind so kalt, dass er an den Wangen schmerzt und die Augen zum Tränen bringt. Noch einen Moment, bittet Anne, als David sagt: Lass uns gehen, ich erfriere.
Noch einen Moment.
Sie tritt an den Rand der Promenade, das Meer ist dunkel und unwillig, ein Vogel kommt auf sie zugeflogen, kurz sieht es aus, als verlöre er die Kontrolle, als könnte der Wind ihn hin und her schütteln und mit ihm machen, was ihm gefällt. Dann setzt er sich neben sie auf die Brüstung. Er ist sehr weiß, nur das Gesicht ist hinter einer schwarzen Maske verborgen. Er schaut sie abwartend an. Ich habe nichts für dich, sagt sie, nicht einen Krümel.
Der Vogel zuckt rasch mit dem Kopf vor und zurück, blickt nur noch aus den Augenwinkeln zu ihr hin. Als er wegfliegt, scheint der Wind ihn zu tragen. Als habe er die Elemente gerufen. Als seien sie zu nichts anderem da, als ihm zu dienen.
Es ist ein Jahr her – nein: ein Jahr und zwei Tage –, dass sie mitten in der Nacht aufwachten, weil Karen an ihrem Bett stand. Hatte sie etwas gesagt, ihre Namen gerufen? Anne weiß es nicht mehr. Woran sie sich erinnert: Davids Tasten nach seiner Brille auf dem Nachttisch, die Angst in Karens Stimme.
Es geht um Yola, sagte sie, sie ist nicht da.
Ihr plötzliches Verschwinden von der Party, kurz vor oder während Karens Karaokeauftritt. Das Fahrrad, das sie sich von einer Freundin geliehen hatte, ein altes Ding. Statt auf mich zu warten, mir wenigstens Bescheid zu geben, sagte Karen. Nein, keine Ahnung, ob die Lichter gingen. Als sie nach ihrem Auftritt aus dem Fenster schaute, hatte sie gesehen, dass es regnet, aber wie lange schon, wie heftig – ich weiß es nicht, sagte sie. Sie fing an zu weinen.
Hör auf, sagte David, hör jetzt bitte auf, die Bitte wie eine Drohung, und Karen wischte sich über die Augen und zog die Nase hoch und sagte: Vor zwei Stunden war das oder vor drei.
Sie riefen die Polizei an, eine müde Stimme am anderen Ende der Leitung. Nein, keine Unfallmeldung, nicht heute Nacht. Die kommt schon wieder, sagte der Polizist. Vielleicht ist sie bei einer Freundin. Einem Freund.
David unterbrach ihn: Ab wann wird gesucht?, und der Polizist sagte: Wenn sie am Morgen noch nicht da ist. Und: Wir melden uns, falls wir etwas hören. Kleine Kinder, kleine Sorgen, sagte er. Große Kinder, große Sorgen.
David zog sich eine Hose an, einen Pullover über das T-Shirt, das er im Bett getragen hatte.
Ich fahr die Strecke ab, bleibt ihr hier.
Nein, sagte Anne, ich komme mit.
Sie ging ins Schlafzimmer, nahm eine Jeans aus dem Schrank, eine Strickjacke. Sah, dass ihre Hände zitterten. Karen saß am Esstisch, die Arme vor der Brust verschränkt, sie sagte: Ruft mich an, sobald ihr etwas wisst, okay?
Es hatte aufgehört zu regnen, der Mond war von Wolken verborgen. Sie verließen das Dorf, vier Kilometer bis zum nächsten, dazwischen flaches Land. Anne sah angestrengt aus dem Fenster: die Radwege, die Dünen hinter dem Ulmenhain, dann wieder Gartenmauern, Zäune, Kreuzungen, schmale Gassen zwischen den Grundstücken. Vor dem Supermarkt stand ein Lastwagen, weißes Licht brannte über dem Seiteneingang, zwei Arbeiter schleppten Kisten mit Milchkartons und Joghurts vom Wagen zum Eingang. Beim Gemeindehaus hielten sie an, die Kirchglocken nun ganz nah, zwei Uhr. Im Vorgarten lagen einige leere Coladosen, über dem Eingang hing noch die Girlande aus Plastikbuchstaben, glänzend vor Nässe, Happy Birthday, ein Luftballon mit einer 19 drauf. Hier musste sie losgefahren sein.
Wir fahren im Schritttempo die ganze Strecke ab, sagte Anne, und wo das Auto nicht hin kann, laufe ich.
Der Weg durch das Dorf, vorbei an der Kirche, in die Seitenstraße. Hier entlang, oder eher da?
David kratzte sich am Kopf: Ich weiß es nicht.
Also, sagte Anne, hier lang.
Sie hatten die Fenster geöffnet, kalt zog es in den Wagen hinein. Auf der Landstraße machte David den Warnblinker an. Anne lief den Radweg ab. Zog das Handy aus der Hosentasche, wählte Yolas Nummer. Sprach auf die Mailbox, noch eine Nachricht. Sie konnte das Meer hören, vom Wind gestreift. Als der Radweg endete, ging sie zum Auto zurück.
Nichts, sagte sie, als sie neben ihm saß.
Hier muss sie auf der Straße weitergefahren sein, sagte David. Lass mich mal aussteigen.
Sie kletterte auf den Fahrersitz. David lief am Rand der Straße, blickte die Böschung entlang, starrte in das Dunkel des Waldes. Anne rief Karen an. Nichts Neues, sagte Karen. Und bei euch? Auch nichts, sagte Anne, leider. Es hatte wieder zu regnen begonnen. Nach jeder Bewegung der Scheibenwischer konnte sie David kurz sehen, bevor er wieder hinter den Tropfen verschwand. Sie kurbelte das Fenster herunter. Komm wieder rein!, rief sie. Du kannst von hier drinnen alles genauso gut sehen. Ich weiß nicht, sagte David, meinst du? Aber er ging schon auf den Wagen zu.
Es war noch nicht hell, als sie nach Hause kamen. Karen sagte: Ich mache Kaffee. Sie ging in die Küche. Anne setzte sich an den Esstisch und stützte das Gesicht in die Hände. David hatte den Pullover ausgezogen, ein Handtuch lag auf seinen Schultern. Er sah aus wie ein Sportler, der ein Spiel verloren hat.
Wir rufen jetzt ihre Freundinnen an, sagte er, und als er Annes Gesicht sah: Herrgott, Anne, das ist ein Notfall!
Gibt es, fragte Anne, als Karen den Kaffee brachte, einen Jungen, von dem wir nichts wissen?
Karen überlegte. Ich glaube nicht, sagte sie.
Es war halb sieben, als sie vor der Wache parkten. Der Himmel gelb und blau gefleckt. Es roch nach nasser Erde, nassem Asphalt. Als wäre das Meer über die Insel geschwappt. Als hätte es sich die Insel einverleibt und sie wieder ausgestoßen. Der Polizist, der aus einem der hinteren Zimmer trat, hatte helles fedriges Haar, das ihm über die Ohren fiel. Die Augen fast ohne Wimpern und Brauen, wie bei einem Neugeborenen.
Unsere Tochter ist verschwunden, sagte David, und ich verlange, dass Sie jetzt nach ihr suchen.
Doch es war Karen, die Yola fand. Noch bevor der Suchtrupp aufbrechen konnte, hatte sie ihr Fahrrad genommen und war zum Gemeindehaus gefahren. Auf dem Rückweg sah sie zwischen den Baumstämmen das Schutzblech blitzen. Sie stieg ab und ging über die Böschung in den Wald. Yola lag nicht weit entfernt vom Rad. Karen rief ihre Eltern an, sie klang ganz ruhig. Erst als sie im Auto saß, begann sie zu schreien, hoch und so verzweifelt, dass Anne sie an sich drückte, um sie zu trösten und ihren Schrei zu ersticken, der von nun an, das wusste sie, zu ihnen gehören würde: zu Karen, David und ihr, den Überlebenden.
David trägt das silberne Tablett vor sich her, darauf Brötchen und Kaffee und Orangensaft, Butter und Marmelade. Er bringt es ans Bett, und Anne tut so, als läge sie nicht schon seit Stunden wach, sondern sei eben erst erwacht und überrascht.
David sagt: Frühstück. Mach mal Platz!
Sie versucht, im Liegen zu essen, aber das geht nicht. Sie setzt sich in den Schneidersitz, während David die Kissen in seinem Rücken stapelt und Anne zwischen zwei Bissen anschaut, die Augen zusammengekniffen, weil hinter ihr das Fenster ist. Der Hund winselt leise. Dann komm halt, sagt Anne. Mit einer Hand schiebt sie die Decke zur Seite, der Labrador springt auf das Bett und kringelt sich zusammen, den Kopf auf den Hinterpfoten.
Oje, sagt David, schon so spät.
Er steht auf, sagt: Du hast noch Zeit, oder?
Sie sieht ihm hinterher, wie er das Zimmer verlässt, sie hört ihn duschen, dann sieht sie ihm zu, wie er nackt umhergeht, Socken aus dem Schrank nimmt, Unterwäsche, wie er sich anzieht und ihr dabei von Zeit zu Zeit einen Blick zuwirft, der freundlich ist und fragend.
Hast du abgenommen?, fragt sie.
Er sieht an sich herunter, zuckt mit den Achseln, klopft sich kurz auf den Bauch.
Möglich, sagt er, ich weiß nicht.
Sieht gut aus, sagt sie. Dann fügt sie hinzu: Ich gehe heute nicht arbeiten.
Ist dir schlecht?, fragt David, und Anne sagt: Nein, das ist es nicht.
Als sie hört, wie die Haustür geschlossen wird, steht sie auf. Stellt sich unter die Dusche, bis die Haut ganz rot und heiß ist, dann trocknet sie sich ab, ohne in den Spiegel zu sehen.
Die Idee ist ihr plötzlich gekommen, eine Idee, die zugleich ein Entschluss war: Sie würde ihre Arbeit kündigen, heute noch, sie würde anrufen und sagen, dass sie nicht mehr komme.
Wie meinst du das?, fragt Eva. Heute? Oder diese Woche?
Nein, sagt Anne. Generell.
Sie räuspert sich, ein Pochen im Hals, dreh um, denkt sie, jetzt geht es noch. Jetzt ist Eva noch überrascht, ein wenig belustigt vielleicht, aber nicht verärgert.
Ich habe ja noch Urlaub gut, sagt Anne hilflos, und Eva sagt: Hör mal, Anne, was ist los?
Nichts, sagt sie. Ich weiß nicht.
Sie hört Eva ausatmen, stellt sich vor, wie sie die Augen aufreißt, Fassungslosigkeit signalisiert, Unverständnis, für die Kollegen.
Nimm das mal so an, sagt Anne. Ich kündige.
Dann legt sie auf, ohne Evas Antwort abzuwarten.
Auf dem Tisch liegen einige Broschüren, dazwischen ein Briefbeschwerer, ein kleines, gusseisernes Nilpferd, das nutzlos und hübsch dasteht, mit dem Rücken zum Besucher. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, das Zimmer einzurichten. Fast schon gemütlich, mit seinem blumenumrankten Teppich, der Federzeichnung an der Wand, über dem Holzschrank eine lange Reihe antiker Schlüssel, jeder an einem Nagel aufgehängt. Anne weiß nicht, ob der Mann, der ihr gegenübersitzt, dazu passt. Ob sie ihm die Schlüsselsammlung abnimmt. Die Blumen und das Nilpferd. Er ist jünger als sie, aber vielleicht täuscht sie sich auch. In letzter Zeit glaubt sie von den meisten Menschen, dass sie jünger seien als sie. Vielleicht kommt das daher, dass sie sich schwer fühlt. Schwere Beine, schwere Füße, die in keine schönen Schuhe mehr passen. Ein schwerer Körper, den sie mit sich herumträgt, pflichtschuldig, ohne jede Zuneigung. Nur ihr Kopf kommt ihr manchmal leicht vor, schwindelig, als würde er gleich davontaumeln und sie zurücklassen, orientierungslos wie der kopflose Reiter.
Tristan, sagt er. Der Vater ein Wagner-Verehrer, darum die Namen der Kinder: Gunther, Isolde, Tristan. Er lächelt, es hätte schlimmer kommen können: Lohengrin oder Parsifal. Sie kennen sich vom Sehen, Karen und sein Sohn gingen einmal in dieselbe Klasse, Tristan erinnert sich an einen Elternabend, auf dem Anne mit der Mathematiklehrerin Streit bekam, einer rabiaten Oberstudienrätin. Worum es ging, hat er vergessen. Aber eindrücklich war es, sagt er, und dass er – natürlich – auf ihrer Seite war. Sie kann sich nicht erinnern. Nicht an den Streit, nicht an seinen Beistand. Nur die Lehrerin sieht sie vor sich. Ihre groteske Aufmachung. Streng und unmodern. Aber schrille Farben. Eine Demonstration ihrer Unangreifbarkeit.
Also?, fragt Tristan, und Anne sagt: Ich muss mich neu orientieren, so sagt man doch, nicht wahr? Neu beginnen. Irgendwas. Alles. Sie lacht trocken. Zunächst einmal den Beruf.
Tristan nickt, nimmt einen Block zur Hand, einen Stift. Schreibt ihren Namen oben auf das erste Blatt. Darunter das Datum.
Damit zumindest bist du richtig hier, sagt er. Er klingt belustigt, auf eine freundliche Art, nicht spöttisch.
Was sie gelernt hat. Was sie gemacht hat. Studiert, sagt sie, Geschichte. Als Lehrerin gearbeitet, aber nur kurz. Dann kamen die Kinder. Und irgendwann begann sie als Reiseführerin zu arbeiten. Fuhr die Touristen über die Insel, zeigte ihnen das, was sie aus ihren Reisebüchern kannten. Die hellen Felsen. Den Glockenturm und das Inselmuseum. Das Skelett des Pottwals. Die Ausstellung der Miniaturbilder, manche so klein, dass sie auf einen Hemdenknopf passen. Ganze Landschaften. Und später die Arbeit im Büro der Inselverwaltung. Keine Ausflüge mehr, dafür ein besseres Gehalt. Mehr Verantwortung. Mehr Langeweile. Sie sagt: Die Tage vergingen so langsam. Langsam und gleichzeitig viel zu schnell. Als würde mein Leben verrinnen. Ohne mich.
Will sie das sagen? Ist es das? Sie verstummt und Tristan sagt: Einen Kaffee. Ich hole uns einen Kaffee, einverstanden? Als er wieder ins Zimmer kommt, hat sie sich gefangen. Lobt den Kaffee, zeigt auf die Schlüssel an der Wand. Hast du die gesammelt? Nein, sagt Tristan. Die stammen von meinem Vater. Er selbst sei kein Sammler. Verliere höchstens Sachen. Jeden Tag eine Kleinigkeit. Die Insel muss gesprenkelt sein von meinen Besitztümern. Er lacht. Anne fragt: Ist das gut oder schlecht? Gut, sagt er nach einer Weile. Ich glaube, das ist gut.
Und was willst du jetzt machen?, fragt er, als sie ihre leere Tasse auf den Tisch stellt.
Sie sieht ihn an, fühlt sich kurz sehr jung. Keine Ahnung, sagt sie. Sie überlegt. Keinen Bürojob.
Er zieht eine vertikale Linie in der Mitte des Blattes. Teilt es in zwei Hälften, eine gute und eine schlechte, denkt Anne. Wie sie es als Kind gemacht hat, wenn eine Entscheidung anstand. Plus, hatte sie über die eine Seite geschrieben, Minus über die andere. Bis zu ihrem Studium hatte sie es so gehalten, dann nicht mehr. Hätte es geholfen? Etwas geändert? Und wenn sie es heute noch mal tun würde, noch mal ihr Leben in eine Liste zwingen würde?
Was sie will. Und was nicht. Er notiert es. Manchmal nimmt sie etwas zurück. Nein, sagt sie, das doch nicht. Sie überlegt. Wenn sie aufschaut, blickt sie in seine Augen. Grün, denkt sie, vielleicht auch braun. Sie ist zu weit entfernt, der Tisch zu groß. Falten, wenn er lacht. Vielleicht ist er doch nicht jünger als sie. In blondem Haar sieht man die grauen Strähnen erst, wenn man ganz nah herangeht. Sie lächelt und er lächelt auch. Wie Verschwörer, denkt sie kurz. Aber Verschwörer wogegen? Sie betrachtet den Vogel auf der Zeichnung hinter ihm an der Wand. Der breite ungeschützte Bauch, der schmale Schnabel. Dunkle Knopfaugen ohne Mitte. Der Ast, auf dem er sitzt, trägt Blüten, Kirsche, vielleicht Pflaume. Tristans Gesicht davor, als wäre es ein Teil der Illustration. Als wüchse ihm der Vogel aus dem Kopf und wachte über ihm. Seine Kopfgeburt, denkt Anne.
Mehr weiß ich nicht, sagt sie irgendwann.
Das war, sagt er, schon recht viel.
Er steht auf, geht ins andere Zimmer, kommt mit einer Kopie der Liste zurück.
Wir sollten drüber schlafen, sagt er. Komm doch morgen wieder. Machst du das?
Ja, sagt sie, das mache ich.
Als sie nach Hause kommt, hat David das Essen vorbereitet. Brot, Schinken, Schafskäse. Gurken. Tomaten.
Tristan, sagt er, als sie zu Ende erzählt hat. Kenn ich nicht. Er schüttelt den Kopf. Ist er denn so traurig, wie man meinen sollte?
Sie sagt: Ich glaube nicht. Iss nicht so schnell.
Sie legt das Messer neben den Teller, die Hände in den Schoß.
Lass uns einmal nicht schon die Gabel füllen, während wir noch kauen, schlägt sie vor. Lass uns das Essen in die Länge ziehen, was meinst du?
Er sieht sie mit komischer Verzweiflung an. Und wenn ich Hunger habe?
Dann erst recht, sagt sie.
In der Nacht wacht sie auf, weil er sich an sie drängt. Sie schließt die Augen, irgendwann dreht sie sich zu ihm um. Streichelt sein Gesicht, seine Brust. Fährt hinab zu seinem Bauch, seinem Geschlecht. Sie beugt sich über ihn. Doch, sagt sie, als er sich sträubt. Es ist gut. Dann legt sie sich hin. Sein Kopf zwischen ihren Beinen. Kurz hält sie ihn zurück, lässt ihn innehalten. Sucht nach einem Bild. Einem Körper. Einem Gesicht, nur vage vertraut. Löst den Druck ihrer Hände.
Und, sagt Tristan, hast du darüber nachgedacht?
Er sitzt hinter dem Tisch und scheint heute nur aus Augen zu bestehen. Augen und einem Mund, vielleicht noch zwei Arme in einem blassblauen Pullover.
Sie nickt. Und du?
Ich auch. Du musst aber zuerst sagen, was dir in den Sinn kam. Das ist nämlich wichtiger.
Aber du bist der Profi.
Er lacht kurz. Berater sind nie Profis, weißt du das etwa nicht? Wir stümpern nur so ein bisschen herum. Laien von Berufs wegen.
Ach ja? Sie sieht ihn ungläubig an. Holt schließlich, als er ihrem Blick standhält, tief Luft, als gelte es abzutauchen. Sagt: Ich glaube, mit diesen Reiseführungen, die ich machte, lag ich gar nicht so falsch. Nicht, dass ich genau das Gleiche wieder machen will. Aber mit Menschen – sie unterbricht sich kurz, kräuselt die Stirn über die Banaliät der Aussage – na, du weißt schon. Mit Menschen zu tun zu haben, gefällt mir.
Er nickt. Ja, das dachte ich mir.
Tourismus also, sagt sie. Vielleicht. Das Problem ist nur, dass die Insel so klein ist.
Klein, denkt sie, und umzingelt vom Meer. Kein Entkommen möglich. Und kein Geheimnis. Jeder von ihnen ein offenes Buch. Eine Landkarte, auf der die Lebensstationen eingezeichnet sind wie Sehenswürdigkeiten. Heirat, Kinder, Scheidung, Tod. Aber stimmt das? Was weiß sie denn von ihm? So gut wie nichts. Und er von ihr? Nicht viel mehr. Sie wünscht es sich.
Ja, sagt er. Groß ist sie nicht. Er sieht sie nachdenklich an, dann schaut er zum Fenster, das erfüllt ist von der Nachmittagssonne. Die Kälte ist noch einmal zurückgewichen. Ein spätherbstliches Hoch hat sich zwischen Regen und Schnee gedrängt wie ein resoluter Polizist, der den Verkehr umleitet.
Wollen wir, fragt er, ein bisschen rausgehen? Er wirkt verlegen. Du bist meine letzte Klientin heute und die Sonne ist so schön – aber sag ruhig, wenn es dir nicht recht ist.
Doch, sagt sie. Gern.
Er führt sie durch den Garten. Öffnet ein niedriges Tor. Sie stehen auf einem Weg aus festgetretenem Sand. Links geht es zur Innenstadt, rechts in einen kleinen Wald. Er lässt sie entscheiden. Rechts, sagt sie, und sie gehen los.
Einige Minuten sagt keiner ein Wort. Es ist kein angestrengtes Schweigen. Eher eine Ruhe, die Anne Zeit gibt, sich umzuschauen. Der Weg verläuft parallel zu einem Bach, den sie nach kurzer Zeit auf einer schmalen Holzbrücke überqueren. Wenn sie sich über das Geländer lehnt, kann sie die Fische im Wasser erkennen. Ihre dunklen kleinen Leiber, die launischen Richtungswechsel. Als sie den Wald betreten, wird die Luft merklich kühler. Irgendjemand hat ein Baumhaus in eine stämmige Eiche gebaut. Von dort oben muss das Meer zu sehen sein. Sie bleiben stehen. Legen den Kopf in den Nacken. Vom Boden zum Haus sind es gut zehn Meter, eine Leiter fehlt. Der oder die Bewohner müssen jedes Mal eine Leiter mitbringen. Oder am Baum hinaufklettern, von Ast zu Ast. Besucher würden rufen müssen. Vielleicht einen Vogelruf imitieren: ruckedigu, ruckedigu.
Mir fielen, sagt Tristan, als sie weitergehen, zwei, drei mögliche Berufe ein. Hör’s dir mal an, okay? Sag nicht gleich nein.
Nein, sagt sie. Also ja.
Tristan sagt: Das Erste, was mir einfiel, war so was wie Eventmanagerin. Klingt fürchterlich. Ist es aber nicht.
Während er spricht, sieht Anne Bilder vor sich. Bilder von sich. Sie, bei der Organisation eines Festes. Bei der Vorbereitung einer Ausstellung. Bei der Eröffnung eines Symposiums. Sie, beim Betreten eines Restaurants. Beim Gespräch mit Kunden. Beim Telefonieren. Sie, gewandter, jünger, schöner, als sie ist. Unversehrt. Als hätte jemand die Zeit zurückgedreht.
Ich weiß nicht, sagt sie. Kann ich so was denn?
Och, sagt er, bestimmt.
Er sagt es zuversichtlich und so, als ob Annes Einwand erwartbar gewesen wäre. Erwartbar, aber unbegründet. Und als würde sie das selbst wissen.
Und was wäre das Zweite?
Tja, sagt er, was ganz anderes. Und doch nicht so unähnlich.
Er sieht sie prüfend an, und sie braucht einen Moment, um es zu bemerken. Inzwischen haben sie den Wald hinter sich gelassen. Felder liegen vor ihnen, abgeerntet. Am Rand blüht späte Ackerwinde. Die stoppeligen Ähren. Der tiefblaue Himmel, das letzte Grau daraus vertrieben. Der baumlose Horizont. Nichts, was den Blick verstellt.
Also?, fragt sie. Sie weiß nicht, ob sie ihm sein Zögern glauben soll. Vielleicht will er sie einfach nur in Sicherheit wiegen. Und sie so dazu bringen, mehr von sich preiszugeben. Ihm zu zeigen, wer sie ist. Wie. Und wenn schon, denkt sie.
Maklerin.
Nur dieses Wort. Er wartet auf ihre Reaktion. Sie sagt langsam: Aha.
Vor allem ginge es wohl um Ferienhäuser, sagt er. Aber nicht nur. Deine Aufgabe wäre es, zu vermitteln. Zwischen den Käufern und Verkäufern. Und beiden das Gefühl zu geben, ihre Interessen zu vertreten.
Klingt gut, sagt sie.
Sie hat keine Ahnung von dem Metier. Aber sie merkt, dass es ihr gefallen könnte. Sie hat sich schon immer für Häuser interessiert. Sie mag es, durch Wohnviertel zu laufen und in erhellte Fenster zu schauen. Einen Blick zu erhaschen auf fremde Möbel, fremdes Leben. Schon als Kind hat sie das geliebt. Manche Bekanntschaften hat sie nur geschlossen, um Zugang zu den Häusern zu erhalten. Sich vorzustellen, ein anderes Leben zu führen. In einem anderen Bett zu schlafen. An einem anderen Tisch zu sitzen.
Keine Ahnung, in welchem Beruf bessere Chancen bestehen, sagt Tristan. Aber das finden wir raus.
An einer Wegkreuzung steht ein Steinkreuz, in dessen Sockel lateinische Worte eingraviert sind.
Kannst du das lesen?, fragt Anne, und Tristan sagt: Lesen schon, nur verstehen kann ich es nicht mehr. Kein Wort.
Sie biegen links ab. Passieren ein dunkles Holzhaus mit roten Fensterläden, ein Försterhaus wie von einer Postkarte. Auf dem Rasen davor steht ein niedriges Gehege. Sie beugen sich über den Gartenzaun, aber sie können kein Tier entdecken. Vielleicht eine Schildkröte, die so grün ist wie das Gras, sagt Anne. Halten die nicht Winterschlaf?, fragt Tristan. Sie gehen weiter und dann sehen sie plötzlich das Riesenrad. Die gelben und roten Gondeln, die im letzten Sonnenlicht schimmernden Speichen. Direkt daneben ein Gerät, das wie eine Windmühle aussieht. Die fünf Flügel dicht mit Menschen besetzt. Die Flügel gehen auf und nieder, drehen sich um sich selbst. Köpfe, die nach unten hängen. Schreie, die sie im Näherkommen hören. Ängstlich und euphorisch.
Komm, sagt Tristan, lass uns schauen gehen.
Am Wegrand stehen etliche Autos. Andere Autos kommen im Schritttempo gefahren. Wenden, als sie keinen Platz finden. Parken dann fünfzig Meter entfernt auf einer gemähten Wiese. Ein Jugendlicher in grellgelber Weste weist die Parkplätze zu.
Tristan hat Annes Arm genommen und zieht sie mit sich. Auf dem Jahrmarkt lässt er sie los, doch manchmal spürt sie seine Hand in ihrem Rücken, als sie durch die Menschen gehen. Kinder kommen ihnen entgegen. Eis und Lebkuchen essend. Zuckerwatte in luftigen rosafarbenen Wolken.
Wusstest du, dass ein Zahnarzt die Zuckerwatte erfunden hat?, fragt Tristan.
Wirklich? Anne lacht. Wie vorausschauend von ihm.
Sie kaufen zwei Lose bei einem Mann, der bis zu den Knien in einem bauchigen Apfelkostüm steckt. Keines der Lose gewinnt. Vor einem mit englischen Flaggen und einem Wachsoldaten bemalten Stand bleiben sie stehen. An der hinteren Wand sind Luftballons angebracht. Drei Pfeile pro Versuch. Und für den Sieger ein Stofftier: Gelbe Kugelfische, orange-weiß-schwarze Clownfische. Springende Delfine. Zwei riesige Haie.
Ich hol dir einen Hai, verspricht Tristan. Für deine jüngere Tochter. Wie alt ist sie noch mal?
Dreizehn, sagt Anne. Sie hat automatisch geantwortet. Jetzt sagt sie noch einmal: Yola ist dreizehn.
Da geht’s ja gerade noch, sagt Tristan.
Der erste Pfeil prallt an einem Ballon ab und fällt zu Boden. Mit den beiden nächsten trifft er. So einer oder so einer, sagt der Mann hinter der Theke und zeigt gelangweilt auf die kleineren Fische. Anne sagt, einen Clownfisch, bitte, und der Mann nimmt einen der Fische von seinem Haken und reicht ihn ihr.
Danke, sagt Anne. Und an Tristan gewandt: Ist sogar schöner als ein Hai.
Sie gehen an einer Schiffsschaukel vorbei und an einer Riesenkrake. Vor der Achterbahn bleibt Tristan stehen. Komm, sagt er. Wir fahren eine Runde.
Nein, sagt Anne, nie im Leben.
Sie hat schon Angst, wenn sie nur davorsteht. Die blassen Gesichter der Menschen, die im Sturzflug auf sie zu sausen. Die zu Schreien geöffneten Münder. Die Achterbahn ist nicht sehr hoch. Trotzdem.
Ach, komm schon, sagt Tristan.
Ich bin noch nie mit so was gefahren, sagt Anne.
Na, umso besser, sagt Tristan. Dann probieren wir heute etwas Neues aus.
Und was ist das Neue für dich?, fragt sie.
Das, sagt Tristan, darfst du bestimmen. Jetzt komm.
Er hat wieder ihre Hand genommen, und sie lässt sich zu der Schlange ziehen, die vor dem Kassenhäuschen ansteht. Während sie warten, schaut Anne nicht zur Achterbahn. Stattdessen beobachtet sie einen jungen Mann, der einen Rollstuhl schiebt. Das Mädchen darin ist an Handgelenken, Bauch und Beinen mit Lederriemen angebunden, der Kopf wird von einer Halterung fixiert. Sie ist vielleicht neun Jahre alt, kaum älter. Ihre Augen wandern umher. Manchmal zuckt es in ihrem Gesicht, als versuchte sie zu lächeln. Oder zu weinen. Wo sie entlangkommen, teilt sich die Menge.
Schließlich sind Tristan und Anne an der Reihe. Tristan bezahlt und die Kassiererin mit den runden Puppenaugen und dem fahlen Teint schiebt die beiden Tickets unter dem Plastikfenster hindurch. Sie setzen sich in einen der Wagen. Anne schließt den Gurt, zieht noch einmal daran. Rüttelt an den Plastikbügeln, die vor ihrem Oberkörper ineinandergreifen.
Alles fest?, fragt Tristan.
Ich glaube schon.
Na dann. Tristan nickt ihr zu. Um ehrlich zu sein, sagt er, bin ich selbst ein bisschen ängstlich. Er sieht sie so nachdenklich an, als sei ihm etwas entfallen. Vierzehn Jahre, sagt er schließlich. So lange ist es her, dass ich das letzte Mal mit so einem Ding gefahren bin. Jon war damals fünf und bestand darauf. Das hat ihn kuriert, danach wollte er nie mehr fahren. Tristan lacht leise.
Hast du noch mehr Kinder?, fragt Anne.
Seine Antwort geht im Geheul der Sirene unter, das sogleich von lauter Rockmusik abgelöst wird. Der Wagen ruckt, dann fahren sie los. Anne sieht noch einmal zu Tristan hin. Er hält sich mit beiden Händen am Bügel fest, hat den Kopf in den Nacken gelegt. Die Jugendlichen in der Reihe vor ihnen schreien. Anne schließt die Augen und spürt, wie sie stürzen. Emporgerissen werden. Und wieder stürzen. Sie merkt, wie ihr übel wird. Eine Angst, die nichts Rationales an sich hat und ihr Tränen in die Augen treibt. Sie schreit nicht, aber sie wimmert ein wenig. Es ist nicht schön. Nichts an dieser Fahrt ist schön. Als sie endlich wieder stehen, als sich die Bügel lautlos heben, als die Rockmusik ausklingt und sie auf wackeligen Beinen aus dem Wagen klettert, ist sie so wütend, dass sie Tristan nicht anschauen kann.
Ist alles in Ordnung?, fragt er, als er hinter ihr die Stufen runtergeht. Anne?
Ja, sagt sie. Und zieht ein Gesicht, das Nein sagt. Nein. Nein. Nein. Es ist inzwischen fast dunkel geworden. Die bunten Lichter, die erleuchteten Gondeln des Riesenrads, der Mond, der von irgendwoher aufgetaucht ist, blass und schmal wie ein kränklicher Cousin.
Ich muss allmählich nach Hause, sagt Anne. Mein Mann fragt sich sicher schon, wo ich bin.
Ja, sagt Tristan. Du hast recht.
Er fragt: Wo wohnst du? Sie sagt es ihm. Ich bringe dich hin, sagt er.
Nein, mein Auto steht ja bei dir, sagt sie.





























