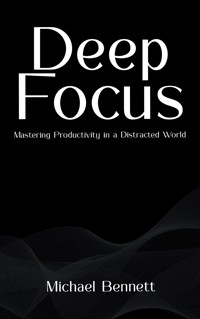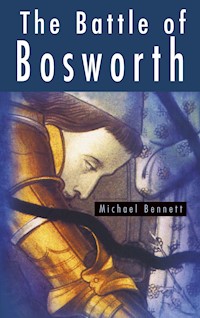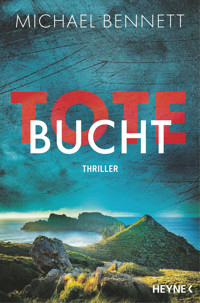
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die-Hana-Westerman-Serie
- Sprache: Deutsch
Der Vergangenheit auf der Spur
Hana Westermann hat ihren Dienst eigentlich quittiert, doch als sie in den Dünen von Tātā Bay auf ein Skelett stößt, löst das etwas in ihr aus. Vor 21 Jahren wurde an derselben Stelle schon einmal die Leiche einer jungen Frau gefunden. Der Fall war einer der Gründe, weshalb Hana sich dazu entschieden hat, Polizistin zu werden. Ist es ein Nachahmer oder handelt es sich vielleicht sogar um denselben Täter? Je mehr sie über den Fall herausfindet, desto mehr Zweifel kommen ihr über die früheren Ermittlungen. Die Vergangenheit droht, Hana einzuholen – und sie kann niemandem vertrauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Hana Westerman hat den Polizeidienst eigentlich quittiert, doch als sie in den Dünen von Tātā Bay auf ein Skelett stößt, kommen Erinnerungen in ihr hoch. Vor einundzwanzig Jahren wurde an dieser Stelle schon einmal die Leiche einer jungen Frau gefunden. Der Fall war einer der Gründe, weshalb Hana sich dazu entschieden hat, Polizistin zu werden. Ist es ein Nachahmer, oder handelt es sich vielleicht sogar um denselben Täter? Je mehr sie über den Fall herausfindet, desto mehr Zweifel kommen ihr über die früheren Ermittlungen. Die Vergangenheit droht Hana einzuholen – und sie kann niemandem vertrauen.
Zum Autor
Michael Bennett (Ngāti Pikiao, Ngāti Whakaue) arbeitet als preisgekrönter Regisseur, Produzent und Showrunner für Film und Fernsehen in Neuseeland (Aotearoa). In seiner Reihe um Ermittlerin Hana Westerman verknüpft Michael Bennett seine Leidenschaft für spannende Geschichten mit Fragen von Identität und Herkunft, die eng mit dem kolonialen Erbe seiner Heimat verbunden sind. Mit seiner Partnerin und seinen drei Kindern lebt Michael Bennett in Auckland (Tāmaki Makaurau).
Lieferbare Titel
6 Tote
Tote Bucht
MICHAEL BENNETT
TOTE BUCHT
THRILLER
AUSDEMNEUSEELÄNDISCHENENGLISCHVONFRANKDABROCK
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe Return to Blood erschien erstmals 2024 bei Simon & Schuster UK Ltd, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Kiris Gedicht und Teile des Dialogs von Kiri stammen aus der Gedichtsammlung e kō, nō hea koe? © 2024 by Matariki Bennett.
Das Zitat auf S. 293 stammt aus Guess How Much I Love You von Sam McBratney © Sam McBratney, 1994.
Auf S. 174 finden sich Auszüge aus »Till We Meet Again« music by Richard A. Whiting, lyrics by Raymond B. Egan © 1918
Das Rezept für Miesmuscheln auf S. 166 stammt von Elaine Jocelyn Bennett (geb. Westerman).
Deutsche Erstausgabe 07/2025
Copyright © 2024 by Michael Bennett
Original characters created and developed by Michael Bennett and Jane Holland.
© 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de unter Verwendung von © www.buerosued.de
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32973-0V002
www.heyne.de
Hinweis zur Sprache der Māori
In diesem Thriller finden sich einige Wörter und Begriffe aus der Sprache der Māori. Übersetzungen und Erklärungen dazu können auf den Seiten 301-302 am Ende des Buches nachgeschlagen werden.
Für Ngamaru Raerino Moe ma rā e te rangatira. Tukua kia tū takitahi ngā whetū o te rangi. Lasst jeden Stern am Himmel in seinem eigenen Licht erstrahlen. Māori Whakatauki (Sprichwort)
1
Die Götter Von Auckland
Ich werde mit jener Nacht beginnen.
Es war ein Samstag. Und die letzte Vollmondnacht in Auckland. Die Nacht, in der Dax mein Leben in einen Trümmerhaufen verwandelt hat. Die Nacht, die alles veränderte. Gibt es eigentlich ein Emoji für »Alles ist im Arsch«? Das sollte es.
Dax. So liebenswert. Aber was für ein Arschloch.
Er besitzt einen beschissenen alten Motorroller. Allerdings ist er ein lausiger Fahrer, und es ist gut, dass er nicht schnell genug fahren kann, um sich, mich oder sonst wen ernsthaft zu verletzen. Ich weiß zwar eine Menge über eine Menge Dinge, aber ich habe null Ahnung von Technik, es ist also reine Spekulation, dass von den vermutlich vier Zündkerzen seines Rollers nur eine funktioniert. Der Roller ist ein Mülleimer mit Lenker und zwei Rädern. Aber er liebt dieses Ding. Es sieht total bescheuert aus, wenn er auf seinem Roller mit dem qualmenden, rostigen Auspuff zu einer unserer »Youth at Risk«-Sitzungen aufkreuzt. Dazu dieses breite Grinsen in seinem hässlichen, aber attraktiven Gesicht. Versteht mich nicht falsch. Er sieht verdammt gut aus. Aber auf eine ungewöhnliche Weise. So könnte man es ausdrücken. Rothaarige sind den Leuten suspekt, aber ich steh nun mal auf Sommersprossen, blasse Haut und rote Haare. Gegensätze ziehen sich wohl an. Und seine Nase erinnert an eine antike Statue oder so was in der Art. Das heißt, sie ist groß. Ein wenig zu groß für sein Gesicht. Viel zu groß. Dax sagt, dass er damit besser atmen kann, was auch immer zum Teufel das zu bedeuten hat.
Ich finde, sie sieht würdevoll aus. Ich liebe sie. Als wir uns zum ersten Mal küssten, habe ich zuerst seine Nase geküsst.
Das einzig Gute an Dax’ beschissenem alten Roller ist dessen Name.
Die Götter von Auckland.
Das geht auf mein Konto.
Als ich noch zur Schule ging, ein paar Jahre bevor ich Dax kennenlernte, war ich fasziniert von den Atua. Den Göttern der Māori. Ich besuchte eine erstklassige Schule, und unter den fast siebenhundert Schülerinnen gab es höchstens eine Handvoll mit dunkler Haut wie mich. In jedem Halbjahr hat man uns etwas über die Kultur der Māori erzählt, weil das vermutlich im E-Mail-Newsletter einen ziemlich guten Eindruck machte. Ihr wisst schon: Diversität. In diesen paar Stunden brachte man uns die Grundlagen bei, wie Vater Himmel und Mutter Erde durch ihre Kinder getrennt wurden. Dass die Regentropfen, die vom Himmel fallen, die Tränen von Vater Himmel sind, der um seine bessere Hälfte weint. Dass der Nebel das betrübte Seufzen von Mutter Erde ist. Und dass in dem Raum zwischen Mutter und Vater die Kinder zu Göttern wurden. Da war Tāne Mahuta, der Gott des Waldes und der Vögel, der sich seinem Vater entgegenstellte und die Eltern auseinanderriss. Und der Kriegsgott Tūmatauenga und sein kleiner Bruder Rongo, der Gott des Friedens. Ich schätze, dass die beiden Geschwister sich nicht gut vertragen haben. Sie haben sich bestimmt die ganze Zeit gestritten, oder? Was die Frage aufwirft: Wie verhält sich der Gott des Friedens, wenn es hart auf hart kommt, wenn es bei einer handfesten Auseinandersetzung heftig zur Sache geht?
Anfangs fand ich diese ganze Götter-Nummer ziemlich schrecklich. Fast alle Schnitzereien von Māori-Göttern, die man auf Fotos sieht, zeigen Männer. Natürlich gibt es auch Göttinnen, aber die Männer bekommen die ganze Aufmerksamkeit. Welch Überraschung. Dann habe ich gründlich darüber nachgedacht und kam zu dem Schluss, dass Götter in Wirklichkeit weder männlich noch weiblich sind. Wie kann der Wind ein Mann sein? Wie können die Sterne, der Wald, der Donner oder der Frieden in ihrer DNA ein X- und ein Y-Chromosom haben? Das hat sich nur irgendwer ausgedacht, so wie diese ganzen Maler beschlossen haben, dass Jesus, ein Typ aus dem Nahen Osten, der sich den ganzen Tag in der Sonne aufhielt, helle Haut und blaue Augen hatte. Sobald ich mir die Götter als geschlechtslos vorstellte, war ich von ihnen begeistert. Es gibt diesen einen Gott, Rūaumoko, das jüngste Kind, das noch im Leib der Mutter war, als die Eltern getrennt wurden. Er war so wütend über das Schicksal seiner Familie, dass er der Gott des Erdbebens wurde. Rūaumoko bedeutet »die zitternden Wellen, die die Erde verwüsten«. Außerdem bekam Rūaumoko den Job als Gott des Tā Moko. Ein Gott für Tätowierungen! Das ist großartig.
Eines Tages habe ich Dax von den Göttern erzählt. Er schnappte sich darauf eine meiner Spraydosen und sprühte auf das Schutzblech den Namen des Rollers. Die Götter von Auckland.
Ich liebe diese supercoolen geschlechtslosen Götter. Und ich liebe Dax.
Oder sollte ich sagen: »liebte«? Die Sache mit Vergangenheits- und Gegenwartsform ist etwas kompliziert für mich. Ihr werdet schon sehen. Ich brauche einen Korrekturleser.
Einerseits liebe ich Dax, andererseits hasse ich ihn. Ich hasse es, dass er an keinem Klamottenladen vorbeigehen kann, ohne sich in ein Hemd oder eine Jacke zu vergucken, und er das Kleidungsstück einfach klauen muss, nur um es einen Tag später wegzuwerfen, weil er festgestellt hat, dass es ihm eigentlich gar nicht gefällt. Ich hasse es, dass er seine Kippenpackung in seinen T-Shirt-Ärmel wickelt. Er hat das aus einem Film, den er mal gesehen hat, aus einem uralten Film namens Badlands. Mit diesem hübschen, sonderbaren, dürren Mädchen und diesem gut aussehenden Draufgänger. Der hatte auch immer eine Kippenpackung in seinen T-Shirt-Ärmel gewickelt. Dabei raucht Dax nicht mal gern. Aber er will ein Typ aus einem Film sein.
Was für ein Arschloch.
Aber … was ich an Dax liebe. Dass er den Menschen auf eine Weise in die Augen sieht, als würde er direkt in ihre Seele blicken. Dass er nett zu kleinen Kindern ist. Vielleicht weil zu ihm als kleines Kind nie jemand besonders nett war. Ich liebe es, dass Dax mich zum Ehrengott erklärt hat, nachdem ich ihm von den Atua erzählt hatte.
»Du hast keine normalen Augen. Māori haben keine grünen Augen. Du hast die Augen eines Gottes.«
Das mit den grünen Augen und den Māori stimmt übrigens nicht. Noch etwas, wofür ich mich in der Schule begeisterte: Biologie. Vererbungslehre, Allele und Gene. Meine leiblichen Eltern, beide Māori, hatten braune Augen. Wieso habe ich dann grüne? Ich habe einiges dazu gelesen und gegoogelt und bin meinem Biolehrer noch mehr als meinen anderen Lehrern auf den Wecker gefallen, bis ich es herausgefunden habe. Das ist absolut möglich. Der dominant-rezessive Erbgang ist sehr viel komplizierter, als man denkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich grüne Augen habe, ist nicht besonders groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer, wenn er nicht Schwede, Ire oder Schotte ist, grüne Augen bekommt, ist nicht besonders groß. Lediglich zwei Prozent der Weltbevölkerung haben grüne Augen. Aber es ist durchaus möglich. Und dieser Fall ist bei mir eingetreten.
Dax interessierte sich nicht für die wissenschaftliche Erklärung. Er ist ein Träumer. Er lebt in einem Film.
»Du hast die Augen eines Gottes.«
Später waren wir beide dann zwei siebzehnjährige Ex-Junkies, die versuchten, nicht im Jugendknast zu landen, indem wir am »Youth at Risk«-Programm teilnahmen. Die auf einem beschissenen alten Moped namens Die Götter von Auckland durch die Stadt kutschierten.
Wenn Dax ein E-Zigaretten-Aroma wäre, dann würde er nach Tequila und Auspuffabgasen schmecken. Was für ein Arschloch. Aber so liebenswert.
Wie auch immer. Besagte Nacht.
Ein Samstag. Die letzte Vollmondnacht. Die Nacht, die alles veränderte. Da war Dax überhaupt nicht liebenswert. Er war das genaue Gegenteil davon, was auch immer das ist. Er war der Gott der Arschgesichter. Ich kapierte nur nicht, warum. Ich musste ihn eine Stunde lang bedrängen und löchern. Sogar noch länger. Und schließlich rückte er mit der Sprache heraus.
»Ich habe mit jemandem geschlafen.«
Rums.
Tangaroa, Gott des Meeres. Schick eine Flutwelle. Spül mich fort.
Er sei nicht in sie verliebt, sagte er, als würde das die Sache auch nur ein bisschen besser machen. Er mochte sie nicht mal besonders. Und wollte ganz sicher nicht mit ihr zusammen sein. Aber ihm war klar, was seine Aktion zu bedeuten hatte. Er teilte mir auf seine kranke Art mit, dass es zwischen uns aus war.
Mein Freund mit der hübschen übergroßen Nase wollte nicht mehr mit mir zusammen sein.
Ich lief aus dem Haus. Raus auf die Straße. Holte tief Luft. Und betrachtete den großen Vollmond über der Stadt. Ich wusste nicht, was ich als Nächstes tun sollte. Wusste nicht, wie ich das wieder zusammenflicken sollte, was so plötzlich, so unerwartet und so vollends in die Brüche gegangen war. Was so vollends im Arsch war.
Dax bewahrt neben seinem Bett ein Glas mit Geld auf, hundert Dollar. Das hat eine symbolische Bedeutung. So viel kosten zwei Tütchen Crack. Nachdem wir einen Entzug gemacht hatten, wollte Dax mit dem Glas voller Geld zum Ausdruck bringen: »Wir sind jetzt clean. Wir haben’s geschafft. Wir können neben dem Geld für zwei Tütchen Crack schlafen, ohne der Versuchung nachzugeben. Wir sind stärker.«
Ich musste an das Glas denken. Ich hob einen Backstein auf, ging zurück und warf ihn durch Dax’ Fenster, kletterte ins Haus, brüllte ihn an, er solle sich verdammt noch mal von mir fernhalten, nahm das alberne Glas mit dem symbolischen Geldbetrag. Und lief hinaus in die Nacht.
Nun.
Das war die Nacht, die alles veränderte. Es war ein Samstag. Sieben Tage später, am nächsten Samstag, würde in den frühen Morgenstunden über Auckland ein Sichelmond aufgehen.
Aber ich sollte den Sichelmond nicht aufgehen sehen.
Oder sonst jemals irgendeinen Mond.
Dann werde ich tot sein.
2
Schwarze Sanddünen
Hana joggt den menschenleeren, unberührten Strand entlang.
Ihre Füße finden auf dem vom zurückweichenden Wasser fest gewordenen Sand guten Halt, und auf dem letzten halben Kilometer treibt sie ihren Puls ordentlich in die Höhe. Hana trägt beim Joggen unter ihrer Laufbekleidung stets einen Badeanzug. Sie legt einen letzten heftigen Sprint ein, mit hochgezogenen Knien und rudernden Armen, und als sie den Sandstreifen unterhalb ihres Hauses erreicht, schmerzt ihre Lunge. Sie zieht ihre Joggingsachen und Schuhe aus und stürzt sich in ihrem Badeanzug in die Fluten. Sie schwimmt einige Hundert Meter aufs Meer hinaus. Schaut zurück zu der Gebirgskette fünfzig Kilometer landeinwärts, über der gerade die Sonne aufgeht. Die morgendlichen Strahlen spiegeln sich golden in ihren Augen, das Wasser ist ruhig, der Himmel wolkenlos. An der Westküste bricht ein traumhafter Tag an.
Dieser Küstenabschnitt kann ein rauer, trostloser Ort sein. Im Laufe der Jahrtausende haben die vorherrschenden Seewinde den eisenhaltigen Sand landeinwärts geweht und, so weit das Auge reicht, geschwungene Dünen gebildet. Erleuchtet von den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne, heben sich die grünen und silbergrauen Gräser im Gegenlicht deutlich vom schwarzen Sand ab. Einen Kilometer weiter nördlich die Küste hinauf stehen große Bäume, deren Silhouetten in der Morgensonne wie eine Reihe alter Männer wirken, die, gepeinigt von arthritischen Schmerzen, den Strand entlangmarschieren, ihre Wirbelsäulen von Jahrhunderten voller Wind verdreht und gekrümmt. Es ist ein majestätischer Anblick, als hätte ein Barockkünstler auf der Höhe seines Könnens diesen Ort erschaffen und nicht das zufällige Wirken der grausamen und unaufhaltsamen Natur.
Viele Orte in Neuseeland verbreiten eine ähnliche Atmosphäre.
Hana treibt auf dem Wasser. Die friedliche Stille in den zwanzig Minuten vor und nach Sonnenaufgang ist ihre liebste Tageszeit. Während ihrer Kindheit ist sie das ganz Jahr hindurch hier heruntergekommen und hat sich in die frühmorgendlichen Fluten geworfen; im Winter ist sie meistens nur kurz ins Wasser gehüpft, aber das reichte, um ihren Kreislauf für mehrere Stunden in Schwung zu bringen. Zu dieser Jahreszeit, wenn sich das Meer erwärmt, hat sie es nicht eilig, an den Strand zurückzukehren, auch wenn die großen Meerestiere in der Morgen- und Abenddämmerung auf Jagd gehen und die größte Gefahr für Menschen darstellen. Überall im Land gibt es Haie, allerdings nicht annähernd so viele wie in den wärmeren Gewässern Australiens. Statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, dass eine gesunde, sportliche Frau von Ende dreißig auf irgendeine andere Weise stirbt. Hana wird es darauf ankommen lassen. Wenn sie an diesem Strandabschnitt einem Weißen Hai zum Opfer fallen sollte, dann dient sie in ihren letzten Momenten wenigstens einer gefährdeten Art als Nahrung.
Schließlich schwimmt sie zur Küste zurück. Am Strand reibt sie Schultern, Arme und Beine mit schwarzem Sand ein und massiert damit vorsichtig Hals und Gesicht. Ein mineralhaltiges Peeling, die Art von Körperpflege, für die sie in der Stadt vielleicht den Gegenwert ihrer wöchentlichen Lebensmitteleinkäufe ausgeben würde, aber hier bekommt sie es gratis. Nachdem Hana vor sechs Monaten den Polizeidienst quittiert hatte – nachdem sie die Kündigung eingereicht, ihren Dienstausweis als Senior Sergeant abgegeben und ihren Schreibtisch ausgeräumt hatte und im Polizeipräsidium von Auckland zum letzten Mal mit dem Aufzug vom achtzehnten Stock nach unten gefahren war –, traf sie eine Entscheidung. Sie kehrte an diesen Ort zurück, an dem sie aufgewachsen ist, und mietete ein Haus, nur ein paar Hundert Meter vom Haus ihres Vaters Eru entfernt. Seitdem ist sie jeden Morgen die Straßen und Hügel der kleinen Stadt entlanggelaufen und im Meer geschwommen. Und hat ihre Haut mit eisenhaltigem Sand eingerieben.
Sie springt noch einmal ins Wasser, um den Sand abzuspülen. Dann macht sie sich auf den Heimweg.
Vor dem Betondenkmal, das am Fuße der Dünen knapp oberhalb der Wasserlinie errichtet wurde, bleibt Hana wie üblich stehen. Es ist schlicht und wunderschön. Ein Betonkreuz, auf dem ein einziges Wort steht.
PAIGE
Hana wischt etwas Sand von dem Denkmal. Sie besuchte das vorletzte Jahr der Highschool, als Paige Meadows vor einundzwanzig Jahren ermordet wurde; Hana war eine Klasse unter ihr. Dieses Ereignis führte bei ihr zu einer frühen Erkenntnis, die sich nur bestätigte, als sie ihre kleine Stadt verließ, um in der großen Stadt ein Cop zu werden: Verglichen mit Angriffen durch Meerestiere ist es wahrscheinlicher, durch die Taten seiner Mitmenschen zu sterben. Durch einen Autounfall zum Beispiel. Durch Krankheiten, die von der Tabak- oder Alkoholindustrie verursacht werden.
Oder, wie bei Paige, durch einen Mord.
Sie wurde erwürgt, und man fand in den Dünen ihre verscharrte Leiche. Das Verbrechen wurde zwar rasch aufgeklärt, aber es hat in der Gemeinde eine tiefe, bleibende Wunde hinterlassen.
Hana legt eine glänzende weiße Muschel auf den Sockel des Kreuzes zu den anderen kleinen Kostbarkeiten, die die Einheimischen dort platziert haben. Glasscherben, die die Wellen im Laufe der Jahre glatt poliert haben, ein hübscher Seestern, der an Land gespült wurde, ein Stück Treibholz in Form eines Herzens.
Schließlich läuft Hana durch die silbergrauen und grünen Gräser zu ihrem Haus zurück.
»Tīmoti. Kumpel, wir warten.«
Ein halbes Dutzend Teenager und junge Erwachsene aus Tātā Bay hat sich auf dem Rugbyplatz gegenüber dem Marae versammelt. Hana und ihr Vater Eru gehen jeden Morgen in der Früh zum Marae und stecken rings um das Rugbyfeld mit orange leuchtenden Verkehrshütchen einen Hindernisparcours ab. Die beiden haben dieses Projekt kurz nach Hanas Rückkehr ins Leben gerufen. Sie bereiten junge Einheimische auf die Führerscheinprüfung vor, Hana benutzt dafür ihren eigenen Wagen. Fast alle Teilnehmer können bereits fahren; dies hier ist eine ländliche Gegend. Kein Vierzehnjähriger lässt sich davon abhalten, seine älteren Geschwister so lange zu löchern, bis sie ihm erlauben, zum Schwimmen an den Fluss hinunterzufahren oder bei Ebbe auf dem harten schwarzen Sand herumzukurven. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man nur weiß, wie man fährt, oder ob man einen Führerschein macht, der einen dazu berechtigt.
Tīmoti ist siebzehn Jahre alt. Er ist schlaksig, hat mehrere selbst gestochene Tätowierungen und einen akkurat rasierten Vokuhila. Er ist der Sohn von Hanas Cousine zweiten Grades, Ngahuia. Man hat ihr als Kind den Spitznamen »Eyes« verpasst, weil sie so große, ausdrucksvolle Augen hat, und seitdem wird sie so genannt.
Als Kinder standen sich Eyes und Hana sehr nahe, aber im Teenageralter kam es zwischen ihnen zum Bruch, und seitdem ist diese Kluft noch größer geworden. Eyes verachtet Hana, sie hält sie für eine Wichtigtuerin. Für eine Angeberin, die bei der ersten sich bietenden Gelegenheit ihre kleine Heimatstadt verlassen und in der großen Stadt einen tollen Job angenommen hat, ohne an diejenigen zu denken, die sie zurückgelassen hat. Als Hana nach ihrer Kündigung bei der Polizei wieder hierherzog, war Eyes nicht bereit, ihre Meinung über ihre Cousine zu ändern oder ihre Rückkehr zu akzeptieren. Im Gegenteil. Denn Hana hatte es Leuten wie Eyes überlassen, das Ahi Kā zu sein, das heimische Feuer am Leben zu halten. Und jetzt glaubt Hana, sie könne einfach wieder hier aufkreuzen und sich an der Wärme erfreuen? Jedes Mal, wenn im Marae eine Veranstaltung oder ein Familientreffen stattfindet oder wenn sie und Eyes sich auf der winzigen Hauptstraße begegnen, wird Hana die Ablehnung ihrer Cousine schmerzlich bewusst.
Und die familiären Spannungen haben auf Eyes’ Sohn abgefärbt.
»Ich weiß, wie man fährt.«
Tīmoti lehnt sich gegen einen der Rugbypfosten und klopft mit seinen teuer aussehenden Basketballschuhen auf den Boden. Der hektische Rhythmus ist eine Botschaft für Hana. Er wäre jetzt gern an so ziemlich jedem anderen Ort der Welt als in diesem Fahrkurs.
»Das weiß ich, und du bist ein guter Fahrer«, sagt Hana geduldig. Dieses Gespräch führt sie mit Tīmoti jeden Tag. Das heißt, wenn er sich blicken lässt. »Aber du hast keinen Führerschein. Was ist, wenn dich ein Cop anhält?«
Es wäre am einfachsten, ihn nach Hause zu schicken, wenn er nicht hier sein will. Aber für Hana ist jemand wie Tīmoti genau der Grund, weshalb sie das hier tut. Wenn junge Māori in kleinen ländlichen Regionen mit wenig Arbeitsmöglichkeiten wie Tātā Bay einen Führerschein haben, können sie dorthin fahren, wo man studieren kann, falls sie das wollen, oder zu einer Farm oder einem der großen Forstbetriebe in einer der Nachbarstädte, um dort Arbeit zu finden. Wenn man wegen illegalen Fahrens erwischt wird, vor allem mit einem nicht zugelassenen oder schadhaften Wagen – was meistens die einzigen Autos sind, die junge Fahrer sich leisten können –, dann bekommt man eine Geldstrafe aufgebrummt, die man nicht bezahlen kann. Und sollte das erneut passieren, wird eine weitere Geldstrafe fällig, die man nicht begleichen kann, und man droht seinen Wagen zu verlieren. An einem Ort wie Tātā Bay ist ein Führerschein sehr viel mehr als ein Führerschein. Er ist ein Schlüssel zu Arbeit, zu Ausbildung; zu einem Leben.
»Die Jungs da wollen fahren. Lass sie nur«, sagt Tīmoti zu Hana und deutet mit seinem wippenden Basketballschuh verächtlich auf die anderen. »Das ist ihre Vorstellung von Spaß. Nicht meine.«
Tīmoti hat letztes Jahr die Schule beendet. Hana ist aufgefallen, dass er mit keinem aus der Gruppe befreundet ist. Wenn sie am Morgen eintreffen, sitzt Tīmoti immer abseits, und wenn die anderen zusammen herumhocken oder ihren Spaß haben, schreibt er Nachrichten auf seinem Handy. Hana vermutet, dass er andere Freunde hat, vielleicht auch eine Freundin. Es ist offensichtlich, dass er den Rest der Gruppe für Versager hält, und dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit.
Als Eru seine Nichte darum bat, Tīmoti für den Kurs anzumelden, reagierte sie kurz angebunden. »Deine Tochter, was? Will sich schon wieder wichtigmachen«, sagte Eyes. Eru ist kein sarkastischer Mensch. Aber gegenüber Eyes nahm er kein Blatt vor den Mund. Einige Monate zuvor war Tīmoti von der Polizei wegen Fahrens ohne Führerschein angehalten worden, was eine Geldstrafe nach sich zog, die Eyes kaum aufbringen konnte. Eru erklärte seiner Nichte, dass es ihm egal sei, was für ein Raruraru die beiden Cousinen miteinander hätten, er wolle, dass ihr Junge an dem Fahrkurs teilnehme.
Eru, der die Auseinandersetzung neben den Rugbypfosten beobachtet hat, tritt jetzt vor und legt Tīmoti seine Hand fest auf die Schulter.
»Die anderen kommen schon noch an die Reihe. Steig wieder in den Wagen.«
Wenn Hanas Vater spricht, reagiert Tīmoti völlig anders, als wenn sie versucht, mit ihm zu reden. Eru ist Ende sechzig. Er hat langes, wallendes graues Haar und trägt einen zerbeulten Buschhut aus Filz. Hana hat sein Lächeln geerbt – und sein Auftreten. Sie zeichnen sich beide durch ihre ruhige Art aus, weder Vater noch Tochter gehören zu den Menschen, die einen stillen Moment mit ihrem Geplapper übertönen müssen. Eru spricht mit leiser Stimme, aber wenn er etwas sagt, haben seine Worte Gewicht. Er ist einer der Stammesältesten im Marae, und als er mit Tīmoti redet, verfliegt dessen aggressives Verhalten gegenüber Hana.
»Okay«, sagt Tīmoti widerwillig. »Na schön, Matua.«
Als Eru zum Marae zurückgeht, um für die Teilnehmer das Mittagessen zuzubereiten, nimmt Tīmoti hinter dem Steuer Platz, Hana auf dem Beifahrersitz. Sie üben das Parken am Straßenrand. Zwei Reihen Hütchen stellen jeweils ein Auto dar. Zwischen ihnen ist genug Platz zum Einparken.
Tīmoti fährt an den orangen Verkehrshütchen entlang rings um das Rugbyfeld und kommt neben einer Reihe Hütchen zum Stehen. Dann setzt er, die Entfernung korrekt abschätzend, direkt in die Lücke zurück. Piep, auf dem Handy in seiner Hosentasche geht eine Textnachricht ein. Hana sieht dabei zu, wie er eine Antwort tippt und abschickt, bevor er sie anschaut.
»Alles gut?«, fragt er.
»Sehr gut sogar.«
»Hab ich doch gesagt.«
»Aber du bist durchgefallen. Sogar zweimal.«
»Schwachsinn. Was hab ich falsch gemacht?«
»Du hast nicht geblinkt. Und du hast dein Handy benutzt. Ein Fehler und du bist raus. Das waren sogar zwei. Die Fahrprüfer lassen dir nichts durchgehen.«
»Ich bin gut gefahren.« Sein Fuß wippt auf dem Bremspedal. Diesmal in einem schnelleren Rhythmus. Er ist frustriert. Und wird langsam wütend.
»Tīmoti, du musst dir deswegen keine Sorgen machen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Fehler zu machen. So etwas wirst du in der Prüfung nicht tun. Fahren wir eine weitere Runde.«
»Nein.«
Er steigt aus dem Wagen, läuft davon und setzt sich mit dem Telefon in der Hand unter die Torpfosten. Schreibt eine Nachricht. Und Hana weiß, dass er für den Rest des Tages nichts anderes tun wird.
»Großvater, erzähl PLUS 1 deine Geschichten. Über Großmutter Jos.«
Auf der Sandfläche unterhalb von Hanas Haus sind Decken mit einem Picknick ausgebreitet. Hanas Tochter Addison und ihr bester Freund PLUS 1 sind nicht mit leeren Händen gekommen: Sie haben leckeren Käse, Oliven und Cracker mitgebracht. Addison ist in dem Monat, in dem ihre Mutter den Polizeidienst quittiert hat und nach Tātā Bay zurückgezogen ist, achtzehn geworden und hat zusammen mit PLUS 1 Hanas Haus in der Stadt gemietet. Sie studieren beide, komponieren zusammen Musik und spielen Konzerte. Sie haben ein paar Songs veröffentlicht, die langsam Beachtung finden. Außerdem haben sie ein neues Projekt: eine junge Hündin namens Boca, die gerade unbeholfen durch die Dünen wankt, weil ihre Pfoten noch viel zu groß für ihren Körper sind.
Boca ist eine Hündin mit völlig unklarer Abstammung aus einem Tierheim; ihr Kopf deutet auf einen Staffordshire-Bullterrier-Whakapapa hin, ihr Körper und ihr Fell erinnern an einen Labrador, und ihre überdimensionalen Vorderbeine sind lang wie die eines Boxers. Beim Anblick ihres Gesichts haben PLUS 1 und Addison sich sofort in sie verliebt. Die schwarzen Ringe um ihre Augen sehen aus wie akkurat aufgetragener Lidstrich und laufen an den Rändern spitz zu. Außerdem formt Bocas Maul auf natürliche Weise ein freundliches Lächeln, was auch immer sie gerade wirklich fühlt: Es wird also bestimmt niemand übers Herz bringen, mit diesem liebenswert aussehenden Tier zu schimpfen, egal was es anstellt. Wie zum Beispiel ständig überall hinzupinkeln, was Boca die letzten paar Tage getan hat. PLUS 1 und Addison sind sich ziemlich sicher, dass sie einen Harnwegsinfekt hat.
Von Auckland nach Tātā Bay ist man eine ganze Weile unterwegs – wenn man nicht aufgehalten wird, fährt man mit einem guten Auto zwei Stunden. Aber der gebrauchte Wagen, den sie von PLUS 1’ älterem Bruder übernommen haben, ist eine Schrottkiste, und da Addison erst vor ein paar Monaten den Führerschein gemacht hat, ist sie nicht gerade die sicherste Fahrerin. Heute haben sie sogar noch länger gebraucht, weil sie etwa alle halbe Stunde anhalten mussten, damit Boca pinkeln konnte, und mehr als nur einmal haben sie es nicht rechtzeitig rausgeschafft, um auf dem Rücksitz ein Unglück zu verhindern.
Addison hockt jetzt im Schneidersitz auf den Decken im Sand; ihr Kopf ist, wie schon seit einigen Jahren, kahl rasiert. Sie lächelt und hält Erus Hand.
Es versetzt Hana einen kleinen Stich, als sie sieht, dass ihre Tochter und Eru die Finger ineinander verschränkt haben. Hana kann sich nicht erinnern, wann ihre Tochter zuletzt ihre Hand gehalten hat. An vielen Orten ist es völlig normal, wenn Mutter und Tochter Händchen haltend spazieren gehen. In Italien, zum Beispiel, in vielen islamischen Kulturen und in Südamerika. Die Menschen in Neuseeland tun das seltener, und Hana findet das ein wenig schade. Sie hat das Gefühl, dass der einfache Akt des Händchenhaltens die innige Liebe für ihre Tochter auf eine Weise zum Ausdruck bringen würde, wie es das »Hab dich lieb xx« am Ende einer SMS einfach nicht kann.
»Die Geschichte mit dem Gewehr«, beschwört Addison ihren Großvater.
»Addisons Großmutter war der begabteste Mensch, den ich kannte«, erklärt Eru PLUS 1, während sie das Essen herumreichen. »Jocelyn konnte einen Vergaser reparieren und hatte einen Stimmumfang von drei Oktaven.«
»Drei Oktaven, Mum! Du hast davon nichts abbekommen, Großmutter hat das direkt an mich vererbt.«
»Ich kann auch singen«, sagt Hana.
»Ein paar Backing Vocals. Ich und Großmutter Jos sind Leadsängerinnen.«
»Hey!«
Addison kann von den Geschichten ihres Großvaters über ihre Großmutter, an die sie sich kaum erinnert, gar nicht genug bekommen; Jocelyn ist an einer undiagnostizierten Venenschwäche gestorben, als ihre Enkelin noch sehr klein war. Addison erinnert sich vor allem an ihr Lachen und ihre funkelnden kobaltblauen Augen.
Während die Sonne untergeht, erzählt Eru die Geschichten, die Addison so liebt, von der hübschen Krankenschwester, die er kennengelernt hat, als er aus Vietnam zurückkehrte, mit einem zertrümmerten Bein, das zwar wieder zusammengeflickt wurde, aber an kalten Tagen immer noch Ärger macht. Davon, wie sich herausstellte, dass die Schwester nicht nur hübsch, sondern ihm in den meisten Dingen ebenbürtig und in vielen Dingen sogar überlegen war.
»Als mein Bein wieder verheilt war, gingen wir mit ihr auf die Hirschjagd, ich und mein Bruder. Wir dachten, sie würde höchstens eine halbe Stunde durchhalten und dann nach Hause wollen. Aber wir waren sechs Stunden unterwegs. Wir haben zwar keinen Hirsch erlegt, aber als wir auf ein paar Kiefernzapfen geschossen haben, war sie der mit Abstand beste Schütze. Sie hat uns ganz schön alt aussehen lassen. Und …«
Addison und Hana sprechen den letzten Satz mit, den sie beide so oft gehört haben. »Und sie hat das allen immer wieder unter die Nase gerieben.«
Addison nimmt Eru lachend in den Arm. »Das hier sind die Oliven, die du so magst, oder, Großvater? Und ich habe den Hummus für dich selbst gemacht.«
Eru häuft etwas Hummus auf ein Stück Brot. Während er isst, wirft er PLUS 1 einen Seitenblick zu. »Nicht binäre Geschlechtsidentität. Habe ich das richtig verstanden?«
PLUS 1 grinst Addison an. Das ist ein weiteres Gespräch, das sie jedes Mal führen, wenn sie sich treffen, und PLUS 1 genießt es. Viele Eltern ihrer Freunde wissen überhaupt nicht, wie sie mit dem Gender-Thema umgehen sollen, mit der heiklen Frage, welche Pronomen sie verwenden sollen. Und für die meisten Großeltern ihrer Generation ist das alles völlig verwirrend, also wird das Thema vermieden, als hätte man es mit einem Gespräch über eine Krankheit und nicht über Geschlechtsidentität zu tun. PLUS 1 findet es großartig, dass Eru direkt zur Sache kommt. Auch wenn er das jedes Mal auf dieselbe Weise tut.
»Ja. Nicht binär, Mr. Westerman. Wie beim letzten Mal.«
»Nicht binär klingt irgendwie flexibel. Als könntest du es dir anders überlegen. Heißt das, dass du nächste Woche vielleicht beschließt, ein Mann zu sein? Oder eine Frau?«
»Großvater! So funktioniert das nicht.«
Addison und PLUS 1 lachen beide. Hana ebenfalls, denn sie weiß, dass Eru, als man ihm von PLUS 1 erzählte, im Internet gründlich recherchiert hat, um seine Wissenslücken zu schließen; er weiß genau, was eine nicht binäre Geschlechtsidentität ist.
»Wenn wir uns das nächste Mal sehen«, sagt Eru, der das Thema noch nicht auf sich beruhen lassen will, »geben wir uns dann die Hände? Küssen wir uns? Oder drücken wir die Nasen aneinander?«
»Wir können das alles tun«, schlägt PLUS 1 vor. »Und unsere Hintern aneinanderstoßen, wenn Sie wollen. Warum sich entscheiden?«
Eru bricht in schallendes Gelächter aus, jene Art von Gelächter, das jedem in Hörweite ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Aufgeschreckt durch die plötzliche Explosion menschlicher Laute, klettert Boca auf Hanas Schoß.
Für einen Moment wirkt Eru nachdenklich. »Wisst ihr, ich habe immer noch mein Gewehr. Ich durfte es nach dem Krieg behalten. Oder vielleicht habe ich auch vergessen zu erwähnen, dass ich es noch hatte. Das nächste Mal, wenn ihr hier unten seid, nehme ich euch beide zum Schießen mit.«
»Wir sind Pescetarier, Großvater.«
»Ist das etwas anderes als nicht binär?«
Eru verzieht keine Miene. Und die anderen fangen an zu kichern.
»Wir essen zwar Fisch, aber nichts, was Beine hat. Wir werden keinen Hirsch erlegen.«
»Ich habe längst aufgehört, Tiere zu töten«, versichert Eru ihnen. »Wir werden Feuer und Zorn auf ein paar leere Konservendosen herabregnen lassen, die auf einem Baumstamm aufgereiht sind.«
»Oh ja«, sagt PLUS 1 begeistert.
Draußen auf dem Meer zerteilt der Horizont die Sonne jetzt genau in der Mitte, und die Gesichter der vier werden in die letzten warmen gelben Strahlen getaucht. Hana beginnt, das Essen einzupacken.
»In zwanzig Minuten wird es dunkel. Wir sollten nach Hause gehen.«
Kurz darauf marschieren sie durch die Dünen zurück, und während Eru PLUS 1 die Funktionsweise eines Armeegewehrs viel ausführlicher erklärt, als das vielleicht nötig wäre, geht Hana im Gleichschritt neben Addison her.
»Die neue Wohnsituation«, sagt sie leise, um vorsichtig ein Thema zur Sprache zu bringen, das sie beschäftigt, seit Addison und PLUS 1 zusammengezogen sind. »Wenn ich nicht zu Besuch bin, steht dann eines der Zimmer leer, um dort Musik aufzunehmen, oder …?«
Addison versucht, nicht die Augen zu verdrehen. Doch ohne Erfolg. »Du willst wissen, ob wir miteinander schlafen?«
»Es ging bei meiner Frage um Musik.«
»Mein Gott, Mum, du bist so durchschaubar. Nein, ging es nicht.«
»Antworte mir, welche Frage du auch immer beantworten willst.«
Boca, die nicht angeleint ist, trottet mit der Unbeholfenheit eines Welpen neben ihnen her und gibt sich größte Mühe, nicht zwischen ihre Füße zu geraten.
»Stan ist neulich vorbeigekommen. Er hat die Lebensmittel vorbeigebracht, die er in deinem Auftrag für uns gekauft hat. Aber es war klar, dass er nur da war, um sich bei uns mal umzusehen und dir Bericht zu erstatten.«
Hana begreift, dass man sie ertappt hat. Aber sie rechtfertigt sich nicht. »Wenn ich kein Interesse zeigen würde, wärst du gekränkt.«
Die beiden gehen schweigend weiter. Vor ein paar Wochen war direkt vom Meer ein schwerer Wirbelsturm herübergezogen und hatte die Küste von Tātā Bay getroffen. Hana war an diesem Tag zu Erus Haus gegangen. Sie hatten die Fahrstunde abgesagt und tranken den ganzen Tag heiße Schokolade, spielten Monopoly und beobachteten, wie die lädierten Wirbelsäulen der alten Bäume erneut durchgerüttelt wurden. Einer von ihnen stürzte um. Und mehrere Dünen wurden fast vollständig abgetragen.
Als sie jetzt einen besonders stark betroffenen Strandabschnitt entlanggehen, rennt Boca mit einem plötzlichen Ausbruch von Energie durch die verwüstete Landschaft. Addison gibt Hana den Picknickkorb, den sie in der Hand hält.
»Ich bin erwachsen. Und PLUS 1 auch. Du musst irgendwann die Nabelschnur durchtrennen.«
»Du meinst, du willst nicht an meinem Rockzipfel hängen.«
Addison gibt ihrer Mutter einen Kuss. »Bewahr dir dein Interesse, Mum. Das ist toll. Solange du mich damit nicht erdrückst.«
Hana beobachtet, wie Addison durch den Sand dem Hund hinterhereilt. Aber Boca findet, dass nichts mehr Spaß macht, als noch weiter wegzurennen, je öfter Addison nach ihr ruft. Während ihre Tochter hinter einer stark eingestürzten Düne in der Dunkelheit verschwindet, weiß Hana immer noch nicht, ob Addison und PLUS 1 nur zusammen leben oder zusammenleben. Sie schaut aufs Meer hinaus. Die Sonne ist jetzt verschwunden, und die letzten Strahlen am Himmel verblassen langsam. Eine Möwe fliegt landeinwärts Richtung Küste, um im Ort noch einmal auf Nahrungssuche zu gehen.
»Mum?«
Addison ruft nach ihr, irgendwo weiter hinten in den Dünen. Hana kann die Angst in der Stimme ihrer Tochter hören.
»Addison? Stimmt was nicht?«
»MUM. ACHDUSCHEISSE, MUM.«
Addisons offensichtliche Panik beantwortet ihre Frage. Hana rennt in die Richtung, aus der sie ruft, und sieht ihre Tochter am hinteren Ende einer eingestürzten Düne stehen, wo etwas freigelegt wurde, das im schwarzen Sand seine einsame Ruhestätte gefunden hat.
Ein menschliches Skelett.
Während PLUS 1 und Eru herüberkommen, betrachtet Hana die Knochen. Die Beckenknochen verraten ihr, dass es sich um eine Frauenleiche handelt.
Und Hana bemerkt noch etwas anderes.
An Handgelenken und Fußknöcheln hängen Reste von Klebeband. Die Frau ist keines natürlichen Todes gestorben.
Addison starrt auf die sterblichen Überreste hinunter, während sie Boca wie ein Baby in den Armen hält.
3
Karakia, Hīmene
Es ist eine klare, kühle Nacht in Tātā Bay. Der Strand erstrahlt im Licht batteriebetriebener Polizeischeinwerfer.
Tief unter den schwarzen Sanddünen liegen die Gebeine Dutzender Krieger, die vor Jahrhunderten mit einem Patu oder Taiaha erschlagen wurden. Vor der Ankunft der Engländer auf ihren großen Schiffen fanden zwischen den rivalisierenden Māori-Stämmen, die um diese westliche Küstenregion konkurrierten, zahlreiche tödliche Kämpfe statt. Der gewaltsame Tod war hier lange Zeit zu Gast, und jetzt ist er ungefragt zurückgekehrt.
»Du fehlst mir«, sagt Lorraine. »Uns allen. Ohne dich ist es im Büro nicht dasselbe.«
Hana steht bei zwei ranghohen Cops des Auckland CIB, der Ermittlungsabteilung für Kapitalverbrechen, für die sie bis vor ein paar Monaten gearbeitet hat. Lorraine Delaney ist in Hanas Alter und bekleidet denselben Dienstgrad wie Hana vor ihrer Kündigung: Detective Senior Sergeant. Jaye Hamilton ist Hanas Ex, in jedem Sinn des Wortes; der Detective Inspector ist ihr Ex-Mann und Addisons Vater und ihr Ex-Chef. Nachdem Addison auf die Knochen gestoßen war, rief Hana ihn sofort an. In einem etwas weiter entfernten Bauerndorf gibt es zwar ein Polizeirevier mit zwei Beamten, aber sie wusste, dass man einen ungeklärten Todesfall umgehend nach oben an die Ermittler des CIB weiterleiten würde, also sparte sie sich diesen Zwischenschritt.
»Andererseits überträgt man mir seit deiner Kündigung die interessanten Fälle«, fährt Lorraine lächelnd fort. »Also danke, Kollegin. Komm so bald nicht wieder zurück.«
»Die Gefahr besteht nicht, Lorry.«
Hana und Lorraine kennen sich bereits aus ihrer Zeit auf der Polizeischule, wo sie zwei Frauen in einer fast nur aus Männern bestehenden Klasse waren, zwei Frauen, die einen von Männern dominierten Beruf ergriffen hatten; bisher hat es in Neuseeland keinen weiblichen Polizeipräsidenten gegeben. Damals hätten die weiblichen Kriminalbeamten des Landes in einem mittelgroßen Streifenwagen Platz gehabt. Auf der Polizeischule und nach dem Abschluss waren die beiden nicht gerade beste Freundinnen. Hana, die junge, ehrgeizige Māori aus der Kleinstadt. Und die blonde blauäugige Lorraine aus einer einfachen Arbeiterfamilie von Pākehās im Süden Aucklands. Aber sie hatten sich gegenseitig unterstützt. All die Jahre in den lauten Polizeibars, wo die harte tagtägliche Polizeiarbeit regelmäßig im Konsum von viel zu viel Alkohol mündete und einige junge männliche Cops, die zu viel getrunken hatten, manchmal glaubten, Lorraine mit ihrem roten Lippenstift oder die dunkelhaarige Hana hätten nur auf sie gewartet. Die Frauen versuchten, die Situationen mit Humor oder einem angemessen furchterregenden Blick zu entschärfen. Und mehr als einmal, wenn der ungebetene Annäherungsversuch fortgesetzt wurde, packten sie den schwankenden jungen Mann an den Armen und beförderten ihn an die frische Luft. Während sie beide die Karriereleiter hinaufkletterten, unterstützten sie sich weiter gegenseitig und auch die anderen Frauen, die den Polizeidienst in Neuseeland allmählich veränderten. Nach Hanas Kündigung war es naheliegend, Lorraine den Posten des ranghöchsten Ermittlungsbeamten in Jayes Team zu übertragen.
Die meisten Scheinwerfer sind jetzt auf die eingestürzte Düne mit den freigelegten Knochen gerichtet. Polizeifotografen und Kriminaltechniker begutachten den Fundort. Und ein Pathologe ist eingetroffen, um sich die sterblichen Überreste vor Ort anzusehen, bevor sie für die Obduktion weggebracht werden.
Jaye und Lorraine warten mit Hana in einiger Entfernung.
»Es ist gut, dass die Sache in zuverlässigen Händen ist«, sagt Hana. »Allerdings sollte euch klar sein, dass das für die Einheimischen unerfreuliche Neuigkeiten sind. Jetzt gibt es eine weitere Frau, die ermordet und in den Dünen entsorgt wurde.«
Die beiden Cops wissen von der jungen Frau, von Hanas Mitschülerin, an die das schlichte Betonkreuz am Meer erinnert.
»Paige Meadows wurde wann, vor zwanzig Jahren getötet?«, fragt Lorraine.
»Vor einundzwanzig Jahren. Ich war im vorletzten Jahr der Highschool.«
»Ich kann mich erinnern, dass du in der Polizeischule davon erzählt hast. Leben die Eltern immer noch hier?«
»Direkt gegenüber den Geschäften.«
Lorraine schaut zu den drei Straßenlaternen hinter den Sanddünen, die die gesamte Länge der kleinen Hauptstraße der Gemeinde Tātā Bay markieren.
»Sie werden nicht begeistert sein, wenn die Polizei an ihre Tür klopft«, sagt sie. »Aber es wäre mir lieber, wenn sie nicht aus der Zeitung davon erfahren. Tust du uns den Gefallen?«
»Ich werde gleich morgen früh zu ihnen gehen«, versichert Hana. Sie dreht sich wieder zu der Stelle um, wo die Kriminaltechniker gründlich den schwarzen Sand rings um die Verstorbene durchsuchen.
»Die sterblichen Überreste scheinen nicht aus alten Zeiten zu stammen. Die Knochen sind unversehrt und in einem guten Zustand. Meiner Meinung nach liegt die Leiche hier höchstens drei bis fünf Jahre. Was denkst du?«
Jaye und Lorraine wechseln einen Blick. Was Hana nicht entgeht. Sie hat die beiden zwar benachrichtigt, und beide sind enge ehemalige Kollegen. Aber sie sind eben ehemalige Kollegen. Das hier ist eine polizeiliche Ermittlung, und Hana ist nicht mehr bei der Polizei. Wenn sie an Lorraines oder Jayes Stelle wäre, würde sie jetzt etwas in der Art sagen wie: »Du kannst nach Hause gehen.«
Der Wind wird stärker. Ein paar Strähnen von Lorraines blondem Haar haben sich gelöst, und sie greift danach und steckt sie wieder zu diesem leicht zerzausten, wilden Dutt zusammen, der, wie Hana weiß, sorgfältig frisiert ist, obwohl er so ungezwungen wirkt.
»Hat mich gefreut, dich zu sehen, Hana«, sagt sie und läuft zu der in Scheinwerferlicht getauchten Düne zurück. »Du kannst jetzt nach Hause gehen.«
Es ist eine Stunde vor Sonnenaufgang, als der schwarze Leichenwagen auf den Parkplatz am Rand der Dünen biegt. Bei ihrer Ankunft früher am Abend hat Eru Jaye und Lorraine erklärt, dass die Einheimischen die erforderlichen Rituale abhalten möchten, um der Toten ihren Respekt zu erweisen.
Eine tief liegende Nebelbank zieht vom Meer landeinwärts, als der Leichensack mit den sterblichen Überresten aus den Dünen in den Leichenwagen verfrachtet wird, bei dem Eru und ein weiterer Stammesältester des Marae bereits warten. Eru ruft alle Anwesenden herbei, und die Detectives und Kriminaltechniker treten zu den versammelten Einheimischen. Sie bilden einen Halbkreis um die offene Hecktür des Leichenwagens. Eru spricht auf Te Reo Māori, preist das Land, die Berge und das Meer. Segnet die Verstorbene und fordert ihre Vorfahren auf, ihre Seele wieder in ihre Obhut aufzunehmen.
Der Stammesälteste beschließt das Ritual mit einem halb gesprochenen, halb gesungenen Karakia. Als er das Gebet beendet hat, nimmt Addison ihre Eltern an den Händen und tritt mit ihnen zu den sterblichen Überresten.
Dann beginnt sie zu singen.
Tama ngākau mārie,
Tama a te Atua,