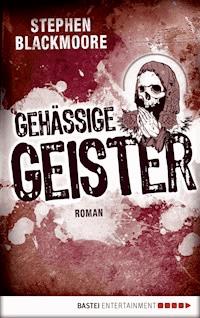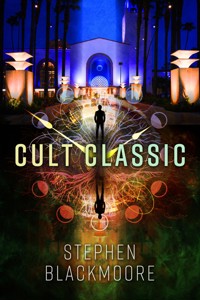7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erik Carter sieht die Geister der Toten und verdient gutes Geld damit, sie ins Jenseits zu befördern. Als seine Schwester Lucy brutal ermordet wird, kehrt er nach 15 Jahren wieder nach L.A. zurück. Damals verließ er die Stadt auf der Flucht vor einem brutalen Gangster, der damit drohte, jeden umzubringen, den Carter liebte. Hat sein alter Feind seine Drohung nun doch wahrgemacht? Ist Lucy seinetwegen gestorben? Carter findet seine schlimmsten Ängste bestätigt, als er am Tatort eine Nachricht an ihn findet — eine Nachricht aus der Geisterwelt, die niemand außer ihm sehen kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Danksagung
Über den Autor
Stephen Blackmoore war nach eigener Aussage als Kind der Ansicht, man könne seine Zeit am besten damit verbringen, Dinge in Brand zu stecken. Bis er entdeckte, dass Augenbrauen nur sehr langsam nachwachsen. Neben seinen Romanen um das von dunklen Mächten unterwanderte L. A. schreibt er Kurzgeschichten, Artikel und betreut als Redakteur das Pulp-Magazin needle: a magazine of noir.
STEPHEN BLACKMOORE
TOTE DINGE
Roman
Aus dem Amerikanischen von Thomas Schichtel
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe: Copyright © 2013 by Stephen Blackmoore Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Dead Things« Originalverlag:DAWBooks Inc. By arrangement withDAWBooks New York Dieses Werk wurde vermittelt durch Interpill Media GmbH, Hamburg
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2016 by Bastei LübbeAG, Köln Textredaktion: Dr. Frank Weinreich Titelillustration: © Thinkstock/egal Umschlaggestaltung: Guter Punkt, MünchenE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1514-1
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Kapitel 1
Als ich an der Kneipe vorfahre und der Truck dabei Staub und Schotter hinter mich schleudert, weiß ich, dass es schon zu spät ist, um noch jemandem zu helfen. Unter den acht oder neun Wagen auf dem Parkplatz sind zwei der Texas State Troopers, und ihre Blaulichter blinken nach wie vor.
Das Auto, das ich suche und seit Miami verfolge, ein 1973er Cadillac Eldorado Cabrio, wurde ordentlich auf dem Schotterstellplatz neben zwei Ford F-150 abgestellt, beide mit Gewehrständern und Schmutzfängern voller Chromfrauen.
Ich überzeuge mich davon, dass ich alles bei mir habe, und bekreuzige mich bei jedem Artikel. Wie in dem alten Witz: Brille, Hoden, Brieftasche und Uhr.
Nur sind es diesmal ein Fleck Friedhofserde auf der Stirn, die Gürtelschnalle (ein komplexes Eisengeflecht, um den Bösen Blick abzuwehren), ein Rasiermesser, das ich dem Mann entwendet habe, mit dem es begraben wurde, und, ja, eine Uhr. Eine Illinois Sangamo Special Railroad Grade Watch von 1919. Hält die Zeit fantastisch gut fest!
Ich hoffe, dass ich sie nicht benutzen muss.
Als Nächstes kommt der Rucksack an die Reihe. Ich habe schon fünfzehn Mal hineingeblickt, seit ich heute Morgen aufgewacht bin, aber es lohnt sich, genau zu wissen, wo man sein Zeug findet.
All das, was der anspruchsvolle Nekromant braucht: Astragale, eine Schlinge vom Hals eines gehängten Mörders, ein Satz Karten, zusammengesetzt aus Assen und Achten, und ein Beutel, den ich mir an den Gürtel hänge. Er ist voller pulverisierter Friedhofserde, Salz, zermahlener Knochen und Blut, das unter einem Vollmond getrocknet ist.
Und eine Browning Hi-Power 9 mm, speziell für die Wehrmacht angefertigt, nachdem die Nazis in den Besitz der Fabriken gelangt waren und ehe die Belgier damit loslegten, diese zu sabotieren. Das Ding trägt reichlich Waffen-SS-Kennzeichnungen.
Ich glaube nicht so recht an das Böse, aber diese Knarre ist einfach schlimm. Es ist die Pistole eines Mörders, eines Sadisten. Jedes Leben, das damit zerstört wurde, ist darin eingebrannt wie die Stempel des Dritten Reichs, die den Verschluss bedecken.
Wenn ein Typ wie ich sie benutzt, verleiht ihr all diese Energie einen Wumms, neben dem eine .44er wie ein Spielzeuggewehr abschneidet.
Ich schieße nicht gern mit dem Ding. Fasse es nicht mal gern an. Fühlt sich an, als huschten Kakerlaken unter den Fingern herum. Manchmal ist das beste Werkzeug für einen Job jedoch eines, das gar nicht existieren sollte.
Die Knarre ist nicht ganz so schlimm wie die Uhr, aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Also klemme ich mir das Holster in den Hosenbund und hoffe, dass ich mir nicht die Eier wegballere.
Die Sonne in West-Texas ist brutal und backt alles in einem Dunstschleier aus verbranntem Karamell zusammmen. Warum zum Teufel irgendjemand mitten in diesem Kalksteinödland eine Kneipe eröffnet, bleibt mir verborgen. Yucca, Kreosotbüsche, ein paar Agaven und eine vom Wind geschüttelte Wellblechhütte sind die einzigen störenden Elemente in der endlosen Weite der Landschaft.
Charles Tyrone Washington ist ein harter Brocken. Konnte sich in den 1960ern aus einer Totschlagsanklage in Detroit winden und bezog einen Wohnwagen in Florida. Gründete diese bescheuerte Voodookirche, um die Einheimischen zu prellen und mit ihren Töchtern zu schlafen.
Feines Geschäftsmodell, wenn man es richtig hinkriegt, schätze ich. Geholfen hat dem Typ, dass er echt ist. Er spricht wirklich mit den Toten, verflucht seine Feinde, sagt die Zukunft voraus. Das volle Programm. Hat echt was drauf. Verschwendet das Talent auf Böse Blicke und Pferdewetten.
Letztlich haben sich die Gespräche mit Voodoogeistern ausgezahlt, und er hat in den 1990ern genug Knete zusammengerafft, um die ausgebrannte Hülse einer Villa von vor dem Bürgerkrieg mitten in den Everglades zu erwerben. Sechs Monate später kamen einige seiner Anhänger zu Besuch und entdeckten seine verwesende Leiche in einem Kreis aus Salz und Kerzenwachs in der Eingangshalle.
Von da an hat er sich richtig ins Zeug gelegt.
»He, Chuck«, sage ich und betrachte das Blutbad. »Du wirst kreativ.« Ich stehe an der Tür und betrachte eine grausige Szene, angesichts der Hieronymus Bosch rot geworden wäre.
Ich muss sehr an mich halten, um gelassen zu bleiben und nicht die ganze Bude vollzukotzen. Ich habe schon Tote gesehen, aber das hier ist der reinste Irrsinn. Wer Glück hatte, ist auf seinem Stuhl gestorben. Fünf, vielleicht sechs Typen; im Gewirr der Körperteile ist das etwas schwer zu erkennen. Er hat ihre Schädel zur Explosion gebracht und die offenen Rümpfe in einem Meer aus Blut auf dem Fußboden abgeladen.
Die anderen, besonders die Trooper, haben die fürstliche Behandlung abgekriegt. Mit den Flügeln eines Deckenventilators an die Rückwand genagelt, die Brustkörbe aufgerissen, um leere Hohlräume zu zeigen, auf Barhockern gepfählt, mit tausend Schnitten von Glasscherben zerfetzt. Ein armes Schwein besteht nur noch aus seinem Torso. Jesus allein weiß, was Washington mit dem Rest von ihm angefangen hat.
Der schlimmste Fall hat eine Verwandlung begonnen, aber nicht zum Abschluss gebracht. Die Gliedmaßen ragen in schiefen Winkeln hervor, und Fellbüschel und Chitin sind an die Stelle der Haut getreten. Ein Dutzend kleiner Münder steht offen und lässt die Zungen heraushängen. Das einzig erkennbar menschliche Teil an ihm sind die Cowboystiefel.
Es treiben sich keinerlei Geister herum. Bei so viel Verwüstung ist es eigentlich normal, dass jemand mindestens einen Geist hinterlassen hat. Washington hat sie aber schon verspeist.
Er sieht nach einem drahtigen, siebzig Jahre alten Schwarzen in Hawaii-Hemd und Khaki-Cargohose aus. Eine Nickelbrille mit schmalem Gestell hockt auf seiner Nase. Typischer Ruheständler in Florida. Spielt vielleicht Golf. Hängt auf seiner Veranda herum und blickt den vorbeischlendernden kubanischen Chicas nach.
Aber das ist nur der Eindruck, den man auf dieser Seite bekommt. Drüben auf der Zwielichtseite ist er eine brennende, durcheinanderquirlende Masse von Gesichtern – in jener Zwischenwelt, wo die Toten ihre Kadaver parken, um auf das zu warten, was auch immer danach kommt. Die Loa tanzen unter seiner Haut und leuchten wie heiße Kohlen – eben jene Voodoogeister, die ihm genug Lotteriezahlen verraten haben, um seine Versorgung mit Alkohol und Zigaretten zu gewährleisten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist.
Nach Washingtons Tod kamen allmählich Gerüchte in Umlauf, denen zufolge er dort unten eine echt üble Magie abziehen sollte. So was kommt vor. Den Tod eine Zeit lang zu beschummeln ist gar nicht so schwierig, wie man vielleicht denkt. Er hing mit den Loa ab und ernährte sich von Geistern, die er in umliegenden Städten erjagte.
Natürlich hat niemand versucht, ihn aufzuhalten. So ticken Magier nun mal nicht. Er fand überhaupt nur akademisches Interesse. Man kann von uns nicht erwarten, auch nur einen Scheiß auf ihn zu geben, solange er uns nicht in die Parade fährt oder zu viel Aufmerksamkeit der Normalen weckt.
Die Magierszene funktioniert wie die der illegalen Kämpfe. Man redet nicht darüber. Schließlich dürfen die normalen Bürger nicht erfahren, dass der ganze Scheiß real ist. Wir müssten sonst vielleicht was abgeben.
»Du bist mal ein zähes Arschloch, Eric Carter«, sagt Washington. Er kippt sich ein Miller-Bier hinter die Binde und zieht an seiner Zigarette.
»Das gehört zu meinem Charme«, sage ich.
Auf der anderen Seite sehe ich die Gesichter unter seiner Haut aufleuchten wie Benzin, das man auf einen brennenden Scheiterhaufen schüttet. Zu sehen, wie das Land der Toten unsere Seite überlagert, hat seinen Nutzen, obwohl es manchmal schwierig wird zu erkennen, was wirklich ist und was nicht. Aber ich blicke auf Jahre der Übung zurück. Magier werden mit einem Talent geboren. Illusionen, Transformationen, Weissagungen. Manche Leute sind in manchen Dingen einfach besser als andere.
Ich hab das Talent für die toten Dinge abgekriegt. Juhu!
»Ich will schon länger mit dir reden. Ich wusste, dass du herkommen würdest«, sagt Washington. »Sobald ich erst mal genug Leute umgebracht hatte, wusste ich, dass du es spüren würdest. Und schnurstracks zu mir kommst.«
Ich bin gut, aber nicht so gut. Ich deute mit dem Daumen über die Schulter. »Nee. Hatte einfach Glück. Habe einen Funkscanner im Auto. Hörte, wie die Cops in den Einsatz gefahren sind. Ich wollte gerade nach Süden. Dachte mir, du hättest dich inzwischen nach Mexiko verpisst.«
Washington hat schon eine ganze Weile lang in seinem Sumpfpalast sein Ding durchgezogen. Nicht wirklich tot, nicht wirklich lebendig. Irgendwann, vermutlich vor ungefähr einem Jahr, ging er dann noch ein bisschen weiter und über alle Grenzen. Anstatt die Loa um Gefallen anzubetteln, fing er damit an, ihnen Fallen zu stellen, mit ihnen zu experimentieren, sie in leicht genießbare Häppchen zu zerschneiden. Begann, sie zusammenzuflicken und sie auf der Seele zu tragen, wie ein Psychokiller, der sich abgezogene Haut überstreift.
Damit machte er manche Dinge ganz entschieden unglücklich. Als Daumenregel kann man sagen, dass man sich nicht mit Sachen anlegt, die große Brüder und Schwestern haben. Die könnten einem womöglich auf den Leib rücken. Schlimmer noch: Sie könnten jemanden wie mich schicken.
»Du könntest mich einfach in Ruhe lassen«, sagt er. »Auf diese ganze Farce verzichten und jemanden deinesgleichen in Frieden leben lassen. So von Nekromant zu Nekromant.«
Ich bin kein großer Fan dieses Begriffs. Muss dabei immer an Türme im Moor und mittelalterliche Schädeldecken denken. Sicher, ich lasse auch zuweilen einen schwarzen Widder bei Vollmond ausbluten, aber komm schon! Wir schreiben das beschissene 21. Jahrhundert. Gewöhn dich dran!
»Zwei Punkte«, sage ich und zähle sie an den Fingern ab. »Erstens hast du kein Leben. Ich weiß nicht recht, ob du überhaupt noch als Mensch zu betrachten bist, obwohl ich damit kein Problem habe. Du weißt doch, jedem sein Pläsierchen. Und zweitens gehört es zu meinem Job. Ich habe einen Vertrag. Tut mir leid.«
»Behaupte nicht, ich hätte dir keine Chance gegeben, mein Junge«, sagt er.
»Yeah, denn das hat in Florida schon so gut für dich funktioniert.«
Ich hatte ihn in seiner Villa im Sumpf gefunden, die er schon eine Zeit lang als Ritual- und Forschungszentrum nutzte. Clever von ihm. Die Bude hockte auf einem Knotenpunkt wilder Magie, die wie Methan aus dem Sumpf blubberte. Wer immer das Haus gebaut hatte, wusste genau, was er tat. Es verlieh seinen Zaubersprüchen eine Menge mehr Pep.
Ich hätte es beinahe nicht geschafft. Hatte aber Glück. Während er die Scheiße aus mir herausprügelte und mich durch das Zimmer schleuderte, sah ich ein Stück eines der Loa wie einen losen Faden an ihm hängen. Mehr brauchte ich nicht. Ich warf einen Bannzauber darauf, riss es von Washington herunter und schickte es zu Mama nach Hause.
Als würde sich ein Pullover auflösen, zog es den Rest der Loa heraus. Washington hatte sie nicht so gut in der Hand wie gedacht. Hat ihm eine Scheißangst eingejagt. Er warf mich durch ein Fenster und haute ab, wobei er mitnahm, was er konnte.
Habe dann drei Tage gebraucht, um ihn in Miami wieder aufzuspüren, wo er in einem Vier-Sterne-Ferienhotel auf Fisher Island untergetaucht war. Hatte geglaubt, sich hinter all dem Salzwasser ringsherum verstecken zu können. Eine Zeit lang ging das auch gut. Ähnlich wie so viele andere Magier kann er allerdings nicht von der Idee lassen, Magie wäre die einzige Möglichkeit, etwas zu erreichen.
Ich fand ihn, indem ich die Prostituierten vor Ort abklapperte, bis ich eine fand, die er gemietet hatte. Da gibt der Typ tausend Mücken pro Nacht aus, um sich vor mir zu verstecken, und schnappt sich eine billige Nutte mit Meth-Abhängigkeit. Zwanzig Dollar und eine falsche Dienstmarke waren alles, was ich brauchte.
»Sieh mal«, sage ich. »Wir spielen jetzt schon fast einen Monat lang Verstecken. Ich weiß, dass ich es leid bin. Ich denke mir, du vermutlich auch.«
»Das hört sich so an, als wolltest du einen Deal mit mir machen.«
»Nein, ich möchte die Sache einfach hinter mich bringen.« Ich ziehe die Browning, jage zwei Kugeln in ihn und werfe mich hinter einen umgestürzten Tisch. Ungeachtet der fast perfekt ins Ziel gehenden Kugeln stellen diese nur eine Version von »Hey, wie geht’s dir?« dar. Sollten sie eine Beule in Washingtons Abwehr schlagen, wäre ich überrascht.
Ich höre das laute Krachen von berstendem Holz, und die Hütte bebt. Ein gewaltiger Riss fährt durch den Fußboden und zerreißt den Untergrund in zwei Hälften. Ich springe zur Seite und jage einen weiteren Schuss los. Das waren drei. Ich möchte mich ungern verzählen.
Washington beschwört einen lila Feuerball und wirft ihn nach mir. Er hat diesen Scheiß auch schon im Sumpf probiert. Hab dabei auf die harte Tour gelernt, wie ich damit umgehen muss.
Ich hole eine Faust voll Pulver aus dem Beutel am Gürtel und werfe das Zeug zwischen uns, wobei ich darauf achte, so viel wie möglich davon auf die am nächsten liegenden Leichen zu streuen.
Der Zauberspruch im Pulver funktioniert prima. Er wird mir zwar einen Scheiß nützen, wenn Washington das gute Geschirr auspackt, aber wir sind ja auch erst in der Aufwärmphase. Der Feuerball verpufft, als er die Linie aus verstreutem Pulver überquert.
Wir könnten das den lieben langen Tag fortsetzen, aber ich bin wirklich nicht in Stimmung. Ich habe noch nicht zu Mittag gegessen, und es trennen mich zwanzig Meilen von den nächsten Tacos.
Ich führe eine Finte nach links aus und jage zwei weitere Kugeln los. Das macht fünf. Er hebt mit Gedankenkraft einen Tisch hoch und wirft ihn nach mir. Ich ducke mich, und das Manöver bringt mich ihm näher. Ich möchte ja nicht, dass es zu leicht wirkt.
Noch mehr Pistolenschüsse. Die Knarre strahlt jedes Mal ein Gefühl von verletztem Stolz aus, wenn ich absichtlich danebenschieße. Sieben Schuss insgesamt. Es wird Zeit, die Sache zu Ende zu bringen.
Ich ducke mich unter einem geworfenen Stuhl hindurch und krache voll in Washington hinein. Im Handumdrehen hat er seine Hand um meinen Hals geschlossen.
Er rammt mich heftig an die Wand. Allmählich denke ich, dass es vielleicht ein Fehler war, und hoffe, dass der auf den Leichen verstreute Zauber seine Arbeit verrichten wird.
»Dachtest du, du könntest mich mit einer Kanone umbringen?«, fragt Washington. »Du bist schwach. Und es wird mir Freude bereiten, deine Seele zu naschen.«
Ich erzeuge einen krächzenden Laut. Es ist das Beste, was ich unter den Umständen hinkriege.
»Möchtest du etwas sagen, mein Junge?« Ich nicke, und er lockert den Griff ein wenig.
»Hab dich!«
Er erstarrt, als er die Mündung der Browning seitlich an den Schädel gedrückt spürt.
Ich bin den vergangenen Monat lang auf Abstand geblieben, weil mir keine andere Möglichkeit eingefallen ist, ihn auszuschalten. Ich musste dicht genug an ihn herankommen und in dem Moment schneller sein, wo er abgelenkt war. Und ich brauchte Hilfe, um das durchzuziehen. Wie nett von ihm, ein paar Leichen für mich herumliegen zu lassen.
Die kopflose Leiche hinter ihm drückt ab, und Kugel Nummer acht – aus Silber und Gold hergestellt, mit den eingravierten Symbolen aller Familien der Loa versehen: Ghede, Rada, Kongo, Petro, Nago, und schließlich gesegnet von Baron Samedi und Maman Brigitte persönlich – pustet Washington den Kopf von den Schultern.
Die Leiche kippt um, und grüne Flammen schießen aus dem Halsstumpf. Das Feuer breitet sich schnell aus, und ich reiße seine Hand von meinem Hals, um zu verhindern, dass ich zusammen mit ihm verschlungen werde. Diesmal stirbt er wirklich.
Bald ist er nur noch ein verwelktes Bild, das matt leuchtet wie vom Wind getriebene Kohlenfetzen und dann ganz verschwindet.
Kapitel 2
Es hat keinerlei Sinn, hier sauberzumachen. Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte. Es werden bald weitere Trooper eintreffen, und ich möchte mich lieber nicht aus dieser Szene herausschwatzen müssen.
Ich lasse den Truck draußen stehen. Er ist gestohlen, und Washingtons Caddy gefällt mir ohnehin besser. Ist ein guter Schlitten, und ich belege ihn mit einem Seht-mich-nicht-an-Zauber und wende mich nach Norden, Richtung New Mexico. Etwa zehn Meilen weiter sehe ich eine Kolonne State Trooper, die den Highway herabgebraust kommen.
Ich möchte derzeit gar nicht gern in ihren Schuhen stecken. Sie werden eine Schippe brauchen, um alle Reste einzusammeln. Ich fahre seitlich ran, um ihnen Platz zu machen, und sehe ihnen im Rückspiegel nach, bis sie verschwunden sind. Und in dem Augenblick geht das große Zittern los.
Man sollte denken, dass ich inzwischen daran gewöhnt bin, nach lebenslangem Umgang mit den Toten, nach Jahren, in denen ich meine Kunst entwickelt und Grauenhaftes gesehen habe, schlimmer noch als das, was Washington in der Kneipe dort unten an der Straße angerichtet hat. Dass es mir nicht mehr so an die Nieren geht.
Dem ist jedoch nicht so.
Ich steige aus und erbreche mich am Straßenrand. Leichen verkrafte ich. Tote verkrafte ich. Was er jedoch dort unten getan hat, was er mir hätte antun können, falls ich es verpfuscht hätte!
Ich setze mich wieder ins Auto, wische mir den Mund mit einer zerknüllten Karte ab und fahre weiter. Packe diese ganzen Gedanken und schiebe sie in den Hinterkopf, wo sie mir nicht mehr in die Quere kommen.
Ich überquere die Grenze nach New Mexico etwa eine Stunde später. Komme gut voran und fahre noch vor Sonnenuntergang nach Carlsbad hinein. Finde am Stadtrand, neben dem College, ein Hotel. Zwölf Zimmer mit Kabelfernsehen, drahtlosem Internetzugang, Café und Lebensmittelladen gleich nebenan. Ich besorge mir in dem Laden eine Flasche Johnnie Walker Red.
Ich erblicke auf dem Weg in mein Zimmer ein paar Wanderer, ungebundene Geister, die nicht auf einen bestimmten Ort begrenzt sind. Die meisten von ihnen sind Traumapatienten aus dem Krankenhaus in der Nähe. Verbrennungen, Autounfälle, Schussverletzungen. Yeah, ich treibe mich mit echt coolen Kids herum.
Geister umschwirren mich wie Motten eine Flamme. Ich kann sie sehen, und sie können mich sehen. Sie hängen wie Groupies in meiner Gesellschaft ab. Ich verstreue eine Hand voll Sonnenblumenkerne vor der Zimmertür und pappe ein paar Klebezettel mit Palindromen an den Türpfosten. Um die Geister wirklich loszuwerden, müsste ich aber mindestens eine tote Katze ans Fenster nageln, doch das erschien mir immer schon ein bisschen extrem.
Sie halten vor der Tür an, zählen die Sonnenblumenkerne, lesen die Palindrome rückwärts und vorwärts. Wiederholen das in einem fort wie gute kleine Zwangsneurotiker. Ich schließe vor ihren leeren Gesichtern die Tür.
Ich dusche und spüle mir dabei den Schweiß und Staub herunter. Da unten in der Kneipe bot mir das Adrenalin den Treibstoff, und ich hab erst bemerkt, dass Washington mich ganz schön in der Gegend herumgeschleudert hat, als ich schon zehn Meilen weit entfernt war. Prellungen, Schnitte und eine Rippe, die sich anfühlt, als wäre sie mit dem Vorschlaghammer bearbeitet worden. Pflaster kümmern sich um die schlimmsten Schnitte.
Die Prellungen sind schwer zu erkennen. Der größte Teil meines Körpers ist bedeckt von Tätowierungen. Vom Hals bis zu den Hand- und Fußgelenken. Schutzzauber und Sigillen. Symbole in toten Sprachen, die Gefahren abwehren, die Aufmerksamkeit anderer schwächen. Mir helfen, mich auf die Magie zu konzentrieren. Habe vor Jahren angefangen, sie zu sammeln, und ergänze meine Sammlung laufend weiter.
Ich habe eine Tätowierung, die wie ein Strahlenkranz in einem Auge aussieht und magische Angriffe auf meine Gedanken abwehrt. Dann eine von einem Gürteltier, die richtig gut vor Schusswaffen schützt. Nützt bloß einen Scheiß gegen Baseballschläger. Habe das in einer Gasse in Philadelphia auf die harte Tour gelernt.
Habe auch einen fliegenden Krähenschwarm, der sich von einer Schulter zur anderen über die Brust zieht. Ich kann mir das im Spiegel nicht allzu lange ansehen. Sie bewegen sich in einem fort. Krieg ich Kopfschmerzen von.
Verglichen mit mir trägt Der illustrierte Mann nur ein Arschgeweih, das er einer Yoga-Mutti aus Orange County abgezogen hat. Ein Flecken auf dem linken Unterarm ist bei mir frei von Tätowierungen, aber mit kleinen Narben bedeckt. Viele meiner Zauber benötigen Blut, und man findet nicht immer einen schwarzen Widder, wenn man ihn gerade braucht.
Ich öffne die Flasche Johnnie Walker und gieße etwas in ein Glas, das zu meinem Schutz fürsorglich gesäubert wurde. Ich setze mich auf den einsamen Stuhl im Zimmer, einen Lehnstuhl, der sich nur teilweise zurückklappen lässt. Fühle mich wie zu Hause.
Was es im Großen und Ganzen auch ist. Es fällt mir nie leicht, sehr lange am selben Ort zu bleiben. Wurzeln sind nichts, was ich gern schlagen möchte. Hab’s ausprobiert. Hat nicht gut funktioniert. Mein Leben besteht aus einer losen Abfolge von Rastplätzen und billigen Hotels. Klamotten von Walmart und Fundstücke aus Haushaltsauflösungen. Ich habe drei Anzüge von Goodwill, die in den Sechzigern in Mode waren. Die meisten meiner Sachen stammen von Toten. Wie mein neuer Cadillac.
Ich mache es mir gerade mit dem zweiten Glas Whisky bequem, als jemand an die Tür hämmert. Ich ziehe die Browning und blicke durch den Türspion. Hotelangestellte. Ich entspanne den Hahn der Waffe wieder und öffne die Tür für zwei Männer und eine Frau, die ich noch nie gesehen habe.
Dann fällt mir auf, dass einer der Männer keine Hose trägt.
»Oh, ihr seid es. Kommt rein.«
Die Frau und einer der Männer betreten das Zimmer in beinahe königlicher Haltung. Der ohne Hose bewegt sich auf eine halb springende, halb gleitende Weise herein. Gott sei Dank trägt er wenigstens eine Unterhose. Und aus irgendeinem Grund Socken und Schuhe. Ich biete der Dame den Stuhl an und überlasse es den Männern, selbst zu sehen, wohin sie sich begeben möchten. Ich bleibe an der Tür stehen.
Soweit es Loa angeht, sind die Barone Samedi und Kriminel sowie Samedis Frau Maman Brigitte in etwa so hochgestellt, wie man es überhaupt erwarten kann. Sie führen die Ghede-Familie, die für die Toten zuständigen Loa. Loa sind natürlich nicht die einzigen Geister, die so was machen, aber sie gehören zu denen, die besser bekannt sind.
Die Loa ergreifen lieber von ihren Anhängern Besitz und reiten auf deren Körpern wie auf Pferden, statt in eigener Gestalt aufzutreten. Wenn keiner ihrer Anhänger greifbar ist, reicht, wie ich vermute, notfalls wohl eine beliebige Reinigungskraft. Die Wirte erinnern sich an nichts davon. Was für den Typ ohne Hose vermutlich nur gut ist.
»Barone«, sage ich, »Madame. Ich habe euch nicht vor morgen Abend erwartet.«
»Wir kommen, wenn wir es scheiße noch mal möchten«, informiert mich Kriminel in dickem haitianischem Akzent, der aus dem Mund eines Weißen mittleren Alters in enger Unterhose sonderbar klingt. Er knurrt, und Speichel läuft ihm übers Kinn. Er ist immer so.
»Wir hielten es für klüger, früher zu erscheinen, Eric«, sagt Maman Brigitte.
»Stimmt irgendwas nicht?«
»Stimmt nicht?«, fragt Samedi. Verglichen mit Kriminel ist sein Akzent wie der Brigittes fast unauffällig. »Nein, alles ist in Ordnung. Unsere Kinder und Brüder und Schwestern sind zu uns zurückgekehrt.«
Als sie mich anwarben, erklärte mir Samedi, dass er für alle Familien spräche. Washington hatte Loa aus jeder Familie geraubt. Sie persönlich hatten vor Washington keine Angst, waren aber besorgt. Er hatte so viele Loa eingefangen, dass die Fürsten unter ihnen kein Risiko mehr eingehen wollten, ihm letztlich doch in die Hand zu fallen.
»Okay, also …«
»Wir möchten uns bei dir bedanken und dir deine Gebühr auszahlen«, sagt Brigitte.
»Und eine Warnung übermitteln«, ergänzt Samedi.
Ah, ich wusste doch, dass da etwas im Busch ist.
»Scheiß auf seine Bezahlung und seine Warnung«, sagt Kriminel. Er hat die Flasche Johnnie Walker geköpft und schüttet sich den Inhalt in den offenen Mund. Das meiste landet auf dem Hemd. Der Typ sollte froh sein, dass er nichts Teures angezogen hat.
Brigitte greift in ihre Handtasche, bringt einen kleinen Beutel zum Vorschein und reicht ihn mir. Ich öffne ihn. Dublonen.
»Das ist aber nicht, worauf wir uns geeinigt hatten.«
Kriminel geht richtig auf mich los und faucht mich an: »Für wen hältst du dich eigentlich, dass du hier Forderungen stellst?«
Je länger die Fürsten in ihren Wirten bleiben, desto mehr ähneln die ihnen. Der von Kriminel riecht allmählich nach Friedhofserde und Verfall. Ich schiebe ihn von mir weg.
»Ich weiß, dass wir was anderes ausgemacht hatten«, sagt Brigitte. Sie zögert und sieht aus, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. »Aber wir hatten Probleme damit. Kriminel hat zu schnell eingewilligt, und wir waren an die Abmachung gebunden. Wir wissen aber nicht, was eine ›Banküberweisung‹ ist.«
Nun, sie hatten augenscheinlich auch niemanden finden können, der es wusste, geht es mir durch den Kopf.
»Gib jetzt nicht mir die Schuld, Brigitte«, verlangt Kriminel.
»Ich verstehe«, sage ich. Es ist nicht mehr zu ändern. »Ist keine Beschwerde, nur eine Feststellung. Das hier ist mehr als ausreichend.« Ich kenne jemanden in New Jersey, der die Münzen für mich wechseln kann, also stellt das kein Problem dar. »Ihr habt von einer Warnung gesprochen?«
»Sei auf der Hut, wem du dein Vertrauen schenkst«, sagt Samedi.
»Oh, es ist eine von diesen Warnungen!« Manche Dinge drücken sich gern geheimnisvoll aus, andere können gar nicht anders. Und manche sind durch alte Gesetze darauf festgelegt, sich nur in mancher Hinsicht geheimnisvoll auszudrücken, zum Beispiel bei Prophezeiungen und Schicksalsfragen. Sieht so aus, als ginge es hier um einen dieser Fälle.
»Ich wünschte, wir dürften mehr sagen«, erklärt Brigitte. »Wir mögen dich.« Sie blickt zu Kriminel hinüber, der mit dem Scotch fertig ist und jetzt mit dem Shampoo vom Abstellregal im Bad weitermacht.
Er wirft ihr einen finsteren Blick zu. »Scheiß auf ihn!«, brüllt er. »Zur Hölle mit ihm!«
»Na ja, Samedi und ich mögen dich«, korrigiert sie.
»Wir sähen nur ungern, wenn etwas Unglückliches geschähe«, sagt Samedi, »was uns einen unserer begabtesten Freunde kostet. Also sei bitte vorsichtig.«
»Können wir jetzt gehen?«, fragt Kriminel. »Ich finde hier nichts mehr zu trinken.« Gut, dass er die Minibar nicht bemerkt hat. Sein Hemd und Gesicht sind mit Shampoo, Scotch und Rasiercreme vollgekleckert. Mir tut der Typ leid, den er übernommen hat. Er wird morgen früh einen scheußlichen Kater haben.
»Ja«, sagt Samedi. »Du hast dein Geld erhalten, und wir haben dir unsere Warnung übermittelt.«
Kriminel ist als Erster zur Tür hinaus und brummelt dabei etwas von schwarzen Gockeln. Samedi folgt ihm auf dem Fuße, doch Brigitte zögert an der Schwelle, dreht sich zu mir um und legt mir eine Hand auf die Wange. Sie sucht in meinem Blick nach etwas.
»Sei wirklich auf der Hut. Dinge wurden bereits in Gang gebracht, aber deine Rolle wartet noch auf ihren Einsatz. Es beginnt heute Nacht.«
Was ist wohl so schlimm, dass sie mir persönlich eine Warnung überbringen? Und Kriminel dazu bewegen, dass er sie begleitet?
Ich schließe die Tür hinter ihnen und frage mich gerade, was Brigitte gemeint hat, als das Telefon klingelt.
Ich starre es an, als wäre es eine Klapperschlange. Zufälle muss man mit der Lupe suchen, soweit es um Magie geht. Ich warte darauf, dass es aufhört zu klingeln und sich die Voicemail des Hotels einschaltet. Da muss sich jemand verwählt haben. Niemand weiß, dass ich hier bin.
Und ich meine wirklich niemand. Ich habe so viele Weiterleitungszauber in meine Haut integriert, dass es schon an ein Wunder grenzt, wenn ich mich selbst auf der Landkarte finde. Sicher, man kann mich aufspüren, aber es ist nicht einfach.
Es klingelt fünf Mal, zehn, zwanzig. Ich ziehe den Telefonstecker aus der Dose. Es klingelt weiter.
Das hatte ich befürchtet. Es ist einer von diesen Anrufen.
Wir schwingen uns in einen Rhythmus ein, das Telefon und ich. Es klingelt. Ich reagiere nicht. Ich kann das die ganze Nacht machen. Ich lasse es klingeln und kippe ein paar weitere Drinks.
Ein Nachbar hämmert an die Wand, und ein gedämpftes Gebrüll fordert mich auf, endlich an das verfluchte Telefon zu gehen. Ich lasse es noch ein wenig weiterklingeln.
Je länger das so geht, desto angefressener bin ich. Jemand hat sich große Mühe gegeben, mich aufzuspüren. Ich habe eine Voicemail-Nummer, die ich alle paar Tage abfrage, ob sich Klienten gemeldet haben oder Jobs angeboten wurden. Die ist leicht zu finden.
Nachdem das Telefon eine halbe Stunde lang geklingelt hat, gehe ich endlich ran, sage aber nichts.
»Hallo Eric«, sagt die Stimme am anderen Ende. Leise und zögernd. »Ich weiß, dass du da bist.«
Das ist mal eine Stimme, die ich lange nicht gehört habe. Sinnlos, das zu leugnen. »Ist eine Weile her, Alex. Wie viel, zehn Jahre?«
»Fünfzehn.«
»War es schwer, mich aufzuspüren?«
»Yeah. Du bist nicht leicht zu finden.«
»Gut. So soll es auch sein.« Ich lege auf. Es klingelt schon wieder, ehe der Hörer auf der Gabel liegt.
Weiteres Klingeln. Weiteres Geschrei des Nachbarn.
Da kann ich genauso gut mit ihm reden. Es läutet sonst in einem fort. Ich nehme ab. »Ist ja gut, ich gebe auf. Was gibt es?«
Einen Taktschlag lang bleibt es still, dann: »Lucy ist tot.«
Ich möchte fragen: »Lucy wer?« Ich weiß jedoch, von wem er spricht. Ich habe meine jüngere Schwester nicht mehr gesehen, seit ich Los Angeles verlassen habe. Hat Alex recht? Ist es fünfzehn Jahre her? Damit wäre sie wie alt gewesen? Zweiunddreißig?
»Was ist passiert?«, frage ich.
»Es tut mir leid«, sagt er.
»Alex, was zum Teufel ist passiert?«
Eine Pause tritt in der Leitung ein. Wenn er erwartet, dass ich heule und mit den Zähnen klappere, wird er lange warten.
»Ermordet«, sagt er. »Etwas hat sie zu Hause angegriffen.«
»Etwas? Damit meinst du vermutlich kein Tier.«
»Nein. Obwohl die Cops es behaupten. Sie wissen nicht, wie sie es sonst nennen sollen. Eric, sie wurde zerfetzt. Es war schlimm. Und es stinkt nach Magie.«
»Wann ist es passiert?«
»Vor ein paar Wochen. Hab seitdem versucht, dich aufzuspüren.«
Ich hege nicht den mindesten Zweifel, dass Alex sich womöglich irrt. Lucy war keinesfalls mächtig, aber sie hätte genug gewusst, um sich irgendwelche Schutzzauber für ihr Haus zu kaufen. Sie hätte sich das auch leisten können, sofern sie Erbe und Treuhandfonds nicht durchgebracht hatte, die sie nach dem Tod unserer Eltern erhielt.
Dieses taube Empfinden geht auf den Schock zurück. Ich habe das schon erlebt. Eine Woge der Trauer trifft Anstalten hindurchzubrechen. Ich möchte schreien. Auf etwas einschlagen. Ich vergrabe das Gefühl tief in mir, wo es mich nicht mehr erreichen kann, wo es mir nicht mehr in die Quere kommt. Entweder beherrsche ich es, oder es beherrscht mich.
»Weißt du, wer es war? Oder warum?« Mir bricht nicht einmal die Stimme.
»Nein. Ich habe eine Weissagung probiert, als ich dort im Haus war, aber was immer das war hat seine Spuren richtig gut verwischt. Ich frage mich jedoch …«
»Was?«
»Na ja, ich weiß, dass es lange her ist, aber vielleicht Boudreau? Deshalb bist du doch damals fortgegangen, nicht wahr?«
»Yeah, deshalb bin ich fortgegangen.« An diesen Namen habe ich seit Jahren nicht gedacht. Hab mir das nicht gestattet. Hab’s hinter mir gelassen, nie zurückgeblickt.
»Na?«
»Warte einen Moment. Ich überlege.«
Ich habe L. A. eilig verlassen. Hab niemandem erzählt, dass ich fortgehen würde, aber alle müssen gewusst haben, warum ich verschwunden bin. Ich hatte einen Kerl namens Jean Boudreau umgebracht. Ich war so überrascht wie alle anderen auch, als es geschehen war. Damals war ich noch grün hinter den Ohren. Zornig. Habe seitdem viel gelernt.
Er hatte eine Bande angeführt, die mit magischen Typen Scheiße baute. Hatte dabei einige mächtige Magier auf seiner Seite. Eine Menge Leute sind damals sauer geworden, als ich ihn umbrachte.
»Nein«, sage ich. Er kann es nicht gewesen sein. »Das denke ich nicht. Hast du jemals von einem Ben Duncan gehört? Ein Schwarzer. Vermutlich inzwischen in den Fünfzigern. Hat für Boudreau gearbeitet.«
»Aus dem Schlamassel hab ich mich rausgehalten, Mann. So gut, wie es irgendjemand von uns konnte.«
»Schlau von dir. Er stand ganz weit oben in der Nahrungskette. Hat mich geschnappt, nachdem es passiert war. Hat mich vor die Wahl gestellt. Ich verpisse mich, oder er bringt mich um. Auch Lucy und so ziemlich jeden, den ich kenne.«
Die Stille in der Leitung dehnt sich lange.
»Na, das erklärt vieles«, findet Alex, auch wenn etwas in seiner Stimme durchklingen lässt, dass damit nichts entschuldigt ist.
Ich drücke mir die Handballen auf die Augen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darauf einzugehen.
»Er hätte keinen Grund gehabt, irgendwas zu unternehmen«, sage ich.
Ich versuche, das wie einen beliebigen Job zu behandeln, aber meine Selbstbeherrschung steht auf brüchigem Grund.
»Wo steckst du gerade?«, fragt Alex.
»New Mexico.«
Ich hatte lange keinen Kontakt mehr mit Lucy gehabt. Unsere Eltern sind schon lange tot, und ich habe nie etwas von sonstigen Familienmitgliedern gehört.
Scheiße! Jemand muss sich um die Sache kümmern. Die Beerdigung in die Wege leiten.
Wie stelle ich das an? Ich gehe nicht auf Beerdigungen. Verdammt, ich gehe nicht mal auf Friedhöfe! Ich treibe mich mit echten Toten herum. Niemand stirbt auf einem Scheißfriedhof.
Mir wird schwindlig, und ich werde kurzatmig.
»Beerdigung. Ich muss … Scheiße, Alex, ich muss eine Beerdigung organisieren!« Das Zimmer legt los und dreht sich um mich.
»Ist schon okay«, sagt Alex. »Schon erledigt. Sie ist bei deiner Mom und deinem Dad. Ich hab mich darum gekümmert.«
Auf einmal bin ich sauer auf Alex. Ich hätte das tun sollen! Ich bin ihr Bruder. Ich konnte nicht für ihre Sicherheit sorgen, als ich dort war, und ich konnte nicht für ihre Sicherheit sorgen, indem ich fortging. Das Mindeste, was ich hätte tun können, das Mindeste, was Alex mir hätte ermöglichen können, war, ihre verdammte Beerdigung zu organisieren.
Waren viele Menschen gekommen? Ich weiß nicht mal, wer ihre Freunde waren. War sie mit jemandem zusammen gewesen? Hatte sie geheiratet? Heilige Scheiße, was, wenn sie Kinder hat?
Ich reiße mich zusammen. Hole tief Luft.
»Okay, danke. Ich bin in … Scheiße, gib mir zwei Tage Zeit. Wo kann ich dich treffen?«
»Ich hab eine Kneipe in Koreatown. Ich bin dort jeden Tag.« Er nennt mir die Adresse an der Normandie Avenue und seine Telefonnummer.
Ich weiß nicht recht, wer von uns beiden erstaunter ist. Er darüber, dass ich dort auflaufen werde, oder ich, dass er ein Geschäft hat. Als ich Alex zuletzt sah, widmete er sich Trickbetrügereien in Hollywood, wo er seine Opfer mit Hilfe von Magie um ihre Knete erleichterte. Jesus, was hat sich wohl sonst noch verändert?
»Ich hab einen Rausschmeißer«, erklärt er. »Sag ihm einfach, dass du mich sehen willst. Er wird dich einlassen.«
»Klingt nach einer vornehmen Bude«, sage ich.
»Ich halte mir Gesindel gern vom Leib.«
»Wir sehen uns dort.«
Ich lege auf und denke zu spät daran, dass ich keine meiner Fragen bezüglich Lucy gestellt habe. Ich würde ihn ja zurückrufen, aber das war kein Anruf der Sorte, wo die Rufnummer übermittelt wird. Ich versuche, meinen Atem wieder in den Griff zu kriegen, und kämpfe gegen den Drang an, das Telefon quer durchs Zimmer zu schleudern. Mache es aber trotzdem.
Es heißt, man könne nie nach Hause zurückkehren. Werde wohl bald herausfinden, ob das stimmt.
Kapitel 3
Die frühe Morgensonne bleicht die Landschaft. Gestrüpp, Erde. Meilenweit nur weitere Meilen. Irgendwie ein Anblick, der einen in den Wahnsinn treiben kann. Ich bin erschöpft und sehe danach aus. Hab die Nacht damit zugebracht, mir Szenarien auszudenken und irgendeinen Plan zu entwickeln. Doch es sind zu viele Unbekannte. Alles, was über »Sieh zu, dass du L. A. erreichst« hinausgeht, ist ganz schön sinnlos. Ich probiere es trotzdem weiter.
Die Wüste ist auch nicht hilfreich. Alle haben mir erzählt, es wäre eine trockene Hitze, vom Typ am Motel-Empfang bis zu der Frau, bei der ich mir einen Kaffee gekauft habe. Ja, klar doch, als ob das helfen würde!
Wie ein Typ, den ich aus Texas kenne, so gern sagt: »Leckt mich doch alle mal.«
Ich bin kein Fan der Wüste. Weder der Hitze noch der Trockenheit oder der Magie.
Die meisten von uns haben nicht genug Macht, um den Furz eines Affen anzuzünden, geschweige denn einen Feuerball zu werfen, also zapfen wir das örtliche Potenzial an. So wie das Aroma eines bestimmten Bodens in Weintrauben hineinsickert, so sickert der Charakter einer Landschaft auch in die Magie hinein.
Die Wüste schmeckt trocken, wie Staub und Wind. Luftzauber fallen hier leicht. Wasserzauber erfordern schon etwas mehr Mühe. Fahr zu den Everglades hinunter, und es ist schon eine ganz andere Geschichte. Da unten ist alles wucherndes Grün und nasser Lehmboden. Das verrückte Wachstum und die Tödlichkeit des Sumpfes sind ein perfekter Nährboden für Pflanzenmagie, Fruchtbarkeitsmagie, Todesmagie.
Ich fahre zur 82 hinauf und halte mich nach Westen, nach Alamogordo und dem Holloman-Luftwaffenstützpunkt. Die Magie schmeckt nach Flugbenzin und Öl, heißem Metall und Ordnung. Dieses Gefühl hält sich, bis ich White Sands ein gutes Stück hinter mir gelassen habe.
Jede Stadt ist anders. Ihre Menschen, ihre Geschichte prägen den Charakter. New York ist schwer wie Mauerstein und Mörtel, metallisch wie Hämmer. San Francisco ist dunkel und vielschichtig wie Schokolade in Goldfiligran. Vegas schmeckt nach Verzweiflung.
Ich hab vergessen, wie L. A. schmeckt. Es verändert sich. Reißt sich ein, baut sich neu auf. Erneuert sich tausendmal an einem einzigen Tag. Ein Block verströmt die Gewichtigkeit der Kabbala, der nächste den Staub Afrikas. Geh zwei Schritte weiter, und du findest dich tief in Aztekenmagie wieder, wie mexikanische Einwanderer sie mitgebracht haben, vermischt mit den nicht ganz so alten, aber nicht minder machtvollen Illusionen Hollywoods.
Städte werden zu Countys, die zu Staaten werden. Ich pfeife mir wegen des gestrigen Kampfes was gegen Schmerzen und Entzündungen rein. Was die Prellungen angeht, fühle ich mich besser, aber der Magen randaliert. Mit jeder Meile, die ich näher an Zuhause bin, wird das Bedürfnis stärker umzukehren.
Ich fahre weiter.
Ich sehe die ersten Schreine am Straßenrand. Wie ich sie schon in Juarez gesehen habe oder in Texas, näher an der Grenze. Sind der Santa Muerte geweiht, einer Skelettversion der Jungfrau Maria. Schutzpatronin der Drogendealer und Killer. Ich bin ihr noch nicht persönlich begegnet, hab aber schon das eine oder andere gehört. Sie hat eine Menge Anhänger. Nicht nur unter den Narcos, sondern auch bei den Familien in Kriegsgebieten, da, wo zwei Typen einfach in einen Club spazieren, zwanzig Leute umnieten und in Ruhe wieder gehen können.
An solchen Orten kannst du dich drauf verlassen, dass sie den Tod anbeten.
Als ich Arizona erreiche, komme ich an einem weiteren Schrein am Seitenstreifen einer unübersichtlichen Kurve vorbei, wo verwelkende Blumen zu Füßen des Skeletts liegen. Die meisten, die ich bislang gesehen hab, waren aus Holz geschnitzt und etwa halb lebensgroß gewesen. Dieses Skelett hier ist mehr als einen Meter fünfzig lang, und die Knochenhände lugen aus den Ärmeln eines prunkvollen Hochzeitskleides. Der Schädel bleibt durch einen hauchdünnen Schleier hindurch erkennbar.
Ich blicke in den Rückspiegel, sobald ich vorbei bin, und ich könnte schwören, dass das Ding den Kopf dreht und mir nachblickt.
Nicht lange, nachdem ich die Grenze Kaliforniens überquert habe, halte ich am Chiriaco Summit oberhalb von Indio. Tanke nach, strecke mich, kippe ein paar Red Bulls. Seit ich Carlsbad verlassen habe, habe ich nur noch angehalten, um zu tanken und zu pissen. Die Sonne geht allmählich unter, und ich kämpfe mit der Erschöpfung.
Ich schnappe mir im Diner neben dem George-Patton-Museum einen verbratenen Burger. Das Museum ist ein schlichtes Gebäude, umgeben von Panzern aus dem Zweiten Weltkrieg, die für Ausbildungszwecke benutzt wurden. Sie hocken auf Schotter und Gestrüpp, und Unkraut wächst an ihren Laufketten empor.
Sind nicht viele Menschen in diesen Panzern gestorben, aber ein paar schon. Gespenster in Panzerfahrermonturen, die an ihre Fahrzeuge gebunden sind. Hocken auf den Türmen, lehnen an den Ketten, betrachten mich.
Ich winke ihnen zu, und einer von ihnen zeigt mir den Stinkefinger. Mir sind Gespenster allemal lieber als Wanderer. Sie stecken fest. Sind an ein Haus, ein Auto, einen Flecken auf der Straße gebunden. Diejenigen, die nicht weitergezogen sind und nicht wegkonnten.
Natürlich sind Gespenster meist viel stinkiger. Wie würde es dir gefallen, ein paar hundert Jahre dieselben vier modrigen Wände anzustarren, die jemand um dich gebaut hat, damit du dort stirbst?
Ich lasse die Gespenster zurück und fahre nach Indio hinein. Der Eldorado gleitet über den Freeway 10. Der tiefe Bass des Achtzylinders kollert kontinuierlich vor sich hin, und die Städte fließen vorbei. Die Magie wechselt von einem Ort zum nächsten. Ein Menü der Kostproben bei achtzig Stundenmeilen.
Mit offenem Verdeck und dem Wind in den Haaren kann ich meine tote Schwester beinahe vergessen. In den Kreisen, in denen sich unsere Familie bewegte, nannte man Lucy immer »speziell«. Nicht im Sinne von Kindern mit Muskelschwund, obwohl man das der Art, wie sie redeten, nicht wirklich entnehmen konnte.
Die magischen Kreise sind ein engstirniger Haufen. Rasse, Reichtum, Familie, das sind nicht die entscheidenden Kriterien. Wohl aber, ob man die nächste Woche aus den Eingeweiden eines Schweins vorhersagen, jemanden mit einem Stück Schnur verfluchen oder den Mond herabrufen kann wie in dem Song von »Man«.
Lucy konnte mit knapper Not einen Münzwurf beeinflussen. Das hatte sie zwar den meisten Leuten mit dem Talent voraus, beschränkte sie aber trotzdem auf die unterste Stufe.
Ich würde nicht so weit gehen, sie als Enttäuschung für unsere Eltern zu bezeichnen, aber sie war das schwarze Schaf. Mom und Dad hatten Macht im Überfluss. Etwas davon ging auf mich über. Fast nichts davon auf Lucy. Obwohl sie hartnäckig übte. Meinte immer wieder zu mir, eines Tages würde sie diesen Münzwurf präzise hinbekommen und es mir zeigen. Dazu kam es nie.
In Riverside halte ich an, um zu Abend zu essen. Von hier aus ist der ganze Freeway ein Parkplatz. Mir bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten.
Es ist hart, wenn man als fast normale Person in der Gesellschaft Zauberkundiger aufwächst. Lucy war das Problemkind, über das wir nicht reden konnten. Nicht weil sie uns peinlich gewesen wäre, sondern weil sie zu schwach war, um sich zu verteidigen. Wir leisteten gute Arbeit dabei, sie zu verstecken. Die meisten Leute wussten nicht einmal, dass ich eine Schwester hatte. Magie und Geld erweisen sich als hilfreich, um eine Menge Sünden zu verbergen.
Der Verkehr geht von einem Tsunami zum üblichen Wellenschlag des Meeres zurück, und ich stürze ein paar weitere Red Bulls hinunter. Müssten vorhalten, bis ich in L. A. einen Platz finde, mich hinzuhauen.
Nach weiteren zwei Stunden geht es einfach nicht mehr. Koffein und Guaraná sind nutzlos. Das Bild verschwimmt mir vor den Augen, und ich fahre den Caddy wie ein Blinder. Hätte mir etwas Koks besorgen sollen. Ein paar Strich davon, und ich könnte diese Mühle bis nach Hawaii fahren.
Stattdessen halte ich in einer Nebenstraße in Pomona und sage mir, dass es nur ein Nickerchen wird. Ein paar Stunden, und ich bin wieder unterwegs.
Sieben Stunden später erwache ich aus einem Traum von meinen Eltern, die in unserem Haus schreiend verbrennen. Lucy stürmt zu ihnen hinein.
Ich habe sie damals aufgehalten. Hab sie gerettet, was mir bei unseren Eltern nicht gelang. In dem Traum komme ich jedoch zu spät, und sie verbrennt mit ihnen.
Kapitel 4
Das Motel ist voller Geister. Ist eine gute Sache, auch wenn das merkwürdig klingt.
Oft können sie lästig werden. Dir das Blickfeld überladen und Hintergrundrauschen erzeugen. Sie können jedoch auch zur Tarnung beitragen. Seit Alex’ Anruf frage ich mich, ob meine Weiterleitungszauber noch halten. Magisch ausgedrückt, bietet eine große Gruppe Geister ein ebenso gutes Versteck wie eine Menge lebender Menschen. Je schwieriger es ist, mich zu sehen, desto besser.
»Vierzig Mücken pro Nacht, ob Sie nun die ganze Nacht bleiben oder nicht.«
Die Frau am Empfangstisch trägt ein rosa Babydoll, das ihr um drei Größen und zwanzig Jahre zu klein ist. Haare schlecht gefärbt, Augenbrauen nachgezogen. Eine halb aufgerauchte Marlboro hängt ihr zwischen den Lippen.
Ich reiche ihr ein paar Hunderter. »Ich bin einige Tage lang hier.«
Sie pflückt mir die Scheine aus der Hand. »Einige Tage, hm?«
»Mehr oder weniger.«
Sie reicht mir einen Schlüssel. »Nummer acht, hinten.«
Das Zimmer entspricht weitgehend meinen Erwartungen. Ein echtes Loch. Könnte einen kampfstarken Kammerjäger gebrauchen, aber die Bettwäsche ist einigermaßen sauber. Ist ja nicht so, dass ich hier viel Zeit verbringen werde.
Ich pfeffere ein paar halbherzige Schutzzauber auf die Wände, um die Geister und die Gangs draußen zu halten. Verbringe die nächste Stunde damit, auf und ab zu gehen und mich zu fragen, was ich unternehmen soll, da ich nun mal hier bin. Möchte nicht sofort bei Alex auflaufen. Muss mir erst ein Gefühl für die Stadt verschaffen. Es ist so lange her. Bin hier jetzt ein Fremder.
Ich dusche und verbinde meine Schnittwunden neu. Sie verschwinden so langsam, und die Rippe bereitet mir auch nicht mehr so viele Schwierigkeiten. Fühle mich aber nach wie vor, als hätte ich mehr als eine Runde gegen Tyson hinter mir. Ich starre in den Spiegel und versuche zu erkennen, wie ich mich verändert habe. Versuche mich zu erinnern, wie ich früher ausgesehen hab. Die Haare sind kürzer, und ich hab Gewicht verloren. Die Ringe unter den Augen sind vermutlich dunkler als früher.
Um’s mal ganz ehrlich festzustellen: Ich sehe beschissen aus.
Ich bin nicht mehr in der Wüste. Jeans und Boots weichen einem Anzug und einer Krawatte. Bin beinahe selbst davon überzeugt, ich wäre geschäftlich hier. Dass ich es nur wie jeden beliebigen Job angehen muss, und schon wird mir die Sentimentalität nicht in die Quere kommen.
Ich bin hier, um herauszufinden, wer Lucy umgebracht hat. Und um mich zu revanchieren. Das ist alles. Rein, raus.
Yeah, klar doch.
Ich verwerfe diese Vorstellung schon innerhalb der ersten Stunde, in der ich in der Stadt herumfahre. Manches ist fort, was hätte bleiben sollen, und manches ist geblieben, das man lieber abgerissen hätte. Der Bauernmarkt in Fairfax ist eine riesige Freiluft-Einkaufszeile. Auf dem Hollywood Boulevard wimmelt es von Hipstern. Irgendein Arschloch hat das Ambassador-Hotel abgerissen. Wer zum Teufel hat das für eine gute Idee gehalten?
L. A. pisst auf die eigene Geschichte. Reißt sie ab oder verspachtelt sie, bis man sie nicht wiedererkennt. Verändert sich fortlaufend, versucht ständig, etwas Neues zu werden. Scheitert dabei immer. Eine hässliche Stadt, um darin alt zu werden.
Ich schlucke letztlich die bittere Pille. Wird Zeit nachzusehen, ob sich hier wirklich alles so stark verändert hat, dass ich nicht bleiben kann. Manche Erinnerungen lässt man lieber begraben, statt sie zurückzurufen und dabei zu erleben, wie sie zerstört werden.
Roscoe’s Chicken and Waffle an der Gower Street. Muss herausfinden, ob der Laden noch so gut ist wie in meiner Erinnerung.
Ist er nicht.
Alex’ Kneipe liegt in Koreatown zwischen der Western Avenue und der Normandie Avenue. Brownstone-Gebäude mit vergitterten Fenstern und Bankenhochhäuser. Ladenschilder in koreanischer Schrift sieht man so viele wie englische, und man kann darauf wetten, dass ein Drittel der Menschen, die diese Straßen entlanggehen, die zweitgenannte Sprache kaum beherrschen.