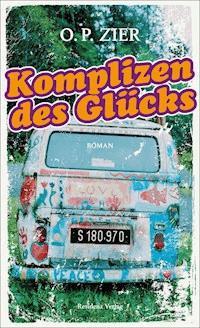O.P. Zier weckt einmal mehr die schlafenden Hunde der Provinz. Die Macht, ihre Marionetten und ein Mord - und alles spricht gegen den Erzähler. Barbara Lochner ist tot, aber wer ist ihr Mörder? Alles spricht gegen Werner Burger, den Erzähler - außer die Figuren seines Romans, die nach und nach freimütig gestehen, sie würden Barbara Lochner am liebsten umbringen. Doch zur Tatzeit wartet nur er am Tatort, um sie mit den verbrecherischen Umtrieben einer von der Politik korrumpierten Bürokratie zu konfrontieren. Eines ihrer Opfer ist der rechtschaffene Erwin Lang, der sich einer Verschwörung auf der Spur wähnt und schließlich geradewegs in der Irrenanstalt landet. Ist Lang vielleicht nur ein Opfer seines Verstandes geworden? Wider Willen wird Burger zum Anwalt von dessen Kampf gegen "das geheime System" und stößt schon bald auf toll gewordene Kleinstadt-Honoratioren, welche die Jahreszeiten neu erfinden wollen ... O. P. Zier siedelt seinen Roman auf der Schattseite einer alpinen Urlaubsidylle an, in der Tristesse zwischen Hochsaison und Hochsaison. Beobachtungsgenau und mit der Unerbittlichkeit eines Ermittlers leuchtet er die Winkel aus, die vom Blitzlicht der Kameras noch nicht erhellt sind. Er erzählt dabei nicht nur einen ungemein spannenden Krimi, sondern auch einen Roman über die Fallstricke des Erzählens, in dem der Autor immer zugleich Täter und Opfer ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
O. P. Zier
Tote Saison
O. P. ZIER
Tote Saison
Roman
Residenz Verlag
Sämtliche Figuren dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2007 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4225-7
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1485-8
Nein, der Charakter eines Mannes ist nicht sein
Schicksal; das Schicksal eines Mannes ist der Witz,
den sich das Leben mit seinem Charakter erlaubt.
Philip Roth, Operation Shylock
I
Eine Tat, auf der Suche nach ihrem Täter, findet – mich?
1
Hätte ich sie bloß umgebracht!
Wäre ich Barbara Lochners Mörder, es spräche nicht mehr gegen mich denn so.
Ich hatte nicht nur kein Alibi und am Tatort meine Spuren hinterlassen, ich war überdies zur Tatzeit nachweislich und unbestritten mit dem Mordopfer dort verabredet gewesen.
Darüber hinaus verfügte ich – nach allem, was zuvor geschehen war – über mehr als genug Gründe für dieses Gewaltverbrechen.
Ich hatte schon die längste Zeit das Gefühl, dass mir auch mein Verteidiger nicht so recht glaubte.
Aber was hieß hier überhaupt Verteidiger! – Wir waren als Kinder und Heranwachsende eng befreundet gewesen. Fritz hatte irgendwie zu der Bande gehört, die aus Alex und mir bestanden hatte. Er war, wie Alex, ohne Vater aufgewachsen, ein Lediger. Seine Mutter war Handarbeitslehrerin in Lend gewesen. Fritz hatte keine Ahnung, wer sein Vater war, aber schon früh hatte er sich in Andeutungen gefallen, dass es sich dabei um einen Baron oder einen Grafen handle. Wir hatten diese Mutmaßungen nicht als abwegig erachtet, denn an Geld hatte es seiner Mama offenbar nie gemangelt. Es schien immer erheblich mehr davon vorhanden zu sein, als mit Strick- und Kochunterricht an einer Hauptschule zu verdienen war. Auch lebten die beiden allein in einem stattlichen, von einem großen, verwilderten Obstgarten umgebenen Haus, das auf mich immer seltsam leer, regelrecht verlassen gewirkt hatte. Fritz verfügte darin über ein randvoll mit den herrlichsten Spielsachen angefülltes Kinderzimmer, in dem er sich jedoch nur selten aufhielt – ganz und gar unbegreiflich für uns Gassenbuben, die jede Minute des Aufenthaltes in diesem Kinderparadies genossen. Doch wie oft hatten wir unseren Freund vergeblich zu überreden versucht, mit uns in seinem Zimmer zu spielen.
Wie faszinierte uns allein die elektrische Eisenbahn, deren Geleise sich in vielen Windungen auf einer großen Holzfaserplatte über den ganzen Zimmerboden schlängelten, an Schranken und naturgetreu nachgebauten Bahnhöfen vorbei, um gleich darauf im Tunnel eines Pappmaché-Berges zu verschwinden.
Leider fand Fritz stets neue Ausflüchte, unser Drängen abzuwehren. Er zog es vor, mit uns an einem Bach im Schlamm zu wühlen, im mit Steinen und Dreck gestauten Wasser selbstgebaute Schiffe auszusetzen und Lagerfeuer zu entfachen; oder auf dem Boden unserer engen, muffigen, aus alten Brettern zusammengenagelten, mit Dachpapperesten gedeckten Hütte auf Obstkisten zu hocken und die hier versteckten und längst feucht gewordenen Zigaretten zu rauchen.
Alex und ich hingen oft der Vorstellung nach, dass Fritz’ Vater, der Herr Baron oder der Herr Graf, eines Tages in Lend auftauchen und auch uns beide reichlich beschenken würde, als engste Freunde seines Sohnes. Fritz selbst schien seinen Vater überhaupt hoch zu Ross zu erwarten. Er zeichnete seit der Volksschule mit Vorliebe Reiter in prächtigen Phantasieuniformen, die an Kavalleristen aus der Zeit der Monarchie erinnerten. Kostümierungen waren die große Leidenschaft unseres Freundes gewesen. Und wenn ich ihn jetzt in seiner Tracht vor mir sitzen sah, durfte ich annehmen, dass sich daran nichts geändert hatte.
Fritz’ hartnäckig wiederholte Behauptungen seiner adeligen Abstammung schienen uns Buben jedenfalls nicht aus der Luft gegriffen. Denn sogar als Kind hatte ich den Eindruck gehabt, als gehe Fritz’ Mutter ihrem Beruf nur zum Zeitvertreib nach. Die mädchenhafte Frau wirkte auf mich im Schulhaus wie eine Besucherin. Lachend und gelöst schwebte sie in ihren in hellen, fröhlichen Farben gehaltenen Kleidern durch die Gänge, als schaue sie auf einen Sprung für ein Tässchen Kaffee und einen kleinen Plausch mit einer Freundin im Konferenzzimmer vorbei. Und wenn wir uns im Schulhaus begegneten, winkte sie mir zu, als sei auch ich zum reinen Vergnügen hier.
Nichts war bei ihr zu entdecken von der verkrampften Ernsthaftigkeit des überwiegenden Teils der übrigen Lehrkräfte in Lend, die wichtigtuerisch mit ihren riesigen Gefängniswärter-Schlüsselbünden durchs Schulgebäude streiften und die vor lauter Verantwortung ständig die Stirnen in Falten gelegt hatten, als wären sie fleischgewordene Ermahnungen an die Kinder, so sauertöpfisch zu werden wie sie selbst.
Und jetzt war Fritz, das magere Bürschchen von damals, dessen Rippen sich unter dem Turnleibchen abgezeichnet hatten wie jene der meisten anderen Kinder in Lend, die während der Sommerferien von der Krankenkasse zum Aufpäppeln nach Italien verschickt wurden, jetzt also war dieses untergewichtige Kerlchen, das dennoch nie sonderlich viel von der Leichtfüßigkeit und offenkundigen Leichtlebigkeit seiner Mutter gehabt hatte, zu diesem behäbigen, gelegentlich verschmitzt schmunzelnden Mann geworden, der den Großteil seiner Zeit mit der Zucht von Rennpferden und auf Pferderennplätzen verbrachte und sich während seiner Anwesenheit in diesem schrecklich kahlen Raum, in dem wir von einem ungerührt geradeaus schauenden Justizwachebeamten beaufsichtigt wurden, immer wieder mit seinem großen, altmodischen Stofftaschentuch, in das mit rotem Zwirn übertrieben verschnörkelt seine Initialen eingestickt waren, den Schweiß von der Stirn tupfte.
Seinen Jägerhut mit dem enormen Gamsbart hatte er bei seiner Ankunft auf die Resopalplatte des Tisches gelegt, wo er sich ausnahm wie eine fremdartige Skulptur. Das Wesen eines Gamsbartes, das wurde mir schlagartig klar, liegt in seiner grotesken Übertriebenheit – eine hilfreiche Erkenntnis für einen des Mordes Verdächtigten! Aber in mir arbeitete weiter das Gehirn eines Schriftstellers und nicht das eines Gewaltverbrechers.
Neben dem Hut hatte Fritz den Schnellhefter mit den Unterlagen zu meinem Fall abgelegt, in die er während unseres ganzen Gesprächs keinen einzigen Blick warf. Dass er sich auch keine Notizen machte, schien mir die schiere Unglaubwürdigkeit meiner hilflosen Unschuldsbeteuerungen noch zu unterstreichen.
2
Eine massive silberne Uhrkette spannte sich in mattem Schimmer über seinen Wanst, und der Trachtenanzug meines Freundes ließ mich denken, dass Fritz wohl sein Leben lang dem Adels-Thema verpflichtet bleiben würde; auch wenn er vermutlich längst herausgefunden hatte, dass sein Vater keineswegs ein auf weitläufigen Besitzungen feudal residierender Baron oder Graf war, sondern ein verschwitzter, alkoholisierter Tanzpartner seiner Mutter, eine Zufallsbekanntschaft, die das lebenslustige, angesäuselte Mädchen auf dem Heimweg nach einem Sommerfest im Lärchenwald umgelegt und geschwängert hatte und danach für die Frau, die womöglich nicht einmal seinen wahren Vornamen kannte, nicht mehr auffindbar gewesen war. Oder es war nach einer Kirchenchorprobe passiert. Allein ich kannte eine ganze Menge Kinder von katholischen Landpfarrern, bei denen die Mütter sich ihr Lebtag lang standhaft weigerten, Auskünfte über die Vaterschaft zu erteilen; und das, obwohl den verhärmten Frauen, die so viel Zeit in kalten, düsteren Kirchen zubrachten und sich dort rheumatische Erkrankungen holten, das quälende Schuldbewusstsein über ihr Leben in der Schande kilometerweit anzusehen war; nicht zuletzt deshalb, weil die Kollegen der Väter ihrer Kinder von den Kanzeln gnadenlos wider die Unkeuschheit wetterten, ledige Kinder verteufelten und den Sünderinnen schlimmste Folgen für die unendlich lange Zeit im Jenseits verhießen.
Jede seiner wenigen Bewegungen zeigte sich unmittelbar in Fritz’ Gesicht, das sich schon unter der geringsten Anstrengung merklich verzerrte. Mir schien einerseits, als hätte er mir erneut signalisiert, dass ich meine Unschuld nicht länger zu beteuern bräuchte, da er nach Lage der Dinge ohnehin von meiner Täterschaft überzeugt sein müsse, andererseits hatte ich den Eindruck, als würde er mir überhaupt nicht zuhören, da die Gefühle unserer Kindheit sein Inneres so sehr in Aufruhr versetzten, dass rationale Überlegungen wenig Aussicht hatten, sich gegen diese mächtige Aufwallung durchzusetzen.
In meiner Verwirrung hatte ich Fritz’ Namen genannt, als es darum gegangen war, einen Rechtsbeistand, einen Verteidiger, namhaft zu machen. Er selbst oder irgendjemand in seiner Kanzlei war daraufhin unverzüglich telefonisch über meinen Fall informiert worden.
Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt längst in jenem tranceartigen Zustand befunden, aus dem ich lange nicht wieder herausfinden sollte. Völlig überwältigt von den Vorgängen rund um meine ganz und gar unerwartete Festnahme und Einlieferung, verstört von der Einvernahme durch die Kriminalbeamten, der erkennungsdienstlichen Behandlung samt Speichelabstrich und erst recht betäubt von der niederschmetternden Vorführung beim Untersuchungsrichter, der mir in sachlichem Ton ein Indiz nach dem anderen präsentiert hatte und dem ich so gar nichts Überzeugendes zu meiner Entlastung entgegensetzen konnte!
Wieder in meine Einzelzelle zurückgebracht, war ich auch schon erschöpft eingedöst und hatte im Halbschlaf plötzlich die Überzeugung gewonnen, von einem Spiel zu träumen, dessen Regeln ich mit der Nennung eines Anwalts zwar noch nachgekommen war, an dem ich meine Teilnahme allerdings so schnell wie möglich ein für alle Mal beenden musste. Wie auch immer: Als real hatte ich das, was mit mir geschah, keinesfalls empfunden. Ganz und gar nicht.
Fritz war mir eingefallen, weil ich seine Kanzlei in der Stadt Salzburg gelegen wusste. Erst später, allein in der Zelle, als ich Fritz bereits nominiert hatte – Hilfe aus einer abenteuerlich-unbeschwerten Kindheit? –, entsann ich mich meiner letzten Begegnung mit Richard Moser.
Wie war das nur möglich, dass ich nicht sofort an die erst vor wenigen Tagen erfolgte Unterredung mit Richard gedacht hatte? Hatte es sich dabei doch um ein Gespräch gehandelt, welches mit dem, was mich nun in diese Lage gebracht hatte, auf das Engste in Verbindung stand!
Erst als ich mit geschlossenen Augen auf der Pritsche gelegen war, hatte ich plötzlich wieder Richards bärtiges Gesicht vor mir gehabt, aus dem mich am Ende unserer Aussprache seine in kaum zu vergessender Eindringlichkeit gesprochenen Worte erreicht hatten: »Damit haben Sie etwas gut bei mir, Herr Burger. Denken Sie daran, wenn Sie einmal Hilfe brauchen.«
Wie konnte es sein, dass mir dieses Angebot nicht augenblicklich eingefallen war, wo ich doch nichts dringender bedurfte als der sachkundigen Hilfe eines versierten Juristen wie Richard Moser? Weil ich mir meiner aussichtslosen Lage keineswegs bewusst gewesen war? Weil der Tatverdacht, die Indizien, die Festnahme für mich alptraumhafte Züge hatten und unendlich weit entfernt waren von jedem nachvollziehbaren Zusammenhang mit meiner Person?
All meinen Anstrengungen zum Trotz gelang es mir nicht, eine auch nur halbwegs plausible Erklärung für diese Gedächtnisschwäche zu finden. Sie hinge doch nicht damit zusammen, dass mir in einem fort ein Satz durch den Kopf ging: »Eine Tat sucht sich ihren Täter – und findet mich?« Dass ich also, anstatt sämtliche Kräfte zu bündeln und auf meine tatsächliche Situation bezogen zu denken, auf das Unfassbare der Verdächtigung, Barbara Lochner ermordet zu haben, geradezu reflexartig und durchaus spielerisch mit Literatur reagierte? Auf Vorgänge mit Poesie antwortete, die meine reale bürgerliche Existenz vernichten konnten!
Ist jemand, der alles, auch die massivste Bedrohung, unverzüglich in Kunst verwandelt, im banalen Alltag überhaupt lebensfähig? Sollte Eva womöglich Recht haben, wenn sie sich gelegentlich weniger als Ehefrau, denn als meine Lebensretterin verstand? – Immerhin: Kaum war sie für zwei Wochen verreist, landete ich auch schon unter dringendem Mordverdacht hinter Gittern.
3
Natürlich hatte ich meine für mich nicht im Mindesten vorhersehbare, weil in meinen Augen völlig grundlos erfolgte Festnahme nach dem ersten Schock nicht ernst zu nehmen vermocht.
Gegen neun Uhr saß ich immer noch beim Frühstück und versuchte mich durch Zeitungslektüre von meiner erneut aufkeimenden Wut auf diese verfluchte Lochner abzulenken, obwohl dieses Kapitel nun ein für alle Mal beendet war und ich endlich wieder zu meiner Arbeit zurückkehren konnte. Doch es wollte mir nicht gelingen, meines Zornes auf die Kulturbeamtin, die Tochter eines früheren Landeshauptmannes von Salzburg, Herr zu werden, von der ich mich am Vortag zum Narren halten, mich bei spätherbstlichem Sauwetter kurzfristig von St. Johann auf eine mehr als siebzig Kilometer entfernt gelegene Baustelle am nördlichen Stadtrand von Salzburg locken – und prompt versetzen hatte lassen.
Und wie groß war vor allem die Wut auf mich selbst! Wie konnte ich nur dermaßen naiv sein und auf so blamable Weise auf die Frau hereinfallen, mit der ich persönlich ausreichend negative Erfahrungen gemacht hatte, um ein für alle Mal gewarnt zu sein! Ganz zu schweigen von dem, was mir gerade in den letzten Tagen im Zuge meiner aufreibenden Nachforschungen von anderen über die Lochner erzählt worden war.
Als ich mir erneut mit einem Schwall heftiger Selbstvorwürfe zuzusetzen begann, kamen zwei Männer die hölzerne Außentreppe herauf und klopften an die Wohnungstür. Sie wiesen sich als Beamte der Kriminalabteilung Salzburg aus und eröffneten mir ohne Umschweife und in unaufgeregtem Ton, dass sie mich zur Befragung auf den St. Johanner Polizeiposten mitnehmen müssten, da ich dringend des Mordes an Frau Barbara Lochner verdächtigt werde.
Die Frau, vernahm ich benommen, als sei mein Kopf von Watte umhüllt, sei gestern gegen 18 Uhr 30 vom provisorisch gesicherten Balkon ihrer im Rohbau befindlichen, im fünften Stockwerk gelegenen künftigen Wohnung in den Tod gestoßen worden.
In Anbetracht der Indizien, die für meine Täterschaft sprächen, solle ich besser gleich Unterwäsche und Toiletteartikel einpacken, da ich anschließend an die erste Einvernahme in Untersuchungshaft genommen werden würde.
Ich spürte, wie mir die Hitze in den Kopf stieg. Gleich darauf hatte ich den Eindruck, als werde mir ein heißes Bügeleisen gegen Wangen und Stirn gepresst. Im Magen machte mir ein flaues Rumoren zu schaffen, das in alle Richtungen auszustrahlen schien und meinen Beinen die Festigkeit entzog, so dass ich mich unverzüglich setzen musste.
Während ich in unserer morgendlich-düsteren Wohnküche fassungslos auf einem Stuhl kauerte, redete einer der beiden Herren auf mich ein. Er belehrte mich offenbar über meine Rechte und machte mich auf verschiedene Einzelheiten der bisherigen Ermittlungsergebnisse aufmerksam. Doch nur Satzteile und einzelne Wörter des Gesprochenen konnten sich gegen den dröhnend lauten Pulsschlag, der in meinen Schläfen hämmerte, behaupten und drangen durch die Benommenheit bis in meine Ohren vor: Hausdurchsuchung angeordnet … welche Schuhgröße … gestern getragene Schuhe … Kleidung … Textilfasern überprüfen … Autoreifen … Spuren … Aussage des Zeugen …
Beim Einpacken der Toilettesachen zitterten meine Hände so stark, dass ich große Mühe hatte, den Reißverschluss des Täschchens auf- und zuzuziehen – und dieses Zittern breitete sich bis in die Oberarme aus, nachdem ich beim Abklingen des ersten Schwächeanfalls gehofft hatte, mich wieder halbwegs gefangen zu haben. Gleich darauf schwankte ich zwischen Lach- und Weinkrampf, wie ich da hilflos im Badezimmer hantierte, während ich mich von den Ermittlern durch die halb offene Tür beobachtet wusste. Geschirr und Frühstücksreste ließ ich auf dem Tisch stehen. Einer der Kripobeamten riet mir, die Warmhalteplatte der Kaffeemaschine auszuschalten und die Butter in den Kühlschrank zu legen. Und trotz meiner Benommenheit registrierte ich, dass er noch einen raschen Blick zum Herd warf, bevor wir die Wohnung verließen.
War es dieses Zeichen der Fürsorglichkeit, aus dem ich plötzlich schloss, dass das Ganze nichts weiter war als ein inszenierter Witz? Denn als ich zwischen den beiden Männern, von denen der eine ein Sakko und der andere ein dunkelgrün gefärbtes Raulederblouson trug, auf einen unauffälligen Mittelklassewagen zuging, war ich davon überzeugt, soeben zum Opfer der Sendung Versteckte Kamerazu werden. – Dass mir das nicht gleich eingefallen war!
Immerhin hatten meine heftigen Auseinandersetzungen mit dem Hofrat Krenn und Barbara Lochner vor noch nicht allzu langer Zeit in der Öffentlichkeit hohe Wellen geschlagen. Der Mordverdacht – lachhaft! Evas USA-Reise mit unserem Schwager Gernotti – sie wäre also ebenfalls nur Teil dieser Inszenierung! Eva, sagte ich mir, habe irgendwann in den letzten zwei Tagen während meiner Abwesenheit die Fernsehleute zur Vorbereitung in unsere Wohnung gelassen, damit ich heute versteckt gefilmt werden konnte. Auch erschien es mir jetzt völlig logisch, dass Barbara Lochner gestern nicht zu unserem Treffen auf die Baustelle gekommen war. Ihr Fernbleiben war die notwendige Voraussetzung der heutigen Inszenierung. Deshalb hatte sie unserer Aussprache auch sofort zugestimmt! Ich dachte in diesen Momenten nicht daran, dass ich es war, der um die Begegnung gebeten hatte. Und vor allem, dass dieser Bitte die Geschichte mit dem Magister Lang vorausgegangen war, ohne die ich ein Gespräch mit der Lochner nie und nimmer gesucht hätte. Wie doch auch das bedrückende Schicksal von Erwin Lang letztlich Richard Moser auf den Plan gerufen und zu seinem Versprechen geführt hatte, mir bei Bedarf beizustehen, nachdem ich ihm in der heiklen Angelegenheit entgegengekommen war, die eine stattliche Anzahl von Honoratioren der jungen Stadt St. Johann in den Abgrund zu reißen drohte, falls auch nur ein Bruchteil dessen publik würde, was mir herauszufinden gelungen war …
An all das dachte ich nicht, weil ich nur noch davon erfüllt war, einer geschickt eingefädelten und sorgfältig vorbereiteten Sache auf den Leim gegangen zu sein.
Zwei vom Fernsehen engagierte Kleindarsteller konfrontierten mich drehbuchgemäß mit Mordverdacht – und schon fiel ich beinahe in Ohnmacht, obwohl ich mir keiner Schuld bewusst war. TV-Klamauk! Also versuchte ich, ein lässiges, überlegenes Grinsen aufzusetzen, um den Eindruck etwas zu korrigieren, in Panik geraten zu sein. Gleichzeitig sah ich mich heimlich nach dem Urheber der Inszenierung um.
Ich rechnete nämlich fest damit, dass sogleich hinter dem Kleinbus, der mit irgendeiner tarnenden Firmenaufschrift versehen und so vor unserem Haus abgestellt war, dass ideal gefilmt werden konnte, einer dieser übervergnügten, toll frisierten Fernseh-Knallfrösche hervorspringen und mich mit herzlichem Dank für meine grandiose Mitwirkung wissen lassen würde, dass alles nur Spaß gewesen sei. Doch nichts von alldem, worauf ich innerlich jetzt vorbereitet war, geschah. Vorerst, wie ich dachte. Ich grinste in Richtung des Kleinbusses, als mir bewusst wurde, dass diese Sequenz als Hinweis, dass ich alles längst durchschaut hätte, ohnehin geschnitten werden müsste. Also tat ich, was von mir verlangt wurde, und nahm im Fond des Wagens neben einem der Beamten-Darsteller Platz, während sich der andere ans Steuer setzte. Als wir losfuhren, flüchtete ich mich in die Vorstellung, dass man die Geschichte natürlich weiter treiben würde, um ausreichend sendetaugliches Material zu sammeln.
Auf der Polizeistation, dem vormaligen Gendarmerieposten, irritierten mich die betretenen Gesichter der Uniformierten, die nicht gespielt wirkten und mit denen die Männer irgendwelche Papiere zusammenrafften und bei unserem Auftauchen sogleich das Weite suchten. Wenn hier versteckt gefilmt werden musste, hätten die doch etwas mitgekriegt. Oder war alles einzig über den Chef der Dienststelle gelaufen?
Den Beamten jedenfalls war anzusehen, dass sie peinlich berührt waren von dem, was mit mir geschah. Immerhin hatte ich vor gar nicht allzu langer Zeit selbst hier gedreht. Für eine Fernsehdokumentation hatte ich in zahllosen Anläufen eine Aussage des Bezirkskommandanten zum Problem Alkohol im Straßenverkehr aufgenommen und später bei der Nachbearbeitung der Bänder mit meinem Bildmeister viel Zeit und Energie aufgewendet, um in das Gestammel des Mannes einen halbwegs nachvollziehbaren Rhythmus hineinzuzaubern und künstlich etwas herzustellen, das für die Dauer dieses 15-Sekunden-Sagers verdammt nahe an eine flüssige Rede herankam, und wofür mir der Beamte eigentlich auf ewige Zeiten Dankbarkeit schuldete, da er dem Fernsehpublikum mit einer Eloquenz in Erinnerung bleiben würde, die er nie in seinem Leben besessen hatte. Zweimal war die im Funkhaus gefürchtete cholerische Veranlagung meines Cutters mit ihm durchgegangen und der Mann mit seinen Zigaretten und dem Feuerzeug in der Hand fluchend in die Studiokantine gerannt, wo ich ihn jedes Mal aufs Neue dazu überreden musste weiterzumachen, während er mich beschwor, diesen verfluchten O-T einfach wegzulassen und mir mit einem simplen Sprechertext zu behelfen, auch wenn ich ihm noch so oft sagen möge, dass mir dieser dann die gesamte ausgeklügelte Komposition meines nur aus Originaltönen montierten Filmes ruinieren würde.
Bis zum Beginn der Einvernahme war ich also davon ausgegangen, dass man mich zum späteren Gaudium der Fernsehzuseher zum Narren hielt. Erst als mir einer der beiden Kriminalbeamten diese schrecklichen Fotos vorlegte, wurde mir schlagartig klar, dass ich mich in einem sehr realen Alptraum befinden musste. Keine Unterhaltungsredaktion ginge so weit, solche Bilder nachzustellen!
Es handelte sich um Farbfotos vom Tatort. Bei Dunkelheit aufgenommen, bildeten die Schneeflocken irritierend unscharfe, fast schmetterlingsgroße weiße Flecken. Umstellt von den Täfelchen der Spurensicherung, sah ich einen offenkundig leblosen Körper im Dreck jener Baustelle liegen, vor der ich am Vortag mit zunehmender Wut herumgestapft war. Und es handelte sich tatsächlich um Barbara Lochner, die da so entsetzlich hilflos auf dem Bauch im Bauschlick lag. Bei einem Fuß, der unnatürlich verdreht war, fehlte der Schuh. Die Strumpfhose der Frau war an mehreren Stellen zerrissen. Der über die Knie gerutschte Rock verdreckt. Der Kopf lag so neben einem Bottich, als habe sich eine Verdurstende mit allerletzter Kraft dorthin geschleppt, bevor sie kurz vor ihrem Ziel doch das Bewusstsein verloren hatte.
Der vernehmende Beamte schob mir noch weitere Fotos über den Tisch, während mich sein Blick fixierte, damit ihm nichts von meiner Reaktion auf das Gesehene entging. Diese Bilder zeigten genau ausgeleuchtete Fußspuren, von denen er annehme, wie er mich wissen ließ, dass sie von meinen Schuhen herrührten. Die Größe stimme überein. Auch das Muster der Sohlen, das er in meiner Wohnung kurz in Augenschein genommen habe. Gewiss rühre der Schmutz auf ihnen ebenfalls von der Baustelle her. Und dass sich unter den Reifenspuren, die im Nahbereich des Rohbaus sichergestellt worden waren, die meines Autos befinden würden, davon gehe er nach Lage der Dinge aus.
Abschließend konfrontierte er mich noch mit einem Bild jenes Mannes, der mich gestern mit der Frage nach Top 16 dieser Wohnanlage angeschnauzt hatte und meiner Vorstellung von einem NS-Blockwart sehr nahekam. Dieser Herr, von den zukünftigen Bewohnern zum Vertrauensmann gewählt, habe die Leiche gefunden, als er gegen 18 Uhr 40 noch einmal zur Baustelle zurückgekehrt sei, um nachzusehen, ob ich noch dort wäre. Ich sei ihm bekannt vorgekommen und das habe ihm keine Ruhe gelassen. »Er war sich sicher, Ihr Gesicht schon einmal irgendwo gesehen zu haben. Es gelang ihm jedoch nicht, es zuzuordnen. – Im Übrigen geht der Zeuge davon aus, dass Sie, Herr Burger, in dem Auto gesessen sind, das ihn geblendet hat und dann mit hoher Geschwindigkeit abgefahren ist, obwohl er Zeichen gegeben hat, stehen zu bleiben. Bei Ihrem Zusammentreffen mit dem Zeugen war weit und breit niemand anderer auf der Baustelle. Nur Sie beide waren da. Oder wollen Sie etwas anderes behaupten?«
Ich schüttelte nur den Kopf.
Heute früh habe man im Zuge der Ermittlungen in Frau Lochners beruflichem Umfeld mit ihrem Vorgesetzten gesprochen. »Wie Ihnen bekannt ist, war Hofrat Krenn zufällig im Büro von Frau Lochner, als Sie angerufen haben. Er hat mitbekommen, wie Sie das Treffen auf der Baustelle ausgemacht haben.«
Es nütze mir gar nichts, ständig darauf zu beharren, dass wir uns für 17 Uhr 30 verabredet hätten.
»Auf dem Kalender steht eindeutig 18 Uhr 30! Warum wohl, bitte schön, sollte 18 Uhr 30 vermerkt sein, wenn 17 Uhr 30 ausgemacht worden sei? Ein Schreibfehler vielleicht? – Ich bitte Sie! Diese Uhrzeit und B. für Burger ist der einzige Eintrag für den ganzen gestrigen Tag.«
Sofort nach dem Gespräch mit Hofrat Krenn habe man dem Zeugen ein Foto von mir vorgelegt. »Er hat Sie eindeutig identifiziert. Jeder Zweifel ausgeschlossen. Diese Aussage ist wasserdicht! Sie, Herr Burger, sind der Mann, den er um 18 Uhr am Tatort angesprochen hat. Circa 18 Uhr 30, wie gesagt, wurde als Todeszeitpunkt von Frau Lochner festgestellt. Deshalb sind wir hier. Und müssen Sie jetzt auf Grund der vorliegenden Indizien und Ihrer Aussagen wegen dringenden Verdachts, Frau Barbara Lochner getötet zu haben, zum Antritt Ihrer Untersuchungshaft nach Salzburg bringen.«
»Noch einmal: Ich habe keine Sekunde lang bestritten, vor der Baustelle gewesen zu sein. Vor der Baustelle, wohlgemerkt. Aber ich habe den Rohbau nicht betreten. Die Lochner hat mich versetzt! Wie oft soll ich das denn noch …«
Mein Versuch eines Einwandes erstarb in kleinlauter Resignation. Als schämte ich mich bereits für meine dürftige Ausrede, um halb sechs verabredet gewesen zu sein, bis sechs etwa vergeblich gewartet und mich zur Tatzeit schon auf dem Heimweg befunden zu haben. Allein in meinem Auto. Irgendwo auf der Autobahn von Salzburg nach St. Johann unterwegs. Des schlechten Wetters wegen entsprechend langsam.
Wie verlogen hörte sich die Wahrheit inzwischen schon in meinen eigenen Ohren an. Vor allem: Wie einfallslos schlecht konstruiert! Unwürdig eines Menschen, der nicht zuletzt davon lebte, möglichst raffinierte Geschichten zu erfinden.
Während der schweigend verlaufenden Autofahrt nach Salzburg, bis zu meiner Einlieferung in das landesgerichtliche Gefangenenhaus in der Schanzlgasse, dachte ich zwanghaft an die Bilder von der hilflos im Bauschlick liegenden Barbara Lochner. Und ich hatte das rektale Fiebermessen vor Augen, von dem mir mein Freund Alex erzählt hatte, nachdem er als junger Notarzt erstmals miterlebt hatte, wie bei einem Mordopfer die Körpertemperatur festgestellt und unter Einbeziehung der Außentemperatur eine ungefähre Todeszeit errechnet wurde.
Natürlich hatte der vernehmende Beamte sofort bemerkt, dass mir diese Bilder an die Nieren gingen, und mir ausgemalt, wie sehr mich ein Geständnis erleichtern würde. »Herr Burger! Sie sind doch kein abgebrühter Mörder, der das einfach wegstecken kann …« Wenn ich das glaubte, würde ich die Bürde so einer Tat gewaltig unterschätzen
Fritz stützte die Hände auf seine weit geöffneten, wuchtigen Oberschenkel und atmete bei vorgeneigtem Oberkörper schwer durch den Mund. An seinen Schuhen klebte Pferdemist; mein Anwalt roch nach Stall. Er sah mich an, als wären wir Zehnjährige, die sich einer gerade abgemachten Verschwörung vergewisserten – ehe sie zum Mittagessen heimlaufen würden.
Überhaupt hatte ich das Gefühl, als ginge es zwischen uns jetzt nur um das, was einmal war! Ich spürte, dass das Gewesene unser erstes Wiedersehen nach langen Jahren dominierte, auch wenn es mit keinem Wort direkt angesprochen wurde. Als finde bei so viel Vergangenheit die Gegenwart kaum Platz! Wo doch gerade das Schreckliche meiner momentanen Lage jeden Millimeter Platz für sich und seine Aussichtslosigkeit okkupiert zu haben schien.
Verzagt fragte ich: »Fritz, was könnten wir denn tun?«
Mein Freund sah mich lange betrübt an, ohne zu antworten.
»Wie könnten wir nachweisen, dass ich auf der Heimfahrt war? Ich war auf der Heimfahrt, verstehst du!«
»Du bist doch Autobahn gefahren, Werner?«
»Ja. – Glaubst du, dass jemand aufzutreiben wäre, der mich gesehen, sich an mein Auto erinnern …«
»Nein, das nicht. Aber vielleicht … vielleicht gibt es eine andere … eine kleine Hoffnung …« Ein Kartellbruder von der Straßenerhaltungsgesellschaft habe ihm einmal erzählt, dass sich an den Tunnelportalen der Tauernautobahn Kameras befänden.
»Ja?!«
»Das lasse ich sofort prüfen, Werner«, hörte ich Fritz in einem Ton sagen, als befürchte er, damit nur auf einen weiteren Beweis meiner Schuld zu stoßen.
4
Als ich mit Fritz zum letzten Mal zusammengetroffen war, hatte er in der Stadt Salzburg gerade eine eigene mickrige Kanzlei eröffnet – ein enger Schluff, in dem früher einmal eine Fritten- und Bosnabude mit Gassenverkauf untergebracht gewesen war. Zwei winzige Räume, in denen ich bei einem unserer zufälligen Begegnung auf der Staatsbrücke folgenden Besuch noch immer den Geruch stark gewürzter Bosnas und alten Frittenfettes wahrzunehmen glaubte.
Im Vorzimmer hatte er ein vergrämt blickendes altes Mädchen als Sekretärin sitzen gehabt, das den Eindruck erweckte, als sei er ihm mindestens drei Monate Gehalt schuldig. Eine Frau in mittleren Jahren, deren Gesicht vom Kummer gezeichnet war; dem Kummer vieler Frauen mit erwachsen gewordenen Kindern, deren Ehemänner sich gerade in Begleitung jüngerer Gespielinnen aus dem Staub machen. Frauen, die dadurch zu starken Raucherinnen wurden und nicht selten bereits am Vormittag so nebenher mit dem Trinken anfingen.
Ich verspürte eine tiefe Niedergeschlagenheit angesichts der Trostlosigkeit der Frau an dem altmodischen, wackeligen Maschinschreibtischchen; eine Ausweglosigkeit, in die sich dann auch ein unbestimmter Vorwurf zu mischen schien, mit dem ich mich bedacht fühlte, während sie mich warten ließ, bis sie es für angebracht erachtete, meinem Wunsch nachzukommen und ihrem Chef mein Eintreffen zu melden.
Wie gesagt, Fritz’ Büro war eine winzige Angelegenheit, zwei hohe schlauchförmige Räume, in denen kein Platz mehr für einen Schirmständer war, doch mein Freund saß an jenem verregneten Nachmittag in dieser düsteren Besenkammer an seinem in die Ecke gequetschten Schreibtisch, als befehlige er ein Heer von Konzipienten, werde von einem Geschwader energiegeladener junger Sekretärinnen umschwirrt und sei mit den aufsehenerregendsten Fällen der Justizgeschichte befasst. Ganz so, als sitze nicht dieses im Schein einer zu schwachen Glühbirne verdrossen auf einer museumsreifen Kugelkopfschreibmaschine herumhackende alte Mädchen da draußen, sondern als strahle einem wie bei Richard Moser eine unmittelbar vor der Krönung stehende Miss Austria hinter einem Empfangspult entgegen, das mit jedem auf dem Kennedy- Airport mithalten konnte!
Gut ein Jahr davor war ich mit meinem Freund aus Kindertagen an einem lauen Spätfrühlingsabend unter dem dichten Blättergewölk eines alten Kastanienbaums in einem Biergarten gesessen, und Fritz hatte mir erzählt, dass er sich mit dem Gedanken trage, Kampfhunde zu züchten. Mastinos. Killerhunde, die damals in Österreichs Unterweltkreisen gerade in Mode zu kommen begannen; scharfe vierbeinige Waffen, die muskelbepackte, solariumgebräunte, eindrucksvoll tätowierte und mit reichlich Gold behangene Zuhälter stolz an kurzer Leine durch die Innenstädte führten und deren Vorzüge als Bewacher ihrer Villen er seinen Brüdern aus dem Cartellverband schmackhaft zu machen beabsichtige. »Die Sache zahlt sich schon aus«, hatte mir Fritz anvertraut, »wenn sich auch nur ein Viertel der Villenbesitzer unter den Brüdern für ein, zwei solcher Hunde entscheidet. Ab da, Werner, ist das ein Bombengeschäft!«
Seit meinem Besuch in dieser Doppelnische von Kanzlei hatten wir uns nicht mehr gesehen. Ich wusste nur, dass er inzwischen längst ein geräumiges Büro an einer respektablen Adresse bezogen und offenbar passable Geschäfte gemacht hatte. (Auch ohne Killerhunde.) Gleichfalls war mir bekannt, dass Fritz mit beachtlichem Erfolg in der Pferdezucht und im Pferderennsport mitmischte. Auf der Krieau in Wien war mein Freund zu einer anerkannten Größe aufgestiegen, eine Respektsperson geworden. Die Großstadtbazis mit ihren Schirmmützen und cremefarbenen Freizeitjacken hatten aufgehört, sich über seine Aufsehen erregende Trachtenkleidung lustig zu machen und suchten bei jeder Gelegenheit die Nähe des Erfolgreichen. Fritz soll es nicht ungern hören, wenn ihn einer dieser Wiener Strizzis im Spaß mit Herr Baron tituliert. – Sogar auf der Pferderennbahn stellte die Geschichte aus der Kindheit ihre beeindruckende Langlebigkeit unter Beweis.
Irgendwo bei Mondsee befand sich sein Gestüt; auf einem, wie mir jemand erzählt hatte, herrschaftlichen Anwesen. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie mein Freund dort in Reitstiefeln herumstapfte und seinem kroatischen Rossknecht Anweisungen erteilte oder der ausnehmend gut aussehenden jungen Pferdepflegerin aus Polen, die eigentlich ausgebildete Grundschullehrerin war, auf den Hintern klatschte, wenn er stolz an eine der Boxen trat …
Fritz wischte sich wieder mit seinem großen Stofftaschentuch die stark gerötete Stirn und reinigte damit auch seine Brille, die sich erneut beschlagen hatte, nachdem ihm der Dunst auf den dicken Gläsern schon bei seinem Eintreten die Sicht genommen hatte.
Der Justizwachebeamte saß reglos auf seinem Stuhl und schien in Gedanken weiß Gott wo zu sein.
Ich sah Fritz – und sah ihn wieder nicht. Wie ich mich in Untersuchungshaft zu befinden schien – und wieder nicht. War ich denn überhaupt noch bei Sinnen?
Seit ich von Barbara Lochners Tod erfahren hatte, fühlte ich nicht nur überhaupt keine Genugtuung darüber, sondern sogar immer häufiger eine angesichts unserer Auseinandersetzungen vollkommen unbegreifliche, absurde Art von Verpflichtung, den Mord – zuzugeben. Zu gestehen. Eine Untat zu bekennen, die ich nicht begangen hatte!
Ich hatte also nicht nur mit der offenkundigen Unmöglichkeit zu kämpfen, der Beteuerung meiner Unschuld Beweise folgen zu lassen, sondern mich auch noch gegen einen verrückten Drang zur Wehr zu setzen, ein Verbrechen zu gestehen, das ich meines Wissens nach nicht begangen hatte. Aber: Wie viel wusste ich von mir? – Vielleicht nicht einmal einen Bruchteil dessen, was mir über jede von mir erfundene Romanfigur bekannt war?
War ich, kaum in Haft, bereits dabei durchzudrehen? Oder bestünde die dringendste Überlebensmaßnahme für mich einmal mehr darin, mich rechtzeitig vor mir selbst in Sicherheit zu bringen? Müsste ich in meinem Pferde züchtenden Freund aus der Kindheit womöglich weniger meinen Verteidiger als vielmehr den Exekutor meiner konsequenten Selbstzerstörung sehen? Ich hatte doch schon als Jugendlicher Angst davor gehabt, über Brücken zu gehen, da ich mir zutraute, gegen meinen Willen hinunterzuspringen. Wie ich später im Auto manchmal glaubte, mir nicht sicher sein zu können, bei der nächsten Kurve nicht einfach Vollgas zu geben – und geradeaus zu rasen.
Verlor man auf diese Weise seinen Verstand – oder bewies man sich damit nur, dass man keinen zu verlieren hatte?
5
»Eine Tat sucht sich ihren Täter – und findet mich?« Lag ich wirklich so falsch mit diesem Satz, der mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte?
Was war geschehen?
Ich hatte Barbara Lochner ein letztes Mal mit den gegen sie (auch, aber nicht nur gegen sie) gerichteten Ergebnissen meiner mich in ohnmächtigen Zorn versetzenden Nachforschungen zu den Ursachen für den Nervenzusammenbruch von Erwin Lang konfrontieren wollen. Die zum Zeitpunkt meiner Verhaftung in einer grünen Mappe gesammelt auf meinem Schreibtisch liegenden Papiere – Gedächtnisprotokolle von Gesprächen und Telefonaten sowie meine knapp notierten Analysen von Vorgängen – waren im Zuge der unmittelbar nach meiner Verhaftung durchgeführten Hausdurchsuchung zu den Akten genommen worden, zur Untermauerung meines Mordmotivs.
Dabei hatte ich der Lochner einfach alles nur an den Kopf werfen wollen, um danach Schluss zu machen. Keineswegs mit ihr, sondern mit der so überaus deprimierenden Angelegenheit, die den Gymnasiallehrer Lang um den Verstand gebracht hatte und mit der ich ganz und gar gegen meinen Willen in Berührung gekommen war, bis mich später mein Schuldgefühl gegenüber dem Magister immer tiefer in die Sache hineingetrieben hatte.
Natürlich hatte ich der Lochner nicht an die Nase gebunden, dass ich von der weinenden Herta Lang inständig darum gebeten worden war, die Geschichte auf sich beruhen zu lassen, damit nicht noch mehr Unglück geschehe. »Die nehmen auf nichts und niemanden Rücksicht, Herr Burger. Ich habe solche Angst! Die gehen über Leichen!«
»Werner …«
Mein Freund atmete mit einem tiefen Seufzer aus. Sein leidend anmutender Blick stachelte mich noch einmal an.
»Fritz: Ich war auf der Baustelle. Ziemlich pünktlich zum ausgemachten Termin um 17 Uhr 30. Dort habe ich dann rund eine halbe Stunde vergeblich auf Frau Lochner gewartet und mich währenddessen immer mehr über mich selbst geärgert, weil ich mich von diesem Trampel so plump hereinlegen habe lassen.«
Als ob die Lochner auch nur eine Sekunde lang vorgehabt hätte, sich mit mir zu treffen! Nachdem sie vorher sämtliche meiner Versuche, mit ihr über Erwin Lang zu sprechen, mit immer neuen Ausreden abgewehrt hatte. Am Telefon war sie jedes Mal verstummt, hatte einfach den Hörer aufgelegt und war für den Rest des Tages nicht mehr erreichbar gewesen. Die Dame in der Vermittlung hatte mich bei meinen wiederholten Anrufen schließlich mit kleinlauter Stimme ängstlich-warnend gefragt, ob ich denn nicht wisse, wer der Vater der Frau Lochner sei. Und das, als ob es darum ginge, wem Salzburg gehöre! – Ganz zu schweigen von meinem blamabel endenden Überraschungsbesuch in ihrem Büro. (Auch dieser Vorfall hatte – dank meiner eigenen Notiz darüber – in die Liste der Gründe Aufnahme gefunden, die gegen meine Unschuldsbeteuerungen sprachen.) Und so jemand sollte sich auf einmal bereit gefunden haben, sich von Angesicht zu Angesicht meinen Rechercheergebnissen auszusetzen? War ich denn von allen guten Geistern verlassen!
Das Warten wurde mir als sinnlos bewusst. Ich stapfte mit zunehmender Wut auf mich selbst im leichten Schneeregen vor dem Rohbau herum. Ich war so sehr in Rage geraten, dass ich noch am nächsten Tag auf der Polizeistation in St. Johann bei der ersten Befragung geäußert hatte, dass ich, wäre sie noch gekommen, die Frau womöglich tatsächlich vom Balkon gestoßen hätte.
Der Untersuchungsrichter hatte auf meine Darstellung gelassen reagiert. Der Fall sei für ihn doch längst gegessen, wie er mehrmals betont hatte. Mein Leugnen helfe mir gar nichts. Bei fehlendem Geständnis käme es zu einem reinen Indizienprozess. Und der würde hundertprozentig zu einer Verurteilung führen. Darauf könne ich Gift nehmen. Ich solle mir aber darüber im Klaren sein, dass ich durch mein Verhalten wegen mangelnder Schuldeinsicht meine Lage nur verschlimmere. »Sie sind sehr, sehr schlecht beraten, Herr Burger, wenn Sie weiterhin leugnen.« Damit würde ich eine völlig falsche Strategie verfolgen. Eine, die für mich nur Nachteile zeitigen werde.
Der Mann war ruhig, aber beharrlich bei seiner Version des Tathergangs geblieben: »Obwohl der Eintrag auf ihrem Kalender klar dagegen spricht, nehmen wir einmal an, die Frau hat sich verspätet. Sie waren wütend. Verständlich. Als Frau Lochner gekommen ist, haben Sie die Nerven verloren. Die Verspätung haben Sie als Provokation aufgefasst. Es ist zu einer Auseinandersetzung gekommen, in Frau Lochners zukünftiger Wohnung. Wahrscheinlich zu einer ziemlich lautstarken.« Leider habe so schlechtes Wetter geherrscht, sonst, behauptete der Untersuchungsrichter, gehe er davon aus, dass es gelungen wäre, auf Barbara Lochners Gesichtshaut meine DNA-Spuren sicherzustellen. »Egal. Wir haben genug andere Spuren. Im Verlauf dieses Streites ist es passiert. – Herr Burger: Ein Geständnis wird auch für Sie eine ungeheure Erleichterung sein. Glauben Sie mir das!«
Nach längerem Schweigen hatte mir der U-Richter empfohlen, auf Totschlag im Affekt plädieren zu lassen. Alles andere, vor allem weiteres Leugnen, sei schlichtweg dumm. Und kurzsichtig. »Herr Burger, Sie sind doch kein Mörder! Jemand, der so etwas kaltblütig plant. Es ist Ihnen passiert!« Die Zeugenaussage des Hausvertrauensmannes, all die Spuren, das Motiv – die Indizien seien schlichtweg erdrückend. »Ein Geständnis ist der einzige Weg für Sie, beim Strafausmaß besser auszusteigen. Sie sind unbescholten. Und die Affekthandlung nehme ich Ihnen ab. Totschlag, begreifen Sie das doch endlich, wird auch das Gericht akzeptieren. Sie müssen gestehen! – Sonst wird es Mord. Vorsätzlich geplanter Mord, auf Grund der nachweislichen Verabredung mit dem Opfer.«
Der Zeuge … Die unangenehme Begegnung mit diesem Menschen – kurz vor sechs, wie er später korrekt ausgesagt hatte – war für mich wohl letztlich ausschlaggebend dafür gewesen, nicht noch länger gewartet, sondern gleich nach ihm das Areal ebenfalls verlassen zu haben. Über dieses für mich so entscheidende Faktum konnte er natürlich keine Aussage machen, vielmehr habe ihn, als er später zurückgekehrt sei, ein Wagen absichtlich geblendet, in dem er niemand anderen als mich vermutete. Das Fahrzeug habe die Baustelle verlassen, obwohl er eindeutige Handzeichen gegeben habe, stehen zu bleiben, wiederholte der U-Richter, was ich schon von den Kriminalbeamten gehört hatte.
Der Mann war in seiner Trainingshose und den knallgelben Gummistiefeln auf mich zugekommen, abrupt vor mir stehen geblieben und hatte mich schweigend aus schmalen Augen gemustert. Die über den Kopf gezogene Kapuze seines Parkas ließ ihn unheimlich wirken. Ohne sich mit einem Gruß aufzuhalten, herrschte er mich in gereiztem Ton an: »Also sind Sie das von Top 16?!«
Wütend, wie ich war, schüttelte ich nur den Kopf.
Der Unbekannte starrte mich eine Weile durchdringend an, bevor er meinte: »Ja wer ist das denn dann, Himmelherrschaftnocheinmal! Muss doch irgendjemandem gehören, Top 16! – Scheren sich überhaupt um nichts, manche Leute.«
Ohne Verabschiedung wandte er sich zum Gehen. Nach ein paar Metern drehte er sich noch einmal um und schnauzte mich an: »Was tun Sie dann eigentlich hier?«
Ich sei mit jemandem verabredet, rotzte ich meinerseits so hin, dass klar war, eine weitere Unterhaltung darüber war ausgeschlossen. Mit diesem Ton wiederum schien er auf Anhieb einverstanden zu sein. Er schüttelte zwar verständnislos den Kopf, akzeptierte die Auskunft jedoch widerspruchslos, ohne nachzuhaken.
Hatte mir der Untersuchungsrichter anfangs vorgeworfen, dass meine Behauptung, nach dem Zeugen gleichfalls die Baustelle verlassen zu haben und keineswegs in dem Auto gesessen zu sein, das den Mann nach seiner Rückkehr geblendet hatte, obwohl sich unter den sichergestellten Reifenspuren die meines Wagens befanden, in ihrer Einfallslosigkeit meiner doch keinesfalls würdig sei, so meinte er plötzlich, dass diese angesichts der Indizien wenig intelligent erscheinende Rechtfertigung vielleicht sogar überklug sei; eine, mit der ich meinem Beruf sehr wohl Ehre mache, da sie mit der daraus zu gewinnenden Einsicht spekuliere, dass sich ein phantasievoller Mensch niemals dermaßen dumm herauszureden versuchen würde. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ich offenkundig gar nichts unternommen hatte, um am Tatort zumindest die gröbsten meiner Spuren zu verwischen. Aber gerade darin schien der Untersuchungsrichter inzwischen eine höchst raffiniert über mehrere Ecken gedachte Strategie zu erblicken, die er einem Berufsschriftsteller wie mir durchaus zutrauen würde. Gerade einem Menschen, der darin geübt sei, sich komplizierte Geschichten auszudenken, wie er mir vorwarf. Denn das, was sich auf den ersten Blick als reichlich beschränkt und einfallslos ausnehme, halte er mittlerweile für eine von einem überdurchschnittlich klugen Täter stammende Strategie, die das Wissen um die Intelligenz des Verdächtigten seitens des Gerichtes für sich zu nutzen!
Andererseits finde er damit aber auch seine Totschlag-Theorie bestätigt, behauptete der U-Richter: Ich sei einfach nicht in Mordabsicht zur Baustelle gekommen und habe nach der Tat schnell erkannt, dass ich unmöglich alle Spuren verwischen könne, die sich von mir finden würden, weshalb ich mich dazu entschlossen hätte, gar keine Spuren zu verwischen und mich auch noch auf die auf den ersten Blick unglaubwürdigste und simpelste Rechtfertigung zu versteifen. Der Umstand übrigens, dass in der Wohnung selbst oder auf dem Balkon bislang nichts entdeckt worden sei, das auf meine Anwesenheit schließen lasse, falle weniger ins Gewicht als all das, was sonst gegen mich spreche.
Je öfter er sich den Sachverhalt durch den Kopf gehen lasse, desto raffinierter erscheine ihm meine Vorgangsweise. »Und ich halte Sie für intelligent, Herr Burger«, hatte er geschlossen, »für sehr intelligent sogar.« Denn das müsse man sein, um sich als »Mann der Phantasie«, wie er sich ausdrückte, mit solcher Konsequenz als einfallslos präsentieren zu können.
Bei diesem Lob als Begründung für seine Bezichtigung hatte ich eine leichte Gänsehaut verspürt.
6
Fritz blickte mich jetzt an, als säßen wir uns tatsächlich anlässlich eines Klassentreffens gegenüber: Erwartungsvoll, ungeheuer gespannt, von mir zu hören, wie es mir denn seit dem letzten Klassentreffen vor zehn Jahren ergangen sei. Unübersehbar die Bereitschaft zu neidloser Anerkennung dessen, was ich aus meinem Leben Bewundernswertes gemacht hätte!
Wir schwiegen eine Weile.
Ohne dass ich mich von ihm abgewandt hätte, entglitt seine massige Gestalt meinem Bewusstsein. Und als sie dort wieder aufzutauchen begann, glaubte ich plötzlich die enormen emotionalen Kräfte wahrnehmen zu können, die in ihm arbeiteten und auf mich übergriffen und mich wie eine Welle der Sentimentalität mit sich zu reißen drohten.
Er hatte mich lange schweigend an seine breite Brust gedrückt, nachdem er mit offenem Lodenmantel ins Zimmer gekommen war. Danach hatte er mich so an den Schultern festgehalten, als gelte es damit zu verhindern, dass ich mich in Luft auflöse. Seine blassen Augen waren nass, als er mich über die Ränder der beschlagenen Brillengläser hinweg tief gerührt ansah.
War während Fritz’ Anwesenheit der Anwalt hinter dem Jugendfreund überhaupt zum Vorschein bekommen? Und verschwand nicht auch der Untersuchungshäftling hinter dem zu jedem Abenteuer aufgelegten Straßenbuben?
Die verbrauchte Luft in dem Besprechungszimmer des landesgerichtlichen Gefangenenhauses war doch auch der Gestank des überfüllten, schlecht gelüfteten Krankensaales, in dem ich als Elfjähriger gelegen war, nachdem ich mir beim Schifahren den Fuß gebrochen hatte – und in dem mich mein Freund Fritz eines Tages mit einer Packung Neapolitaner-Schnitten aufgesucht hatte, um sie im Verlauf unserer angeregten Unterhaltung nach und nach selber zu verspeisen?
Obwohl ich Fritz’ intensive Gefühle spürte, entging mir nicht, dass sein Blick einmal verstohlen das Zifferblatt seiner Armbanduhr suchte. (Die Uhrkette aus massivem Silber, die auf der mächtigen Wölbung seines Bauches ruhte und das Trachtengilet zierte, war also nur Dekoration für den Heimatfilm-Adeligen?)
»Es ist noch Zeit, Werner«, sagte er jetzt auf meinen Hilfe suchenden Blick. »Die Ermittlungen sind noch nicht zur Gänze abgeschlossen … Es wird auch in andere Richtungen … darauf werde ich dringen!«
So, wie mein Freund mich jetzt anschaute, stieg in mir erneut die Befürchtung auf, dass mich also auch mein Verteidiger für den Täter hielt!
Fritz erhob sich mühsam. Als wir uns gegenüberstanden, ergriff er mich wieder mit seinen auffällig beringten, dicken, kurzen Fingern. Die schwarzen Ränder der Nägel, die mir vorhin schon aufgefallen waren, zeugten wohl mehr vom intensiven Umgang mit seinen erfolgreichen Rennpferden als von einem ausgedehnten Aktenstudium?
Er erfasse mich. Zumindest physisch tue er dies, mit seinen Händen, dachte ich, als gelte es, eine Satire zu schreiben, und nicht, um meine persönliche Zukunft zu bangen.
Mein Freund drückte mich jetzt fest an sich.
»Werner …«
»Fritz …«
Er sah mich aus wässrigen Augen an. Wortlos klopfte er mir mit beiden Händen auf die Schultern, griff nach seiner alpinen Hutskulptur sowie dem Schnellhefter, bedeutete dem Wachebeamten mit einem Nicken, dass er fertig sei, und ging.
II
»Haben Sie eine Pistole oder ein Messer?«
1
Es war ein nasskalter, nebliger Spätnachmittag Mitte Oktober, dessen letztes, fahles Licht einen so verklärenden Schimmer auf das Mobiliar legte, als döste es friedlich vor sich hin – eingebettet in eine ganz und gar harmonische Welt. Eva und ich hatten soeben grünen Tee getrunken und genossen es, uns von einer sanften Welle des Wohlbehagens erfassen zu lassen.
Draußen röche es bereits nach Schnee; die Autos würden zischend durch die Pfützen des nassen Asphalts jagen und die Schulkinder auf dem Heimweg vom Nachmittagsunterricht mit ihren bunten Gummistiefeln das durchnässte, glitschige, frisch lackiert anmutende Laub vor sich herschieben, das sich an den Gehsteigrändern gesammelt hatte. Und sie täten damit, was ihre Eltern schon getan hatten und später auch ihre eigenen Kinder tun würden. – Wer wollte sich also unter solchen Aspekten schon so wichtig nehmen, mit seiner mickrigen, in vielem vorangegangene Leben mit kleinen, vom technischen Fortschritt ermöglichten (oder diktierten) Variationen wiederholenden Existenz? Und dennoch gerieten überall auf diesem Planeten Menschen wegen nichtigster Nichtigkeiten in erbitterte Auseinandersetzungen, bereit, einander zu zerfleischen, ehe sie über kurz oder lang auf einem der Friedhöfe landeten, auf dem dann Menschen, die zu ihren Lebzeiten Todfeinde gewesen waren, Sarg an Sarg vermoderten. Einige Zeit wären ihre Grabsteine noch Mahnmale der Lächerlichkeit dessen, woran sie so viel an Lebenszeit und -kraft verschwendet hatten, bis auch die Erinnerungen an sie und ihre Kämpfe gestorben wären, sich aber längst neue Narren gefunden hätten, um es ihnen gleichzutun und einander ihre kurze Lebenszeit zur Hölle zu machen …
Natürlich versuchte ich mich damit einmal mehr der Richtigkeit meiner Entscheidung zu vergewissern, von meiner Seite aus diesen absurden Kleinkrieg mit dem Hofrat Krenn und Barbara Lochner beendet zu haben. Gut einen Monat war es mittlerweile her, dass Eva für uns einen Last-minute-Flug gebucht hatte und ich sozusagen nach Griechenland desertiert war in der festen Absicht, mich nie wieder in den Kampf gegen die Salzburger Partei-Kulturbürokratie hineinziehen zu lassen.
Ich dachte häufig an den Irrwitz, dem ich damit entkommen war – angesichts dessen, was der Tag noch bringen sollte, war die in solchen Gedanken gelegene Ironie allerdings kaum zu überbieten!
Der Blick aus dem Fenster ließ mich unwillkürlich an meinen Freund Alex denken – mein Lebenslehrer kostete jede Jahreszeit voll aus, brütende Sommerhitze gleichermaßen wie eisige Winterkälte. Nebel, Regen, Sturm – egal, Alex genoss das vielfältige Angebot der Natur, die ihm immer eine wunderbar einfallsreiche Lebensveranstalterin war. Keine Sekunde lang empfände mein Freund die momentane Witterung als etwas, wovor man am besten sofort Reißaus nähme, weil sie unsere Gebirgsschluchten regelrecht in ausbruchsichere Naturgefängnisse verwandelte, sobald ihnen der dicht schließende Deckel von Nebel oder Regenwolken aufgesetzt war. In all dem sähe Alex nur einen erfreulich großen Aufwand, damit er in puncto Abenteuer auf seine Rechnung käme. Wo er war, wurde Leben veranstaltet – und das bei seinem Beruf als Notarzt, der ihn nicht selten zwang, vor den kümmerlichen Überresten menschlichen Lebens zu stehen, wenn er an eine Unfallstelle gerufen wurde …
Für meine Eltern – und die ungezählten Menschen aus ihrer Schicht – hatte das Leben sehr wohl auch beglückende Momente bereitgehalten, zuallererst jedoch aus dem fortdauernden Kampf um etwas zum Beißen und ein Dach über dem Kopf bestanden. Was mich betraf, war die gegenwärtige Auftragslage zufrieden stellend. Diese kleine Ideenwerkstatt zu betreiben, um Verlage, Zeitungen und Zeitschriften, Fernsehsender und Hörfunkanstalten zu beliefern oder bei Veranstaltungen aufzutreten, schien momentan in ihrer Existenz nicht gefährdet. War das der Grund für meine Ausgeglichenheit oder fluteten womöglich noch Reste des Opiates durch meinen Körper, das mir eine Woche lang jeden Morgen über eine Infusionsflasche in die Blutbahn geträufelt worden war, damit ich mich wieder ohne fremde Hilfe fortbewegen konnte?
Aus dem warmen Griechenland heimgekehrt, hatte ich mir – bei Zugluft zu leicht bekleidet – eine Entzündung des Lumbago-Nervs zugezogen und war um die Erfahrung bereichert worden, von einem Tag auf den anderen nur unter größten Schmerzen in langwieriger Prozedur aus dem Bett klettern und auf allen vieren zur Toilette kriechen zu können.
Nunmehr wieder auf den Beinen, war ich immer noch von dieser wunderbaren Gelassenheit all den Lappalien gegenüber erfüllt, die einen gelegentlich in völlig unangemessene Raserei zu versetzen vermögen.
Sollte ich in der Praxis meines Hausarztes gar zu einem Infusionsjunkie geworden sein? Hinter dem bunten Kunststoffvorhang auf die Liege hingestreckt, aus den Nebenabteilen das beängstigende Röcheln von Asthmatikern und an Staublungen Leidenden im Ohr, während mich der Anblick des Vorhangs an eine Duschnische in einem russischen Hotel erinnerte, in das mich eine Lesereise unmittelbar nach dem Zusammenbruch des so genannten Realen Sozialismus geführt hatte …
»Hätten wir uns etwas zu sagen gehabt, wir würden es vermutlich getan haben.«
So lautete der letzte Satz meiner für eine in Deutschland erscheinende Anthologie verfassten Erzählung, deren Korrekturfahnen ich soeben zu Ende gelesen hatte. Eine Geschichte, in der – dem Thema der Sammlung entsprechend – minutiös der Höhepunkt in einem hier im Salzburger Gebirge, in Bischofshofen, angesiedelten Ehekampf beschrieben wurde, und zu der mir die norddeutsche Herausgeberin des Buches herzlich gratulierte. »Unter erheblichem Gruseln«, wie sie im Begleitbrief der Druckfahnen in einer stark nach links fallenden Handschrift – die Buchstaben muteten an, als seien sie auf diesem Blatt Papier in heftigstem Gegenwind unterwegs! – angemerkt hatte, da sie darin auf verblüffende, »mir manchmal fast den Atem benehmende« Weise in zahlreichen Details so viele ihrer eigenen Erfahrungen während der letzten Monate vor ihrer Scheidungsverhandlung widergespiegelt gefunden habe. »Obwohl«, wie sie schrieb, »ich keine Ahnung habe, wo dieses Bischofshofen liegt und ob es so einen Ort in Wirklichkeit überhaupt gibt oder ob damit nicht einfach sehr raffiniert auf den Hof des Bischofs angespielt werden sollte, was für die Handlung dieser turbulenten Geschichte auf geradezu grimmige Weise Sinn machen würde!«
Während ich das Kuvert für die Rücksendung der korrigierten Druckfahnen beschriftete, dachte ich an Thea Moser. Richards Frau hatte kürzlich bestens gelaunt – etwas beschwipst, wie Eva und mir schien – aus Italien angerufen, um uns mitzuteilen, dass sie noch in der Toskana festsitze, da sich ein Mario (oder war es ein Marco?) an ihr festgekrallt habe. »Sieht aus wie 22«, sagte sie mit unverhohlenem Stolz, »ja, wie 22 – aber, Eva, ich fürchte, der ist noch keine 18!« Jedenfalls habe er sich wie ein Rhesusäffchen an ihr festgeklammert. Aber, hatte die Anwaltsgattin gemeint, lieber hier festsitzen als in diesem scheußlichen St. Johann, das ihr von Italien aus betrachtet wie eine Zwangsjacke vorkomme. »Alle diese Gebirgsnester sind doch im Grunde nichts anderes als Zwangsjacken, aus denen man sich aus eigener Kraft kaum befreien kann! Und viele dieser Irren sind auf so eine Zwangsjacke auch noch so stolz wie auf ihren im Rausch vollgekotzten Trachtenjanker!« Kichernd hatte die Weinliebhaberin mit hörbarem Zungenschlag hinzugefügt: »Ist das nicht furchtbar?«
Vielleicht, hatte Thea gemeint, habe sie dieser Halbwüchsige zum Nachdenken gebracht, ob sie nicht schon auf dem Weg dazu gewesen sei, auch eines jener Arschlöcher zu werden, vor denen sie sich in ihrer Jugend so sehr geekelt habe. Etwas Verwesendes, von dem dieser grauenhafte Geruch aus Anpassung und Verlogenheit aufsteige, dieser entsetzliche Gestank, der ihr in Gesellschaft von Richards Bekannten in St. Johann immer so zu schaffen mache. Auch wenn sie mittlerweile über einige äußere Annehmlichkeiten verfüge, eines sei ihr jetzt klarer denn je: »Aufrichtigkeit und eine eigene Überzeugung sind immer noch der allergrößte Luxus!«
Ich hatte soeben das Kuvert zugeklebt, als das geschah, was mich in weiterer Folge hinter Gitter bringen sollte.
2
Eva war, nachdem sie vom Einkauf von Babykleidung für das von Moni erwartete Kind zurückgekommen war, gerade damit beschäftigt, ein paar Zeilen an ihre Schwester in Gmunden zu richten, die sie dem Paket beilegen wollte, das ich dann mit den korrigierten Druckfahnen rasch noch vor Schalterschluss zur Post bringen sollte.
Vielleicht, weil meine Frau kopfschüttelnd gemeint hatte, dass es doch wirklich zu komisch sei, dass jetzt gerade Moni, die sich immer so entschieden gegen eigene Kinder (und für den Erhalt ihrer phantastischen Model-Figur, wie ich einwarf) ausgesprochen habe, dass nun ausgerechnet sie als erste der beiden Schwestern Nachwuchs bekommen würde; vielleicht, weil ich noch irgendetwas von Timing und Gernotti und der Kampagne seiner Partei für Kinder und Familie gebrummt und Eva mich halbherzig, aber durchaus hörbar ermahnt hatte, um meine Erziehung auch in einer sozusagen windstillen Stimmung wie der momentanen nicht gänzlich zu vernachlässigen; vielleicht, weil Eva gerührt gemeint hatte, dass es doch eine nette Idee unseres Schwagers sei, sie zu diesem Ärztekongress in die USA einzuladen, nachdem sich Moni im fortgeschrittenen Stadium ihrer Schwangerschaft die Strapazen der Reise ersparen wollte: Worin auch immer der Grund dafür gelegen haben mochte, wir hatten jedenfalls beide niemanden die hölzerne Außentreppe heraufkommen gehört und schraken furchtbar zusammen, als gleichzeitig mit einem kurzen, heftigen Poltern die Tür unserer Wohnküche so gewaltsam aufgestoßen wurde, dass sie laut gegen die Wand krachte und ihre Schnalle die dort schon vorhandene Ausbuchtung erheblich vertiefte, aus der dann noch geraume Zeit der Verputz zu Boden rieselte und sich auf dem ausgetretenen alten Kunststoffbelag als formvollendete kleine graue Pyramide sammelte.
Magister Erwin Lang, Professor für Deutsch und Geschichte, stürmte – ein abgeschraubtes Couchtischbein als Keule schwingend – laut keuchend herein!
Er blieb für einige Augenblicke entgeistert im Raum stehen, um sich einen Überblick zu verschaffen. (Im Nachhinein zweifle ich nicht daran, dass er prüfte, ob seine Verfolger nicht schon vor ihm am Ziel seiner Flucht angekommen wären!) Dann warf er sich mit dem Rücken gegen die Tür, die nach dem Aufprall an der Wand von selbst wieder zugefallen war. Während er sich in Schräglage mit seiner rechten Schulter so gegen das Türblatt stemmte, als habe er damit einem starken, von außen kommenden Druck zu begegnen, griff er mit seiner linken Hand in einer grotesk aussehenden Verrenkung hinter sich, schob den nur noch an seinem Bart hängenden Schlüssel zurück ins Schloss und drehte ihn zweimal um. Schwer atmend und ein Bein etwas nachziehend, hastete er dann die wenigen Schritte zum Fenster, neben das er sich mit dem Rücken gegen die Wand stellte. Kopf, Körper, Arme und Hände flach an die Mauer gedrückt, verharrte er wie angeklebt in völliger Reglosigkeit und starrte vor sich hin ins Leere. Nach einer Weile drehte er ganz langsam seinen Kopf zum Fenster, um hinter den Store nach draußen zu spähen.
Fassungslos, unfähig ein Wort herauszubringen, fixierten meine Frau und ich den Mann.
Als beängstigend und gespenstisch empfand ich allein den Anblick seines panischen, zu lehmfarbenen knotigen Wülsten verzerrten Gesichtes. Die tief in stark geröteten Höhlen liegenden Augen starrten selbst dann nur ins Leere, als ich sie einmal kurz auf mich gerichtet glaubte. Wie schrecklich, den kleinen, harten, wie aus Plastilin geformten weinroten Mund sehen zu müssen.
Mein Puls jagte und die Knie knickten bei dem Versuch, mich von meinem Stuhl zu erheben, sogleich ein. Auch die Arme erwiesen sich als kraftlos, als ich mich hochstemmen wollte. Das flaue Gefühl, das ich im Magen spürte, breitete sich über meinen ganzen Körper aus und ließ ihn schlottern. (Rückblickend erkenne ich darin die Vorwegnahme des Zustandes bei meiner Festnahme.) Es wollte mir vorerst nicht gelingen aufzustehen.
Noch immer nur vom äußersten Fensterrand vorsichtig ins Freie lugend, berichtete der Professor Lang so stoßweise, wie er atmete, dass sie hinter ihm her seien. Denn er habe dieses Geheimpapier gefunden. Und kenne den Code!
Nach diesem letzten Wort, das er sehr leise, aber mit Betonung ausgesprochen hatte, sah er sich wieder entsetzt in dem dämmrigen Raum um.
»Ja, darum sind sie … sie sind deshalb natürlich hinter mir her!«
Ruckartig nickte er mehrmals bekräftigend zuerst ungefähr in meine, dann in etwa in Evas Richtung.
Nur durch einen gewagten Sprung über eine sehr steil abfallende Böschung der Straße nach Wagrain sei er ihnen gerade noch entkommen. Ganz knapp.
»Um Haaresbreite!«
Eva und ich starrten gleichzeitig auf sein zerfetztes Hosenbein. Stärker hinkend als vorhin, wie mir schien, war er nämlich erschrocken einige Schritte in den toten Winkel neben dem Fenster zurückgewichen, nachdem er entweder draußen eine Bewegung wahrgenommen hatte oder befürchtete, sich zu weit aus seiner Deckung hervorgewagt zu haben.
Wieder verharrte er in völliger Reglosigkeit. Hinterkopf, Rücken und Arme gegen die Wand gepresst. Mit ausdruckslosem Blick starrte der Magister in die rasch zunehmende Dämmerung der Wohnküche, in der momentan kein anderes Geräusch zu vernehmen war als sein abgekämpft klingender Atem.
3
Plötzlich richtete er seinen Blick auf mich. Meine Augen schien er wiederum knapp zu verfehlen, als er mit jener selbstverständlichen Beiläufigkeit, mit der einen wildfremde Menschen an einer Bushaltestelle um Feuer bitten, nach einer Pistole oder einem Messer fragte.
Es bleibe ihm nämlich gar nichts anderes mehr übrig, als Schluss zu machen, stellte er nach einiger Zeit erkennbar angestrengten Nachdenkens in unerwartet sachlichem Ton fest. Denn er wisse jetzt alles. »Ich kenne den Code!«
Auch wenn er noch so viel herumrätseln, sich darüber den Kopf zerbrechen würde, ob denen vielleicht nur ein Fehler unterlaufen sei oder ob sie das Geheimpapier für ihn hinterlegt hätten. Weil sie doch gewusst hätten, dass er darauf stoßen würde. Nein, natürlich sei es ihm hinterlegt worden! Faktum sei jedenfalls auch … An dieser Stelle brach er so unvermittelt ab, als habe ihm irgendetwas die Sprache verschlagen. Schweigend starrte er wieder vor sich hin ins Leere.
Nach einer längeren Pause sah er abwechselnd in Evas und meine Richtung, als er erläuterte, dass er nunmehr in der Lage sei, sämtliche versteckten Nachrichten zu entschlüsseln. »Alle, verstehen Sie. Wirklich alle!«
Die Panik in seinem Gesichtsausdruck steigerte sich wieder, als er mehr flüsterte denn sagte, dass es überall nur so wimmle von geheimen Botschaften.
»Sie verstecken sie überall, diese Nachrichten … Einfach überall!«
Jawohl, und die Kenntnis des Codes brächte nunmehr also nicht nur ihn selbst, sondern mit ziemlicher Sicherheit auch alle jene Menschen, die jemals mit ihm zu tun gehabt hätten, in Bedrängnis. Nein, in Gefahr, in allergrößte Gefahr!
»Da darf man sich nichts … es wäre dumm, ganz dumm wäre es, sich da etwas vorzumachen, Herr Burger. Das … das ist so.«
Der Magister bebte mittlerweile am ganzen Körper.
Der große, massiv gebaute Mann setzte mit brüchiger, belegter Stimme ängstlich und kurzatmig hinzu: »Alle … alle sind in Lebensgefahr, verstehen Sie!«
Er drehte sich zu Eva und wiederholte mit größter Eindringlichkeit: »In Lebensgefahr! Frau Burger, hören Sie: in Lebensgefahr!«
Dann richtete er seinen Blick zu Boden und murmelte: »Eigentlich … eigentlich müsste man denen … wenn man es genau bedenkt, dann müsste man denen … man müsste ihnen damit zuvorkommen. Schneller sein als die.«
Ohne dass ihm dies bewusst zu werden schien, wiederholte sich der Professor des Öfteren mit der Feststellung, die er wie eine auch ihn selbst jedes Mal überraschende Neuigkeit vorbrachte, dass er seit kurzem in der Lage sei, die Botschaften zu dechiffrieren. Und die steckten hinter noch so harmlos anmutenden Worten und Texten. Gerade dort seien sie zu finden! Weil sie dort ganz gezielt versteckt worden seien. Versteckt. »Deshalb stecken sie ja dort, verstehen Sie«, erklärte er mit so großem Ernst, als erläutere er ein sprachwissenschaftliches Phänomen, während er mit den Nägeln seiner linken Hand über den Rücken seiner rechten schabte, als gehöre diese Bewegung zu seinen Ausführungen.
Aber um das zu erkennen, müsse man natürlich über den Code Bescheid wissen. Ohne den gehe gar nichts. Wie denn auch! Doch den kenne er. Der sei ihm bekannt, seit er in einer der schrecklichsten Stunden seines Lebens auf das Geheimpapier gestoßen sei.
Ja, gerade die scheinbar banalen Worte hätten es in sich. Die böten sich natürlich an, als unverdächtige Verstecke. Als Gefäße, auf die niemand käme. Scheinbar harmlose Buchstaben in Worten, mit denen man im Alltag dauernd konfrontiert sei. Und bei denen man sich üblicherweise gar nichts denke. »Wie denn auch, nicht? Wenn man keine Ahnung hat, was dahintersteckt!«
Solche banalen Worte dienten nämlich in Wahrheit einzig und allein als Vehikel für die Übermittlung versteckter, geheimer Nachrichten. Mit diesen Botschaften melde sich das zweite System. Das verdeckte