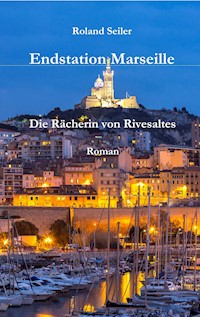Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der verwitwete Robert Schneider führt als kantonaler Beamter ein eher biederes Leben, bis er ein Opfer des Stellenabbaus wird. Knall auf Fall verliebt er sich in eine junge Deutsche und folgt dieser Hals über Kopf in die Provence, wo er in erhebliche Turbulenzen gerät. Er wird mit mysteriösen Todesfällen konfrontiert, versucht diese aufzuklären, gerät dabei selber in Gefahr und wird schliesslich von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. Dabei lernt er einen Teil Provence sowie deren Bewohner, Alltag, Bräuche, Geschichte und Küche kennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autor
Roland Seiler ist 1946 in Bönigen im Berner Oberland geboren.
Nach einer Lehre als Vermessungszeichner und dem Ingenieurstudium an der Fachhochschule in Basel war er zuerst in der Verwaltung, dann rund 25 Jahre als Verbandsfunktionär tätig.
Während 16 Jahren vertrat er die Sozialdemokratische Partei im Grossen Rat des Kantons Bern.
Seit 1972 ist er verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
Heute lebt er zusammen mit seiner Frau in Moosseedorf (Kanton Bern) und in Cucuron (Provence).
Buch
Der verwitwete Robert Schneider führt als kantonaler Beamter ein eher biederes Leben, bis er ein Opfer des Stellenabbaus wird.
Knall auf Fall verliebt er sich in eine junge Deutsche und folgt dieser Hals über Kopf in die Provence, wo er in erhebliche Turbulenzen gerät.
Er wird mit mysteriösen Todesfällen konfrontiert, versucht diese aufzuklären, gerät dabei selber in Gefahr und wird schliesslich von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt.
Dabei lernt er einen Teil Provence sowie deren Bewohner, Alltag, Bräuche, Geschichte und Küche kennen.
Für Irène, Alex und Simone
«Ich habe Angst!», flüsterte – nein: hauchte mir Monika ins rechte Ohr.
Ich nahm sie in meine Arme und zog sie fest an mich, um ihr das Gefühl von Sicherheit zu geben. Dabei war meine eigene Sicherheit nur noch gespielt, denn auch mir war die Situation längst nicht mehr geheuer.
Wir waren seit ein paar Tagen mit unserem silbergrauen Simca 1500 Spécial in der Provence unterwegs. Monika hatte aus Jeans-Stoff einen Vorhang geschneidert, welcher unerwünschten Beobachtern den Blick ins Wageninnere verhindern sollte, wenn wir uns auf den Liegesitzen zum Schlafen eingerichtet hatten, oder wenn wir trotz hochsommerlicher Temperaturen unserer Liebeslust freien Lauf lassen wollten.
Von Nîmes her kommend, hatten wir am Nachmittag unter dem gigantischen Pont-du-Gard Halt gemacht, wo wir am Ufer einen schattigen Sandplatz gefunden hatten. Am Abend waren wir in der Papststadt hängen geblieben, nachdem wir am Stadtrand auf ein paar junge Maghrebiens gestossen waren, welche in einer Nische der Stadtmauer eine Grilleinrichtung improvisiert hatten und illegalerweise für ein paar Francs Essen und Trinken anboten. Das kam unserem bescheidenen Ferienbudget entgegen und weil bekanntlich Liebe blind macht, übersahen wir geflissentlich, dass das Fleisch mehr verkohlt als gegrillt war. Das Essen schmeckte uns ebenso wie der billige Algerierwein.
Bestens gelaunt und ein wenig angeheitert entschieden wir uns, möglichst in der Nähe einen geeigneten Übernachtungsplatz zu suchen. Als ich eine dunkle Sackgasse entdeckt hatte, stimmte auch Monika sofort zu und verzichtete für einmal darauf, die nähere Umgebung zu erkunden, was sie üblicherweise aus angeborener Vorsicht tat.
Ich musste sofort eingeschlafen sein und bereits zwei, drei Stunden geschlafen haben, als mich Monika weckte. Mein «Was ist los?» unterdrückte sie mit ihrer Hand auf meinem Mund und einem zischenden «Pssst!».
«Da ist jemand!», raunte Monika. Ich spürte instinktiv den Ernst der Lage, denn wegen einer Lappalie hätte sie mich kaum geweckt.
Augenblicklich war ich hellwach. Keine zehn Meter von uns entfernt spielte sich eine dramatische Szene ab. Eine leicht bekleidete Frau – offensichtlich handelte es sich um eine Prostituierte – stand am geöffneten Fenster eines weissen Cadillacs und redete gestikulierend auf den am Steuer sitzenden Fahrer ein. Anscheinend war sie daran, mit ihrem Zuhälter die Tagesabrechnung auszuhandeln. Wir verstanden zwar die Worte des immer lauter werdenden Dialoges nicht, ahnten aber, dass sich die beiden über Geld stritten. Plötzlich sprang der grossgewachsene Gigolo-Typ aus seinem nicht mehr ganz neuen Ami-Schlitten, packte die Frau und versetzte ihr zwei, drei Schläge ins Gesicht. Mit einer beeindruckenden Wendigkeit löste sich die Dirne aus dem Griff des Zuhälters und ging zum Gegenangriff über. Obwohl sie die körperlich Unterlegene war, deckte sie ihrerseits den Hünen mit ein paar Schlägen ein. Dieser schlug noch brutaler zu und versetzte der Frau einen Faustschlag mitten ins Gesicht, sie torkelte, schlug mit dem Hinterkopf an die offene Autotüre und fiel zu Boden. Der Schläger lachte zynisch und zündete sich in aller Ruhe eine Gauloise an. Als der am Boden liegende Körper auch nach einer Zigarettenlänge reglos blieb, schien der Mann doch langsam nervös zu werden. Zuerst schrie er sein blutüberströmtes Opfer an, dann bückte er sich unsicher nieder. Jetzt wurde ihm bewusst, dass die Frau ernsthaft verletzt war. Er blickte sich um, überlegte kurz, öffnete den Kofferraum, schleifte den leblosen Körper hinter seinen Cadillac und hob ihn grobschlächtig hinein.
Während der ganzen Szene, die in Wirklichkeit wohl nicht viel mehr als eine Viertelstunde gedauert hatte – uns aber wie eine Ewigkeit vorgekommen war –, hatten wir kaum zu atmen gewagt.
Jetzt setzte sich der rüpelhafte Fahrer wieder in seinen Cadillac und drehte dessen Zündungsschlüssel. Der Motor heulte laut auf und der Lichtstrahl der eingeschalteten Scheinwerfer erleuchtete das Innere unseres Autos – wir blickten uns erleichtert an. Doch halt. Unverhofft verstummte das Motorengeräusch. Hatte der Typ uns entdeckt? Von Angst gelähmt hörte ich die nahenden Schritte. Mein Blut stockte. Unsere verschlossen geglaubte Autotüre wurde aufgerissen und ich wurde am Oberarm ergriffen.
***
«Avignon. Hatten Sie nicht gesagt, Sie müssten in Avignon aussteigen?»
Ich öffnete die Augen und schaute in das apart schöne Gesicht einer schätzungsweise vierzigjährigen Südfranzösin, welche mich am Oberarm ergriffen hatte, um mich zu wecken. Ich musste geträumt haben. Die Hübsche war in Valence in den TGV zugestiegen und wir hatten ein paar belanglose Worte gewechselt. Sie kam aus Paris, hiess Geneviève Faure und wollte in Marseille ihren kranken Vater besuchen. Ich hatte ihr erzählt, dass ich aus Bern stamme und einige Tage in der Provence verbringen wolle, und sie hatte mir sofort angeboten, mir ihre Heimatstadt Marseille zu zeigen. Ihre Visitenkarte hatte ich dankend in eine der vielen Taschen meines neu erstandenen Gilets gesteckt – wohl wissend, dass ich keinen Bedarf für eine Reiseführerin haben würde.
Meine wirklichen Pläne hatte ich nicht preisgegeben. Kein Wort vom neuen Lebensabschnitt, der morgen für mich in Aix-en-Provence beginnen würde. Dass ich in Avignon aussteigen müsse, hatte sie zum Glück noch mitbekommen, bevor ich mich von der unhöflichen Seite gezeigt hatte und eingeschlafen war.
Der Zug stand bereits still. In aller Hast ergriff ich meine Reistasche und rannte, ohne mich für das Wecken zu bedanken und ohne mich ordentlich zu verabschieden, zur Ausgangstüre.
Höchste Zeit. Die Türen schlossen sich und der Zug fuhr ab. Benommen stand ich auf dem Bahnsteig. Wie ein Schock wirkte der Wechsel aus dem klimatisierten TGV in die frühsommerlich heisse Provence. Der Schweiss rann mir den Rücken hinunter. Ob hervorgerufen durch den Klimaschock oder als Folge des Angst einflössenden Traumes, aus dem mich meine vorübergehende Reisebegleiterin gerissen hatte, war mir im Moment einerlei.
Ich atmete mehrmals tief durch, versuchte mich zu erholen und torkelte dem Bahnhofausgang zu. Erst jetzt nahm ich die schwungvolle Architektur des vor wenigen Jahren neu gebauten TGV-Bahnhofes wahr, der mich an einen Flughafen erinnerte. Über den mit typisch französischer Grosszügigkeit gestalteten Umgebungsanlagen flimmerte die Luft in der gleissenden Mittagssonne.
Plötzlich fühlte ich mich sehr einsam und verlassen. Sozusagen im luftleeren Raum zwischen zwei Leben. Zwischen meinem bisherigen Leben, das ich in Bern abgeschlossen hatte, und dem zukünftigen Leben, das morgen mit Brigitte in der Provence beginnen sollte.
«Jetzt nur keine Zweifel aufkommen lassen», ging es mir durch den Kopf.
Ich hatte mich zu diesem Schritt entschlossen und meine Zelte in der Schweiz abgebrochen. Obwohl ich mir der Sache sicher war, spürte ich in den letzten Tagen eine innere Unruhe und psychische Anspannung.
In der quälenden Ungewissheit begannen längst verheilt geglaubte Wunden zu bluten. Als die Leute vom Brockenhaus meine Zweizimmerwohnung in Bümpliz geräumt hatten, konnte ich nicht mehr zuschauen und musste an die frische Luft. Nicht etwa, weil ich an den Möbeln und Haushaltgegenständen gehangen hätte.
Nein, aber die Situation glich zu stark jener vor dreissig Jahren, als ich nach Monikas Tod nicht weiter in der Wohnung in Ittigen bleiben wollte. Weil ich es damals nicht ertragen hätte, durch die gemeinsam zusammen gesparte und abgestotterte Wohnungseinrichtung dauernd an unsere glücklichen Jahre erinnert zu werden, hatte ich auch damals das gesamte Inventar der Heilsarmee überlassen.
Ich gab mir einen Ruck und versuchte die grüblerischen Gedanken zu verscheuchen. Doch was hatte ich eigentlich vor? Die Idee, vor dem Start des neuen Lebensabschnittes einen «freien» Tag in Avignon einzuschieben, war spontan entstanden, nachdem die Wohnungsübergabe problemlos über die Bühne gegangen war und ich nicht recht wusste, wie und wo ich den vorsichtshalber eingeplanten Reservetag verbringen sollte. Ich hatte mir vorgestellt, mir einen letzten Tag, ganz für mich allein, zu gönnen, einen Tag zwischen Abschied und Ankunft, eine Atempause zwischen gestern und morgen.
Nun stand ich hier vor dem TGV-Bahnhof in Avignon und war mir nicht im Klaren, wie ich den gewonnenen Freiraum nutzen könnte. Irgendwie kam ich mir auf einmal fast lächerlich vor. Warum sollte ich mir vierundzwanzig Stunden in Avignon um die Ohren schlagen, während wenige Kilometer von hier meine künftige Lebenspartnerin auf meine Ankunft wartete? Und wie wäre es, wenn ich sie überraschen würde? Kurz entschlossen ging ich in die Bahnhofhalle zurück, kaufte mir eine Telefonkarte und steuerte auf die nächste Telefonkabine zu. Weil ich dummerweise vergessen hatte, mir die Nummer ihres Hausanschlusses zu notieren, wählte ich die Nummer ihres portablen Telefons. Nach ein paar Summtönen meldete sich die mir zwar bekannte Stimme, aber im für Deutsche typischen Französisch.
«Hallo! Hier spricht Brigitte. Ich bin im Moment nicht erreichbar. Hinterlassen Sie doch eine Mitteilung, damit ich zurückrufen kann.»
Ich legte den Hörer auf.
Damit war klar, dass ich ein paar Stunden in Avignon verbringen würde. Eine gute Stunde später lag ich auf dem Bett im sechs Quadratmeter grossen Zimmer Nummer 10 des «Hôtel Le Magnan». Der Pendelbus hatte mich vom ausserhalb der Stadt liegenden TGV-Bahnhof ins Stadtzentrum gebracht und ich hatte mich nach kurzem Studium der Hotelliste, welche ich mir im Office de Tourisme beschafft hatte, für dieses Zweistern-Hotel entschieden, welches direkt hinter der südlichen Stadtmauer von Avignon liegt.
Die vollbusige Concierge hatte mir unaufgefordert einen «Spezialpreis» von 40 Euro offeriert, aber auf Vorauszahlung bestanden. Im Zimmer standen ein französisches Bett, ein kleiner Schreibtisch, ein Stuhl und ein Kleiderschrank. Ich stellte mir vor, wie knapp es hier für zwei Personen wäre. Auch Dusche, WC und Waschtisch waren auf kleinstem Raum untergebracht, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte und das Haus machte einen relativ gepflegten Eindruck.
Ziellos schlenderte ich durch die Stadt der Päpste, die mir gleichzeitig bekannt und doch sehr fremd vorkam. Vieles war genau gleich wie damals, vor über dreissig Jahren, als ich hier mit Monika zwei glückselige Tage verbracht hatte. Und doch war es nicht mehr der verträumte Flower-Power-Ort, den wir damals als frisch verheiratetes Paar erlebt hatten. Dieselben verwinkelten Strässchen in der Altstadt, aber viele der traditionellen Quartierläden waren von Boutiquen und Modegeschäften verdrängt worden, welche auch in vielen anderen europäischen Städten anzutreffen sind. Der Palais des Papes verströmte zwar immer noch eine majestätischtrutzige Atmosphäre. Ich empfand die mittelalterliche Burg, welche tatsächlich einigen Päpsten und mehreren Nebenpäpsten im 14. und 15. Jahrhundert als Wohnsitz gedient haben soll, aber irgendwie lächerlich herausgeputzt, unzeitgemäss und deplatziert. An der Place de l'Horloge hatte es immer noch zahlreiche Restaurants, aber in der Luft lag nicht mehr das Duftgemisch von Knoblauchbrot und Marihuana von damals, sondern ein penetranter anonymer Fritüre-Gestank.
In nostalgische Gedanken verloren, war ich ausserhalb der beeindruckenden Stadtmauer gelandet. Ob hier wohl immer noch verkohltes Fleisch und billiger Wein angeboten würden? Die Jungs von damals müssten zwar längst über fünfzigjährig sein, aber vielleicht hatten sie den «Betrieb» in jüngere Hände übergeben. Nichts! Keine Grillnische in der Stadtmauer. Keine improvisierten Sitzgelegenheiten. Sogar die Russspuren des seinerzeitigen Grillfeuers auf den Steinen der Stadtmauer waren verschwunden – vermutlich war dieser «Schandfleck» einer Sauberkeitsoffensive der vor ein paar Jahren neu gewählten bürgerlichen Stadtpräsidentin zum Opfer gefallen.
Irgendetwas trieb mich zum Weitersuchen an. Die Erinnerungen waren vulkanähnlich aus meinem Unterbewusstsein herauskatapultiert worden und hatten in mir nostalgische Gefühle ausgelöst. Die in meinem Traum im TGV aufgetauchten Bilder waren plötzlich derart präsent, als ob ich erst kürzlich da gewesen wäre.
Unvermittelt stand ich vor der Sackgasse, wo wir damals unser Nachtlager eingerichtet hatten. Mein Magen zog sich zusammen. Was wäre wohl passiert, wenn dieser Zuhälter nicht tatsächlich mit seinem Opfer im Kofferraum abgefahren wäre, sondern uns entdeckt hätte, wie ich geträumt hatte? Warum wohl hatte ich die Szene im Traum bis zur bevorstehenden Abfahrt des Cadillacs wirklichkeitsgetreu wiedererlebt, dann aber eine fiktive dramatische Wendung geträumt? Wohl wegen des schlechten Gewissens, die Prostituierte feige ihrem Schicksal überlassen und aus Angst vor Scherereien auf eine Meldung bei der Polizei verzichtet zu haben? Oder kamen die Angstgefühle zurück, die ich damals vor Monika zu verstecken versucht hatte, weil ich den «starken Mann» spielen und ihr Eindruck machen wollte?
Mich fröstelte. Erst jetzt bemerkte ich, dass die Sonne untergegangen war und es zu dunkeln begann. Mein Magen knurrte. Ausser einem Mütschli vor der Abfahrt in Bern und einem mickrigen, aber schamlos teuren Sandwich im TGV hatte ich den ganzen Tag nichts gegessen. Ich entschloss mich, zurück ins Hotel zu gehen, um mich umzuziehen und anschliessend das Restaurant zu suchen, in welchem wir uns damals trotz unseres bescheidenen Budgets ein teures Nachtessen geleistet hatten.
Erst beim dritten Anlauf fand ich oben an der «Rue de la République» die Anschrift «HIELY» des Restaurants, das im ersten Stock eines Geschäftshauses untergebracht ist. Der Chef de Service bedeutete mir freundlich, aber nicht salbungsvoll, ich hätte wirklich Glück, ohne vorgängige Reservation einen Platz zu finden, und führte mich an ein kleines Tischchen an der Fensterfront.
Das «Hiely Lucullus», welches ein stilgerechtes Belle-Époque-Interieur aufweist, verströmt eine einmalige Ambiente. Zum mit Liebe gepflegten Dekor passen auch die Menükarte und der gepflegte Service. Neben dem Chef de Service werden die Gäste von einem Chef de Table sowie einem Sommelier verwöhnt.
Ich entschied mich für das Drei-Gang-Menü «Jean Vilar». Wie mir der Chef de Service bereitwillig erklärte, sei Jean Vilar ein Theatermann gewesen, welcher nicht nur das «Theâtre National Populaire» in Paris gegründet und geleitet, sondern auch das alljährlich stattfindende Theaterfestival von Avignon gegründet habe. Er soll zudem ein grosser Gourmand und regelmässiger Gast im «Hiely» gewesen sein, weshalb sein seinerzeitiges Lieblingsmenü seit ein paar Jahren auf der Karte geführt werde.
***
Damals mit Monika hatten wir uns ebenfalls für ein dreigängiges Menü entschieden, obwohl dieses ein kaum zu verantwortendes Loch in unsere Reisekasse riss. Wir hatten uns darauf geeinigt, während der Ferien einmal wöchentlich vom üblichen Menüplan abzuweichen, welcher unseren finanziellen Verhältnissen entsprechend aus Sandwiches, Früchten, Melonen und Salaten bestand.
Nicht dass wir mittellos gewesen wären. Hatte ich doch kurz vor unserer Hochzeit meine Stelle beim kantonalen Vermessungsamt angetreten und Monika hatte weiter Schule gegeben. Im Herbst hatte sie aufgehört die Pille einzunehmen und war bereits zwei Monate darauf schwanger geworden. Obwohl ihr häufig unwohl war und sie morgens erbrechen musste, liess sie ihre Klasse nie im Stich und liess keine einzige Schulstunde ausfallen. Ich bewunderte ihre Kraft, ihren Mut und ihre Willensstärke.
Die Reise in die Provence war ihre Idee gewesen. In einem der Bücher, welche ich im Hinblick auf die Geburt und meine künftige Rolle als Vater aus der Bibliothek nach Hause gebracht hatte, war der siebte Schwangerschaftsmonat als besonders heikel beschrieben worden. Monika nahm meine Bedenken jedoch auf die leichte Schulter und als auch noch Dr. Bär, ihr Frauenarzt, ihre Ferienpläne unterstützt hatte, musste ich kapitulieren. Nach dem Vorfall in jener Nacht hatte ich kein Auge mehr zugetan. Ich sorgte mich um unser Kind und befürchtete, die Aufregung könnte ihm schaden. Mit dem Vorschlag, die Ferien vorzeitig abzubrechen, drang ich nicht durch, aber wir einigten uns wenigstens darauf, von nun an nur noch auf offiziellen Campingplätzen zu nächtigen.
Das relativ teure Nachtessen war in jeder Beziehung ein Volltreffer gewesen. Wir liessen uns die Schmeicheleien des charmanten Kellners gefallen und genossen die typisch südfranzösische Küche. Selbst die Tatsache, dass Monika während des Fussmarsches zum Campingplatz das gute Essen im Strassengraben zurücklassen musste, konnte uns die Stimmung nicht wirklich verderben.
***
Der Chef de Service behauptete, Jean Vilar habe 1971 noch am Tag vor seinem Tod im «Hiely» das heute nach ihm benannte Menü gegessen. Meine Frage, ob besagte Mahlzeit etwas mit dem Ableben des grossen Theatermannes zu tun gehabt habe, fand der bis dahin ausserordentlich freundliche Herr jedoch gar nicht lustig, und er schenkte mir keinen einzigen Blick mehr. Trotzdem genoss ich das Essen in vollen Zügen.
Das «Amuse-Bouche», welches wie in jedem guten französischen Restaurant offeriert wurde, liess bereits die Vorfreude aufkommen. Drei kleine rouladenähnliche Häppchen mit verschiedenen Fleisch- und Fischpasten wurden mit den jeweils passenden Sösschen dargereicht.
Das Gemüse-Trüffel-Risotto, welches als Vorspeise serviert wurde, war ein echter Hochgenuss. Nicht umsonst hatte die französische Schriftstellerin Colette den Trüffel als «Juwel der Erde» bezeichnet. Der Kellner, der mir nach der Verstimmung des Chef de Service gar noch um eine Spur freundlicher erschien, hatte mich mit einem schelmischen Grinsen daran erinnert, dass der Trüffel, der auch etwa «Gaumenkitzler» genannt wird, aphrodisiakische Eigenschaften nachgesagt würden. Ich grinste zurück und dachte mir, wenn’s nichts nütze, dann schade es wenigstens nicht.
Mit grossem Tamtam wurde der Hauptgang aufgetischt, welcher all meine Erwartungen übertraf. Das rosa gebratene Lammkarree war butterzart, das Peperonigemüse hatte den nötigen Pfiff und die beiden Saucen ergänzten das Ganze hervorragend.
Dann kam die übliche Qual der Wahl: Dessert oder Käse? Ich erinnerte mich daran, dass Monika damals einen imposanten Dessertwagen mit rund zwanzig verschiedenen Desserts zur Auswahl vorgeführt bekommen hatte. Bedauernd erklärte mir der Chef de Table, dass er häufig auf diese früher weit herum bekannte «Hiely»-Attraktion angesprochen werde, obwohl diese bereits vor ein paar Jahren eliminiert worden sei.
Ich entschied mich schliesslich für den Käsewagen und wurde nicht enttäuscht. Die enorme Palette hatte ich zwar erwartet, aber das Spezielle waren die für mich ungewohnten Zutaten. Neben Trauben, Nüssen und Kümmel bot mir der Kellner hausgemachte Konfitüren an. Auf meinen fragenden Blick versicherte er mir, das sei durchaus ernst gemeint und empfehlenswert, was ich ihm danach auch bestätigen konnte.
Mit vollem und schwerem Magen entschloss ich mich nach dem Verlassen des hervorragenden Restaurants zu einem Verdauungsspaziergang. Die engen Ladenstrassen mit den herunter gelassenen Metallrollladen waren nun abgesehen von ein paar Nachtschwärmern praktisch ausgestorben. An der Rue Galante hatte sich ein Obdachloser in einem Hauseingang mit alten Kartonschachteln ein Nachtlager eingerichtet. Hinter der Kirche Saint Didier standen ein paar junge Leute albernd und kichernd unter einer Strassenlaterne zusammen. Beim Vorübergehen stieg mir der unverwechselbare Geruch eines Joints in die Nase.
An der Ecke «Rue des Lices» / «Rue du Portail Magnanen» hörte ich Musik. Obwohl ich die «Bar du Sud» nicht als besonders einladend empfand, trat ich ein, um mir noch einen Digestif zu gönnen. An der Theke hingen zwei laut gestikulierende Männer und begrüssten mich mit der Aufforderung, ihnen etwas zu spendieren. Ich ignorierte sie und bestellte mir einen Calvados.
Nachdem die zwei alkoholisierten Typen das Lokal verlassen hatten, war ich der einzige Gast in der Bar. Ich unterhielt mich mit dem buckeligen Kellner, der eigentlich eher dem Klischee eines Piraten entsprach als jenem eines Barkeepers. Wir hatten etwa eine Viertelstunde über die aktuellen Sportereignisse gefachsimpelt, als die Türe wieder aufging und eine junge Frau eintrat, die trotz der vorgerückten Stunde allein zu sein schien. Ich war perplex, denn die späte Barbesucherin wies eine frappante Ähnlichkeit mit meiner Tochter auf.
***
Das Verhältnis zu Suzanne konnte eigentlich nicht als normale Vater-Tochter-Beziehung bezeichnet werden. Nach Monikas Tod war ich froh gewesen, dass Annemarie und Erwin bereit waren, die Kleine zu sich zu nehmen. Für meine Schwägerin war diese Hilfe nicht nur eine familiäre Pflicht. Nach der schwierigen Geburt von Rolf hatten ihr die Ärzte von einer weiteren Schwangerschaft abgeraten und sie hatte sich nur widerwillig in ihr Schicksal gefügt. Mit Suzanne war auf eine Art ihr Wunsch nach einem zweiten Kind in Erfüllung gegangen.
Da ich in all den Jahren nie daran gedacht hatte, eine neue Beziehung einzugehen und für meine Tochter eine Stiefmutter zu suchen, wuchs Suzanne zusammen mit ihrem Cousin Rolf in Interlaken auf und gehörte zur Familie meines Bruders. Wir hatten vereinbart, Suzanne erst auf ihren Schuleintritt hin über ihre Herkunft aufzuklären. Bis zu diesem Zeitpunkt hielt sie mich für ihren Onkel und hatte danach Mühe, mich als ihren Vater zu akzeptieren.
Erst nachdem sie sich entschlossen hatte, wie ihre Mutter Lehrerin zu werden und in Spiez das damals noch bestehende Seminar zu besuchen, fand sukzessive eine Annäherung zwischen uns statt. Wir trafen uns ab und zu in Bern, ich lud sie zum Essen sowie zu Konzert- oder Theaterbesuchen ein und manchmal übernachtete sie sogar bei mir in Bümpliz, wenn sie den letzten Zug ins Oberland nicht mehr erreichen konnte.
Dieses freundschaftliche Verhältnis pflegten wir auch weiter, nachdem sie in Ostermundigen als Lehrerin an die Unterstufe gewählt worden war. Bereits während des Seminars hatte sie sich bei den Jungsozialisten engagiert und an Aktionen von Greenpeace teilgenommen. Ich schätzte es, mit ihr über Gott und die Welt zu diskutieren und bewunderte ihre unabhängige und dezidierte Meinung. Ich war stolz auf sie, als sie in Ostermundigen als jüngstes Mitglied in den Grossen Gemeinderat gewählt worden war und wenn ich in der Zeitung von ihren Vorstössen und politischen Aktionen las. Als sie und Jürg beschlossen hatten, zu heiraten, wurde ich als einer der ersten eingeweiht, und ich verstand mich mit ihrem Mann recht gut. Um so mehr Mühe machte mir das Unverständnis, mit dem die beiden reagiert hatten, als ich ihnen von Brigitte erzählt und ihnen eröffnet hatte, dass ich in die Provence ziehen würde.
***
«Tu es triste?», fragte mich das Ebenbild meiner Tochter unvermittelt und riss mich aus dem grüblerischen Tagtraum.
Sie legte ihre kleine Hand auf meinen Unterarm, sah mich treuherzig an und stellte sich als «Elodie» vor. Ich musste eine ganze Weile in meine Gedanken versunken gewesen sein, denn die Cola-Rum, welche sie bestellt hatte, war bereits leer. Nein, traurig sei ich nicht, antwortete ich, aber müde. Ich bestellte für mich einen zweiten Calva und für sie eine weitere Cola. Zum Dank bekam ich einen Kuss auf die rechte Wange und beim Anstossen unserer Gläser überrumpelte sie mich mit der Frage
«Tu veux faire l’amour avec moi?»