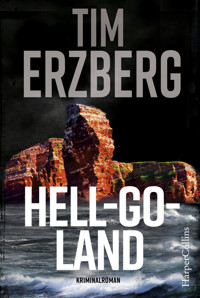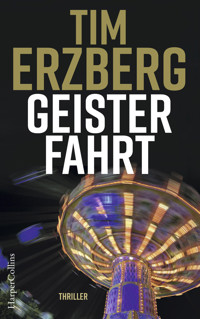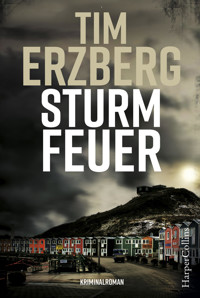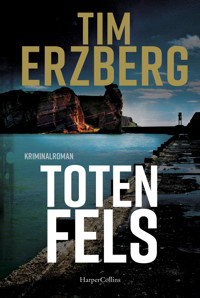
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Krimi
- Serie: Anna Krüger
- Sprache: Deutsch
Helgoland. Auf der Hochseeinsel wird ein monströser Blindgänger gefunden. Wenn die Bombe explodiert, könnte das verheerende Folgen haben. Die Entschärfungsarbeiten gestalten sich schwierig. Und dann wird in einem Tunnel im Felsen auch noch eine Leiche gefunden, die zahlreiche Rätsel aufgibt. Während sich Anna Krüger und ihre Kollegen von der Helgoländer Polizei mit dem Kampfmittelräumdienst und der Kripo auseinandersetzen müssen, beginnt ein Unbekannter ein mörderisches Spiel mit der jungen Polizistin zu treiben. Und alles Böse, was der Insel und Anna widerfahren ist, fügt sich plötzlich zu einem scheinbar unentrinnbaren Albtraum.
»Meisterhaft erzählt, höchst spannend und sehr bewegend.« SR3 über Sturmfeuer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2020 by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Copyright © 2020 by Tim Erzberg
Covergestaltung: Büro für Gestaltung / Cornelia Niere, München Coverabbildung: plainpicture / C. Müller, Gordan / Shutterstock Lektorat: Thorben Buttke E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959679183
www.harpercollins.de
Prolog
18. April, 12.04 Uhr. Noch 56 Minuten bis zum großen Inferno.
Die See war ruhig. So ruhig, als wäre dies ein ganz normaler Tag in der Geschichte der Insel. Der Nordsee. Der Menschheit. Die meisten Schiffe hatten sich bereits auf ihre vorgesehene Position begeben, nur einige kleinere Schnellboote lagen noch an den provisorisch wieder instandgesetzten Kais. Doch auch sie würden in wenigen Augenblicken ablegen und sich auf eine Entfernung von mindestens neun Seemeilen zurückziehen. Ein Abstand, der von den Experten des Teams bestimmt worden war: eine Sicherheitsmaßnahme, die alle Eventualitäten berücksichtigte: Druckwellen, Splitterschutz, Aschewolken, Flutwellen. Alle Faktoren waren berechnet worden. Zumindest all diejenigen, von denen die Experten wussten. Doch niemand ist im Besitz aller Informationen, nicht einmal diejenigen, denen das Leben ihrer Untergebenen anvertraut ist.
1
1
SONNTAG
Natürlich musste das an einem Sonntag passieren. Die Insel bekam kaum Luft vor lauter Touristen, der Südstrand war voll von Spaziergängern, Dutzende Kinder tummelten sich auf den Spielplätzen, die Fähren waren bis auf den letzten Platz besetzt, um Ausflügler auf die Düne zu bringen oder von dort zurück auf die Hauptinsel. Vor den Strandcafés warteten die Leute auf einen freien Tisch – und oberhalb der Hummerbuden, wo sich, wie an solchen Tagen üblich, zahllose Menschen zu Krabbensalat, Fischbrötchen, Knieper oder auch nur zu einem Bier versammelt hatten, war geschehen, was irgendwann hatte geschehen müssen: Ein Teil des Hanges war abgerutscht. Eigentlich waren ja gerade Sicherungsarbeiten im Gange gewesen. Aber die Arbeiter waren wegen der starken Regenfälle in der letzten Woche nicht schnell genug vorangekommen. Anna hatte es geahnt. Sie hatte die Baustelle mehrmals besucht, hatte sorgenvoll auf die Stahlträger geblickt, die noch unverbaut an der Seite lagen, statt das Erdreich zu stützen. Und es war eingetreten, was hatte eintreten müssen: Die Arbeiter waren weg – und der Hang war abgesackt. Nur einige Meter. Es waren keine Menschen zu Schaden gekommen. Ein kleiner Teil des Invasorenpfads war verschüttet worden, aber man konnte noch seitlich daran passieren, vorausgesetzt, es kam nicht zu weiteren Erdrutschen. Im ersten Moment hatte Anna sogar eine Art Genugtuung empfunden, weil man ihre Sorgen nicht ernst genommen hatte. Doch dann hatte sich die ganze Dimension des Problems gezeigt. Und es war eine Dimension, die man nicht einmal ansatzweise einschätzen konnte – weder sie noch Paul Freitag, ihr Vorgesetzter, noch gar die Arbeiter, die angesichts des Problems im ersten Moment die Panik gepackt hatte.
Und nun saßen die Inselbewohner auf einem Pulverfass – wortwörtlich. Eine kleine Veränderung, eine Unachtsamkeit, eine unbedachte Aktion und es würde zur Katastrophe kommen. Helgoland war eine zauberhafte Insel. Immer gewesen. Oder jedenfalls fast immer. Aber sie war auch eine zerbrechliche Schönheit. Mehr denn je. Der Fels im Meer, er bot den Menschen Schutz. Aber er war auch auf den Schutz durch die Menschen angewiesen. Eine Gefahr, wie sie jetzt eingetreten war, war schlicht nicht mehr vorgesehen für diese Insel. Auch wenn sie immer wieder eintrat. Immer noch. Nach all den Jahren und Jahrzehnten.
»Wir werden evakuieren müssen«, sagte Paul, der unbemerkt neben seine Kollegin getreten war.
»Sicher«, erwiderte Anna. »Je schneller, desto besser.«
»Ausgerechnet am Sonntag.«
»Solche Dinge geschehen immer zur Unzeit.«
Paul seufzte. »Ich habe schon mit dem Bürgermeister, mit den Reedereien, mit der Kurverwaltung und mit der Hafenmeisterei gesprochen.«
»Der Hafenmeisterei?«
»Wenn es schnell gehen muss, brauchen wir auch die Frachtschiffe. Da können wir nicht warten, bis uns Cassen Eils ihre Flotte rüberschickt.«
Anna betrachtete das Monster, das vor ihnen aus der Erde ragte, und atmete schwer. »Wir werden aufpassen müssen, dass keine Panik ausbricht.«
»Wir werden warten, bis die Tagestouristen wieder weg sind. Dann informieren wir die Insulaner und die Übernachtungsgäste.«
Anna nickte. »Das klingt sinnvoll. Wie lange werden wir brauchen?«
»Beim letzten Mal waren es zwei Tage.«
»Das war im Winter, oder?«
»Ja. Da hatten wir nur die tausend Menschen zu evakuieren, die auf der Insel leben.«
»Wie viele haben wir aktuell?«
»Elftausendvierhundert.«
»Davon fünfzehnhundert Einheimische.«
»Yup. Die sind das Problem.«
Anna musste lächeln. Die Halunder waren ein sympathisches Völkchen, vor allem aber ein eigensinniges. Einem echten Helgoländer zu sagen, er müsse seine Insel verlassen, war ein mehr als schwieriges Unterfangen. Die Insulaner hatten den Fels mehr als einmal verlassen müssen. Jedes Mal zwangsweise. Und ihre Rückkehr war stets ungewiss gewesen. »Wir könnten sie auf den Nordteil evakuieren«, schlug sie vor.
»Vielleicht«, entgegnete Paul. »Wir können es sowieso nicht selbst entscheiden. Aber wenn ich mir das Ding so ansehe … Ich schätze, das Problem ist zu groß, um nur ein klein wenig in Deckung zu gehen.«
Trotz des milden Tages und der strahlenden Sonne lief Anna ein Schauder über den Rücken. Ja, das Ding hatte etwas Furchterregendes. Und das lag nicht nur an seinem Bestimmungszweck, sondern auch daran, dass es so groß war, wie Anna es bisher nur an einem Ort gesehen hatte: drüben beim Schwimmbad. Da hatten sie so eines ausgestellt oder vielmehr: aufgestellt. Eine Fünftausendkilo-Bombe, ein Monstrum mit einer Zerstörungskraft, die man sich in friedlichen Zeiten kaum vorstellen konnte. Und hier ragte sie aus dem Erdreich wie ein schlafendes Raubtier, das, wenn man es weckte, alles zerreißen würde, was ihm unterkam. »Mitten im Ozean schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer, tief auf dem Grunde«, flüsterte Anna.
Paul atmete schwer. Dann sagte er mit rauer Stimme: »Ein einziger Schrei – die Stadt ist versunken, und Hunderttausende sind ertrunken.« Trutz, Blanke Hans, dachten sie beide, und jeder von ihnen wusste, dass der andere es dachte. Liliencrons altes Gedicht über die legendäre Stadt Rungholt, das sie alle in der Schule gelernt hatten, das jeder Halunder kannte und an das jeder bei jedem Sturm dachte. Das Lied von der Insel, die in der Nordsee versunken und von der nur noch die Erinnerung geblieben war. Ob es dem roten Felsen einst auch so ergehen würde? Ob der Tag womöglich näher war, als sie es sich hätten ausmalen können?
Als hätte er ihre Gedanken gelesen, erklärte Paul: »Eine einzige Bombe wird die Insel nicht versenken.«
»Nein, Paul. Das wird sie nicht. Sie kann Menschen töten, aber nicht Helgoland.«
Denn auch das wussten die Insulaner: Helgoland war unsinkbar. Zumindest beinahe. Die Insel hatte unendlich schwere Bombardements überlebt, sie würde nicht an einem einzelnen Monstrum zugrunde gehen, wie groß es auch sein mochte. Und dieses Monstrum war groß. Riesig.
*
Natürlich hatte sich der Fund herumgesprochen. Doch statt sich in sicherer Entfernung zu halten, drängten sich immer wieder und immer mehr Neugierige um die Fundstelle. Anna wurde übel, wenn sie sich bewusst machte, dass etliche der Schaulustigen praktisch genau unterhalb des Blindgängers standen, um mit ihren Handys die besten Fotos für ihre Profile zu schießen. Wenn das poröse Erdreich nur ein wenig mehr nachgab, musste das verfluchte Ding nicht einmal explodieren, um Menschenleben zu kosten. Der Koloss war schwer genug, ein Dutzend Umstehende in den Tod zu reißen oder schwer zu verletzen.
Natürlich hatten sie die Fundstelle notdürftig mit Absperrband gesichert. Und jetzt hielt Anna Wache, während Saskia sich um die Polizeistation kümmerte und Paul das weitere Vorgehen mit der Verwaltung besprach und alle darauf warteten, dass der Kampfmittelräumdienst auf die Insel kam. Ein Einsatz der Seenotrettung verbat sich, weil im Notfall Verletzte evakuiert werden mussten. Also hatte Paul die Küstenwache organisiert, die bereits mit mehreren Spezialisten auf dem Weg war und voraussichtlich in zwei Stunden eintreffen würde. Ein Vorauskommando war inzwischen in der Luft und musste jeden Augenblick auf der Düne landen. Immerhin war die MS Helgoland inzwischen ausgelaufen und der Halunder Jet hatte die Motoren angeworfen, sodass bald eine große Anzahl an Touristen die Insel würde verlassen haben. Jeder Mensch weniger, der sich in dieser Situation auf der Insel aufhielt, war ein Risiko weniger.
»Ganz schönes Kaliber«, hörte Anna jemanden schräg hinter sich sagen. Sie fuhr herum, um den Mann von diesem Ort zu verscheuchen. »Oh, Herr Eck«, sagte sie. Saskias Vater, der seit einigen Monaten auf der Insel lebte. Oder vielmehr: seine Entziehungskur machte. »Ja. Ein gewaltiges Ding. Eine der größten Bomben, die die Briten für Helgoland übrighatten.«
»Aha.« Der alte Mann musterte den rostigen Koloss ungerührt. »Schon erstaunlich, dass man immer noch Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg findet, was?«
»Überhaupt nicht, Herr Eck«, erwiderte Anna. »Seit Kriegsende waren es allein auf Helgoland über zweitausend.«
»Zweitausend! Mein Gott …«
»Es sind jedes Jahr mehrere.« Sie betrachtete das Monstrum, das nur sechs oder sieben Meter entfernt aus dem Erdreich ragte. »Aber es war noch nie eine so große. Zumindest nicht, soweit ich weiß.«
»Das heißt, Sie wissen gar nicht, was passiert, wenn das Ding hochgeht.«
»So kann man es sagen.«
Es war schon bemerkenswert. Sie hatte Eck auf dem Dom in Hamburg kennengelernt, einen Penner, der mit Glück eine Schussverletzung überlebt, obwohl er eigentlich schon mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Ein verrückter Zufall hatte es gewollt, dass er bei der Gelegenheit seiner Tochter wiederbegegnet war, nach vielen Jahren: Saskia Berneking, Annas Kollegin. Aber dass Saskia ihn zu sich auf die Insel holen würde, damit er wieder zurückfände in ein normales Leben, damit hätte Anna nie gerechnet. Nicht bei Saskia, die ein Biest war, eigensüchtig, eitel und lebenshungrig – vor allem: männerhungrig. Und doch hatte sie es getan. Also war Eck seit einigen Monaten im Inselklinikum untergebracht, das zwar keine Entzugsklinik war, aber immerhin seine neurologischen Ausfälle behandeln konnte. Dass man ihn nebenbei auch noch möglichst schonend trockenlegte, war ein Deal, den Paul für die junge Kollegin eingefädelt hatte.
»Dann hoffen wir mal das Beste«, sagte Eck und winkte müde. »So ein schönes Fleckchen Erde. Wäre ein Jammer, wenn ihm was passieren würde. Und den netten Menschen hier …« Er blickte Anna vielsagend an. »Ja«, murmelte sie und sah ihm hinterher, wie er zum Klinikum hinunterging. »All die netten Menschen hier.«
Zweitausend Bomben. Und doch hatte es sich ergeben, dass sie selbst noch nie bei einer Entschärfung hatte dabei sein müssen. Einmal hatte sie die Stellung auf der Hauptinsel gehalten, während die Männer vom Kampfmittelräumdienst drüben auf der Düne eine Fünfzig-Kilo-Bombe unschädlich gemacht hatten. Einmal war sie nicht auf der Insel gewesen. Einmal war es nur eine verrostete Wassermine gewesen, die die Spezialisten auf die hohe See gezogen und dort kontrolliert gesprengt hatten. Und jetzt dieses gigantische Mordwerkzeug! Es gab auf der Insel einen Krater, einen einzigen, der von einer solchen Bombe in den Fels gerissen worden war, mitten auf dem Oberland. Ein beliebtes Fotomotiv. Das Loch war so groß, dass man ein ganzes Haus darin hätte versenken können. Wenn diese Bombe hier hochging, dann …
Eine kleine Maschine kam aus Richtung Elbmündung herein, um auf der Düne zu landen. Vielleicht der Sprengmeister. Anna atmete auf. Auch wenn er das Monstrum nicht würde entschärfen können, solange nicht mindestens ein Großteil der Insel evakuiert war, war es doch beruhigend zu wissen, dass es zumindest einen Menschen auf Helgoland gab, der sich mit den Dingern auskannte und die konkrete Gefahr wirklich einschätzen konnte.
Sie konnte sehen, wie Paul die Polizeistation verließ und sich auf den Weg Richtung Landungsbrücke machte, wo die Profis mit der Fähre anlanden würden. Er blickte zu ihr herauf und winkte ihr zu. Zögerlich winkte Anna zurück, die von einem plötzlichen stechenden Schmerz in ihrem Kopf getroffen wurde. Stalin. Ihr persönlicher Folterknecht. Der offenbar unauslöschliche Schmerz ihres Lebens. Ein düsterer, perfider Begleiter, der sie immer dann packte, wenn sie nicht mit ihm rechnete. Sie musste nach Hause, brauchte ein paar Tabletten, um das Schlimmste in den Griff zu bekommen. Doch momentan konnte sie hier nicht weg. Denn es gab noch Schlimmeres als das Schlimmste. Und das lauerte in ein paar Schritten Entfernung und wartete seit über siebzig Jahren darauf, sein mörderisches Werk zu Ende zu bringen.
*
Zum wiederholten Male checkte Anna ihre Wetter-App. Regen für die nächsten Tage. Der Vorteil: Es würden weniger Touristen auf die Insel kommen – wenn man sie denn überhaupt noch kommen ließ. Der Nachteil: Der verdammte Hang würde nicht gerade stabiler werden, wenn er sich noch weiter mit Wasser vollsog. Man konnte nur hoffen, dass die Bombe nicht so gefährlich war, wie sie aussah. Oder dass der Sprengmeister sie ruckzuck entschärfte. Was nicht zu erwarten war. Denn nach allem, was Anna wusste, gingen die Spezialisten sehr sorgfältig vor – und das kostete Zeit.
Nun saß sie in der kleinen Polizeistation der Insel, wo sie Saskia abgelöst hatte, die ihrerseits auf Posten am Hang gegangen war. Am Falm, genauer gesagt, jenem vordersten Rand des Oberlands, der sich dreißig Meter über den unteren Teil der Insel erhob. Auf dem Bildschirm hatte sie die Fotos aufgerufen, die sie von der Szenerie gemacht hatten. Natürlich hatten die Kollegen von der Inselverwaltung schon versucht, die Bombe mit Blindgängerkarten abzugleichen. Das taten sie jedes Mal, und sie taten es jedes Mal vergeblich. Denn es war sinnlos, einzelne Sprengsätze lokalisieren zu wollen. Helgoland war wie kein anderer Ort auf dem Planeten bombardiert worden. Buchstäblich. Nirgendwo sonst waren auf so engem Raum so viele Bomben gefallen. Die Hölle. Hell-go-Land hatten die Briten die Insel getauft. Zu Recht. Es war ein Wunder, dass der Fels wieder bewohnbar gemacht werden konnte. Nein, eigentlich war das Wunder, dass es ihn überhaupt noch gab.
Das Telefon klingelte. Anna hob ab. »Polizei Helgoland«, sagte sie automatisch.
»JVA Kiel hier«, meldete sich eine Stimme am anderen Ende der Leitung. »Frau Krüger?«
»Am Apparat.«
»Es gibt eine unschöne Nachricht.«
»Eine unschöne Nachricht?« JVA Kiel. Anna spürte, wie sich die Härchen an ihren Armen aufstellten. Sie wusste, wer dort einsaß. Natürlich. Und sie wusste, warum. »Was ist denn geschehen, Herr Kollege?« Doch sie wusste es im selben Augenblick. Und als der Vollzugsbeamte es aussprach, da hätte sie die Worte mitsprechen können: »Ihr Kollege … Ihr ehemaliger Kollege Weber hat sich das Leben genommen.«
»Ja«, sagte Anna leise. »Ich weiß.«
»Sie wissen?«
»Entschuldigen Sie, so habe ich es nicht gemeint«, erklärte Anna, der plötzlich Tränen in die Augen schossen, obwohl es verrückt war. Weinte sie tatsächlich um den Mann, der sie beinahe ermordet hätte? Sie räusperte sich. »Ich habe es mir gedacht, als Sie sagten, es gebe eine unschöne Nachricht.« Eine unschöne Nachricht. War es das für die Vollzugsbeamten? Durfte man beim Tod eines Menschen von einer »unschönen Nachricht« sprechen? War es nicht eine Tragödie? War es nicht letztlich einfach nur traurig? Trotz allem? »Wie ist es geschehen?«, wollte sie wissen.
»Er hat sich in seiner Zelle erhängt.«
»Sie haben ihm nicht …?«
»Natürlich gab es in seiner Unterkunft keine Kabel, keine Seile, keine Betttücher.« Der Mann sog genervt die Luft ein. »Oder gar Gürtel, falls Sie das annehmen. Aber wir können den Insassen ja schlecht die Hosen abnehmen. Nicht wahr, Frau Krüger?« Er schwieg. Er wusste es. Wusste, dass Anna der Grund war, weshalb Marten zum Mörder geworden war. Dass sie außerdem beinahe sein Opfer geworden wäre. Dass sie es war, die ihn überführt hatte und trotzdem in seine Falle gegangen war. Das alles wusste er natürlich. Denn alle, die den Fall Marten David Weber kannten, wussten es.
»Tja«, sagte der Vollzugsbeamte. »Nun wissen Sie Bescheid.«
»Wann wird er beerdigt?«
»Er wird eingeäschert«, erklärte der Mann.
»Aha. Und wann ist dann die Beisetzung?«
»Das …« Ein Zögern. »Das lässt sich noch nicht sagen. Zuerst muss die Pathologie mit ihm fertig sein. Ich meine: Muss ihn der Pathologe …« Wie seltsam seine Stimme klang. »Freigegeben haben. Seinen Körper. Und dann bestimmt der JVA-Leiter einen Termin für die …«
»Entsorgung«, vollendete Anna bitter den Satz.
»Beisetzung«, murmelte der Vollzugsbeamte. Ein erneutes Zögern. »Also, ich spreche mit Frau Krüger, ja?«
»Anna Krüger, POM.«
»Tja, Frau Krüger, dann kann ich es Ihnen auch direkt sagen …«
»Direkt sagen? Was denn?«, fragte Anna irritiert. Was für ein merkwürdiger Mensch. Was für ein seltsamer Anruf.
»Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. An Sie.«
»An mich.« Sie atmete tief durch. Der Abschiedsbrief eines Mörders und Psychopathen. Wollte sie den haben? Weshalb sollte Marten ihr einen Abschiedsbrief schreiben, nachdem er sie beinahe umgebracht hätte? Andererseits war es ja Liebe gewesen, die ihn in seinem Wahn bestärkt hatte. Oder etwas, von dem er glaubte, dass es Liebe sei. Es schauderte sie, wenn sie sich überlegte, dass er auch nach den Vorkommnissen in jener schrecklichen Nacht, nach dem Gerichtsverfahren, der Zeit in der Psychiatrie, nach den Jahren in Haft noch an sie dachte. Dass seine letzten Gedanken ihr gegolten hatten! Sie mochte sich nicht ausmalen, welche Gedanken das gewesen waren. »Ich nehme an, Sie werten das Schreiben noch aus?«, fragte sie.
»Ja«, bestätigte der Justizbeamte. »Das müssen wir leider.«
»Natürlich.« Es gab kein Briefgeheimnis für Strafgefangene. »Und danach?«
»Danach würden wir es an Sie schicken, nehme ich an. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft keine Einwände hat.«
»Die Staatsanwaltschaft? Was sollte sie dagegen haben?«
»Es war ein gewaltsamer Tod«, sagte der Mann am anderen Ende. »Zunächst muss Fremdverschulden ausgeschlossen werden …«
»War er nicht in einer Einzelzelle untergebracht?«
»Doch, natürlich. Aber wenn keine natürliche Todesursache vorliegt, gehört es zur Routine, dass … das müssten Sie eigentlich wissen.«
»Ja«, bestätigte Anna. »Sicher. Ich weiß.« Für einen Moment herrschte Schweigen zwischen ihnen. »Danke«, sagte sie schließlich und legte auf.
*
Natürlich war ihr erster Impuls, Paul anzurufen und ihm diese traurige Neuigkeit mitzuteilen. Aber Paul war in diesen Minuten mit den Kampfmittelbeseitigern im Gespräch und überhaupt im Stress wegen der bevorstehenden Evakuierung. Sie würde es ihm später erzählen. Jetzt sollte sie erst einmal rüber zur Fundstelle und auf weitere Anweisungen warten. »Frau Schneider?«, rief sie hinüber ins Büro.
»Ja, Frau Krüger?«
»Ich bin kurz weg.«
»Alles klar. Ich weiß ja, wie ich Sie erreiche.«
Anna schnappte sich ihre Jacke und – einem Impuls folgend – die Dienstwaffe, die sie nicht immer bei sich trug. Das hier war schließlich eine kleine friesische Insel und kein Ghetto.
*
Ein Gesicht, das niemand sehen würde. Niemals. Die Perücke lag auf dem Nachttisch, die Wimpern klebten noch an den Fingern. Die Tränen hatten das Make-up verschmiert. Die Werte? Egal. Sie wollte sie nicht wissen, ließ den Brief ungeöffnet. Sie spürte es auch so, wie das Leben verrann. Ihr Leben. Unwiederbringlich. In ein paar Minuten würde sie wieder bereit sein. Bereit, das Spiel weiterzuspielen, solange es noch ging. Aber sie würde jede Minute auskosten, die ihr noch blieb, jede einzelne.
*
Allein in einer Zelle. Wie gut sie sich das vorstellen konnte. Sie starrte an die Decke. Es war Nacht. Nur der grelle Streifen, mit dem der Leuchtturm in regelmäßigen Abständen durch den Himmel säbelte, erhellte die Decke ihres Zimmers. Allein. Das war sie auch. Und würde es immer sein. Denn auch wenn sie manches Mal gedacht hatte, es gäbe eine Chance, jemanden zu finden, mit dem sie ihre Zeit verbringen konnte, jemanden, der zu ihr stehen und vor allem: der sie verstehen würde, hatte sie doch immer wieder feststellen müssen, dass am Ende nur die Einsamkeit auf sie wartete. Die Einsamkeit ihres Körpers und die ihrer Seele. Sie selbst war es, die körperliche Nähe nicht aushielt – und eine unsichtbare Wand war es, die weder sie noch die anderen durchdringen konnten, ein gläsernes Gefängnis, in dem nur sie allein saß. Und Stalin. Der stete Begleiter, der ihr das Leben zur Hölle machte. Manchmal schien es ihr geradezu, als wäre Stalin der Einzige, der sie verstand, ihr Kopfschmerz, der jeden Gedanken im Voraus ahnte, jede Gefühlsregung vorwegnahm und jeden kleinsten Hoffnungsschimmer in ihr schon kannte, ehe sie selbst ihn entdeckt hatte. Und der immer im perfekten Augenblick sein Messer zückte, um es ihr in den Schädel zu treiben: im Augenblick der Schutzlosigkeit, wenn es am meisten schmerzte und ihre Seele am meisten peinigte. Ja, Stalin kannte ihre Seele. Besser als sie selbst.
Natürlich konnte sie nicht schlafen, auch wenn der finstere Geselle in ihrem Kopf sich nicht regte. Sie hatte das Fenster weit geöffnet, um die kühle Nachtluft hereinzulassen. Der Wind trug den Lärm der Wellen herüber und den Schrei einiger Vögel. Morgen um sechs Uhr würde sie wieder zum Dienst antreten. Drüben am Falm, gar nicht weit von ihrer Wohnung entfernt. Aber auf Helgoland, dieser winzigen Insel, war ja nichts jemals weit entfernt. Sie fragte sich, ob auch dieses Haus in Gefahr war, wenn das Ding hochging. Andererseits war der Sprengmeister ziemlich entspannt gewesen. Er hatte die Bombe respektvoll angesehen, hatte ein wenig mit den Stahlkappen seiner Arbeitsschuhe im Erdreich gescharrt, zum Himmel geblickt und dann erklärt: »Ab Sonnenaufgang müssen wir mit den Sicherungsarbeiten beginnen, während wir auf die Geologen warten.«
»Die Geologen?« Anna betrachtete die Situation. »Das ist doch eigentlich alles ziemlich offensichtlich hier, oder?«
»Ist es das?«, fragte Klüver, der Sprengmeister. »Können Sie sagen, wie es um die Festigkeit des Untergrunds bestellt ist? Ob es hier Verwerfungen gibt? Frakturen im Fels, Einschlüsse aus früheren Sprengungen?«
Anna blickte verlegen zur Seite. »Nein«, sagte sie. »Natürlich nicht.«
»Eben. Wir auch nicht. Und die Geologen werden auch nur eine Einschätzung geben können. Und ein paar konkrete Messungen anstellen, die uns zumindest Klarheit verschaffen, wo der Fels besonders sensibel ist.« Er klatschte in die Hände. »Aber erst muss sichergestellt werden, dass unser kleiner Freund hier nicht aus Zufall oder Dummheit herunterfällt und hochgeht, weil er noch ein bisschen weiter abrutscht und der Zünder ausgelöst wird.«
»Und bis dahin?«, hatte Paul gefragt.
»Bis dahin hilft am besten Beten.«
Ein Blick zur Uhr auf dem Nachttisch sagte Anna, dass noch fast fünf Stunden übrig waren bis zum Start der Arbeiten. Sechs Uhr. Um halb sechs würde sie aufstehen, duschen und sich auf den Weg machen. Vielleicht würde sie bis dahin sogar ein paar Minuten geschlafen haben. Es wäre ihr leichter gefallen, hätte sie nicht unablässig an Marten denken müssen. Über ihr hing die Lampe von der Decke. Immer, wenn der Lichtstrahl des Leuchtturms vorüberschwenkte, warf er einen schrägen Schatten an die gegenüberliegende Wand – und die Lampe sah aus, als wäre sie ein Gehenkter am Seil. Das Schlimmste war, dass Anna dieses Bild auch vor sich sah, wenn sie die Augen schloss. Es hatte einen Abdruck auf ihrer Netzhaut hinterlassen, der jedes Mal sichtbar wurde, wenn das Licht wiederkehrte. Wieder und wieder und wieder.
*
Sie musste doch eingenickt sein. Denn als sie wieder auf die Uhr blickte, war es nach drei. Durch das geöffnete Fenster drang kalte Luft. Anna fröstelte. Sie zog die Bettdecke weit über sich und versuchte wieder einzuschlafen. Doch die Kälte war ihr schon unter die Haut gekrochen. Also stand sie auf, um das Fenster zu schließen. Ein Blick hinüber zum Friedhof ließ sich nicht vermeiden, ein Blick dorthin, wo Leo seine letzte Ruhe gefunden hatte – ehe er noch so richtig hatte leben können. Als Anna vor bald drei Jahren die Wohnung in der Kirchstraße gefunden hatte, war sie froh gewesen, ihrem Jugendfreund so nahe sein zu können. Doch nach allem, was seither geschehen war, dachte sie manchmal, es wäre besser, anderswo hinzuziehen, wo sie nicht täglich mit den düstersten Stunden ihrer an düsteren Stunden reichen Vergangenheit konfrontiert wäre. Mit klammen Fingern schloss sie das Fenster und war schon im Begriff, wieder zum Bett zurückzukehren, als ihr aus den Augenwinkeln eine Gestalt auffiel, die auf dem Kirchhof stand. Erschrocken drehte sie sich noch einmal um und starrte in die Dunkelheit. Dort! Zwischen Kirchturm und dem Portal zum Gotteshaus: War dort nicht der Schatten eines Menschen zu sehen? Eines Menschen, der zu ihr herüberblickte?
Unwillkürlich wich sie einige Schritte zurück in ihr Schlafzimmer. Er konnte sie hier unmöglich sehen, wer immer es war. Sie hatte kein Licht gemacht, sie stand nicht im Schein der müden Straßenlaterne. Und doch, es wirkte, als starrte der Schatten auf dem Friedhof unverwandt zu ihr her, ja geradezu in sie hinein!
Natürlich meldete sich Stalin, fing an zu bohren. Denn das Monster in ihrem Kopf liebte es ja, immer dann zur Stelle zu sein, wenn es ihr schlecht ging. Ein Schreck, worüber auch immer, war die reine Lust für den Schmerz. Er kroch aus seinem Versteck und streckte seine langen, spitzen Krallen nach ihrem Gehirn aus. Diesmal war es die linke Seite, eine Stelle hinter der Schläfe, die er packte, sodass Anna aufstöhnte, als sie sich wieder unter die Decke krümmte. Vielleicht sollte sie eine Tablette nehmen. Sonst würde sie mit pochenden Kopfschmerzen aufwachen, die sich im Lauf des kommenden Tages zu reiner Folter auswuchsen. Sie kannte sich selbst gut genug, kannte Stalin, kannte ihr Schicksal.
Eine halbe Stunde hielt sie es durch, dann griff sie nach dem Blister, der immer neben ihrem Bett lag, und drückte sich zwei Kapseln heraus, von denen sie dann doch nur eine einwarf, die sie am Wasserhahn im Badezimmer runterspülte. Doch sie legte sich nicht mehr hin. Vielmehr trat sie von der Seite ans Schlafzimmerfenster, stellte erleichtert fest, dass der Schatten verschwunden war, und fragte sich kurz, ob dieser Schatten nicht womöglich doch nur der eines Grabsteins oder Strauchs gewesen sein konnte – und jetzt weg war, weil der Mond seine Position gewechselt hatte.
Dann setzte sie sich an den Küchentisch und nahm ihr Tagebuch zur Hand, in dem sie schon so lange nichts mehr notiert hatte.
Hi Leo.
Sie haben eine Bombe gefunden. Ein großes Ding. Es macht mir Angst, wenn ich davorstehe. Es könnte doch jeden Augenblick explodieren, wer weiß das schon? Und dann wieder denke ich, lass es doch hochgehen, das hässliche Ding! Dann wären wir wieder zusammen, du und ich. Aber das weiß ja auch niemand. Wenn es sowas gibt wie ein Jenseits, lass mir doch mal eine Nachricht zukommen. Denn falls es keines gibt, dann wäre ich hier so ziemlich das Einzige, weshalb Du noch existierst. Und wenn ich auch tot bin, existieren wir beide nicht mehr.
Entschuldige. Blöde Gedanken. Ich bin verwirrt. Irgendwer hat zu mir heraufgeschaut vom Friedhof aus. Das hat mich an Marten erinnert. Ich bin ein bisschen durcheinander. Wird schon wieder. In ein paar Stunden fängt die Arbeit an. Wir werden bald die Insel evakuieren. Das bringt mich hoffentlich wieder auf andere Gedanken. Ich bin froh, wenn ich arbeiten kann. Dann muss ich nicht nachdenken. Über mich und das Leben. Und den Tod.
18. April, 12.07 Uhr. Noch 53 Minuten bis zum großen Inferno.
Das Signal. Ein hoher, durchdringender Ton. Es war nicht das erste Mal, dass sie es hörten. Immerhin hatten sie einige Probesprengungen durchgeführt. Wobei das Signal unmittelbar vor dem Auslösen einer Detonation aggressiver klang. Einerseits. Andererseits gab es nichts, was so aggressiv klang wie der Krieg selbst. Wie das Pfeifen einer Granate, die einen um Haaresbreite verfehlte. Wie das Heulen der Stukas, die auf wehrlose Zivilisten herabstürzten. Wie das Kreischen der Menschen, die zusehen mussten, wie ihre Kinder, ihre Eltern, ihre Nachbarn von Bomben zerfetzt wurden … Kannte er alles. Hatte er alles erlebt. Und noch viel mehr, was er in den Tiefen seiner Seele vergraben hatte. Nichts davon sollte jemals wieder an die Oberfläche kommen. Aber wie sollte das gehen, wenn er wieder und wieder daran erinnert wurde? Durch die Sprengungen, durch die Sirenen und durch die Erinnerungen, die ihn jedes Mal heimsuchten, wenn die Dunkelheit ihn umgab.
Auch das ein Grund, warum er die Arbeit hier unten verabscheute. Sie brachte ihn zurück in die Schützengräben und in die Luftschutzkeller und Unterstände, in die Bunker, in denen er sich in die Hosen gemacht hatte, weil über ihnen Bomben einschlugen, abgeschossene Kampfflugzeuge sich in die Erde bohrten und Panzer rollten. Alles das brachte die Arbeit in diesen verdammten Stollen zurück. Sicher war es auch der Umstand, dass es eben nicht irgendeine Arbeit war, sondern dass er seit Tagen selbst den Tod durch die unterirdischen Gänge dieses verdammten Felsens schleppte. Bomben. Granaten. Minen. All das verfluchte Zeug, das keinen anderen Zweck hatte, als Menschen in den Tod zu treiben. Oder in den Wahnsinn.
»Richard! Hast du gehört? Wir müssen rauf!«
»Nichts lieber als das, John«, rief er dem Kameraden zu. »Ich bin gleich so weit. Ein letztes Kabel noch.«
»Beeil dich.«
»Sicher. Ich bin froh, wenn das hier vorbei ist.« Die letzten Worte waren nur gemurmelt. Musste ja niemand wissen, wie sehr er unter dem Horror litt, der ihn in diesen finsteren Gängen regelmäßig anfiel. Auch wenn er letztlich selbst verantwortlich war für das, was hier geschah. Denn war es nicht seine eigene Idee gewesen? Eine verrückte Idee, halb im Scherz geäußert, auch wenn man solche Scherze besser unterließ. Und doch … Bedauerte er es? Nein. Die Deutschen hatten so viel Leid über die Welt gebracht. Sie hatten auch Richard Grenfells Familie zerstört, hatten seine geliebte Frau getötet mit einem Bombenangriff, der militärisch völlig sinnlos gewesen war. Nein, er bedauerte nicht, was er hier tat. Dass es dieses Labyrinth des Grauens bald nicht mehr geben würde, das fühlte sich richtig an. Tröstlich. Wenn man über so etwas wie Trost überhaupt nachdenken durfte angesichts dessen, was in diesem verfluchten Krieg geschehen war. Es war nur gerecht, was dieser Insel in ein paar Minuten bevorstand.
»Na?«, fragte jemand hinter ihm. »Alles erledigt?«
»Alles fest verschnürt und gut verkabelt«, erwiderte Richard.
»Fein, fein. Dann bist du jetzt dran.«
»Dran? Womit?«
»Verkabelt zu werden.« In dem Moment sah er die Waffe in der Hand des Kameraden.
2
2
MONTAG
»Rein statistisch gesehen gibt es auf diesem Flecken Erde mehr Blindgänger als auf jedem anderen des Planeten«, erklärte Klüver, während er mit dem Finger über die Landkarte fuhr.
»Wieso sollte es?«, warf Paul ein und erntete verständnislose Blicke von allen Seiten.
»Vielleicht deshalb, weil kein Ort von dieser Größe im Laufe der Menschheitsgeschichte mehr Bomben abbekommen hat als Helgoland?«, schlug Gerd Raabe von der Verwaltung vor.
Paul nickte und murmelte: »Sorry.«
»Das macht die Sache noch delikater«, erklärte der Sprengmeister. »Denn wenn das Ding hochgeht, dann müssen wir damit rechnen, dass noch mehr Blindgänger durch die Erschütterung explodieren.«
»Gibt es irgendeine Einschätzung, wie viele solche schlafenden Monster in der Erde liegen?«
Klüver schüttelte den Kopf. »Nein. In jedem anderen Fall trauen wir uns durch Auswertung von Luftaufnahmen solche Einschätzungen zu. Aber erstens ist hier nicht alle paar Meter eine Bombe gefallen, sondern auf jedem Quadratzentimeter mehrere. Und zweitens hat das Bombardement der Insel ja nicht ein- oder zweimal stattgefunden, sondern über Jahre hin wieder und wieder. Jede Luftaufnahme birgt also die Gefahr, dass es eine spätere gibt, die neue und andere Einschläge zeigt. Außerdem wurde die Oberfläche des Felsens durch die Explosionen so heftig umgepflügt, dass manches, was vielleicht einmal sichtbar war, verworfen worden ist. Im wahrsten Sinn des Wortes. Übrigens ein treffender Ausdruck!« Er blickte auf und nickte Raabe zu. »Schlafendes Monster.«
»Eine Schätzung, wie viele es insgesamt sein könnten?«
Klüver zuckte die Achseln. »In ganz Deutschland rechnet man mit siebzig- bis dreihunderttausend. Wenn ich mir die Situation hier ansehe, liegt wahrscheinlich ein Gutteil davon noch im Erdreich dieser Insel.« Er schüttelte den Kopf. »Das ist natürlich eine Übertreibung. Helgoland ist ja nach dem Dauerbombardement der Briten so sorgfältig untersucht worden wie kein anderer Ort vergleichbarer Größe in der ganzen Republik.« Raabe nickte voll Nachdruck. Es war ihm wichtig, dass kein Zweifel daran bestand, dass man auf Helgoland tat, was man nur tun konnte, um solche Gefahren zu bannen. »Dennoch …«, fuhr der Sprengmeister fort, »… kann man natürlich nicht übergehen, dass auch die Operation B. ihren Anteil an nicht gezündeten ›schlafenden Monstern‹ hier haben wird.«
»Operation B?«, flüsterte Saskia Anna zu.
»Als die Briten die Insel sprengen wollten«, erklärte die leise, aber ohne sich Mühe zu geben, dass man sie nicht hörte.
»Die Insel? Du meinst den Hafen oder so.«
»Nein, Saskia: die Insel.«
»Auch in der Hafenregion müssen wir damit rechnen, dass erhebliche Gefahren lauern«, fuhr Klüver fort und deutete auf der Karte auf die Hummerschere im Süden. »Im April fünfundvierzig haben die Briten hier mit sechsunddreißig Lancaster-Bombern ein hübsches kleines Inferno veranstaltet. Da wird sicherlich auch nicht alles hochgegangen sein, was hochgehen sollte. Aber wenn jetzt der Hang abrutscht, weil uns der Kleine da oben explodiert, dann würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass nicht auch dort noch der eine oder andere Blindgänger zündet.«
»Hm«, machte Raabe und starrte auf die Karte, als würde dort jeden Augenblick etwas Entscheidendes passieren. »Und was heißt das jetzt für uns? Was sollen wir tun?«
»Wir tun genau das, was wir sowieso getan hätten«, sagte der Sprengmeister, während er seine Brille abnahm und in die Brusttasche steckte. »Wir entschärfen das verdammte Ding.« Er hob die Hände. »Sprengen scheidet aus, liegen lassen erst recht.«
Alle Anwesenden im Stabsraum schwiegen. Lipotzki von der Feuerwehr drängte sich nach vorne. »Gibt es irgendetwas, das wir speziell tun können, außer uns für den Katastrophenfall bereitzuhalten?«
»Ich möchte, dass Sie mit den Ärzten vor Ort mehrere Sammelpunkte für Verletzte einrichten«, sagte Klüver. »Haben Sie Bergegerät?«
»Wir haben natürlich die Seilwinden an unseren Einsatzfahrzeugen. Außerdem gibt es auf der Insel mehrere …«
»Machen Sie mir eine Liste«, unterbrach ihn Klüver. »Ich möchte wissen, wie viel Mann Sie zur Verfügung haben, welches Gerät Sie zum Einsatz bringen können und wer die Koordination mit uns macht. Gibt es THW?«
»Hier!«, rief ein Mann, der etwas im Hintergrund stand. »Eine Einheit aus Cuxhaven«, erklärte er. »Wir stehen zur Verfügung.«
»Sehr gut. Bitte auch Sie: eine Liste mit allem, was Sie einbringen können.« Der Sprengmeister wandte sich an Paul, Anna und Saskia. »Und nun zu Ihnen«, sagte er. »Wenn uns das hier irgendwie aus dem Ruder läuft, dann garantiere ich Ihnen maximalen Ärger.«
»Ich verstehe nicht …«, sagte Paul.
»Natürlich nicht. Sie leben ja auch im Tal der Ahnungslosen.« Klüver seufzte. »Worauf ich jede Wette eingehe, ist, dass wir am Fundort jeden Tag haufenweise Neugierige haben werden. Machen Sie eine Ordnungswidrigkeit draus und verhängen Sie saftige Bußgelder, sonst kriegen wir das nicht unter Kontrolle.«
»Herr Klüver, Schaulustige sind nun einmal die normalste Sache der Welt«, erwiderte Paul.
»Schon klar. Aber tote Schaulustige sind eine elende Sauerei. Fast so sehr wie tote Kampfmittelbeseitiger. Und ich schwöre Ihnen, wenn Sie den Dingen nur lang genug ihren Lauf lassen, dann fliegt Ihnen irgendwann einer von denen in die Luft – und wir alle mit ihm.«
*
Wenige Augenblicke später waren die Arbeiter bereits mit dem Sprengmeister in der Besprechung darüber, welche Sicherungsmaßnahmen in welcher Reihenfolge vorzunehmen seien. Es galt zunächst, eine provisorische Stütze für den Fall zu errichten, dass sich weiteres Erdreich lösen könnte. Dann musste eine Absperrung eingerichtet werden, die den nötigen Sicherheitsabstand für Dritte gewährleistete und nicht vom leichtesten Wind weggepustet wurde. Im nächsten Schritt ging es dann darum, die Bombe selbst sorgfältig zu befestigen, ehe sich die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes unmittelbar heranwagten. Denn das Erdreich, auf dem der Blindgänger lagerte, war lose, und ein Zugriff von oben war auch nicht möglich, weil hinter dem Sprengsatz ein größerer Hohlraum vermutet wurde, möglicherweise einer von den alten Tunneln, die nach dem Krieg eigentlich so gut wie alle verschlossen worden waren, wenn sie nicht sowieso durch die vielen Explosionen verschüttet lagen.
»Können wir denn sonst irgendwas beitragen?«, fragte Paul, wie immer maximal korrekt und engagiert.
»Schaffen Sie uns einfach nur möglichst schnell die Leute vom Hals und bereiten Sie die Evakuierung sorgfältig vor«, erklärte der Sprengmeister lässig. »Der Rest ist unser Job.«
»Alles klar. Anna?«
»Ja?«
»Ich habe uns den Evakuierungsplan rausgelegt. Ist ja nicht das erste Mal. In Grün die Bereiche, für die du zuständig bist.«
»Okay. Und Saskia?«Die Kollegin stand mit zwei Männern vom Kampfmittelräumdienst etwas abseits.
»Sie übernimmt dann die pinken Bereiche.«
Die pinken Bereiche. Immerhin hatte Paul Humor. »Gut«, sagte Anna. »Dann geh ich jetzt runter zu unserem Laden.«
»Tu das. Und ich bin dann im Rathaus, damit wir uns mit den anderen koordinieren.«
Den anderen. Das waren Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, natürlich auch Seenotrettung und vor allem die Inselverwaltung, die in einem solchen Fall die Federführung innehatte.
Bei der kleinen Polizeistation standen bereits einige Menschen vor der Tür, die, wie sich rasch herausstellte, überzeugt waren, ein Fall für eine Sondergenehmigung zu sein. Denn das Evakuierungsvorhaben war offenbar bereits durchgesickert. In der folgenden Stunde musste Anna sich hauptsächlich mit Problemen herumschlagen wie: »Ich habe nur einen befristeten Forschungsauftrag. Wir arbeiten sowieso schon am Limit«, »Mein Vater hat sich das so gewünscht! Wer weiß, ob er überhaupt noch jemals …«, »Das ist nicht nur für mich wirtschaftlich wichtig, sondern auch für die ganze Insel!« oder »Die Kleine hat vierzig Fieber. Die kann ich doch jetzt nicht auf ein Schiff schleppen«.
»Wir werden uns was für Sie überlegen«, erwiderte Anna und ließ sich die Telefonnummern geben. Sie würde die Informationen an die Inselverwaltung weitergeben, die schließlich zuständig war. Natürlich war es aussichtslos, dass nennenswerte Ausnahmen gemacht wurden. Eine Bombe war eine Bombe war eine Bombe. Da konnte sonst geschehen, was wollte. Kein Forschungsauftrag rechtfertigte es, die Forscher in Lebensgefahr zu bringen, kein Lebenstraum durfte durch die Detonation eines Blindgängers zum Albtraum werden.
Als sie die Leute nach und nach wieder vor die Tür geschafft hatte, wo es inzwischen zu regnen begonnen hatte, konnte sie sich endlich mit dem Evakuierungsplan beschäftigen. »Der Bereich in Grün« war im Wesentlichen das Unterland. Paul hatte »Anna« daneben geschrieben, so wie »Saskia« neben den pink angemarkerten Bereichen im Mittelland und an der Nordseite der Insel stand, »Eversbusch« für das Hafengelände und »Paul« für alles Übrige. Eversbusch war der neue Hafenleiter. Ein ruhiger, freundlicher Mann, der nicht viele Worte machte und offenbar von Anfang an alles ziemlich gut im Griff hatte. Jedenfalls war Anna noch nichts Gegenteiliges zu Ohren gekommen, und das hieß ja was, wenn man bedachte, wie komplex die Aufgaben der Hafenmeisterei auf einer Insel wie dieser waren.
Dann gab es noch den hinter dem Hafen gelegenen militärischen Bereich, der auf dem Plan weiß geblieben war und um den sich die Bundeswehr zweifellos selbst kümmerte. Obwohl Anna gewisse Zweifel hatte, ob die Militärs ihr Gelände tatsächlich komplett räumen würden. Aber letztlich ging es hier ohnehin um eine irgendwie militärische Angelegenheit. Schließlich waren es Soldaten gewesen, die die Bombe auf Helgoland geworfen hatten.
Das Telefon klingelte ohne Unterlass. Frau Schneider, die gerade in der Tür stand, weil sie offenbar ein wenig hatte plaudern wollen, verdrehte die Augen. »Ich weiß nicht, warum alle glauben, sie müssten sich wegen der Evakuierung an die Polizei wenden«, stöhnte sie.
»Na ja«, gab Anna zu bedenken. »An wen würden Sie sich denn wenden?«
»Ich weiß nicht …«
»Eben. Dass sie nicht bei der Kurverwaltung anrufen, liegt auf der Hand. Und im Rathaus ist wahrscheinlich genauso schwer durchzukommen wie bei uns.«
»Vermutlich«, sagte Frau Schneider und seufzte. »Soll ich uns einen Tee machen?«
»Könnten wir vermutlich beide gut brauchen, was?«
»Absolut!« Frau Schneider war der gute Geist der kleinen Polizeistation. Sie war nie krank – nun gut, fast nie: nur einmal, als sie womöglich am dringendsten gebraucht worden wäre, hatte sie tagelang gefehlt –, erledigte alles jederzeit zur besten Zufriedenheit und hatte das Talent, zu jedem Menschen stets freundlich und hilfsbereit zu sein, wie groß der Stress auch war. »Danke«, sagte Anna, als ihr die Sekretärin ein paar Minuten später die Tasse hinstellte. »Sie sind die Beste.«
»Ach, sagen Sie das nicht«, widersprach Frau Schneider. »Jeder hat doch seine Schattenseiten.«
Anna lächelte. »Dann wüsste ich gerne mal Ihre.«
»Ach, glauben Sie mir, Frau Krüger, das wollen Sie nicht.« Kopfschüttelnd ging sie wieder hinüber in ihr kleines Büro, wo pausenlos das Lämpchen an ihrer Telefonanlage blinkte. »Polizei Helgoland, was kann ich für Sie tun?«, hörte Anna die Mitarbeiterin, während sie selbst zum Hörer griff und im Hotel Insulaner anrief. »Krüger hier von der Polizei. Sie haben sicher schon von der Evakuierung gehört?«
*
Nach etwa anderthalb Stunden war Anna mit den Hotels und Gästehäusern des Unterlands durch. Natürlich hatten die Betreiber alle längst von dem Fund gehört und sich auf eine Teilevakuierung eingestellt. Dass die Insel voraussichtlich vollständig geräumt werden sollte, war indes nur auf bedingtes Verständnis gestoßen. Immerhin gab es einige, die eine Chance sahen, ihren Gästen das Ärgernis als Event zu verkaufen. »Sie erwarten aber nicht, dass die Gäste die Kosten für die Evakuierung selbst tragen«, hatte Reinmar Echter von der kleinen »Pension Inselblume« festgestellt. »Die müssen von der Gemeinde übernommen werden.«
»Soweit ich weiß, lieber Herr Echter, werden sie das. Unser Problem ist eher, genügend Plätze auf Schiffen und Booten zu finden, um alle Menschen darauf unterzubringen – also alle, die die Insel nicht sowieso verlassen und aufs Festland zurückkehren.«
»Auch unsere Kosten«, stellte Echter fest, den die Nöte der Polizei wenig interessierten.
»Auch Ihre, da bin ich ganz sicher.«
»Ich möchte, dass Sie mir das schriftlich geben.« Echter war ein knorriger Typ, der das Leben als unablässigen Kampf auffasste: gegen die Konkurrenz, gegen die Behörden, gegen die Umstände. Aber es war ja auch kein leichtes Brot, mit einer kleinen Pension, die nur ein paar Monate lang bewirtschaftet werden konnte, übers ganze Jahr zu kommen.
»Ich werde Ihnen gar nichts schriftlich geben, Herr Echter«, sagte Anna, so freundlich und verbindlich wie klar. »Diskutieren Sie das gerne mit der Inselverwaltung. Wir sind hier bloß dafür zuständig, dass alles geregelt abläuft und alle sich an die behördlichen Vorgaben halten.« Sie hatte es kaum ausgesprochen, da hatte der Pensionsbesitzer schon den Hörer auf die Gabel geknallt.
Andere waren verständiger. Oder sie taten zumindest so. Was außer Frage stand, war, dass Vertrauen gut, aber Kontrolle weitaus besser war. Wenig Verständnis erntete Anna für den Hinweis, dass selbstverständlich auch die Mitarbeiter der Hotellerie und die Inhaber der betreffenden Häuser die Insel würden verlassen müssen.
Frau Schneider erschien in der Tür. »Herr Freitag für Sie.«
»Her mit ihm.«
Die Sekretärin stellte durch. »Und?«
»Die Geologen haben die Gefährdungslage hochgestuft.«
»Hochgestuft? Auf was? Vollkatastrophe?«
»Stufe drei. Höchste unmittelbare Gefahr für Leib und Leben.«
»Klingt entzückend. Und jetzt?«
»Jetzt werden noch ein paar Statiker hinzugezogen.«
»Wow. Was bitte sollen die dann noch machen?«
»Offenbar geht es darum, die Sicherungsmaßnahmen nicht allein den Kampfmittelbeseitigern zu überlassen.«
»Klingt vertrauenerweckend«, stellte Anna trocken fest.
»Hm. Ja. Allerdings.«
»Und soweit es uns betrifft? Müssen wir da irgendetwas Besonderes berücksichtigen?«
»An unserem Vorgehen ändert sich nichts, weil es anders gar nicht machbar ist. Wenn wir dann doch noch zurückgepfiffen werden, haben wir zumindest schon mal alles vorbereitet.«
»Verstehe. Für wann ist die Evakuierung jetzt angesetzt?«
»Mittwochmorgen.«
»Also haben wir achtundvierzig Stunden.«
»Na ja. Dreiundvierzig.«
Richtig, inzwischen arbeitete Anna seit drei Stunden von hier aus, mit der Zeit, die seit Schichtbeginn am Fundort vergangen war, waren das achtundvierzig. »Eigentlich sind es eher dreißig oder so«, sagte sie. »Denn in der Nacht werden wir die Leute nicht mehr aufs Meer schicken können.«
Paul seufzte. »Am Ende wird es auf ein paar Stunden sowieso nicht ankommen«, erklärte er. »Hauptsache ist, wir bekommen das so schnell wie möglich organisiert.«
»Vorhin hatte ich Echter am Apparat, der ernsthaft über die Kosten sprechen wollte.«
»Echter? Von der Inselblume?«
»Genau der.«
»Was für ein Idiot.«
»Herr Polizeioberrat!«, rügte ihn Anna scherzhaft, während sie sich die pochenden Schläfen rieb.
»Ich habe nichts gehört. Muss jetzt raus. Das Problem ist, dass wir uns koordinieren müssen, wer welche Menschen aufnimmt.«
In dem Moment fiel Anna etwas ein. »Sag mal, der Jet kommt heute nicht, oder? Und die anderen. Ich meine: Wir können keinesfalls Touristen anlanden lassen. Oder sonst wen …«
»Keine Sorge. Die kommen alle. Aber ohne Passagiere.«
»Gute Planung.« Anna atmete erleichtert auf. »War das eine Idee von dir?«
»Gehört zum Standardplan bei Vollevakuierungen.«
»Verstehe.« Auch wenn sie von der Insel stammte und seit drei Jahren wieder hier lebte, musste sie doch noch einiges dazulernen. »Ich schau nachher bei euch vorbei.«
»Lass mal. Du musst sowieso die Schicht ab drei übernehmen.«
»Geht klar. Bis nachher.«
»Bis dann.«
Die Schicht ab drei. Anna spürte einen leichten Schwindel, als sie aufstand und sich die Polizeikappe aufsetzte. Jetzt merkte sie die Müdigkeit doch. Kaum Schlaf die letzte Nacht, das würde sich später am Tag noch rächen. Immerhin, die Tablette hatte geholfen, Stalin hielt sich zurück, drückte nur manchmal bei einer unbedachten, plötzlichen Bewegung seinen Stachel in ihr Hirn – oder wenn das Telefon mit seinem fiesen Schrillton läutete.
Die frische Luft tat ihr gut. Dass es etwas regnete, machte Anna nichts aus. Sie mochte Inselwetter. Und Inselwetter war nun einmal echtes Wetter. Wenn der Wind wehte, flatterten die Kleider. Wenn die Sonne schien, brannte sie auf der Haut. Und wenn es schiffte, schiffte es. So war Helgoland. Und so war auch Anna gemacht: offen und direkt.
»Moin!«, rief ihr Henry zu, der vor seiner Hummerbude stand und die Menschen am Südstrand beobachtete. Noch war es zu früh für viel Kundschaft.
»Moin, Henry. Alles klar?«
»Alles bestens, Anna. Einen Kaffee?«
»Gerne. Muss aber schnell gehen, wir haben alle Hände voll zu tun.«
»So gut wie da«, sagte der Wirt, verschwand in seiner Hummerbude und war tatsächlich kaum eine Minute später schon wieder da, um ihr einen Becher mit Kaffee in die Hand zu drücken, schwarz mit Zucker, so wie sie ihn immer trank. »Wann geht es los?«, fragte er.
»Was?«
»Die Evakuierung! Wird ja wohl nicht ausbleiben bei dem Riesending und der Lage …«
»Wir arbeiten längst dran. Wer weg ist, kommt jetzt nicht mehr auf die Insel, das ist mal die erste Maßnahme.«
»Oha. Also keine Touris heute?«
»Nope. Keine Touris.« Sie konnte sich denken, dass ihn das traf. Immerhin, er hatte kein großes Restaurant, das auf seinen Vorräten saß, die frisch verarbeitet werden mussten. Insoweit war es für Henry wohl leichter verschmerzbar.
»Und wie lange wird der ganze Spaß dauern?«
»Übermorgen schaffen wir die Leute von der Insel. Aber ich weiß nicht … das Ding liegt blöd da …«
Henry nickte. »Hab’s mir angesehen. Ziemlicher Brummer.«
»Die größte Bombe, die sie hier gefunden haben bisher.«
»Wird wohl so bleiben. Soweit ich weiß, gab’s keine größeren damals. Höchstens noch die Grand Slam. Aber wenn die nicht explodiert wäre, das wüsste man.«
Anna nickte anerkennend. »Bist gut informiert, Henry.«
»Man tut, was man kann.«
Anna entdeckte die Silhouette eines Dampfers am Horizont. »Die Lady?«
Henry kniff die Augen zusammen. »Könnte sie sein.«
Die Lady von Büsum, eines der Linienschiffe, die täglich Touristen auf die Insel brachten. Sonst. Heute nicht. Heute würde sie nur aufnehmen, wen man ihr zuteilte. So wie all die anderen. Anna nahm einen Schluck, zuckte zusammen, weil er so heiß war, trank dennoch weiter, weil sie keine Zeit für ein Kaffeepäuschen hatte, und klopfte Henry schließlich auf die Schulter. »Danke. Ich schreibe an.«
»Bist eingeladen, Anna.«
»Danke. Grüß mir deine Freundin. Ich schau nachher bei ihr vorbei.«
»Bei Nele?« Henry grinste schräg. »Lohnt sich nicht. Die ist bei mir eingezogen.«
»Echt?« Damit hätte Anna nicht gerechnet. Nele Steenkamp war so ziemlich die selbstständigste Frau, die sie je kennengelernt hatte. Sie ließ sich nichts sagen und kannte keine Konventionen. Wäre auch hinderlich gewesen bei ihrem Beruf. »Und Doras Hotel?«, fragte Anna, die nichts weniger als die bizarrsten Erinnerungen an das kleine Inselbordell hatte, dessen Besitzerin und einzige Mitarbeiterin Nele war.
»Macht Betriebsferien.«
»Aha. Und wie lange?«
»Wenn’s nach mir geht, auf Dauer.«
»Verstehe«, sagte Anna, die sich gut vorstellen konnte, dass es für eine funktionierende Partnerschaft nicht eben einfach war, wenn man als Prostituierte arbeitete. »Na, dann müssen wir das wohl nicht mehr evakuieren.« Sie tippte sich an die Kappe und ging grinsend ihrer Wege. Nele hatte also den Job als Hure an den Nagel gehängt? Hatte ihr Glück gefunden? Anna gönnte es ihr von Herzen. Dieser Beruf war schließlich alles andere als ein Zuckerschlecken. Körperlich ruinös und seelisch sowieso eine einzige Qual. Anna mochte sich gar nicht vorstellen … Sie stand bereits vor dem Rathaus, als Paul sie wieder anklingelte. »Ja?«
»Könnt ihr bitte koordinieren, in welcher Reihenfolge wir die Straßen räumen? Die Feuerwehr möchte das in ihrem Einsatzplan berücksichtigen. Saskia kommt gleich runter.«
»Soll ins Rathaus kommen«, erwiderte Anna. »Ich bin gerade dort angekommen, um genau das zu besprechen.«
Für einen Moment schwieg Paul, und Anna fragte sich schon, ob sie ihre Kompetenzen überschritten hatte. Doch dann gab er ein anerkennendes Brummen von sich und sagte: »Wunderbar. Ich geb’ ihr schnell Bescheid.«
»Danke!« Sie drückte den Anruf weg, als es schon wieder läutete. »Ja?«
»Du bist als Nächste dran«, sagte eine heisere Stimme.
»Bitte?«
»Ja. Du.«
»Paul?« Aber es war nicht Paul. Natürlich nicht. Es war – sie blickte auf das Display: keine Nummer. Es war jemand, von dem Anna nicht wusste, wer es war. »Hallo?« Doch die Leitung war unterbrochen. Nur den Ton, diese fiese heisere Stimme, diesen Ton hatte Anna noch im Ohr, als hätte ihn der Anrufer hineingeklebt. »Als Nächste dran?«, flüsterte sie und starrte auf das Handy. »Als Nächste womit?« Aber da machte sich Anna keine Illusionen. Es war klar, was die Drohung sollte. Die Frage war: Wer war vor ihr an der Reihe gewesen? Und: Was bedeutete das für sie?
*
Und Marten hat sich umgebracht, Leo, stell dir vor. Er hat sich erhängt. Ist es nicht schrecklich? Ich weiß nicht, ob er noch einmal ein normales Leben hätte führen können. Aber jetzt ist alles für ihn vorbei. Irgendwie ist das so unendlich traurig, Leo. Unendlich traurig.
*
DIENSTAG